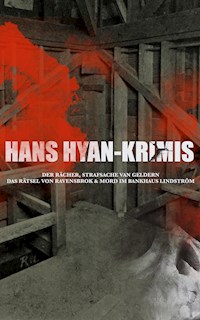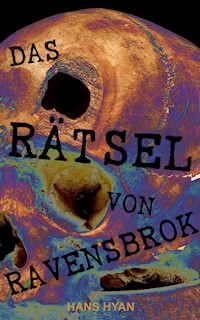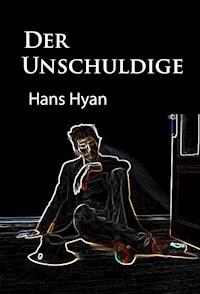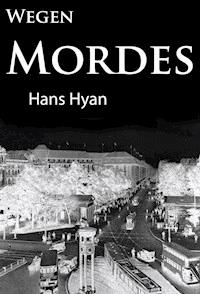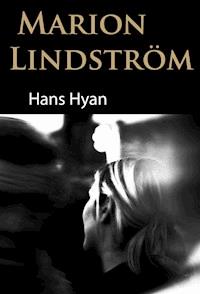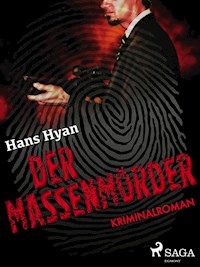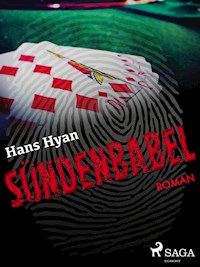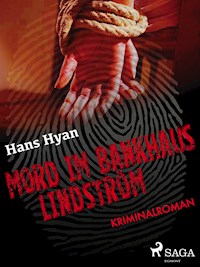Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Mitten hinein in die Kabarettszene und die Spielklubs der Metropole Berlin führt dieses Melodram. Hella Eichholz, zu Unrecht wegen Giftmord verurteilt, wird aus der Haft entlassen. Der couragierte Journalist Martin Deinhardt hilft dem entkräfteten Mädchen, versucht den verworrenen Fall zu klären und sie zu rehabilitieren. Deinhardt, hin und hergerissen zwischen seiner alten Liebe Tessi und Hella, verhilft der schönen Blonden zu einer Karriere als Chansonsängerin. Wäre da nur nicht Hans von Hohenhausen, eine Spielernatur, der ein Auge auf Hella geworfen hat …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 228
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hans Hyan
Die flammende Nacht
Roman
Saga
1
Es ist dunkel, und der Schnee fällt — und meine Locken erbleichen — bald, o Welt! o du Heiland der Welt! — wird dich meine Seele erreichen —“
Die Worte wollten ihr nicht aus dem Sinn, der Müden, die an schwarzen Häusern der wenig erhellten Strasse im strengsten Frost der Januarnacht entlang schlich. Sie hatte den Vers irgendwo gelesen, in einem Buch oder in einem alten Journal, und sie sah den Namen, der darunter stand: Maria Dolorosa, die schmerzensreiche Maria ... eine Frau also ... und eine, die vielleicht ebenso unglücklich war wie sie selber.
Hella Eichholz blieb stehen, vor einem Schaufenster, dessen Auslagen im Finstern schatteten. Sie sah auch nicht da hinein, ihr Gesicht war ganz nach innen gekehrt, sie spähte in ihrer Seele umher und fand nichts als eine trostlose Öde, eine graue, von keinem Stern erhellte Wüste, auf der nichts mehr wachsen und gedeihen würde.
„Na, wie is es mit uns beede, Fräulein, heite abend, wat?“
Fuselatem stiess sie zurück, und zotige Worte liessen sie auf verklammten Füssen weitereilen ... Die Strasse schien mit Eisenspitzen besät, so schmerzten ihre Sohlen. Ihr junger Leib war wie zertreten, und im Rücken zwischen den Schultern hatte sie wütende Schmerzen. Der dünne Flauschmantel, für den Herbst gekauft, wärmte nicht, und ihre arme Brust fror, als wäre sie weit ausgeschnitten. Seit dem Morgen hatte sie nichts gegessen, und wenn nicht ein Wunder sie rettete — das fühlte sie —, würde sie irgendwo in der Finsternis umsinken und erfrieren.
„Mein Gott! mein Gott! warum hast du mich verlassen?!“ wimmerte sie und ward sich nicht bewusst, dass es die Worte des am Kreuze sterbenden Erlösers waren, die sie in die erbarmungslose Nacht redete.
Aber der seit Minuten hinter der Leidenden herging, hatte diese Töne tiefster Menschenqual vernommen. Ein starker, breitschultriger Mensch, den weichen Hut auf dem vollen Haar, im Gehpelz, den Kopf ein wenig vorgeneigt und die Augen an dem Weibe hängend, dessen Weh sein Herz erregte.
Er hatte sie vor der Roheit des Betrunkenen flüchten sehen und war ihr gefolgt, in dem unklaren, aus Mitgefühl und Scheu gemischten Gefühl, das ein egoistisches Interesse nicht ausschloss. Nun er merkte, sie war in wirklicher Not des Leibes oder der Seele, schwand alles Trübe aus seinem Sinn, und nur die Güte blieb, die ihn an ihre Seite treten und sie anreden liess.
Sie zuckte zurück und wäre am liebsten wohl abermals entflohen. Aber war sie schon zu abgehetzt und ermattet oder klang etwas aus seiner Stimme in ihr Herz hinein, das sie vertrauen und zaghaft aufblicken liess in sein grosses, eckiges Gesicht, das im Schein der Strassenlaternen ernst und freundlich in das ihre sah?
„Sie dürfen glauben, dass ich nichts Böses will. Ich bin nicht mehr jung genug, um in jeder Frau den Gegenstand eines Abenteuers zu erblicken.“
Er nahm sanft ihren Arm und legte ihn in den seinen; fühlte, wie sie vor Kälte zitterte, und wollte aus Erbarmen sie fester an sich ziehen.
Da nahm sie den Arm schon wieder fort. Sagte aber gleich, wie um Verzeihung bittend:
„Ich glaube ja, dass Sie es gut meinen ... aber ich ... ich ...“ Nun fing sie so bitterlich an zu weinen, ihm wurde selber ganz elend.
„Vor allen Dingen kommen Sie irgendwo mit rein! Sie müssen ja krank werden, hier draussen in der Hundekälte!“
„Nein ... nein ...“ Sie wollte nicht. Doch da sie eben vor einer Tür standen, die eine Art Portier im Tressenrock öffnete, nahm er sie sanft um die Schultern und zog sie in die Wärme der Kneipe, die, dürftig möbliert, eine jener kleinen Frühstücksstuben schien, die hier im Norden der Stadt an jeder Strassenecke zu kurzer Rast einluden.
Er wollte sich eben mit dem verschüchterten Mädchen in der Nähe des eisernen Ofens niederlassen, als der Kellner in zweifelhaft weisser Jacke herantrat:
„Wollen die Herrschaften ins Kabarett? Das ist da hinten!“
Er zeigte nach dem Ende des Lokals, wo sich ein schmaler Gang auftat, in dem eine gelbe Ampel brannte. Musik setzte ein, durch eine aufgehende Klapptür flogen Fetzen einer Chansonettenstimme.
Martin Deinhardt hatte nur abweisend den Kopf bewegt. Dann sah er das Mädchen an, sah, dass es am Verschmachten war und rief dem Kellner nach:
„Etwas Warmes!“
Der kam zurück.
„Grog? ... von Rum oder von Arrak?“
„Nein, von Rotwein ... und ... haben Sie was zu essen?“
Vom Nebentisch nahm der Kellner die Speisekarte.
„Sehr schönen Kalbsbraten vielleicht?“
„Ja, meinetwegen ... zweimal, bitte ... und recht schnell!“
Er blickte das Mädchen an, das mit gesenktem Kopf am Tisch zusammensank. Es sah fast aus, als schliefe sie ... oder ... als wollte sie sterben ...
Eine grosse Angst überfiel den Mann, der dieses Opfer eines schlimmen Schicksals auf seine Schultern geladen hatte. Für Sekunden hatte Martin Deinhardt etwas wie ein Gesicht ... eine vage und erschreckende Ahnung durchrann ihn: er würde diese Bürde nicht mehr abwerfen können! Er, der vierzig Jahre lang frei geblieben, der nie mehr als den Schaum vom Becher der Liebe geschlürft hatte und allem Joch, aller Hörigkeit der Lust aus dem Wege gegangen war, er könnte hier, in diesem Spinneweb einer vergehenden Seele hängenbleiben, sich für ewig verfangen.
Da blickte sie auf. Er sah ihre im Fieber brennenden, mit einem fast erschreckenden Blick strahlenden Augen und hatte, vielleicht aus seiner romantischen Seele heraus, nur den Wunsch, zu verstehen, zu lernen, was in dem noch im letzten Elend süssen Gesicht dieses Kindes geschrieben stand, was in dem gemarterten und zerstörten Leben der wohl kaum Zwanzigjährigen Unerhörtes vorgegangen sein musste.
Er sprach aber nicht. Sie hing in dumpfer Apathie an ihrem Stuhl. Als das Essen kam, schien sie nicht imstande, etwas zu geniessen. Er schnitt ihr das Fleisch in Stücke und fütterte sie wie ein Kind, gab ihr auch kleine Schlucke von dem warmen Getränk. Sie nahm alles gehorsam, ohne Begier; doch als sie ein wenig gegessen hatte, erholte sie sich und sagte leise:
„Ich danke ... Sie geben sich solche Mühe mit mir ... ich weiss gar nicht ...“ Und die Tränen flossen von neuem über ihre Wangen.
Er streichelte ihre kleine Hand mit den ein wenig stumpfen Fingerchen. Und es war ihm, als sei wirklich nur ein müdes, krankes Kind in seine Obhut geflüchtet, das ihm vertraute. Ihre Wangen hatten sich ein wenig gerötet, die schweren, schwarzen Ringe um die Augen blichen ab, und selbst der erblasste Mund bekam ein wenig Farbe. Da sie ihn jetzt ansah, fand er sie schön, sehr schön ... aber diese Holdseligkeit hatte etwas, das nicht mehr dieser Erde gehörte. Und von neuem befiel ihn die Furcht, das gemarterte Herz dieser vom Schicksal Gezeichneten könne plötzlich zu schlagen aufhören.
Da bemühte er sich, einen frohen Ton zu finden:
„Na, nun sind wir doch wieder auf Deck, mein Fräulein ... ich glaube, jetzt ist das richtigste, man geht nach Hause!“
Sie erschrack sichtlich. Er merkte sogleich den Fehler, den er begangen hatte. War aber nicht geschickt, aus der Verfänglichkeit herauszukommen:
„Das heisst, ich meine ...“
„Ach nein!“ flehte sie, und ihre Augen verdunkelten sich.
Ein bisschen unwirsch schüttelte er seinen lockigen Kopf:
„Seh’ ich denn so aus?! Ich weiss nicht ... aber den Eindruck eines Wüstlings mach’ ich doch nun gerade nicht!“
„Bitte ... bitte!“ Jetzt griff sie nach seiner Hand, „ach, wenn Sie wüssten, was ich ..“
„Was Sie erduldet haben, ja? .. meine arme Kleine .. ich bitte Sie! .. ängstigen Sie sich doch nicht! Ich will Ihnen ja helfen, ohne dass ich dafür irgendeinen Dank beanspruche ..“
„Sie sind gut ..“
„Nein, das bin ich sonst gar nicht! .. Im Gegenteil, ich bin das, was man einen Egoisten nennen könnte .. ja doch, wahrhaftig! Mir ist es auch nicht immer so leicht geworden .. und ich seh’ nicht ein, die anderen können sich ja auch ein bisschen quälen .. Aber .. bei Ihnen .. na, mit einem Wort, Sie müssen jetzt schlafen, mein Fräulein. Sie können sich ja kaum noch aufrecht halten! Wenn Sie nicht zu mir kommen wollen, in meine Wohnung, so bring’ ich Sie in ein Hotel .. und hol’ Sie morgen früh von da ab ..“
„Allein? .. ich .. ins Hotel? .. nein .. nein!“ In ihren Augen flackerte die Angst: „ich will nicht .. ich will nicht allein sein! .. ich schlafe da doch nicht .. im Hotel ..“
„Na, und bei mir? Ich habe eine Zweizimmerwohnung ... ich gebe Ihnen mein Bett und schlafe nebenan auf dem Kanapee, Sie können die Tür abschliessen ..“
„Ach bitte, bitte! ..“ Sie nahm seine braune Rechte in ihre blassen Finger, „lassen Sie doch! ... Wir können ja lieber ins Kabarett gehen.“
Er sah sie gross an:
„Jetzt, in der Stimmung? Aber, wie Sie wollen .. ich mach’ alles mit! Sind Sie denn nun wenigstens satt?“
Sie dankte, ganz glücklich, dass er auf ihren Wunsch einging und dass sie noch nicht von hier fort brauchte.
2
Man mag sich noch so oft im Küssen üben
Und in der Lieb’ verwechseln mein und dein
Nur einen einzigen kann man wirklich lieben
Und nur mit einem kann man glücklich sein!“
Die grosse Blonde, die den Refrain des Gassenhauers mit Inbrunst sang, stieg rasch, vom Conferencier bei der Hand genommen, die Stufen des Podiums hinab und musste durch den vollen Saal hindurch, um hinter der Klapptür zu verschwinden. Erst vom kleinen Gang aus ging’s in die im Keller gelegene Garderobe.
Der Kabarettraum war, wie ein Stall, zu ebener Erde gelegen. Ein alter Tanzsaal, in dem ehemals die Bäckergilde ihre Bälle abhielt. Dann ein Berliner „Schwoof“ übelster Sorte und nun — seltsamer Phönix! — das Kabarett „Zur schmetternden Lerche“.
Martin Deinhardt, der in der Elsässer Strasse wohnte, kam als Nachbar manchmal hierher und kannte alle Künstler. Als Journalist besass er genug Schwung, ein sangbares Lied und hier und da auch ein Couplet zu schmieden. Verschiedenes wurde hier von ihm gesungen. Auch das Walzerlied, das Tessi Sommer — die Blonde, die ihm nicht ganz fern stand — noch eben mit vielem Beifall und mit einer mehr kräftigen als melodischen Stimme gegeben hatte.
Sie war bei ihm stehengeblieben und hatte mit den Augen neugierig zu Hella Eichholz hingewinkt. Als aber der Journalist abweisend den Kopf schüttelte, hatte sie den blonden Haarknoten etwas energisch nach hinten geschoben und war grusslos gegangen. Ihr blaues Seidenkleid, das eng anschliessend und rechts geschlitzt, das vollkräftige Bein freigab, flog glänzend in dem Licht der grossen Deckenlampen, die eben wieder erloschen.
Der Scheinwerfer flirrte über die winzige Bühne und das darunter sitzende Orchestertrio. Dann war der Conferencier oben und schleuderte politische Bonmots ins Parterre, die nicht von allen dort unten begriffen wurden. Er empfahl sich mit dem Bemerken, dass er nicht zu seinem Vergnügen, sondern nur, das Publikum zu erfreuen, hier wäre.
Er werde dafür bezahlt, während die Herrschaften ihr mehr oder minder sauer erworbenes Geld dafür hingäben — eine Tatsache, die er in all den Jahren seiner Kabarettätigkeit nie habe begreifen können .. Und nun, da er die hier offenbar gewünschte Note schon aus reinen Geschlechtsgründen nicht treffen könne, wolle er die grössten Kanonen der „schmetternden Lerche“ ins Feuer schicken, in der sicheren Gewissheit, dass sich auch jetzt wieder der alte Satz bewähren würde: „Je weniger eine Frau anzieht, desto mehr zieht sie an!“
Dann formte er die Hände wie zum Fanfarenstoss vor seinem Munde und schmetterte den Namen der nächsten Programmnummer in den Saal:
„Lala Rokhs Nacktballett!“
Aber die Toilette der Lala-Damen schien noch nicht beendet. Die Lampen, schon im Erlöschen, brannten wieder hoch, und die Musik intonierte einen neuen Shimmy. Das Publikum plauderte gedämpft, nur die Stimme eines Halbtrunkenen und das Geschirrklappern am Büfett waren störend laut.
Martin Deinhardt kannte das alles. Er sah auf seine Dame, die mit gesenktem Kopf neben ihm in der kleinen Weinnische sass. Er bemerkte jetzt erst, wie unordentlich und zerzaust ihr das blonde Haar um die Schläfen und im Nacken hing. Der runde, tiefkrempige Hut aus verblichenem Samt von dunkler Farbe liess nur ein Stückchen ihrer zarten Wange und die ein wenig zu starke Nase sehen. Und auf einmal däuchte ihn dieses Geschöpf unendlich reizlos; er wusste gar nicht, wie er es fertig bekommen hatte, sich derart für sie zu interessieren.
Was wollte er denn? Ein Abenteuer? Doch gewiss nicht! So einen verhungerten Sperling steckt man nicht in seinen Käfig, wenn man hundert bunte Singvögel haben kann. Etwa den Heiland en petit pied spielen? Lächerlich! Er hatte wahrlich das Zeug nicht dazu! Da gab’s doch nur eins: Den schmalen Kassenstand mal bis zur Neige erschöpfen und der armen Kleinen einen Obolus ins ungewaschene Händchen drücken, das wohl nur deshalb nicht aus dem verknitterten Lederhandschuh heraus wollte. Dann war er die Geschichte mit gutem Gewissen los und konnte sich beruhigt in sein keusches Bett legen. Und er setzte schon an, um seinen Sermon schicklich einzuleiten, als sie mit ihren grauen Strahlenaugen aufblickte. Da gab’s ihm einen Stich — aus solchen Sternen sehen die Menschen, die schon am andern Ufer stehen, herüber.
Sie sagte leise:
„Ich habe mich nun ein bisschen aufgewärmt und ... und ... ich ...“ Das Sprechen wurde ihr sichtlich nicht leicht, „Sie sind so gut gewesen zu mir ...“ Ihre Kraft schien schon zu Ende, der Kopf sank wieder auf den zarten Busen, der schwach atmete unter der schwarzen Seidenbluse, die man jetzt zwischen dem geöffneten Mantel sah.
Dem Journalisten griffen abermals Rührung und Mitleid ans Herz. Aber er wehrte sich dagegen, er wollte sich nicht in solch niedergehendes Schicksal verstricken lassen, er wollte hart sein und er selbst bleiben. Was sah denn schliesslich auch bei der ganzen Geschichte heraus? — Er nahm sie mit zu sich nach Haus — sie spielte vielleicht eine Zeit die Spröde, gab sich dann, wie sich noch alle gegeben hatten — und das Ende vom Lied war ein Verhältnis, das viel Geld kostete und das zuletzt an Langeweile und Überdruss starb. Nein, dazu gefiel sie ihm nicht genug! Sein Appetit auf diesen kleinen Friedhofsengel war zu gering, als dass er sich soweit engagieren wollte! Das gedachte er ihr zu sagen. Und da er den Mund öffnete, blickte sie ihn von neuem an und flüsterte fast:
„Ich möchte jetzt gehen.“
„Warum. Wo wollen Sie hin? Sie können doch nicht die Nacht auf der Strasse bleiben!“
Ihr Köpfchen fiel unter seiner harten Stimme noch tiefer, und ihre feinen Schultern zitterten. Sie wollte aufstehen. Er fasste ihre Hand und zog sie wieder auf den Sitz.
„Warten Sie ein bisschen .. ich gehe mal rasch runter in die Garderobe .. ein paar von den Mädels, die hier auftreten, kenn’ ich nämlich. Das sind lauter gutmütige Dinger, da gibt Ihnen die eine oder die andere gewiss für ein paar Tage Obdach.“
Sie schüttelte ängstlich den Kopf, aber sie sprach kein Wort.
Er stand auf:
„Ich komme gleich wieder.“
Und ging. Ging durch den sich eben verdunkelnden Saal, begegnete auf dem Gange den vier Lala-Damen, die noch ihre nicht eben kostbaren Strassenmäntel um den entblössten Körper zusammenhielten. Denn auf dem Gange war’s kalt. Die armen Dinger, die hier für ein paar Pfennig nackt herumhüpften, wurden den Husten gar nicht los. Dabei kicherten sie aber und hatten sicherlich irgendeine Liebesangelegenheit beim Schopf. Die eine stiess den Journalisten absichtlich an und sagte:
„Du Elender verrätst mich schon wieder!“
Er lachte und verschwand hinter der Tür, die ins Souterrain führte. Unten musste er an der Küche, wo’s nach verbranntem Fett roch, vorüber, durch die Heizung. Dann ging er, nur der Form wegen anklopfend, ins Garderobenzimmer. Es gab nur das eine. Ein mässig grosser Raum, von einem kleinen Kanonenofen, der rauchte, ziemlich warm; darin etliche Gartentische und Stühle und auf den Tischen die Schminkkästen und Spiegelchen der Artisten. Das war alles ... Ja, an den Wänden hingen noch, von alten Lappen gegen das Verstauben geschützt, die Kostüme, das wahrhaft einzige Besitztum dieser armen und so fröhlichen Menschen.
Das Tänzerpaar „Illa-Dilla“ zog sich gerade zur nächsten Nummer um. Sie mimte eine Bajadere, eine in Schleier gehüllte Tempeldirne vom Ganges, die den Gott ihrer Liebe und Gebete, den grossen Krischna, umschwebt. Und dieser Gott war ein früherer Reitknecht mit hartgeschnittenen Zügen und sehnig bemuskelten Gliedern. Er selbst sass, beim Tanz vom Scheinwerfer blaubeleuchtet, mit untergeschlagenen Beinen auf dem Podium, in einem mit Messingplättchen benähten, glitzernden Mantel, vor dem brutalen Gesicht eine Maske, in deren Augen kleine Glühbirnen leuchteten. Sie, eine aus dem Elternhause entlaufene Adlige, liebte die harten Männer und das Vagabundenleben. Sie trug eine Perlenkette um den bis zum Nabel enthüllten Leib, deren Wert eine Lebensrente darstellte, aber sie hungerte mit ihrem Stallgefährten, wenn es kein Engagement gab und nahm geduldig, vielleicht gar brünstig, seine harte Faust hin, die manche Nacht die Karten auf den Tisch schlug, ohne an morgen zu denken.
Deinhardt unterhielt sich mit dem Humoristen. Der lag halb, halb sass er in seinem Frack, dünn, wie eine schräg stehende Zaunlatte, auf dem Stuhl und lutschte an seiner ausgegangenen Zigarre:
„Du musst dir darauf nichts einbilden, Martin, wenn ich hier mit dir so leutselig spreche .. is mir ja nich an der Wiege gesungen worden. Mein Vater ...“
„Ich weiss, Walter, dein Vater war Photograph!“
„Xylo .. Xylo! .. Xylograph war er! Aber ihr lernt das nicht .. ich kann’s noch oft sagen! .. Sieh mal, Martin, darum sage ich’s dir doch! Xylograph war mein Vater, sage ich dir! Aber du bleibst bei Photo! .. Dann brauch’ ich’s dir doch gar nicht erst zu sagen! .. Warum sage ich’s dir denn? Sage mal so ’ne halbe Stunde hintereinander: Xylo! Xylo! Xylo! .. ’ne halbe Stunde ununterbrochen, vastehste? .. Ich wer’ solange raufgehn un’n Schnaps trinken!“
Und er ging mit seinen dünnen Beinen, die die engen schwarzen Hosenrohre nicht füllen konnten, steif und hölzern zur Tür, dabei die Frackschösse mit den Händen höchst unanständig lüftend.
Indem kamen zwei der Lalamädchen, soeben mit ihrer Pièce fertig, rasch herein. Effi, sechzehn Jahre alt, und Bella, auch kaum siebzehn:
„Sie hat mich wieder mit dem Schwert gestossen, das Heupferd, die Pauline! .. Nächstes Mal hau’ ich wieder! .. Jedesmal macht sie das bei dem Gladiatorentanz, die alte Kuh! .. Und ich sage dir, Bella, sie tut’s absichtlich! .. Komm, Martin, schnür mir die Sandalen auf!“
Der Journalist liess sich’s nicht zweimal sagen. Das Mädchen hatte Beine wie eine Elfe, ihr ganzer Leib war ein Gedicht, das sie übrigens bereitwillig zum besten gab. Sie, wie ihre kleine Kollegin, warfen die roten Satinröckchen fort, und so standen sie nackt und knospenhaft.
Es klopfte. Martin ging zur Tür, machte sie einen Spalt weit auf, der Kellner stand draussen:
„Ach, Herr Deinhardt, das Fräulein da oben ..“
„Na, was ist denn?“
„Die, mit der Sie hergekommen sind ..“
„Was ist denn mit ihr?“ Martin Deinhardt war wütend, dass ihn dies dumme Abenteuer nicht losliess. Gleichzeitig fiel ihm ein, dass er der Armen da oben im Saal ein Obdach hatte verschaffen wollen. Und weil er’s vergessen hatte, ward er noch ärgerlicher. So wurde es ihm nicht gleich bewusst, was der Kellner sagte:
„Sie ist ohnmächtig geworden, Herr Deinhardt!“
Doch dann war er mit zwei Schritten auf der Treppe.
Oben im Kabarett beruhigte man sich schon wieder. Die Kranke war in den Nebenraum, eine kleine Bar, getragen worden, die selten jemand aufsuchte. Da lag sie, noch bewusstlos, in einem Ledersessel. Ein Medizinstudent hielt ihre Linke, die wie eine welke Blüte aus der Manneshand herniederhing. Da der junge Mann sah, dass Deinhardt Beziehung zu der Leidenden hatte, stellte er sich flüchtig vor.
„Es wäre gut, wenn Sie die Dame recht schnell nach Hause transportieren .. ein Wagen natürlich, laufen kann sie nicht .. ich würde mitkommen, wenn Sie gestatten, denn ich glaube, ärztliche Hilfe ist notwendig.“
Auf den Journalisten stürmten tausend Gedanken ein: Abwehr, Widerspruch, Scham, sich zu erklären, und ein Ärger sondergleichen, dass dieser Unglückswurm sich nun mit seiner Ohnmacht so fest an seinen Hals hing, dass er sie nicht mehr abschütteln konnte. Dann aber trieb sein Herz, in dessen Tiefe trotz alledem die Güte lebte, die bösen Schatten fort. Er liess ein Auto holen, nahm, stark wie er war, die schwach Atmende auf seine Arme, nachdem er sie in seinen Pelz gewickelt hatte, und trug sie mühelos hinaus. Der Mediziner folgte ihm.
Und Martin Deinhardt freute sich, wie leicht er das Mädchen trug .. Am Ende war es gar nicht so schwer, einen Menschen durch die kalte Lebensnacht ins warme Licht der Liebe zu tragen.
3
Am anderen Morgen, so um zehn, klingelte Tessi Sommer bei dem Journalisten. Sie sah brillant aus in ihrem hellen, englischen Kostüm mit Waschbärbesatz. Ihr kräftiges, nicht unintelligentes Gesicht mit den vom klaren Wintertag geröteten Wangen und dem blauen, siegessicheren Augenpaar gefiel den Männern. Tessi hatte, wie stets, auch auf dem Wege hierher mehrfache Ansprache gehabt. Aber sie liess die Begehrlichen abblitzen, dass es eine Art hatte. Ihr Schwarm war nun mal dieser grosse, kräftige Zeitungsschreiber. Und es war noch nicht lange her, dass sie die Hoffnung nährte, Frau Deinhardt zu werden.
Sie hatte eine Weile warten müssen, als er sehr behutsam die Tür aufmachte.
„Pst! ... leise!“ Er liess das Mädchen, das ihn erstaunt ansah, eintreten, führte sie in sein Arbeitszimmer und flüsterte, auf das alte Ledersofa, das halb voll Zeitungen und Büchern lag, hinweisend:
„Setz dich .. da! .. aber recht leise .. sie hat die ganze Nacht Fieber gehabt und ist eben eingeschlafen!“
„Wer denn?“
„Na, du hast sie doch gesehen, gestern abend .. in der Lerche!“
„Ach so .. wo hast du denn .. ich meine ..“
„Was du meinst, kann ich mir denken!“
„Sprich vor allen Dingen ein bisschen mehr piano, Tessi! Du bist doch ’n guter Kerl und wirst nicht wollen, dass das arme Ding da nebenan wieder ihre Fieberdelirien kriegt! ... Nein, nicht wahr! Eher wirst du mir helfen, sie gesund zu machen!“
„Aber wo hast du sie denn bloss her?“
„Von der Strasse! ... aufgelesen wie ein armes, verhungertes, beinah’ schon totgefrorenes Kätzchen.“
„Und was willst du nun mit ihr, Martin?“
Er gab der hübschen, geraden Nase einen Tupp mit dem Finger:
„Heiraten will ich sie! Jawoll! Heiraten! Sowie sie gesund ist! Oder hast du was anderes erwartet, Tessi?“
Sie lächelte und sah lieb aus:
„Sei nicht böse, Martin, aber du weisst doch ...“
„Die Rivalin? — Na, natürlich! Wenn ich nur wüsste, womit ich soviel Liebe verdient habe!“
Sie erregte sich leicht, und das Weinen war ihr nahe:
„Altes Ekel, du!“
„Siehste, so gefällste mir besser! Aber hör’ mal, du könntest das, was ich hier auf den Zettel geschrieben habe, einkaufen gehn ... natürlich, für das arme kleine Tierchen! ... ich versteh’ mich doch auf sowas nicht besonders ... Hier haste Geld und halte dich nich auf! ’s is Medizin dabei, die sie dringend braucht!“
„Du barmherziger Samariter! ... Und was kriege ich dafür?“
„Einen Lobstrich im Himmel! Eigensüchtige Person du! Aber wenn du lieb bist, führ’ ich dich mal wieder in die Oper!“
„Au ja, fein!“ Sie stand an der Tür und hielt ihm den frischen Mund hin, den er gern küsste, dann ging er ins Nebenzimmer, wo er schlief.
In seinem grossen Bett lag Hella Eichholz. Ihre Brust rasselte, die geschlossenen Augen waren wie mit schwarzer Schminke umzogen, und zwischen den fieberroten Wangen stach die Nase hart und spitz hervor. Der kleine Mund darunter stiess zwischen feinen, trockenen, rissigen Lippen den Atem kurz und keuchend aus. Im Fiebersturm hatte sie sich das Hemd zerrissen, nun deckte ein Batisttuch den kindlichen Busen, der es eilig hob und senkte.
Mit tiefem Mitgefühl betrachtete Martin Deinhardt die Kranke. Er begriff jetzt nicht mehr, dass er auch nur einen Moment daran gedacht hatte, sie ihrem Schicksal zu überlassen. Zum Tisch ging er hin, um wieder eine Kompresse auf die brennende Stirn des Mädchens zu legen. Und dabei fiel sein Blick auf das einfache Handtäschchen, das gestern abend im Kabarett vergessen worden wäre, wenn es nicht der Student mitgenommen hätte.
Martin Deinhardt besass eine für seinen Beruf nur sehr bedingt förderliche Eigenschaft: er war diskret. Die Neugier, die gerade dem Zeitungsmann oft seine besten Erfolge verschafft, ging ihm total ab, ja neugierige, zudringliche und taktlose Leute waren ihm im tiefsten Grunde zuwider. So sah er die billige Tasche aus imitiertem Krokodilleder an, wie etwas, das keinerlei Aufmerksamkeit verdient, was einem nicht gehört und das man daher nicht beachtet. Aber auf einmal kam ihm der Gedanke: sie könnte doch Eltern haben, Verwandte, die sich vielleicht ängstigten um sie, die sie suchten! Denen sie wegen irgendeiner Läpperei, die nur in einem Mädchenkopf bedeutsam aussah, davongelaufen war! ... War es nicht seine Pflicht, sich über ihre Herkunft zu vergewissern? Wie hiess sie denn? Wer war sie? Er hätte am Ende gar kein Recht, sie hier zu behalten! Und er nahm mit einem peinlichen und unbequemen Empfinden die Tasche vom Tisch, wog sie, die so leicht war, in der Hand und legte sie schliesslich wieder hin, noch immer unentschlossen und ohne den Mut, den Bügel zu öffnen. —
Dabei fiel ihm Tessi ein, die gleich wiederkommen musste mit ihrem Einkauf. Ein Nachthemd war dabei, das sie ihrer leidenden Mitschwester anziehen würde. Bei der Gelegenheit würde sie natürlich gleich die Tasche bemerken, und sie würde nicht einen Augenblick zögern, den Inhalt zu untersuchen. Wie’s bei Tessi Sommer mit der Diskretion aussah, darüber war sich der Journalist nicht so klar, im allgemeinen pflegen die Frauen von der Bühne keine Bücher mit sieben Siegeln zu sein ... Also ... schien’s ihm doch richtiger, er öffnete die Handtasche. Wenn wirklich ein Geheimnis sich hinter dem abgegriffenen Leder verbarg, so war es bei ihm sicher aufgehoben.