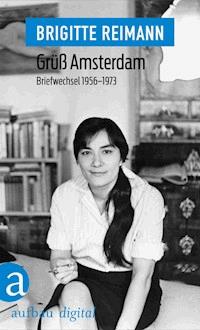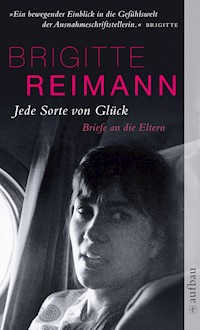13,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 13,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Brigitte Reimanns erster großer Erfolg – eine Liebesgeschichte, mit der sie Tabus brach.
Von ihrem Mann und der Schwägerin wird Kathrin wie ein Stück Inventar behandelt. Erst als sich eine Liebe zu dem ukrainischen Kriegsgefangenen Alexej entwickelt, der auf dem Hof mitarbeitet, während ihr Mann an der Front ist, erkennt sie ihren eigenen Wert. Auch der blinde Hass der Menschen, die sie an den Pranger stellen, kann ihr nichts mehr anhaben. Im Ringen um den geliebten Menschen wächst die junge Frau schließlich über sich hinaus. Mit diesem Roman packte Brigitte Reimann 1956 ein »heißes Eisen« der deutschen Nachkriegsliteratur an, es wurde ihr erster großer Verkaufserfolg. Unerschrocken und mutig betrachtete die junge Autorin differenziert die Rollen von Tätern und Opfern. Bis heute wirft die berührende, aufrüttelnde Geschichte Fragen nach Schuld und Verdrängung auf und darüber, wie wir mit unseren »Gegnern« umgehen.
»Das Buch ist so ein feiner, schmaler Band, aber drin steckt die geballte Geschichte des frühen 20. Jahrhunderts. Eine einfache Erzählung, scheinbar mühelos auf Papier gebracht, die gleichzeitig voller Kraft strotzt – das ist Reimanns großes Talent: gesellschaftliche Umbrüche, Missstände und Grausamkeiten durch wenige Figuren erleb- und erfahrbar zu machen.« Carolin Würfel.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 200
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Über das Buch
Wie gehen wir als Gesellschaft mit dem Fremden, Andersdenkenden um? Vor dieser Frage erscheint Brigitte Reimanns erster Verkaufserfolg aus dem Jahr 1956 hochaktuell: Von ihrem Mann und der Schwägerin wird Kathrin wie ein Stück Inventar behandelt. Erst als sich eine Liebe zu dem ukrainischen Kriegsgefangenen Alexej entwickelt, der zur Arbeit auf dem Bauernhof herangezogen wird, während ihr Mann an der Front ist, erkennt sie ihren eigenen Wert. Auch der blinde Hass der Menschen, die sie an den Pranger stellen, kann ihr nichts mehr anhaben. Im Ringen um den geliebten Menschen wächst die junge Frau über sich hinaus …
Über Brigitte Reimann
Brigitte Reimann, geboren 1933 in Burg bei Magdeburg, war seit ihrer ersten Buchveröffentlichung, »Die Frau am Pranger« (1956), freie Autorin. Mit »Ankunft im Alltag« (1961) gab sie der »Ankunftsliteratur« ihren Namen. Ihr Roman »Die Geschwister« (1963) über die gerade vollzogene deutsche Teilung war eines der meistdiskutierten Bücher jener Zeit. Mit nur 39 Jahren starb die Autorin in Berlin-Buch an den Folgen einer Krebserkrankung. Ihre postum erschienenen Tagebücher »Ich bedaure nichts. Mein Weg zur Schriftstellerin« (Neuausgabe 2023) sorgten dank ihres unerbittlichen Blicks für Aufsehen. Ihr letztes Werk, »Franziska Linkerhand« (ungekürzte Neuausgabe 1998), gilt als einer der bedeutendsten Romane der deutschen Nachkriegsliteratur.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlage.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Brigitte Reimann
Die Frau am Pranger
Erzählung
Mit einem Vorwort von Carolin Würfel
Übersicht
Cover
Titel
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Informationen zum Buch
Newsletter
Widmung
»Man muss das bisschen Wärme festhalten, das noch geblieben ist« — Die Gesellschaft am Pranger
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
Editorische Notiz
Impressum
Wer von dieser Erzählung begeistert ist, liest auch ...
Für G. D.
»Man muss das bisschen Wärme festhalten, das noch geblieben ist«
Die Gesellschaft am Pranger
Vorwort von Carolin Würfel
Wie steht ein Mensch aus Trümmern auf? Das ist eine, wenn nicht sogar die zentrale Frage im Leben von Brigitte Reimann. In ihrem Fall lautet die Antwort: mit Literatur.
»Die Frau am Pranger« – jenes feine Buch, erschienen 1956 im Verlag Neues Leben – war Reimanns Debüt, ihr Eintritt in die Welt der Literatur. Darin erzählt sie die verbotene Liebesgeschichte zwischen der deutschen Bäuerin Kathrin Marten und dem aus der Ukraine stammenden Kriegsgefangenen Alexej Iwanowitsch Lunjew während des Zweiten Weltkriegs. Romeo und Julia auf nationalsozialistischem Boden, könnte man sagen. Eine Geschichte, wie sie seit Jahrhunderten immer und immer wieder in unterschiedlichsten Settings aufs Papier gebracht wird: Zwei verlieben sich, aber diese Liebe darf nicht sein.
Brigitte Reimann ging jedoch einen Schritt weiter. Ihre Erzählung wagte etwas Unerhörtes, sie brach im Nachkriegsdeutschland Tabus, die noch gefährlicher waren als die ohnehin schon skandalöse Liebe zwischen einer Deutschen und dem Kriegsfeind: Reimann hinterfragte die Mechanismen von Schuld und Verdrängung und die vermeintlich unerschütterlichen Rollen von Tätern und Opfern. Sie war 22 Jahre alt, als sie das Buch schrieb. Eine junge ostdeutsche Frau, die nichts Geringeres wollte, als mit Sprache eine neue, bessere Zukunft an den Horizont zu zeichnen. Und wer wünscht sich keine bessere Zukunft, damals wie heute?
»Die Frau am Pranger« machte Brigitte Reimann, geboren 1933 in Burg bei Magdeburg, schlagartig berühmt. Das Buch war ein Riesenerfolg in der DDR, aber auch in der BRD und im sozialistischen Ausland. Es erschien im März 1956, einen Monat später wurde schon alles für die Nachauflage in die Wege geleitet, sie bekam Aufträge für neue Werke, Journalisten aus Ost und West standen Schlange bei ihr, die DEFA bot ihr an, Filmstoffe zu entwickeln, und mächtige Genossen wie der spätere DDR-Kulturminister Klaus Gysi umwarben sie. Fortan hofierte und verehrte man sie wie eine ostdeutsche Marilyn Monroe. Wenn Brigitte Reimann einen Raum betrat, hatten alle nur noch Augen für sie.
Was die wenigsten wissen: Der Ursprung des Romans, der Anfang dieser Erfolgsgeschichte, liegt weit zurück, im Winter 1947/48. In diesem Winter, zwei Jahre nach Kriegsende, erkrankte Brigitte Reimann, damals vierzehn Jahre alt, an spinaler Kinderlähmung. Während sich die Welt von den Verheerungen des Zweiten Weltkriegs erholte und von Trümmern befreite, wurde ihr eigener Körper plötzlich zum Krisengebiet, er versagte ihr den Dienst. Wochenlang lag sie allein in einem Krankenzimmer, zeitweise war das rechte Bein vollständig gelähmt. Was tut man als Mädchen in einer solchen Situation? Brigitte Reimann las. Sie las gegen die Einsamkeit, aber auch für ein Gefühl von Teilhabe an dieser Welt. Sie las, um all das Grauen, das geschehen war, zu verstehen und um die Hoffnung nicht aufzugeben. Die Hoffnung, dass sie wieder gesund werden würde genau wie diese Welt. Wenn selbst jemand wie ihr großes Vorbild Anna Seghers aus Mexiko nach Deutschland zurückkehren und wieder an dieses Land und seine Bürgerinnen und Bürger glauben konnte, würde auch sie das tun. Schon allein um ihrer selbst willen. Und es war ebenjene Hoffnung der Vierzehnjährigen, die sie einige Jahre später in der »Frau am Pranger« ausformulierte. »Eines Tages«, heißt es in dem Buch, »wird es kein Elend mehr geben, keine Feindschaft und keinen Hass. Die Menschen werden in Frieden leben, jeder wird satt sein und glücklich. Wir dürfen wieder träumen, Kathrin …« Diese Hoffnung mag uns heute allzu pathetisch erscheinen, aber Reimann meinte es ernst, jedes einzelne Wort.
»Die Frau am Pranger« ist ein schriftstellerischer Anfang. Ihre Lektoren und Kritikerfreunde ermahnten sie immer wieder, nicht zu viele Adjektive zu benutzen, besser zu dosieren. Gleich auf der ersten Seite regnet es nicht nur. Der Regen, durch den Reimann ihre Hauptprotagonistin Kathrin Marten laufen lässt, ist ein dramatisch »dünnfädig-kalter Herbstregen«. Ein bisschen übertrieben, vielleicht. Aber das war Brigitte Reimann, im Leben und im Schreiben. Immer etwas zu viel aus dem Blickwinkel der sogenannten Norm. Aber weil sie aus der Norm ausbrach, sah sie auch klarer. Und jeder weiß sofort, was sie mit »dünnfädig« meint, wir erleben solchen Regen in Deutschland jeden Herbst, daran hat sich nichts geändert. Und jeder weiß auch sofort, was für ein Typ Heinrich Marten, der Ehemann von Kathrin, ist, wenn er allen Ernstes zu ihr sagt: »Und die Russen sind eben anders als wir, bloß halbe Menschen, verstehst du?«
Heinrich Marten kämpft an der Front, kommt ab und zu für ein paar Tage auf »Heimaturlaub« nach Hause, poltert dann durchs Dorf und über seinen Hof, auf dem jetzt die Frau mit der Schwägerin und dem Kriegsgefangenen Alexej lebt. Heinrich Marten ist stolzer Soldat und liebt sein Land. Mit seinem Trupp stellt er im Osten Familien an die Wand, erschießt Frauen und Kinder. Er denkt dumm und spricht dumm: »Wir wissen ja schließlich, wofür wir kämpfen. Wenn wir erst die Ukraine haben – Mensch, die Felder solltest du sehen! […] Da müsste man einen Hof haben.« Man ekelt, schüttelt sich, erschrickt beim Lesen. Man erschrickt über die Aktualität der Worte und der Taten. Man erschrickt über die Grausamkeiten, die in dem Dorf der Martens, an der Front, in der Ukraine, in diesem schrecklichen Krieg verübt werden. Man erschrickt darüber, dass er nicht mal hundert Jahre überdauert hat, der Frieden, und dass es heute wie damals so schwerfällt, diese eine Wahrheit anzuerkennen: In einem Krieg machen sich immer alle Seiten schuldig.
Davon – von dieser Schuld auf allen Seiten – erzählt auch dieses traurige, brutale, einfühlsame Buch. Es erzählt von der Selbstverständlichkeit des Hasses und der stumpfsinnigen Unterdrückung einzelner Menschen und ganzer Gruppen. Wer nicht dazugehört, ist nichts wert. So war das damals. Aber auch heute – gerade heute – klingt dieser Satz und dieses Denken ganz und gar nicht nach lang zurückliegender Vergangenheit. Im Gegenteil: Das stoische Festhalten an WIR- und IHR-Konstruktionen beherrscht (wieder) die Gegenwart. Reimann schafft es in ihrem Buch jedoch, all die Vorurteile und den ganzen Hass, die diesen grobschlächtigen, schrecklichen Ehemann und das Dorf bestimmen, mit einer kleinen, fast belanglosen Geste zu brechen. »Vielen Dank, Alexej«, lässt sie Kathrin Marten zu dem Kriegsgefangenen eines Tages leise sagen. Wirklich nichts Großes. Aber doch eine Geste, die alles verändert und Mauern in zwei Köpfen einzureißen vermag. Zwei Menschen, Kathrin und Alexej, die nicht unterschiedlicher sein könnten, reichen sich zögernd die Hände und finden im Verlauf der Erzählung allen Widerständen zum Trotz zusammen, schaffen Gemeinsamkeiten und Nähe, wo keine sein sollen. Sie werden wieder zu Menschen mit einem schlagenden Herzen und einem Gewissen. Man liest also dieses Buch und wird wieder und wieder auf die Haltlosigkeit, ja Schwachsinnigkeit von Vorurteilen gestoßen und fragt sich, wie von Sinnen diese Welt gewesen ist und heute sein muss und wie stumpfsinnig die Leute, die sich von den Monstern in ihren Köpfen regieren lassen. Dieses Dorf, das Brigitte Reimann für »Die Frau am Pranger« geschaffen hat, ist ein gesellschaftliches Brennglas, ein Mikrokosmos, in dem die Welt und ihre Absurdität zum Ausdruck kommt, »deutsch« und »ukrainisch« und »russisch« lassen sich durch zig andere Zuschreibungen ersetzen. Das menschenverachtende Spiel ist und bleibt stets das gleiche.
Als Brigitte Reimann das Buch schrieb, gab es noch kein Internet und keine sozialen Medien. Es waren nicht Tausende Bilder von zerbombten Gebieten omnipräsent, von Gräueltaten und Toten, durch die wir uns schon zum Frühstück scrollen. Wir haben uns daran gewöhnt, wir haben gelernt, das fast als normal zu empfinden, weil man als Einzelne ja ohnehin nichts tun kann. Wir sind aber auch abgestumpft, weil die Menschen auf den Bildern oft keine Namen haben und die Zahlen von Toten nur tote Zahlen sind, nicht greifbar oder gedanklich verdaubar. Namen ändern viel bis alles. Und deshalb ist dieses Buch auch so stark. Genau das ist Reimanns große Kunst als Schriftstellerin: Sie reduziert riesige, scheinbar nicht greifbare gesellschaftliche Themen und Katastrophen menschlichen Miteinanders auf wenige Figuren, verhandelt sie in einem alltäglichen Setting, an einem konkreten Beispiel, mit dem alle etwas anfangen können, egal woher man kommt, egal welche Geschichte man selbst in sich trägt, egal auf welcher Seite man steht. Und sie stellt scheinbar mühelos immer wieder die große Frage: Wie gehen wir als Gesellschaft mit jenen um, die anders denken, anders aussehen, von der sogenannten Norm abweichen? Sie fordert dazu auf, die eigene Haltung und die eigenen Glaubenssätze zu überprüfen. In Reimanns Geschichte liebt die Bäuerin Kathrin Marten den Feind. Und das darf offiziell nicht sein, aber passiert eben doch. Kathrin hält das aus. Das Dorf tratscht. Bis die Situation eskaliert. Es gibt eine Verbündete im Dorf, eine alte Nachbarin, die diesen schönen Satz zu Kathrin sagt: »Man muss das bisschen Wärme festhalten, das noch geblieben ist. Man erfriert sonst.« Das meint auch: Man muss sich widersetzen, man muss ausbrechen, selbst wenn kein anderer es tut. Verdammt beeindruckend, dass Brigitte Reimann so jung eine solche Geschichte schreiben konnte. Wie klug sie war, wie viel sie mit Anfang zwanzig schon kapiert hatte.
Es geht in »Die Frau am Pranger« aber nicht nur um die Liebe zu einem, den man nicht lieben darf. Es geht in dem Buch auch um Unterdrückung, vor allem die Unterdrückung von Frauen, und auch das macht diese Geschichte hochaktuell. Der weibliche Körper als ewiges Krisengebiet, das oft übersehen und gleichzeitig so oft benutzt wird, um Dominanz und Macht zur Schau zu stellen. Eine Frau wie Kathrin, sie steht zu keinem Zeitpunkt an der Front, aber muss trotzdem jeden Moment um Leib und Leben fürchten. Das war im Zweiten Weltkrieg so. Das ist teilweise bis heute so. Gewalt ist für Frauen Alltag. Gewalt zu Hause, Gewalt auf der Straße, Gewalt im Krieg. Für Männer ist der Kampf an der Front ein Ausnahmezustand. Für Frauen fängt die Bedrohung schon beim Gang durchs Dorf an. Und das hört wohl erst auf, wenn Kriege, wenn das Patriarchat enden und wenn Frauen aufbegehren. So wie Kathrin Marten es tut. Sie wächst im Verlauf der Geschichte über sich hinaus, entwickelt ungeahnte Kräfte und unbändigen Willen. Sie kämpft ums Überleben. Sie stellt sich gegen die Unmenschlichkeit. Und sie realisiert, dass man Frauen wie sie jahrelang kleingehalten hat, dass sie mehr wert ist, dass man sie nicht weiter »verschachern« darf für ein bisschen mehr Land, ein bisschen mehr Befriedigung im Bett oder ein bisschen mehr Macht. Wie viel das immer noch mit weiblichem Leben und weiblicher Existenz im 21. Jahrhundert zu tun hat, muss man niemandem erklären.
Dieses Leben in der Provinz, wo Leute reden, urteilen und verraten, kannte Brigitte Reimann aus eigener Erfahrung. Sie war auch ein Mädchen aus der Provinz, das vergisst man bei ihr, die so lebenshungrig war, leicht. Der Krieg endete für sie 1945 in ihrer Heimatstadt mit dem Einmarsch der Roten Armee. Man beschlagnahmte das Haus der Familie und versetzte sie und ihren Bruder in Todesangst. Trotzdem schrieb sie dieses Buch mit klarem, differenziertem Blick auf die Grausamkeiten des Krieges und ohne sich von den eigenen Erfahrungen blenden zu lassen. Sie vergaß nicht, dass wir alle Menschen sind. Dass Menschen nie nur gut oder böse sind, dass die offiziell propagierten Rollen von Opfern und Tätern nicht automatisch stimmen müssen. Sie verstand, dass Feindbilder nie mehr als Konstrukte sind, jämmerliche Versuche, einen Keil zwischen die Menschen zu treiben. Später, in ihrem ebenfalls berühmten Buch »Franziska Linkerhand«, erschienen 1974, ein Jahr nach ihrem viel zu frühen Tod, gibt es diese Unterhaltung:
»Und wer hat nun gewonnen, die Russen oder die Amerikaner?«
»Gewonnen? Kriege werden immer verloren, mein Kind.«
»Die Frau am Pranger« war ihr erstes Buch, »Franziska Linkerhand« ihr letztes. Über acht Jahre schrieb sie am letzten. »Im nächsten Heft werde ich vom Glück erzählen«, steht auf der letzten Seite des Manuskripts. Wieder, wie am Anfang ihrer Karriere als Schriftstellerin, will die Hoffnung siegen und das Schöne, der Blick nach vorn, aufs nächste Heft, aufs Weiterschreiben, aufs Glück. Brigitte Reimann hat diesen Roman nicht zu Ende bringen können. Am 20. Februar 1973 starb sie in der Robert-Rössle-Klinik in Berlin-Buch. Sie war 39 Jahre alt. Jahrelang hatte sie gegen den Krebs gekämpft und bis zuletzt gehofft, ihren Körper austricksen zu können. Ihr war das oft genug gelungen, dieses Aufstehen aus inneren und äußeren Trümmern. Sie hatte Kinderlähmung überstanden, später zwei Fehlgeburten, Fäuste von Männern, die rauen Umstände des Kraftwerks Schwarze Pumpe in Hoyerswerda, wo sie in den 1960er Jahren regelmäßig in einer Brigade mitarbeitete, und dann Brustkrebs mit 35. Doch 1973 musste sie kapitulieren. Was hätte die Schriftstellerin noch alles produziert, geschrieben, gedacht?
Bis heute ist Brigitte Reimann vor allem für ihren unkonventionellen Lebensstil bekannt. Der Satz »Die Reimann kommt« meinte stets zweierlei: die erfolgreiche Schriftstellerin und die unkontrollierbare Femme fatale. Sie war viermal verheiratet, hatte unzählige Affären und großen Spaß am Rausch. Kurz: Sie lebte laut. »Hunger auf Leben« heißt ein Spielfilm über ihr Leben aus dem Jahr 2004, mit Martina Gedeck in der Hauptrolle. Die Faszination riss auch nach der Wiedervereinigung 1990 nicht ab, lebte erst richtig auf, als einige Jahre später ihre romanhaften Tagebücher veröffentlicht wurden, existiert bis heute fort und wächst sogar, zuletzt erschien die erste und gefeierte Übersetzung ihres Romans »Die Geschwister« in englischer Sprache. Und vielleicht verdankt sich dieser Umstand auch ihrem frühen Tod. Während die Freundin Christa Wolf nach 1990 als DDR-Staatsdichterin durch die Feuilletons gejagt wurde, wurde Brigitte Reimann über ihre Tagebücher neu entdeckt und verehrt. Das liegt an ihren Werken, wie diesem allerersten großen Triumph, der »Frau am Pranger«, aber sicher auch daran, dass ihre Stimme stets die einer jungen Frau blieb, die sich ihren Drang nach Selbstverwirklichung und ihren Traum von einer besseren Zukunft von niemandem zerstören ließ. Und das ist, was wir bis heute mitnehmen können und sollten: Damit die Zukunft gerechter, freier, besser wird, müssen wir zuallererst daran glauben. Wir erfrieren sonst.
I
Wenn sie über die Dorfstraße ging, schien es, als liefe sie unter dünnfädig-kaltem Herbstregen: den Kopf gesenkt, mit gewölbtem Rücken, fröstelnd und schmal. Sie war Ende der zwanzig und verheiratet seit mehr als fünf Jahren; Fremde hätten sie für ein neunzehnjähriges Mädchen gehalten.
Sie stand unter dem Tor und starrte auf das Telegramm: »… drei Tage Heimaturlaub …« Drei Tage. Sie fröstelte stärker, wurde noch schmaler, noch geduckter. Sie ging ins Haus, mit ihren klebenden Schritten, und legte das Telegramm auf den Küchentisch.
»Heinrich kommt.«
Die Schwägerin saß, Ellbogen aufgestemmt, vor dem Teller mit Pellkartoffeln. Sie blickte auf und sagte mit tiefem Atemzug: »Zeit wird’s. Er kann nach dem Rechten sehen, gerade jetzt. Wir kommen mit der Frühjahrsbestellung nicht zurecht ohne Mann.«
»Drei Tage nur«, sagte die junge Frau. Drei Tage, dachte sie angstvoll, drei unendlich lange Tage und Nächte …
Die Ältere am Tisch schob sich eine Kartoffel in den Mund. »So.« Sie erhob sich, ein strammes Weibsbild, massig, mit breiten Hüften und festen Armen. Sie war fast einen Kopf größer als die Frau ihres Bruders. Sie wischte die Hände an der Schürze ab. »Er wird schon helfen, der Heinrich. Irgendwie. Er bestimmt.« Sie hob die vollen Milchkannen von der Bank, so leicht, als sei es ein Kinderspiel. Im Hinausgehen sagte sie noch: »Schaff, dass was Gutes auf dem Tisch steht heute Abend. Wenn der Heinrich kommt –«
Er kam. Er stand auf der Schwelle, und er schien den Türrahmen zu sprengen, der riesige, schwere Mann. Feldgraue Uniform, Gefreitenwinkel.
Die Schwester hing ihm am Halse. »Gefreiter bist du geworden!« Sie strich über den silbernen Winkel. »Stolz kann man auf dich sein …«
Er sah über ihre Schulter hinweg in die Küche.
»Kathrin!«
Die junge Frau stand am Tisch, mit hängenden Schultern. Sie weinte, als er sie umarmte.
»Nun, nun …« Er tätschelte ihr den Rücken. »Schon gut …«
Die Frau schluchzte. Er brummte begütigend, ungeduldig dann, schob sie zurück. Seine Feldbluse war feucht von ihren Tränen.
»Warum heulst du? Ist was passiert? Freust du dich nicht?«
Die Frau wischte mit dem Ärmel über das Gesicht, sie schluckte. »Doch, Heinrich …«
Der Mann saß am Tisch, die Beine gespreizt, und hieb ein wie ein Verhungernder.
»Zu Hause schmeckt’s doch am besten.«
Kleine Schweißtropfen standen auf seiner Stirn.
Kathrin hockte zwischen Bruder und Schwester, erdrückt vom warmen, massigen, schwitzenden Fleisch der beiden, von lauter Rede und Gegenrede, vom polternden Lachen des Mannes.
Ihre Blicke hingen an seinem Gesicht. Es war gut geschnitten, breit, mit vollem Mund und fleischiger Nase, mit braunen Augen unter dem glänzend dunklen Haar. Im Dorf nannten sie ihn den schönen Heinrich; die Frauen hatten Kathrin Laws scheel angesehen, damals, als Marten ihr auf Schritt und Tritt nachgelaufen war. Keiner begriff, was er an ihr fand, sie selbst am wenigsten. Ein farbloses, lächerlich dünnes Ding war sie, und hellblond alles an ihr: die Haare und das Gesicht und sogar die Augen. Nichts war in ihr an Saft und Kraft wie in den anderen Mädchen seines Dorfes. Dennoch hatte er sie genommen und dazu die Ackerbreiten vom alten Laws, die seinen Grund um mehr als ein Drittel vergrößerten.
Jetzt saß er am Tisch, in feldgrauer Uniform, und sein Mund kaute und schmatzte und lachte und sprach.
»Ein lustiges Pack, die Russen«, sagte er, »heimtückisch und gefährlich. Da marschieren wir neulich in ein Dorf ein …«
Wie hatte sie sich einbilden können, er sei anders geworden in den sechs, sieben Monaten seit seinem letzten Urlaub? Hatte sie erwartet, er werde weniger laut sein, weniger groß, weniger stark?
»… da knallt es aus einem Bauernhaus«, erzählte der Mann. »Und – bums! unser Leutnant ist hin. Partisanen natürlich –«
»Mein Gott, die sind ja wie die Tiere«, sagte Frieda. »Die sind ja gar nicht wie richtige Menschen. Aufhängen müsste man die ganze Bande.«
»Haben wir auch«, sagte der Mann breit und behaglich. »Aber zäh sind sie, stur – die geben keinen Mucks von sich. Die spucken dir noch ins Gesicht, wenn sie die Schlinge schon um den Hals haben.«
Die junge Frau saß, die Augen weit aufgerissen, noch bleicher als sonst.
Gutmütig klopfte er ihre Hand.
»Das ist nun mal nicht anders im Krieg. Man muss hart durchgreifen. Und die Russen sind eben anders als wir, bloß halbe Menschen, verstehst du?«
Kathrin schwieg, wie sie seit Jahren geschwiegen hatte zu allem, was die beiden, Bruder und Schwester, dachten und sprachen.
In der Nacht, endlich erlöst aus seiner gewalttätigen Umarmung, weinte sie vor Scham und Furcht. Er lag auf dem Rücken, mit halboffenem Mund, schnarchend, satt und gesund. Und zum ersten Male in den fünf Jahren geduckten Gehorsams glomm neben Widerwillen und Demut ein winziges Fünkchen Hass.
Am nächsten Tag ging sie ihm aus dem Weg. Es wäre nicht nötig gewesen; er sah und sprach über sie hinweg wie in all den Jahren, bevor er Soldat geworden. Seine derben Späße erfüllten Haus und Hof, umspült vom beifälligen Gelächter der Schwester. Durch Stall und Scheune gingen die Geschwister. Er schlug ihr klatschend auf den Hintern: Eine tüchtige Frau sei sie, habe die Wirtschaft zusammengehalten, wie es sich gehöre.
Frieda, obgleich glücklich über sein Lob, lamentierte: Ein Mann müsse her, sie schaffe die Frühjahrsbestellung nicht. Sie sei nicht mehr die Jüngste – »… ich mache mich kaputt hinterm Pflug, und die Kathrin kann man ja kaum rechnen, diese Handvoll!«
Heinrich nahm die Frau in Schutz. »Sie ist nicht kräftig. Sie kann nichts dafür. Ein Mann muss her, da hast du schon recht.« Er überlegte. »Vielleicht kann ich euch einen Kriegsgefangenen besorgen.«
Frieda hob die Hände. »Bloß keinen Russen auf den Hof!«
»Du wirst doch keine Angst haben?«, fragte er lachend. »Er kommt nicht ins Haus rein, schläft in der Scheune, und das Essen kostet nicht die Welt. Aber ein Mann muss her, Frieda.«
Er ging, ungeachtet ihrer Abwehr, zum Ortsbauernführer; er kam wieder mit zufriedenem Gesicht. »Nächste Woche schon kriegt ihr einen Russen zugeteilt.«
Die beiden Frauen saßen schweigend: die junge, schmale mit gewölbtem Rücken, Hände im Schoß; die ältere, große, mit massigen Hüften, Hilflosigkeit über den derben Zügen.
Der Mann redete ihnen zu: »Was ist schon so ein Iwan? Mit dem werdet ihr alle Tage fertig. Kostet nichts, und die Arbeit wird geschafft. Das ist doch die Hauptsache!«
»Dass man so was ins Haus nehmen muss«, jammerte Frieda. »Der verfluchte Krieg!«
Sie erschrak vor den Augen des Bruders.
»Das sagst du, eine deutsche Frau?« Er stand vor ihr, die Beine gespreizt. »Wir wissen, wofür wir unseren Krieg führen – und du jammerst wegen einem dreckigen Russen! Mach dich nicht lächerlich, Frieda! So ein Mordsweib wie du – und hat Angst vor einem Iwan. Mir dreht es das Herz um, wenn ich sehe, wie meine schönen Felder verludern …«
Sie war ganz Reue, ganz Zerknirschung, schnupfte, versprach, ihm keine Schande zu machen. Sie versuchte sich selbst zu trösten: »Das sind doch bloß halbe Menschen, nicht wahr, Heinrich? Und wir könnten dann endlich mit dem Feld am Hornberg anfangen …« Sie schwatzte, hastig und betulich, um den Bruder zu versöhnen: Drei, vier andere im Dorf hätten auch schon Kriegsgefangene. Man könne mit ihnen auskommen, sie seien ruhig und verstünden zu arbeiten. »Aufgemuckt hat noch keiner, und wenn man sie fest anpackt, sind sie schon zu gebrauchen.«
So war es beschlossene Sache.
Am dritten Tage fuhr Heinrich Marten zurück an die Front. Die Frauen begleiteten ihn bis in die Kreisstadt, zum Bahnhof. Als der Zug einlief, hing die Schwester ihm am Halse, schnupfend und schluchzend. Seine Frau stand, dünn und blond und fröstelnd, unter dem grauen Märzhimmel und starrte hinauf zum Abteilfenster. Sie hob die Hand, zögernd und wie gezwungen, während Frieda neben ihr mit einem mächtigen weißen Taschentuch wedelte.
So blieben sie dem Mann in Erinnerung: die junge Frau, schmaler noch und blasser, neben der breiten, rotgesichtigen Schwester; die eine mit halb erhobener Hand, die andere mit wedelndem Tuch.
Die beiden gingen, während der Zug gegen Osten fuhr, die wenigen Kilometer ins Dorf zurück, und sie sprachen kein Wort miteinander.