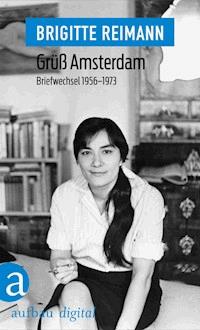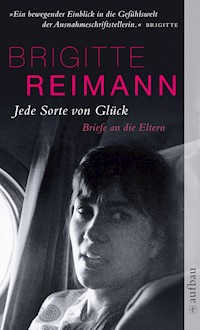8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Vom Idealismus der Jugend – und dem Erwachen.
Drei Freunde wollen vor dem Studium für ein Jahr in einem Industriebetrieb arbeiten. Auf die Schwierigkeiten dort reagiert jeder von ihnen anders: Nikolaus handelt zielstrebig, Recha ist begeisterungsfähig und streitbar, Curt entpuppt sich als Zyniker. Als sich beide jungen Männer in Recha verlieben, muss die sich entscheiden ...
Der legendäre DDR-Roman, der die »Ankunftsliteratur« begründete.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 364
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Über Brigitte Reimann
Brigitte Reimann, geb. 1933 in Burg bei Magdeburg, war Lehrerin und seit ihrer ersten Buchveröffentlichung 1955 freie Autorin. 1960 zog sie nach Hoyerswerda, 1968 nach Neubrandenburg. Nach langer Krankheit starb sie 1973 in Berlin. Wichtigste Veröffentlichungen: Die Frau am Pranger (Erzählung, 1956), Ankunft im Alltag (Erzählung, 1961), Die Geschwister (Erzählung, 1963), Das grüne Licht der Steppen. Tagebuch einer Sibirienreise (1965), Franziska Linkerhand (Roman, 1974, vollständige Neuausgabe 1998), Ich bedaure nichts. Tagebücher 1955–1963 (1997, als Lesung mit Jutta Hoffmann DAV 066-5), Alles schmeckt nach Abschied. Tagebücher 1964-1970 (1998, als Lesung mit Jutta Hoffmann DAV 110-6). Außerdem erschienen die Briefwechsel mit Christa Wolf, Sei gegrüßt und lebe. Eine Freundschaft in Briefen 1964–1973 (1993), mit Hermann Henselmann, Mit Respekt und Vergnügen (1994); Aber wir schaffen es, verlaß Dich drauf. Briefe an eine Freundin im Westen (1995), und mit Irmgard Weinhofen, Grüß Amsterdam. Briefwechsel 1956–1973.
Informationen zum Buch
Vom Idealismus der Anfangsjahre
Gleich nach dem Abitur gehen Curt, Nikolaus und Recha für ein Jahr in einen Großbetrieb, in eine für sie fremde, aufregende Welt. Ein bisschen Trotz ist dabei im Spiel, viel Idealismus und noch mehr Abenteuerlust. Wie schwierig es werden wird, sich zu behaupten, ahnt keiner, und dass die beiden jungen Männer sich in Recha verlieben, macht es nicht leichter.
Ein legendäres Buch, das die »Ankunftsliteratur« begründete.
Kaum war Brigitte Reimann Anfang 1960 nach Hoyerswerda gezogen, da begann sie schon, ein Manuskript über die neue Welt zu schreiben, die sich ihr dort aufgetan hatte. Es sollte ein Buch werden, in dem endlich einmal die wirklichen Probleme in einem Großbetrieb zur Sprache kamen: schlechte Arbeitsbedingungen, Schlampereien, bornierte Funktionäre, dürftige Wohnverhältnisse der Arbeiter. Vor allem aber wollte sie über Leute berichten, die sich nicht kleinkriegen ließen und all diesen Widrigkeiten zum Trotz mehr als das Nötige taten.
Ein Jahr später war das Buch fertig: Drei Abiturienten, Curt, Nikolaus und Recha, wollen vor dem Studium für ein Jahr in einem Industriebetrieb arbeiten. Auf die Schwierigkeiten, denen sie sich unvermutet gegenübersehen, reagiert jeder anders. Nikolaus handelt zielstrebig und ruhig, Recha ist begeisterungsfähig und streitbar, und Curt entpuppt sich als Zyniker. Als sich beide Jungen in Recha verlieben, muss sie sich entscheiden.
Der Roman rief vor allem unter Jugendlichen, die ihre Probleme wiedererkannten, erregte Diskussionen hervor, und sein Titel wurde zum Kennwort für eine ganze Literaturströmung, die »Ankunftsliteratur«.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Brigitte Reimann
Ankunft im Alltag
Erzählung
Inhaltsübersicht
Über Brigitte Reimann
Informationen zum Buch
Newsletter
Erstes Kapitel
1
2
3
4
Zweites Kapitel
1
2
3
Drittes Kapitel
1
2
3
Viertes Kapitel
1
2
Fünftes Kapitel
1
2
3
Sechstes Kapitel
1
2
3
Siebentes Kapitel
1
2
3
Achtes Kapitel
1
2
Neuntes Kapitel
1
2
Zehntes Kapitel
1
2
3
Elftes Kapitel
1
2
3
Zwölftes Kapitel
1
2
3
Impressum
Erstes Kapitel
1
Die drei waren am Abend mit demselben Zug gekommen, aber sie kannten sich noch nicht, und nachdem sie auf der kleinen Station ausgestiegen waren, stand jeder für sich allein und mit einem niederdrückenden Gefühl von Fremdheit auf dem Bahnsteig.
Recha blickte sich um: Der Bahnhof war grau und schäbig und spärlich erleuchtet, dünner Regen stäubte und verwischte die Umrisse der Gebäude. Sie war enttäuscht; sie hatte sich den Eingang zu dieser jungen Stadt anders vorgestellt, großartiger, glänzender. Sie nahm ihren Koffer auf und ging, vorbei an dem Schild mit den blockigen Buchstaben, über den regennassen Bahnsteig und zur Sperre.
Die wenigen Reisenden hatten sich schon verlaufen, und die Vorhalle, mit ihren nüchtern getünchten Wänden und den schmutzigen Fliesen, lag verödet. Hinter der Tür zum Lokal grölte eine betrunkene Stimme. Recha zog fröstelnd die Schultern hoch. Was für ein Empfang in der neuen Heimat, dachte sie und hatte schon jetzt, fünf Minuten in der fremden Stadt, ziehendes Heimweh nach der freundlichen Sicherheit ihrer Schule und der Burg mit den lärmerfüllten Korridoren, nach der blonden Betsy und dem dicken, jungen, korrekten Kramer, der heute morgen am Gittertor gestanden und ihr nachgewinkt hatte.
Er hat mich gewarnt, dachte Recha, er hat gewußt, daß ich bei der ersten Schwierigkeit kopfscheu werde. Gleichzeitig fiel ihr aber auch ein, was sie ihm geantwortet und wie sie sich vor ihm aufgespielt hatte, und sie war beschämt, als stünde sie in diesem Moment wieder vor seinem Schreibtisch, unter Kramers spöttischem Brillenblick.
Recha stellte den Mantelkragen hoch und trat auf die Straße; sie vergaß ihre Enttäuschung vor dem weiten, von weißen und bunten Lichtern heiter überstrahlten Platz und vor den gestaffelten Reihen neuer Häuser mit Terrassen und zierlich verschränkten Balkongittern und mit vergnügten Neonbildern auf den Fassaden. Dies glich dem Bild, das ihre bewegliche Phantasie gemalt hatte und dessen Farben auch der unaufhörlich strichelnde Regen nicht verwischen konnte. Dann sah sie die beiden Jungen am Fuß der Treppe stehen. Wenigstens der eine von ihnen, ein Riese in derbem Kordanzug, Zimmermann vielleicht oder Maurer, schien hierherzugehören, und Recha ging auf ihn zu und fragte nach dem Weg zur H.-Straße.
Der Junge wandte ihr den Kopf zu, einen kleinen, schmalen Kopf mit kurzgeschorenem Haar, und sagte, unwirsch oder verlegen: »Keine Ahnung. Bin selbst fremd hier.«
»Zur H.-Straße?« fragte der andere, näher tretend. »Ich hab’ denselben Weg. Wenn ich Sie begleiten darf?« Er war kleiner und schlanker als der Junge im Kordanzug, er war auch sorgfältiger gekleidet und gab sich gewandt und selbstsicher, sein Gesicht trug einen schwer bestimmbaren Ausdruck von Schläue oder rechnerischem Geist. »Ich kenn’ mich aus«, sagte er, »ich hab’ meine Bude schon vor ’n paar Wochen besichtigt.«
Er betrachtete abschätzend das dünne schwarzhaarige Mädchen, ihren Koffer, ihren weinroten Sommermantel (für den Recha mehr als einen Monat in der Konservenfabrik Beeren und Kirschen ausgelesen hatte), und er sagte: »Praktisches Jahr, stimmt’s?«
»Ja, stimmt«, sagte Recha.
»Dann sind wir ja Kollegen.« Er reichte ihr die Hand, mit angedeuteter Verbeugung. »Curt Schelle, Curt mit C«, fügte er hinzu; er pflegte immer auf dieses C hinzuweisen, das seinem schlichten Namen ein wenig Glanz verlieh.
»Ich heiße Recha Heine«, sagte das Mädchen.
»Recha …«, wiederholte Curt. »Lessing. ›Nathan der Weise‹.« Er grinste schmerzlich. »Der Nathan war mein Thema beim Mündlichen. ›Erläutern Sie die Ringparabel‹ oder so. Hattest du auch so ’nen idiotischen Deutschpauker?«
Jetzt endlich tat der dritte den Mund auf, der die ganze Zeit nachdenklich und mit abwesendem Gesicht danebengestanden hatte, und sagte erstaunt: »Aber ich muß ja auch in die H.-Straße.« Er bemerkte, überempfindlich für die Reaktionen anderer, Curts plötzlich in Abwehr erstarrte Miene, und er beeilte sich zu erklären, daß er ebenfalls in diesem Jahr sein Abitur gemacht habe und nun im Kombinat arbeiten wolle, und wenn sie erlauben, würde er sich ihnen anschließen.
»Also schön, der dritte Mann«, sagte Curt, der sich nicht einmal die Mühe nahm zu verbergen, daß die Gegenwart dieses Dritten ihn störte. »Hoffentlich gehst du nicht so langsam, wie du denkst, sonst sind wir erst morgen früh da.«
Recha lachte, und Curt, ermutigt durch ihr Lachen, stichelte weiter gegen den unbeholfenen Jungen, der sich vorzustellen vergessen hatte: »Dein Name, Großer, ist doch wohl keine Verschlußsache, wie?«
»Nein«, sagte der gehorsam. »Nikolaus Sparschuh.« Er beobachtete die beiden mißtrauisch; er schien darauf zu warten, daß sie sich über seinen altmodischen Namen laut amüsierten. »Nikolaus ohne c«, setzte er dann hinzu.
»Haha«, sagte Curt. »Ein Bursche von unendlichem Humor.«
»Shakespeare. ›Hamlet‹«, sagte Nikolaus gelassen, und Curt, der jetzt das Gefühl hatte, er werde hier unziemlich parodiert, warf seinen Campingbeutel über die Schulter, kommandierte: »Los, haun wir ab!« und ging.
Nikolaus nahm wortlos Rechas Koffer und folgte Curt in kleinem Abstand. Recha deutete auf die schwarze Mappe, die Nikolaus an seinen Koffer gebunden hatte. »Zeichnest du?«
»’n bißchen«, sagte er, »mehr so zum Spaß.« Er verschwieg, daß er seit langem davon träumte, man werde ihn später zum Studium an einer Kunsthochschule zulassen.
»Und was zeichnest du am liebsten?« fragte Recha, um überhaupt etwas zu sagen.
»Ach, eigentlich alles«, murmelte Nikolaus, und damit war das Thema erschöpft, und sie gingen schweigend nebeneinanderher, unbehaglich unter dem zähen Regen. Bei der nächsten Lampe war Curt stehengeblieben und wartete auf sie; er hatte seine unbekümmerte Laune längst wiedergefunden.
Im bläulichen Licht sah Recha sein Gesicht, braungebrannt, hübsch, ein bißchen zu hübsch und zu glatt, fand sie, aber es gefiel ihr, dieser ganze bewegliche, dreiste, gut angezogene Junge gefiel ihr. Um den Hals trug er, nach der Manier gewisser Halbstarker, ein silbernes Kettchen, und Recha überlegte, ob eine Schaumünze an dieser Kette hinge oder etwa ein Medaillon mit dem Bild irgendeines Mädchens.
Der Weg bis zur Unterkunftsleitung war nicht allzu weit, und Curt nutzte die knappe Zeit, um die beiden auszuforschen, woher sie kämen; er selbst, berichtete er, sei aus D., sein Vater Werkleiter in einer volkseigenen Textilfabrik.
»Mein alter Herr hätte mich ja mit dem Wagen herbringen können«, sagte er. »Er fährt ’n Wartburg, und der Wartburg ist immer noch die sauberste Kiste, die wir bei uns laufen haben. Im Juni hab’ ich die Fahrerlaubnis gemacht, aber denkt ihr, er gibt mir den Wagen? Ehe ich ihm mal ’n paar Liter Benzin aus den Rippen geleiert hab’ –«
»Ich habe keine Eltern«, sagte Recha, ruhig und wie beiläufig.
Curt, ernüchtert, merkte endlich, daß diese für einfältige Gemüter berechnete Angeberei hier nicht verfing. Er lachte und sagte mit einem liebenswerten Ausdruck von Aufrichtigkeit: »Du hast recht; ich will bloß Eindruck schinden bei dir.« Er konnte von entwaffnendem Charme sein, wenn er wollte (und meistens wollte er), und er richtete jetzt seine dreisten grünen Augen auf Recha und sagte: »Aber ich bin schon verdammt froh, daß ich den Zug genommen hab’. Ich wär’ sonst um eine reizende Bekanntschaft ärmer …«
Lieber Himmel, der macht’s aber billig, dachte Nikolaus, und er wünschte, das Mädchen würde diesen Burschen und sein Gewäsch so leicht nehmen, wie er es verdiente. Er wagte einen schüchternen Versuch, Recha von dem anderen abzulenken, und fragte, auf welche Schule sie gegangen sei.
»Ich war im Oberschul-Internat in H.«, sagte Recha. »Vor ein paar Jahren noch nannten die Leute unsere Schule die ›rote Burg‹. Das sollte ein Schimpfwort sein, und zuerst ärgerten wir uns darüber, dann gewöhnten wir uns daran, und schließlich redeten wir selbst nur noch von der ›Burg‹. In Wirklichkeit ist es bloß ein komisches kleines Schloß – aber wir fanden es schön, wir waren richtig zu Hause dort, weißt du –« Sie hatte auf einmal Lust, gerade diesem schweigsamen, schwerfälligen Nikolaus von Kramer zu erzählen und von Betsy, von ihrem Treibhaus und dem Park und der immer halbdunklen Bibliothek mit ihrem unverwechselbaren Geruch von Staub und Leder und der Druckerschwärze neuer Bücher und Zeitungen. Er sieht aus, dachte sie, als könnte er gut zuhören.
Curt jedoch, der es nicht ertragen konnte, nicht Mittelpunkt zu sein, zerriß mit einem Witz das schwache Fädchen Einverständnis zwischen Nikolaus und dem Mädchen, er drängte sich näher an Recha, erzählte, gestikulierte, machte sich über seine Lehrer lustig; er hatte eine scharfe Zunge und liebte es, die Schwächen anderer Leute boshaft und treffend zu karikieren.
Sogar Nikolaus lachte; irgend etwas an diesem Curt mit C gefiel oder imponierte ihm. Selbst unbeholfen bis zur Grobheit, bewunderte er Jungen in seinem Alter, die mit heiterer Selbstverständlichkeit Mädchen unterhalten und für sich einnehmen konnten. Er hätte gern diese großäugige, dunkelhaarige Recha für sich eingenommen; ihr Gesicht, mit der schmalen, vorspringenden Nase, erinnerte ihn an das Bild einer Frau, auf deren Namen er sich jetzt nicht besinnen konnte. Freilich wußte er recht gut, daß er gegen den geschmeidigen Curt nicht aufkommen würde, er trottete stumm neben ihm her, und nur einmal, direkt befragt, sagte er: »Ich wohne in M. Mein Vater ist Buchdrucker.« Alles andere, dachte er, geht sie nichts an – vorläufig wenigstens geht es sie nichts an.
Schließlich erreichten sie die Unterkunftsleitung.
Bevor sie sich verabschiedeten und ihre Zimmer in der Zwischenbelegung suchten, sagte Curt: »Wir könnten uns morgen früh treffen und zusammen ins Kombinat fahren.« Dies war, deutlich genug, nur für Recha bestimmt. Sie blickte Nikolaus an, der ein wenig abseits stand, sehr groß, ein bißchen plump in seinem abgeschabten Kordanzug, und er tat ihr leid. »Du kommst doch mit, ja?« fragte sie.
Nikolaus nickte. Er hätte dem Mädchen gern etwas Freundliches gesagt; er merkte, wie unruhig und furchtsam sie die dunklen Häuserfronten musterte, und er versuchte ihr zuzureden: »Du mußt nicht soviel an zu Hause denken, wenigstens nicht in der ersten Nacht. In der ersten Nacht ist das Heimweh am schlimmsten, weißt du, aber nachher gewöhnt man sich schnell –«
»Guter alter Onkel«, murmelte Curt ergriffen.
2
In Rechas Zimmer wohnte eine Tiefbauarbeiterin, ein stämmiges, untersetztes Mädchen Ende der Zwanzig. Sie saß, als Recha eintrat, auf ihrem Bett und stopfte Strümpfe; sie war nur mit einem rosa Hemd bekleidet, und Recha stammelte verlegen: »Entschuldigen Sie, daß ich so spät noch störe …«
»Macht nichts«, sagte das Mädchen, ihre Stimme war männlich tief und rauh. Sie betrachtete Recha unbefangen vom Kopf bis zu den Füßen, dann gab sie ihr die Hand, eine schaufelbreite Hand mit zerspellten Nägeln, und fuhr fort: »Na, richt dich ein! Das Spind links gehört dir. Vertragen werden wir uns, was?«
»Ich glaube schon«, sagte Recha. Sie erkundigte sich, wo sie sich waschen könne, und sie vermied es, das Mädchen direkt anzureden, weil sie nicht sicher war, ob sie ebenfalls das »Du« gebrauchen durfte. Der korrekte Kramer hatte streng darauf geachtet, daß sich, trotz des engen Zusammenlebens im Internat, keine unpassenden Vertraulichkeiten im Umgang zwischen Schülern und Erwachsenen einschlichen.
Sie zog den Mantel aus und setzte sich aufs Bett; sie merkte jetzt erst, wie müde sie war, und sie hätte sich gern schlafen gelegt. Aber sie schämte sich vor dem fremden Mädchen: Dies war nicht Betsy, ihre rundliche blonde Freundin Betsy, vor der sie keine Heimlichkeiten gehabt und mit der sie, sechzehnjährig, abends vor dem Spiegel gestanden hatte (wir haben, entsann sich Recha – belustigt und zugleich geniert –, jeden Sonnabend gemessen, wer den größeren Brustumfang hätte, und Betsy hat mich immer um ein paar Zentimeter überrundet).
»Was machst du? Labor, hm?« fragte das Mädchen.
»Erdarbeiterin, denk’ ich«, sagte Recha kühn.
»Erdarbeiterin«, wiederholte das Mädchen verächtlich. »Mit den Fingerchen? Eine Handvoll wie du … Dünn bist du, daß ich dich mit einer Hand könnt’ durchbrechen.«
Recha schielte auf die gewaltigen Muskeln der anderen, und sie glaubte ihr aufs Wort. Trotzdem reizte die skeptische Herablassung sie zum Widerspruch, und sie sagte, großspurig wie damals vor Kramers Schreibtisch: »Was andere schaffen, schaff ’ ich auch. Zu Anfang wird’s kein Kinderspiel sein, klar. Aber man gewöhnt sich, und wenn man die Technik erst raus hat …«
»Technik! Deine Technik mußt du hier sitzen haben«, sagte das Mädchen und winkelte die stämmigen Unterarme.
Recha widersprach hitzig. »Blödsinn! Hier sitzt die Technik«, und sie pochte sich gegen die Stirn.
»Da sitzt höchstens dein Vogel«, rief das Mädchen, und ihre Stimme klang grollend und rauher als vorher. »Auf Schule bist du gegangen, was? Und das kommt her und redet von Technik … Ich bin beim Tiefbau, Mensch, ich weiß Bescheid.« Sie sah Rechas bestürztes Gesicht und fügte freundlicher hinzu: »Wirst noch ’ne Menge einstecken müssen, Kleine.«
Recha nickte; es tat ihr leid, daß sie sich schon am ersten Abend mit dem Mädchen stritt, das für die nächsten Monate ihre Zimmergefährtin sein sollte. Nach einer Weile bat sie: »Könnten Sie sich mal einen Augenblick umdrehen? Ich möchte mich ausziehen.«
»Ich guck’ dir nichts ab«, brummte das Mädchen, aber sie drehte sich doch um. Gegen die Wand sagte sie: »Hier redt man sich mit Du an. Du kannst Lisa zu mir sagen – wenn du dir nicht zu fein bist dafür.«
Nach einiger Zeit verließ Lisa das Zimmer. Recha lag im Bett, die Arme hinterm Kopf verschränkt, und starrte an die Decke, sie dachte: Das Zimmer ist scheußlich – kein Vergleich mit der Burg. Hier kann man nicht wohnen, hier kann man höchstens schlafen … Die kahlen, blaß gemusterten Wände bedrückten sie, die spärlichen Möbel und die grelle weiße, nichts mild verschleiernde Milchglasglocke unter der Decke.
Dann kam Lisa zurück, sie holte Brot, Wurst und Butter aus ihrem Spind und machte ihre Schnitten für den nächsten Morgen zurecht. Einmal fragte sie über die Schulter: »Heulst du, Kleine?«
»Nein«, flüsterte Recha.
»Du bist zum erstenmal von Mutters Schürzenzipfel weg, was?«
»Ich habe keine Mutter.«
»Ach«, sagte Lisa und wandte sich um. »Gestorben?«
»Vergast«, sagte Recha laut, aggressiv und mit einem Ausdruck von Haß, der Lisa erschreckte.
»Ach«, sagte sie noch einmal. »Ich wollte nicht … Aber ’n Vater hast du doch, oder nicht? Ich meine bloß … du bist so schick angezogen, das muß doch wer bezahlt haben –«
»Vater? Weiß nicht. Muß wohl einen gehabt haben«, sagte Recha in bösartigem Ton, sie dachte – und sie gebrauchte, wenn sie an diesen unbekannten Vater dachte, immer ausgesucht derbe Wörter, die für gewöhnlich nicht zu ihrem Sprachschatz gehörten –: Abgehauen. Verduftet. Ich hoffe, er ist an der Front verschüttgegangen. Ich hoffe, er ist krepiert, der Arier …
Lisa, mitfühlend und neugierig, versuchte noch eine vorsichtige Frage anzubringen, aber Recha lag mit geschlossenen Augen, das Gesicht kalt und versperrt, und antwortete nicht mehr. Lisa knipste das Licht aus und tappte auf nackten Füßen zum Bett. Sie horchte eine Weile auf die Atemzüge ihrer Nachbarin. Sie hatte immer noch diese scharfe, haßerfüllte Stimme im Ohr, und sie empfand etwas wie Widerwillen gegen die sonderbare Fremde mit ihrer dunklen Herkunft.
Lisa stammte aus einer Arbeiterfamilie mit sieben Kindern, ihr Vater war unversehrt aus dem Krieg zurückgekommen – Krieg und Faschismus hatten keinen ihr nahestehenden Menschen vernichtet, und die Leiden anderer kannte sie nur aus Büchern und Berichten. Vergast, dachte sie, und: Muß wohl einen Vater gehabt haben … Sie fand keinen Zusammenhang, konnte sich aus den knappen Andeutungen keine Geschichte reimen, die ihr die Lebensumstände des Mädchens erhellt hätte, aber es nahm ihr den Schlaf (meinen sauer verdienten Schlaf – und morgen früh um vier ist die Nacht für mich rum).
Endlich sagte sie ins Dunkle: »Du, Kleine … Hast du was zu essen mit?«
»Nein«, sagte Recha erstaunt.
»Wenn du nichts zu essen hast«, sagte Lisa, »in meinem Spind ist genug.«
Sie lachte ein bißchen unsicher.
»Wurst und Butter, verstehst du, brauch’ ich jede Menge.«
»Danke schön«, sagte Recha. »Das ist nett von dir.« Sie ahnte, was in Lisa vorging; sie hatte oft genug erfahren, wie verlegen andere Leute wurden, wie unbehaglich und unfrei sie sich plötzlich bewegten, wenn sie von Rechas Mutter hörten – als fühlten sie sich alle mitverantwortlich dafür, dachte Recha, daß in Deutschland einmal Gaskammern für Juden gebaut wurden.
»Ich habe dich vorhin vor den Kopf gestoßen, nicht wahr? Nimm’s mir nicht übel«, sagte Recha nach einiger Zeit, aber es kam keine Antwort, und sie war nicht sicher, ob Lisa sie noch gehört hatte.
Rechas Vater war Architekt gewesen; er hatte sich, ein halbes Jahr nach Rechas Geburt, von seiner jüdischen Frau scheiden lassen; es war ein gefährliches Wagnis, noch im Jahre 1941 mit einer Nichtarierin zu leben – in der Tat waren die meisten Mischehen schon Jahre vorher geschieden worden –, er hatte Ruf und Stellung aufs Spiel gesetzt und, bedrängt, bedroht, getreten von den Nazi-Behörden, schließlich resigniert.
Recha entschuldigte nichts, und sie bürdete dem Mann, dessen Namen sie nicht einmal in den Mund nahm, die Schuld am Tod ihrer Mutter auf. Deborah Heine war nach Ravensbrück gebracht, der kleine Bastard in ein nationalsozialistisches Erziehungsheim gesteckt worden. Obgleich sich Recha an diese Zeit nicht mehr erinnerte, hatte sie Spuren in ihr zurückgelassen, die all die Jahre nach dem Krieg und die freundliche Fürsorge ihrer Lehrer und Heimleiter nicht verwischen konnten.
Recha war, trotz ihrer gelegentlichen Anfälle von Furchtsamkeit und krampfhafter Schüchternheit, von hitzigem Temperament, und manchmal malte sie sich aus, was sie jenem Mann sagen und antun würde, wenn er ihr eines Tages gegenüberstehen sollte. Sie wußte nicht, wie ihre Mutter ausgesehen, was für Haare und Augen sie gehabt hatte, aber sie war überzeugt, sie sei ihr ähnlich.
Eine polnische Genossin, die einmal das Internat besuchte, hatte ihr gesagt, sie sähe – mit ihren dunklen Augen und der schmalen, vorspringenden Nase – wie die junge Rosa Luxemburg aus, und Recha empfand, seit sie deren wunderbare Gefängnisbriefe gelesen hatte, diesen Vergleich als eine Auszeichnung.
Als sich ihre Augen an das Dunkel gewöhnt hatten, nahm sie wieder die Umrisse der Möbel wahr und das hellere Rechteck der Tür. Ein blasser Streifen Licht fiel durch den Spalt am Fenstervorhang. Wir müssen umräumen, dachte sie, wir müssen irgendwas Buntes reinbringen, ein paar Bilder, Blumen, eine Decke über das abscheuliche Wachstuch … Lisa scheint ein bißchen gleichgültig zu sein, es scheint ihr nichts auszumachen, wenn sie zwischen nackten Wänden haust, in einer Wohnung, die den Namen Wohnung noch nicht verdient. Sobald ich das erste Geld verdient habe …
Aber während sie noch Pläne machte, rechnete, entwarf – und sie wußte, daß sie es eigentlich nur tat, um sich abzulenken und ihr Heimweh schlau zu überspielen –, schweiften ihre Gedanken schon ab, zurück in den Park mit seinen von Löwenmaul und Astern und späten Rosen überwucherten Beeten, zurück in die Burg, und sie sah wieder die winklig verbauten Gänge und finsteren Treppen und ihr Zimmer, in das morgen oder übermorgen zwei fremde Mädchen einziehen würden. Vor zwei Jahren, als es den großen Wettbewerb zwischen den Heimschülern gab, hatten sie ihr Zimmer selbst ausgemalt, eifrig, liebevoll und nicht sehr geschickt, und als sie nur den dritten Preis bekamen, waren sie still für sich überzeugt gewesen, Kramer sei ungerecht oder habe zumindest keinen Geschmack.
Sie dachte auch an Betsy, die gestern früh nach Rostock abgereist war, auf die Universität, und sie fragte sich zum hundertstenmal, ob es nicht gescheiter und bequemer gewesen wäre, ebenfalls nach Rostock oder nach Berlin zu fahren, statt hierher ins Kombinat, in ein unbekanntes und aufregendes Gebiet. Bequemer wär’s bestimmt, dachte sie jetzt.
Sie erinnerte sich genau an den Tag im Juni, als Kramer sie zu sich rufen ließ. Es war sehr heiß, seit Wochen hatte es nicht geregnet, der Himmel war weißblau und die Erde grau und rissig vor Dürre. Sie waren eben vom Feld gekommen, schmutzig und verschwitzt, und in ihren Kleidern hing noch der Duft von Heu und wilden Kräutern.
Kramer saß an seinem Schreibtisch, dick, hellblond, noch jung, mit spöttischen grauen Augen hinter der Brille. Er sah aus, als ob ihm die Hitze nichts anhaben könnte, und Recha dachte belustigt: Er ist sogar zu höflich, als daß er in Gegenwart anderer schwitzte.
»Setzen Sie sich, Fräulein Heine«, sagte er. »Nun, haben Sie es sich überlegt?«
»Ja«, antwortete Recha. »Wenn Sie’s für richtig halten, würde ich am liebsten ein Jahr praktisch arbeiten.«
»Irgendwelche Sonderwünsche?«
»Schwarze Pumpe«, sagte Recha.
»Sie könnten doch hier in der Nähe arbeiten, im Persilwerk in G. vielleicht. Warum so weit weg, Fräulein Heine? Warum ausgerechnet in die Schwarze Pumpe?«
Sie zögerte einen Moment, dann sagte sie, verlegen lächelnd: »Unter anderem deshalb, weil es so romantisch klingt …«
»Romantisch, du lieber Himmel … Die Romantik wird Ihnen bitter ankommen, wenn Sie acht Stunden in der Erde herumgekratzt haben.«
»… und gerade deshalb, weil es so weit weg ist«, vollendete Recha.
Kramer sah sie aufmerksam an. »So. Kleiner Selbständigkeitstick bei Ihnen, nicht wahr?«
»Nennen Sie’s, wie Sie wollen«, sagte Recha und errötete vor Ärger.
Nach einer Pause fuhr Kramer fort: »Sie wissen, daß ich es für gesund und nützlich halte, wenn die Abiturienten für ein Jahr in die Produktion gehen. Aber Sie, liebe Recha – für Sie sehe ich schwarz – entschuldigen Sie, daß ich Ihnen das ohne Umschweife sage.« Er griff nach seiner Zigarettenschachtel, ließ die Hand aber wieder sinken; er vermied es, im Beisein seiner Schüler zu rauchen (obgleich er so gut wie jeder andere Lehrer das »Raucherkollegium« kannte und den Winkel, in dem sich die Jungen und ein paar Mädchen zu treffen pflegten). »Ich fürchte, Sie werfen die Flinte ins Korn, wenn nicht alles so glatt und – romantisch vor sich geht, wie Sie es sich vorstellen.«
»Ich werf ’ die Flinte nicht ins Korn«, widersprach Recha heftig. »Ich bin stark genug; ich arbeite auf dem Feld wie die anderen – oder? Und ich will selbständig werden, klar, und ich will nicht ewig Angst haben vor fremden Menschen …« Sie unterbrach sich, sie suchte vergebens nach Worten, mit denen sie ihre Gründe erklären könnte.
»Sie wissen, niemand zwingt Sie«, setzte Kramer noch einmal an.
»Ich mag nicht immer auf meinen VdN-Ausweis reisen«, sagte Recha, leise und entschieden. »Ich mag nicht immer bedauert und gehätschelt werden und aus der Reihe tanzen –«
»Gut, gut«, sagte Kramer schnell. »Ich werde also das Nötige veranlassen … Sie können dann wieder zu den anderen gehen.« –
Die letzten Wochen im Internat hatte Recha in dem Bewußtsein gelebt, daß diese Zeit eine strenge und rasch ablaufende Frist war, nach der sie etwas Köstliches und Unwiederbringliches verlieren würde: eine Heimat, Freundschaften, eine Kindheit und die Geborgenheit in einer festgefügten Gesellschaft.
Heute morgen hatte Kramer sie zum Tor begleitet, er hatte ihr seine dicke, kurze Hand gereicht, blinzelnd hinter den Brillengläsern, und in einem ungewohnt herzlichen Ton gesagt: »Ich bin nicht so anmaßend zu glauben, daß unser Internat so etwas wie ein Elternhaus für Sie war, Recha. Immerhin …«, und er gebrauchte plötzlich das verpönte Du, »wenn du einmal ernsthaften Kummer hast, dann schreib oder komm her …« Er schien noch etwas hinzufügen zu wollen, schwieg aber und begnügte sich damit, ihr die Hand zu drücken und zu winken, als sie die Straße hinabging, langsam, allein und immer wieder den Kopf nach ihm umdrehend.
Vielleicht, dachte Recha jetzt, fürchtete er, ich könnte seine Abschiedsrede für rührseliges Geschwätz nehmen und später darüber lachen …
Lisa hatte sich auf den Rücken gewälzt und schnarchte. Es muß bald Mitternacht sein, dachte Recha, und nun endlich, als sie mit geschlossenen Augen und hochgezogenen Knien dalag und auf den Schlaf wartete, fiel ihr ein, wie sie Kramer damals im Juni ihren Entschluß hätte erklären sollen.
Ich habe nüchternen Verstand genug – hätte sie sagen sollen –, um meine Schwächen zu erkennen: Mangel an Ausdauer, Angst vor jeder Veränderung, Unbeständigkeit der Gefühle – ach, ein ganzes Register von schädlichen Eigenheiten –, und ich nehme dutzendmal im Jahr einen Anlauf, mit ihnen fertig zu werden. Das hier, Herr Kramer, diese gewagte Fahrt ins Neuland, ist solch ein Anlauf, und diesmal will ich nicht auf halbem Weg stehenbleiben oder unbeherzt wieder umkehren. Ja … Und das ist schon alles, was ich Ihnen sagen wollte, glaube ich.
Auf der betonierten Straße ratterte ein schwerer Lastwagen vorüber, und die Scheinwerfer schleuderten ihr starkes Licht durch den Vorhang und in einer breiten, schnell abwärts gleitenden Bahn über die Zimmerdecke. Curt mit C und sein Wartburg, dachte Recha amüsiert, und dieser komische maulfaule Nikolaus … Schon zwei Bekannte oder Kameraden oder wie immer man es nennen will – und zwei sind beinahe mehr, als man sich für die erste halbe Stunde in einer fremden Stadt wünschen darf.
Recha war jetzt ganz zufrieden mit sich: Sie hatte eine Menge guter Vorsätze gefaßt und nahm, wie so oft, den guten Willen schon für die Tat, und so schlief sie schließlich ein, ein bißchen getröstet, sehr müde und mit sanft ineinanderfließenden Bildern von regenfeuchten Gesichtern und einem grauen Bahnhof und dem zitternden Widerschein bunter Lichter auf nassem Asphalt.
3
Nikolaus schaltete das Licht ein; sein Blick fiel, wohin er sich auch wandte, auf Kakteen, ein paar Dutzend Töpfchen mit kugelrunden und stäbchenförmigen und grotesk gegliederten Kakteen, mit wulstigen Hahnenkämmen und schmalen grünen Zungen und weißflockigen Greisenhäuptern, und in jedem Topf steckte ein flaches Holztäfelchen, das den lateinischen und den deutschen Namen trug.
Sie standen, auf hölzernen Gestellen zu Pyramiden getürmt oder in doppelt gestaffelten Reihen, auf den Fensterbänken und Nachttischen und sogar auf der Schrankkante, und Nikolaus sah sie sich an und seufzte.
Ein Mann mit Hobby, dachte er. Na gut, wenigstens hat er mein Bett noch nicht als Blumenständer benutzt.
Er erinnerte sich an die Abende mit einem alten Freund seines Vaters; der Mann hatte sich, seitdem er Rente bekam, der Kakteenzucht zugewandt und betrieb sie mit erschreckender Leidenschaft. Wenn er nicht gestoppt wurde, dachte Nikolaus, konnte er fünf Stunden lang pausenlos von seinen Kakteen reden; sie standen, wenn man ihm glauben wollte, immer kurz vor einem sensationellen Blütenausbruch.
Nikolaus packte seinen Koffer aus und begann sich einzurichten.
Er ließ sich Zeit; sein Nachbar hatte vermutlich Nachtschicht und würde nicht vor sechs Uhr zurückkommen.
Die Kargheit seines Zimmers störte Nikolaus nicht, er war genügsam und gleichgültig gegen Äußerlichkeiten, und er pflegte unbekümmert so lange in demselben Anzug herumzulaufen, bis seine Mutter das abgetragene Stück versteckte und ihm mit Gewalt einen neuen Anzug aufzwang. Zu Hause hatten sie sehr beengt gewohnt – drei Personen in Stube und Küche; Nikolaus hatte in einer Art Abstellkammer gehaust, und es war ihm recht gewesen. Wenn er nur ein Bett besaß und einen Tisch, an dem er zeichnen konnte, war ihm alles recht.
Auf die gelbe Wand neben seinem Bett heftete er drei ungerahmte Kunstblätter, Reproduktionen von Landschaftsbildern van Goghs, und er trat ein paar Schritte zurück und betrachtete sie, mit der gleichen Ehrfurcht, dem gleichen Entzücken wie stets. Er hatte sie hundertmal so angesehen, er hatte sie gleichsam auswendig gelernt – jeden blühenden Baum, jedes sonnenüberstrahlte Kornfeld, jede zärtlich verschwimmende Wolke am überschwenglich blauen Himmel –, und er war in diesen Landschaften zu Hause, als wäre er wochenlang unter der Sonne von Arles spazierengegangen, auf jenen Wegen, die van Gogh gegangen war.
Mein Gott, so malen können, dachte er, diese ekstatischen Farben sehen und für andere sichtbar machen können … Er hatte vorhin, als er eintrat, flüchtig die Fremdheit des Zimmers gespürt – jetzt, mit seinen Bildern an der Wand, erschien es ihm schon vertraut, und er bedauerte, daß er das Licht ausschalten und die leuchtenden Landschaften aufgeben mußte.
Erst als er im Bett lag, begann er den vergangenen Tag zu überdenken: den Abschied von seinen Eltern (seine Mutter hatte geweint; sie hatte eher als Nikolaus begriffen, daß dies ein endgültiger Auszug war und daß von nun an ihr Sohn nur noch ein gelegentlicher Gast sein würde, für den man, wie für jeden anderen willkommenen Besuch, Kuchen bäckt und ein Bett frisch überzieht), die Fahrt durch das flache, von Kiefernwäldern und rötlichvioletter Heide bedeckte Land, die Ankunft im Regen und die Begegnung mit den beiden, die über seine Begriffsstutzigkeit gelacht hatten.
Sie hat auch gelacht, dachte Nikolaus beschämt. Wahrscheinlich habe ich mich furchtbar dämlich benommen … Was für Augen! Und ihr Haar: unter der Laterne schimmerte es wie Mahagoni. Vielleicht darf ich sie malen, irgendwann, später. Wir haben ja noch ein ganzes Jahr vor uns … Aber diesen warmen Mahagoniton kriege ich doch nicht raus, das weiß ich jetzt schon, und dann werde ich mich wochenlang über mich selbst, über meine Stümperei ärgern.
Sie hat gefragt, was ich am liebsten zeichne. Vielleicht zeige ich ihr mal ’n paar Arbeiten … Aber sie interessiert sich bestimmt gar nicht, hat nur so aus Höflichkeit gefragt. Vermutlich ist sie blöd wie alle Mädchen: Sie fragen dummes Zeug und kichern ’n bißchen, oder – und das ist beinah noch schlimmer – sie bewundern einen und schreien oh und ach und begreifen nicht, daß ein Porträt durch die bloße fotografische Ähnlichkeit noch kein Menschengesicht wird …
Nikolaus’ Vater, ein Mann Ende der Fünfzig, war Buchdrucker und hatte viele Jahre in einem Kunstverlag gearbeitet. Vor 1933 war er Sozialdemokrat gewesen, aber er hatte sich politisch nie hervorgetan, und während der Nazizeit verhielt er sich still und wartete ab. Er hatte jedoch genug gelernt in jenen zwölf Jahren, und als sich nach 1945 die beiden Arbeiterparteien zusammenschlossen, trat er ohne gewichtige Vorbehalte der SED bei.
Während seiner Freizeit malte er, ohne Selbsttäuschung und ohne große Ansprüche an sich selbst. Er wußte, daß es für ihn zu spät war, jemals mehr zu werden als ein geschickter Dilettant, und desto eifersüchtiger wachte er über Nikolaus’ Begabung.
»Lern, Junge, verdien dir dein Studium«, pflegte er zu sagen. »Als ich so alt war wie du, hätt’ ich sonst was drum gegeben, wenn man mir solche Chancen geboten hätte wie euch heutzutage.« Nikolaus, der auch ohne Ermahnung ein fleißiger und gewissenhafter Schüler war, fand Predigten dieser Art recht überflüssig und auf die Dauer langweilig, aber er hörte geduldig zu und hielt den Mund. Er nahm, wie die meisten jungen Leute, diese hundertmal herausgestrichenen Chancen mit gelassener Selbstverständlichkeit hin.
Seine Mutter bestand darauf, er sollte nach dem Abitur in einen Betrieb gehen, »damit du nicht vergißt, woher du gekommen bist«, sagte sie. Sie blickte auf seine langen, empfindlichen Hände, sie sagte nachdrücklich: »Und damit du kapierst, wer dein Studium bezahlt. Wir können’s nicht.«
Nikolaus dachte an seinen geduldigen Überdruß bei Vaters Vorhaltungen, und er fühlte sich durchschaut. »In Ordnung«, sagte er, und damit war über das nächste Jahr entschieden.
Nikolaus gähnte, streckte sich und stieß derb gegen das Kopfteil seines Bettes. Es war ein solides, braungestrichenes Metallbett, aber offenbar nicht für Leute von außergewöhnlicher Länge konstruiert.
Er rieb sich den Kopf. Teufel, ich habe meine schöne Schiebermütze vergessen, dachte er, und, mit einem Gedankensprung: Ich glaube, das Mädchen hat mich für einen Maurer gehalten oder jedenfalls für einen, der schon lange dazugehört.
Sie sieht aus, als ob sie einen brauchen könnte, der ein bißchen auf sie achtgibt. Schade, daß ich kein Talent habe, den Ritter zu spielen …
In der Tat war Nikolaus von hartnäckigem Mißgeschick verfolgt: Wenn ihm wirklich einmal ein Mädchen gefiel, zauderte er so lange, erwog mit solcher Gründlichkeit jeden Schritt seiner Annäherungstaktik, daß sie sich längst einem anderen zugewandt hatte, ehe er sich endlich schlüssig geworden war. Er sah sie dann, resigniert und zugleich erleichtert, mit dem anderen über den Schulhof spazieren, und eigentlich fand er es bequemer und erfreulicher, ein Mädchen aus der Ferne zu bewundern.
Über sein Tanzstundendrama lachte die ganze Schule: Der Tanzlehrer hatte ihm ein Mädchen zudiktiert, siebzehnjährig, scheu und mäßig hübsch; sie war nach der 10. Klasse abgegangen und Verkäuferin in einem verstaubten Privatladen geworden. Acht Monate nach dem Abschlußball bekam sie ein Kind, und obgleich es bald ruchbar wurde, daß der Ladenbesitzer, ein geachteter älterer Herr, sein Lehrmädchen mißbraucht hatte, konnte sich Nikolaus wochenlang nicht retten vor dem Gespött seiner Klassenkameraden.
Er verteidigte sich, stotternd und errötend, und er verteidigte das Mädchen, und sicherlich begriff keiner der anderen, wie nah ihm diese Geschichte ging und warum er nichts Komisches oder auch nur Belächelnswertes darin finden konnte.
Auch in diesem Augenblick, als ihm die fatale Begebenheit wieder einfiel, sagte er sich: Und wenn es auch Quatsch sein sollte – ich mache mir Vorwürfe – heute noch. Ich habe doch gemerkt, wie bedrückt die Kleine immer war; natürlich hat der ekelhafte alte Kerl ihr damals schon nachgestellt. Sie hatte Angst vor ihm. Ich hätte mich um sie kümmern sollen, ich hätte sie ausfragen sollen, vielleicht wäre ihr noch zu helfen gewesen. Immer ist man im falschen Moment taktvoll. Nicht taktvoll – gleichgültig, verbesserte er sich.
Dieses Mahagonimädchen … Sie liebäugelt schon mit dem Affen. Mädchen fallen so schnell rein …
Er lag zusammengekrümmt, friedlich dösend, und manchmal horchte er auf die nächtlichen Straßengeräusche: unbekümmert lärmender Gesang, selig und falsch; ein Auto bremste scharf, und die Reifen schrillten; irgendwo im Block dudelte noch ein Radio.
Nikolaus, mit gelassener, durch keine Anfängerfurcht getrübter Vorfreude, malte sich den nächsten Tag aus, die Fahrt zu dritt und das Kombinat; er kannte es nur von Bildern und aus einem Film, und Erwartung spannte ihn, ungezügelte Neugier auf Menschengesichter und auf Eindrücke, die sich in Zeichnungen und Aquarelle umsetzen ließen.
Immer wieder aber, bis in den Schlaf hinein, umkreisten seine Gedanken Recha, für die er sich aus einem schwer bestimmbaren Grund verantwortlich fühlte. Es war eine seiner Schwächen, sich stets für irgendwelche Menschen verantwortlich zu fühlen, auch wenn sie nichts davon ahnten oder keinen Wert darauf legten – und ganz gewiß war es seine liebenswerteste Schwäche.
4
Curt warf seinen Campingbeutel auf den Tisch. Aus einem Knäuel von Kissen und Decken fuhr ein Kopf hoch, fuchsrot und stichelhaarig. »Ruhe, verdammtes Volk!«
»Guten Abend«, sagte Curt vergnügt.
Der Fuchs öffnete ein Auge, er fragte mit schlafdicker Stimme: »Willsten hier, Mensch?«
»Zunächst mal schlafen, wenn’s gestattet ist.«
»Ist gestattet«, sagte der Fuchs und bekam nun, mühsam und blinzelnd, auch das zweite wasserblaue Auge auf. »Dachte schon, es wär’n wieder so ’n paar Verrückte, die ins falsche Zimmer gelatscht sind.« Er fiel auf sein Bett zurück, aber er blieb wach und beobachtete Curt, der nach seinem Schlafanzug fischte.
»Miese Bude«, bemerkte Curt und schleuderte geschickt seine Schuhe von den Füßen.
»In der Neustadt gibt’s Junggesellenwohnungen mit Küche und Bad und allen Raffinessen. Bewirb dich doch«, sagte der Fuchs.
Curt hob ausdrucksvoll die Schultern. »Wenn ich unbedingt wollte … Mein alter Herr ist Werkleiter, verstehst du, er hat ’n langen Arm –«
»Ein langer Arm ist schneller verstaucht als ein kurzer«, sagte der Fuchs.
Er sah Curt an, aufmerksam, ein bißchen abschätzig, dann fügte er aufrichtig hinzu: »Leute mit Beziehungen sind nicht mein Geschmack.«
Curt hatte zum zweitenmal an diesem Abend das fatale Gefühl, er habe die falsche Platte aufgelegt. Scheint, als müßte man sich hier umstellen, dachte er – und mit einem leichtsinnigen kleinen Lächeln: Na schön, stellen wir uns um … Tatsächlich bereitete ihm der Gedanke, er werde hier gleichsam in eine neue Haut schlüpfen müssen, keineswegs Beklemmungen. Er war sicher, daß ihm auch diese neue Haut ausgezeichnet sitzen würde; er kannte seine Anpassungsfähigkeit und kultivierte sie mit Behagen.
Ich habe, sagte er sich, das glückliche Talent, mich sofort in jede Situation reinzufinden, und ich kann mit jeder Sorte Menschen umgehen. Ich werde auch mit diesem Rotkopf klarkommen. Er ist nicht viel älter als ich …
Er schwieg eine Weile, er taxierte das sommersprossige, gescheite Gesicht seines Zimmergenossen und versuchte dessen Beruf zu erraten; der andere aber, gutmütig und arglos, baute ihm schon eine Brücke, er sagte: »Wenn du einen väterlichen Rat vertragen kannst: Hau nicht auf den Putz, mein Sohn, und renommier nicht mit deiner großmächtigen Verwandtschaft, sonst kriegst du hier kein Bein auf die Erde.« Er lächelte (und es erheiterte Curt, zu sehen, wie seine rostbraunen Sommersprossen auseinanderflossen, sobald er das Gesicht verzog), er sagte: »Vor ’nem Jahr habe ich angefangen wie du – eben von der Schulbank weg und dicke Rosinen im Kopf …«
»Wie denn – auch Oberschüler?«
»Na, eine Sprosse höher sind wir schon geklettert. Jungingenieur … Aber wie ich dir sagte: Keine Rosinen, Verehrtester; deiner Brigade kannst du nicht mal mit einem Ministervater imponieren.«
»Okay«, sagte Curt, der sich jetzt für die Rolle des bescheidenen, aber munteren Greenhorns entschieden hatte. »Wenn ich mal ’nen guten Tip brauche, kann ich dich interviewen, ja?«
Der andere nickte, und dann machten sie sich ganz förmlich miteinander bekannt, und der Fuchs sagte, er heiße Heribert Hübner – »aber«, setzte er gleich hinzu, »das i laß besser weg. Meine Eltern sind furchtbar nette Leute, und ich weiß bis heute nicht, warum sie mir diesen Majoratsherrennamen angehängt haben.« Seine Stimme nahm einen tragischen Ton an. »Dieses i hat einen Schatten über meine ganze Kindheit geworfen …«
»Gott ja, wie das Schicksal so spielt«, sagte Curt, schmalzig und voll Mitgefühl, und sie grinsten sich an und waren jetzt bereit, einander ganz sympathisch zu finden.
Trotzdem dachte Curt, er habe noch eine Scharte auszuwetzen, um den Rotkopf vollends für sich zu gewinnen, und er begann von seinem Vater zu sprechen, während er im Schlafanzug auf seinem Bett kauerte und seine Abendzigarette rauchte – in einem köstlichen Unabhängigkeitsgefühl, weil keine gluckenhaft besorgte Mutter hereinkommen und seine verwerflichen Angewohnheiten tadeln konnte.
Er hatte das unersättliche Bedürfnis, sich vor anderen hervorzutun, und er war in seinen Mitteln nicht wählerisch. Wo er mit seinem Motorboot und dem tomatenroten Wartburg, mit der Villa am Stadtrand und einer elektrifizierten Hausbar und ähnlichen unerläßlichen Requisiten eines gehobenen Lebensstandards nicht Eindruck machen konnte, bemühte er die Vergangenheit seines Vaters, dessen Verdienste er unbekümmert auf sich übertrug.
»Du mußt verstehen, daß ich mit ihm angebe und stolz auf ihn bin«, sagte er, und das war nur zur Hälfte geschwindelt; manchmal empfand er wirklich Bewunderung für seinen Vater. »Früher war er Textilarbeiter mit ich weiß nicht wieviel Pfennigen Lohn in der Stunde. Mit achtzehn ist er in die KPD gegangen, und er ist dabeigeblieben, auch nach dreiunddreißig. Bei den Nazis hat er ein paar Jahre im Zuchthaus gesessen, und sie haben ihn gefoltert und zusammengeschlagen …, aber er hat keinen verpfiffen. Dreiundvierzig ist er dann doch noch Soldat geworden, aber er war keine zwei Tage an der Front, da ist er getürmt – hat keinen einzigen Schuß abgegeben. Mensch, nicht einen Schuß, ist einfach abgehauen, und sie haben hinterhergeknallt. Er muß ein toller Bursche gewesen sein, damals …«
Curt schwieg einen Moment, er war selbst überrascht und ein wenig befremdet, als er sich diesen Mann, den er eben einen tollen Burschen genannt hatte, vorstellte: wie er am Tisch saß – sie sahen sich nicht häufiger als zwei- oder dreimal in der Woche –, schon beleibt und in schlechter Haltung, die von ständigen Rückenschmerzen herrührte, oft müde und reizbar, immer in Eile, immer irgendwelche Tabletten schluckend …, ein Mann, der nur für seine Arbeit lebte und sich für die Annehmlichkeiten seines Hauses nicht interessierte, ja sie vermutlich gar nicht wahrnahm.
»Eigentlich kennen wir uns kaum«, sagte Curt, erstaunt, als fiele ihm das heute zum erstenmal auf.
Er erzählte dann weiter: »Drüben, in der SU, war er Bataillonspropagandist in einem Kriegsgefangenenlager. Als er zurückkam, fing er an zu studieren – in dem Alter noch, mein lieber Mann … Er hat seinen Diplom-Ingenieur gemacht und leitet jetzt ein großes Textilwerk.«
»Teufel, Teufel«, sagte Heribert, und dies war sein Ausdruck uneingeschränkter Anerkennung. Jedoch ließ er sich nicht leichtfertig bestechen, und er betrachtete mit einiger Skepsis das glatte, hübsche Bürschchen, das rauchend, mit lässig gekreuzten Beinen auf dem Bett saß; er sagte: »Na, hoffentlich sammelst du auch mal eigene Lorbeeren, mein Sohn.«
Curt drückte seine Zigarette aus, er sagte nichts; es enttäuschte und ärgerte ihn, daß seine Geschichte keine freundlichere Wirkung hatte, und er dachte an seine Schule zurück, wo er – als Sohn eines Bezirkstagsabgeordneten – von Lehrern und Schülern respektiert worden war, umschwärmt von den Mädchen, gefeierter Held seiner Klasse, von dem man nur in Superlativen sprach: Curt Schelle, der eleganteste Tänzer, der amüsanteste Unterhalter, der verwegenste Sportler und begabteste Laienspieler – kurz, ein junger Mann mit einer Menge gesellschaftlicher Talente.
Er war sogar ein guter Schüler, wenn er wollte – und ein paar Wochen vor den Zeugnissen wollte er. Er quälte sich mühsam durch das schriftliche Abitur; die mündliche Prüfung bestand er mit Glanz und Glorie.
Später, im Dunkeln, sagte er plötzlich: »Hör mal, gibt es in eurem Nest ’ne anständige Bar oder wenigstens ’n Kino?«
»Natürlich. Warum?« sagte Heribert in abweisendem Ton; es kränkte ihn, daß sich dieser grüne Junge nicht nach dem Kombinat erkundigte; er war in der Aufbauleitung und hätte bereitwillig und enthusiastisch tausend Fragen beantwortet, wenn sie nur seine Arbeit betrafen.
»Warum? Ich hab’ heute ein zauberhaftes Mädchen kennengelernt.«
»So?« sagte Heribert uninteressiert.
»Sieht ’n bißchen infantil aus, Typ Dornröschen vorm ersten Kuß«, sagte Curt, angestrengt schnoddrig; in Wahrheit beunruhigte ihn das fremdartige Gesicht des Mädchens. »Aber sie hat ägyptische Augen – falls du dir was darunter vorstellen kannst.«
»Mensch, verschon mich mit Weibergeschichten«, murrte der andere. »Ich mach mir nichts draus, ich mag sie nicht, Verehrtester, ich mag sie nicht mehr, und ich kann mich auch nicht für ägyptische Augen erwärmen.«
Curt lachte in sich hinein, er dachte: Eher nehme ich an, sie mögen dich nicht, mein sommersprossiger Freund, oder du hast eine unglückliche Liebe. Nun schmecken unserem hübschen Fuchs die Weintrauben sauer …
»Weibergeschichten«, wiederholte Heribert, immer noch mißmutig, weil das Bürschchen nach einer Bar gefragt hatte statt nach dem Kraftwerk West. »So eine Heuschrecke! Möchte wissen, warum du hergekommen bist.«