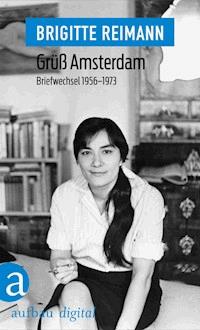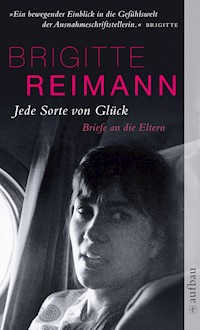6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
„Rebellin mit Leib und Seele.“ Der Spiegel Brigitte Reimann war erst Anfang Zwanzig, als sie eine Schülergeschichte und einen Roman aus dem Künstlermilieu zu schreiben begann, deren Brisanz erstaunlich ist für die frühe DDR-Literatur. Beide wurden damals von den Verlagen nicht gedruckt – aus politischen Gründen oder weil sie zu unkonventionell erzählt waren – und von der Autorin vergessen. Durch einen glücklichen Zufall sind die Manuskripte aufgetaucht, die Brigitte Reimanns früh ausgeprägtes sinnliches Erzähltalent belegen und geradezu als literarische Sensation gelten können. „Brigitte Reimann bricht so radikal mit Tabus wie danach nie wieder.“ taz
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 320
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Über Brigitte Reimann
Brigitte Reimann, geb. 1933 in Burg bei Magdeburg, war Lehrerin und seit ihrer ersten Buchveröffentlichung 1955 freie Autorin. 1960 zog sie nach Hoyerswerda, 1968 nach Neubrandenburg. Nach langer Krankheit starb sie 1973 in Berlin. Wichtigste Veröffentlichungen: Die Frau am Pranger (Erzählung, 1956), Ankunft im Alltag (Erzählung, 1961), Die Geschwister (Erzählung, 1963), Das grüne Licht der Steppen. Tagebuch einer Sibirienreise (1965), Franziska Linkerhand (Roman, 1974, vollständige Neuausgabe 1998), Ich bedaure nichts. Tagebücher 1955–1963 (1997, als Lesung mit Jutta Hoffmann DAV 066-5), Alles schmeckt nach Abschied. Tagebücher 1964-1970 (1998, als Lesung mit Jutta Hoffmann DAV 110-6). Außerdem erschienen die Briefwechsel mit Christa Wolf, Sei gegrüßt und lebe. Eine Freundschaft in Briefen 1964–1973 (1993), mit Hermann Henselmann, Mit Respekt und Vergnügen (1994); Aber wir schaffen es, verlaß Dich drauf. Briefe an eine Freundin im Westen (1995), und mit Irmgard Weinhofen, Grüß Amsterdam. Briefwechsel 1956–1973.
Informationen zum Buch
»Rebellin mit Leib und Seele.« Der Spiegel
Brigitte Reimann war erst Anfang Zwanzig, als sie eine Schülergeschichte und einen Roman aus dem Künstlermilieu zu schreiben begann, deren Brisanz erstaunlich ist für die frühe DDR-Literatur. Beide wurden damals von den Verlagen nicht gedruckt – aus politischen Gründen oder weil sie zu unkonventionell erzählt waren – und von der Autorin vergessen. Durch einen glücklichen Zufall sind die Manuskripte aufgetaucht, die Brigitte Reimanns früh ausgeprägtes sinnliches Erzähltalent belegen und geradezu als literarische Sensation gelten können.
»Brigitte Reimann bricht so radikal mit Tabus wie danach nie wieder.« taz
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Brigitte Reimann
Das Mädchen auf der Lotosblume
Zwei unvollendete Romane
Inhaltsübersicht
Über Brigitte Reimann
Informationen zum Buch
Newsletter
Joe und das Mädchen auf der Lotosblume
[I. Teil:] Drei Tage im November: Ein Morgen und ein Tag
II. Teil: Eine Nacht und ein neuer Morgen und noch ein Tag
Wenn die Stunde ist, zu sprechen …
1. Kapitel Debut der Dreizehnten
2. Kapitel Geschichte des Juden Mandelblüt
3. Kapitel Dr. Rinck läßt bitten
4. Kapitel Heute nachmittag um drei …
5. Kapitel Vor und nach einer Lateinstunde
6. Kapitel Einer spricht zuviel – und was danach geschieht
7. Kapitel Fest im Salon der Ahnfrau
Anhang
Withold Bonner Nachwort
Anmerkungen
Editorische Notiz
Impressum
Joe und das Mädchen auf der Lotosblume
Kleiner Roman
[I. Teil:] Drei Tage im November
Für Joe
Ein Morgen und ein Tag
Joe liegt neben mir, gleichmäßig hebt und senkt sich seine Brust, die grün-weiß gestreifte Jacke seines Pyjamas steht am Hals offen, ich sehe einen Schimmer seiner weißen Haut und die kleine schattige Vertiefung unter seiner Kehle. Joe schläft.
Wie kann er schlafen, wenn ich wache? Wenn Hendrik wacht?
Seit zwei Stunden höre ich Hendriks Pantherschritt im Zimmer nebenan. Er hat das Zimmer Nr. 12, ich habe Nr. 13. Die 12 wäre mir lieber gewesen, ich bilde mir ein, die Zwölf ist meine Glückszahl, ich weiß nicht warum; ich bin ein bißchen abergläubisch, klammere mich an Zahlen-Orakel und zupfe Blütenblätter: er liebt mich, er liebt mich nicht … Wenn ich stolpere – ich bin so ungeschickt, immer hab ich blaue Flecke an Knien und Ellenbogen – wenn ich stolpere, gehe ich drei Schritte zurück, damit mir nichts Böses widerfährt. So albern bin ich manchmal …
Als ich damals, im September, ins Heim gekommen bin, war die Zwölf schon belegt – von dem Maler, der sich jeden Abend besoffen hat, ganz allein für sich, ganz still, ohne Krakeel, und der dann so bitterlich geweint hat, wie der Heilige Georg hier war und ihn behext hat mit seinen schwarzen Augen und mit seiner Kunst.
Da hab ich halt die Dreizehn nehmen müssen, wenn es mir auch gar nicht recht war, und ich hab dreimal gegen den Türpfosten geklopft, ehe ich die Schwelle überschritten hab, aber genützt hat’s nichts, und jetzt kommt das Unglück, das all die Wochen sich in den Winkeln verkrochen hatte. Ich spür es und Hendrik spürt es, darum läuft er nun schon seit zwei Stunden in seinem Zimmer auf und ab und stiehlt mir den Schlaf und wird am Ende auch Joe noch aufwecken.
Wenn Joe nachts zu mir kommt, muß er an Hendriks Tür vorüber, das sind nur drei oder vier Meter, und der rote Läufer im Korridor dämpft die Schritte, aber mir ist es jede Nacht wie ein Wunder, daß Joe diese drei oder vier Meter schafft und an meine Tür klopft und dabei weiß: Hendrik liegt wach, und er hat ein Gehör wie ein Luchs und hört das Klopfen und hört, wie ich den Schlüssel herumdrehe …
Es ist noch nicht sechs Uhr, glaube ich. Ein Morgen im November steigt spät herauf, und die Sonne kriecht träge über den Wald – wie eine alte Frau, die nicht aus dem Bett finden kann und sich so gern noch einmal für ein Stündchen umdrehen und ein Auge voll Schlaf nehmen möchte.
Mein Zimmer schwimmt in grauer Dämmerung, das hellere Fenster-Viereck in der Wand schlitzt ein kümmerlicher Lichtstreif, wo die Vorhänge nicht ganz übereinander gezogen sind. Das Fenster ist wie eine Kino-Leinwand, der Vorhang ist noch geschlossen, aber die Leinwand ist schon [ein] bißchen erleuchtet, und gleich wird der Gong ertönen und der Film beginnen. Die Filmkulissen kenne ich: die Parkbäume und im Osten ein winziges Silberzipfelchen des Sees und darüber ein Stück Himmel, [ein] paar Handbreit Himmel.
Trotzdem bin ich jeden Morgen wieder gespannt auf die Kulisse, die jeden Morgen sich verändert hat: manchmal ist der Himmelsstreifen grau und regenschwer, manchmal ist er verschleiert von weißem Morgennebel, manchmal leuchtet er in dünnem Blau, violett und purpurn gesäumt; der karmesinrote Sonnenball rollt gemächlich herauf, er hat sich noch nicht erhitzt und blendet nicht, man kann ihn ohne Blinzeln betrachten.
Und erst die Bäume! Damals im September – Herrgott, das ist nun fast drei Monate schon her! – waren sie noch dunkelgrün und satt und voller Saft, als hätten sie das ewige Leben – und dann ist ihnen doch der Atem ausgegangen, ganz sacht zuerst, und sie sind [ein] bißchen müde geworden und haben’s noch immer nicht glauben wollen, sie haben sich gesträubt wie manche Frauen sich gegen das Altwerden sträuben: sie legen Puder und Rouge auf und färben sich die Haare und ziehen sich bunte Fähnchen an und laufen dem Leben hinterher.
Manchmal liebe ich den Herbst, seine Verschwendung, sein großzügiges Ausschütten starker Farben, seine krasse Lebensgier … Im Oktober brannten die Buchen wie Fackeln neben den ruhigeren gelben Lichtern der Eichen, [ein] paar Tannen warteten zwischen ihnen, gelassen und selbstsicher in ihrem soliden Kleid. Sie stehen da wie Forstbeamte, nüchtern und zuverlässig in grünen Lodenjoppen, wenn der Novemberwind den anderen längst die letzten bunten Fetzen heruntergerissen hat.
Joe seufzt und streckt sich, aber er schläft weiter.
Eigentlich sollte ich ihn wecken, er muß doch in sein Zimmer zurückgehen, bald wird das ganze Haus erwachen, und ich hab immer noch wie in der ersten Nacht Angst, irgendjemand könne frühmorgens durch den Korridor schleichen und Joe erwischen, wenn er eben mein Zimmer verläßt.
Und wennschon! In Haus wissen es eh’ schon alle, daß Joe und ich etwas miteinander haben, und keiner nimmt Anstoß daran – außer der Kritikerin natürlich. Neulich kamen wir kurz vor Mitternacht in den Klubraum, da stimmten die anderen einen wüsten Rundgesang an, ich hab bloß die ersten zwei Zeilen behalten:
›Es ist nicht unbedingt vonnöten,
daß einer singt und andre beten …‹
Sie waren betrunken, und beim zweiten Abgesang haben sie statt ›singt‹ ein andres Wort gebraucht, ein häßliches, ordinäres Wort – aber was hätten wir tun sollen? Gegen ein Fuder Mist kann man allein nicht anstinken, und Joe hätte nicht ein Dutzend Männer der Reihe nach ohrfeigen können. Sie waren ja betrunken, und wir haben uns ein Lachen um den Mund geklebt, obwohl uns, weiß Gott! nicht zum Lachen zumut war; wir müssen noch froh sein, daß keiner hingeht und uns dem Heimleiter verpfeift: dann fliegen wir mit Schimpf und Schande aus dem Haus.
Da schluckt man schon lieber ein gemeines Wort und lacht und trinkt mit den anderen: Prost, Freunde! Es lebe die Liebe, der Wein und der Suff – Prost, Joe! Zieh kein Gesicht, die sind doch bloß neidisch, übersieh ihre gieprigen Augen, Joe, trink! Uns kann ein schmutziges Wort nicht beschmutzen –
Im Nebenzimmer federt Hendriks Schritt. Denkt er an sein Buch? Denkt er an mich?
Fünf Schritte sind es vom Fenster bis zur Tür. Fünf Schritte: hin – zurück, hin – zurück. Uhrenpendel im Gleichmaß der Unstete. Tickende Uhren im Zimmer machen mich krank. Sie zerhacken die Zeit, jedes Zeitstückchen fällt einzeln in den Raum: ein weißes, ein schwarzes – eine gute, eine schlimme Minute …
Das Fenster-Viereck ist jetzt schon morgenbleich, langsam schälen sich die Umrisse der Möbel aus dem schwimmenden Grau.
Wenn man all die Zeitstückchen sammeln könnte und wieder aufreihen und alles von vorn beginnen – Ich hab schreckliche Angst vor dem Altwerden. Alt zu sein und denken zu müssen: Soviel hast du versäumt … Für wen bewahren wir uns?
Nein, ich werde Joe noch nicht wecken. Ich werde aufstehen und mich anziehen. Soll Joe schlafen, soll er das alles vergessen: Hendrik und den grauen Mann, der heute nacht über seine Schulter sah, und dieses ganze Irrenhaus und das Unglück, das kommen wird, heute oder morgen, ich weiß nicht, aber es wird kommen, ich spür’s.
Joe sagt, ich sei ein Spökenkieker. Heut nacht erst sagte er, ich sei ein Spökenkieker, und er lachte dabei, obwohl er ein bißchen daran glaubt, daß manche Menschen das zweite Gesicht haben. Sein Onkel hatte auch das zweite Gesicht, der war Nachtwächter in einem Dorf im Erzgebirge, und die Leute dachten, er habe einen Sparren, weil er oft verworrenes Zeug redete: Er traf jede Nacht an der Friedhofsmauer eine Selbstmörderin, eine junge Frau, die aus Liebeskummer sich im Dorfteich ertränkt hatte, und er unterhielt sich mit ihr wie mit einer Lebenden. Jedenfalls behauptete er das, und wahr ist, daß er eine Feuersbrunst vorausgesagt hat und später die ganz große Feuersbrunst, die dann halb Deutschland gefressen hat.
Solche Gruselgeschichten hat mir Joe heut nacht erzählt, und ich hab mich sehr gefürchtet.
Wie ich dann die Nachttisch-Lampe anknipste, sah ich Joes verschmitztes Lächeln, die vergnügten Lachfältchen um seine Augen, und ich merkte, daß er mich wieder einmal in seiner sanften Art verspottete, weil ich den ganzen Abend über so unruhig gewesen war und ihm mit meinen bösen Prophezeiungen in den Ohren gelegen hatte.
Trotzdem hab ich es mir nicht ausreden lassen: zuhaus ist etwas geschehn, irgendjemandem, den ich gern mag, ist etwas zugestoßen … Nein, das lasse ich mir nicht ausreden – wenn ich nur wüßte, was geschehn ist, wem etwas zugestoßen ist … Eigentlich hab ich doch gar keinen Menschen, der mir nahesteht, keine Eltern, keine Geschwister; eigentlich hab ich nur den Heiligen Georg, aber der ist mir so lieb wie Eltern und Geschwister und vielleicht noch lieber, weil er zugleich Bruder und Freund ist.
Er hat mir solange nicht mehr geschrieben, Tag für Tag hab ich auf einen Brief von ihm gewartet. Nein, ich hab in den letzten Wochen nicht mehr gewartet, in den letzten Wochen hat es nur noch Joe gegeben, bei Tag und bei Nacht nur Joe, und ich hab den Heiligen Georg fast vergessen. Vielleicht wäre alles anders gekommen, wenn der Heilige Georg mir geschrieben, wenn er mich noch einmal besucht hätte …
Nein, nichts wäre anders gekommen. Das hab ich damals schon gewußt, als der Heilige Georg auf einen Tag zu Besuch hier war und versäumt hat, mich zurückzuholen nach Haus – aber er war ja wie blind und taub, nichts spürte er von dem, was zu der Zeit schon zwischen Joe und mir spann.
Der Heilige Georg ist mir gestern abend erst wieder eingefallen, ich weiß genau: acht Uhr abends war es, wir saßen bei Tisch, wir waren ganz lustig, sogar Hendrik lachte über die Witze des Filmautors, der mit einem Feuerwerk verrückter Reden die Tafelrunde unterhält. Und plötzlich fiel auf meine Ausgelassenheit der Alpdruck – eine dunkle, unbestimmte Angst, die sich sofort mit dem Heiligen Georg verband. Ja, ich bin jetzt ganz sicher, daß ich sofort an den Heiligen Georg dachte …
Auf einmal sackte mir der Magen weg, ich konnte keinen Bissen mehr ’runterbringen, ich schlich mich aus dem Gelächter der anderen. Sehr rasch verdichtete sich die ungewisse Drohung zu einem stechenden Schmerz in der Brust, einer Stelle in der Brust, so genau bestimmbar, daß ich den Finger auf diese Stelle legen kann: hier sitzt der Schmerz.
Nein, ich bin kein Spökenkieker, und Joe darf mich auslachen, wenn es ihm Spaß macht. Aber der Spaß ist ihm ja schon vergangen, heute nacht schon, nachdem er mir seine grauslichen Gespenstergeschichten erzählt hatte.
Als er mich umarmte, blickte ein Mann über seine Schulter. Ich hatte minutenlang vorher schon gewußt, es war ein Dritter im Zimmer, und auf einmal blickte der graue Mann über Joes Schulter, und ich erschrak, weil ich sein Gesicht nicht erkennen konnte, und ich sagte: »Dreh dich nicht um, Joe.«
Joe ist ganz blaß geworden; später sagte er, ich habe eine überreizte Phantasie und sollte zum Nervenarzt gehen, und er hätte mir seine Geistergeschichten nicht erzählen sollen, und überhaupt seien wir beide auf dem besten Weg, verrückt zu werden.
Sicher, wir sind schon halb verrückt, seit Hendrik hier ist, sind wir halb verrückt. Aber nicht nur Hendrik ist schuld, wir selbst sind schuld, weil wir die Welt vergessen haben und uns vom Leben abgeschlossen, als gäbe es kein ›Draußen‹ mehr, und weil wir nicht gearbeitet haben: Joe hat keine Zeile geschrieben, ich hab keinen Strich gezeichnet.
Vielleicht ist es auch das Gewissen …
Früher, als ich ein Kind war, verband sich ›schlechtes Gewissen‹ immer mit Zuckernaschen und Flunkern und ›lieber Gott‹ und Strafe. Abends, in meinem weißen Gitterbett, bat ich den lieben Gott, er möge doch alles wieder gut machen, und am nächsten Morgen sagte ich zu Mutter: »Ich will’s nie wieder tun«, und weinte ein paar Tränen und hatte kein schlechtes Gewissen mehr – bis zum nächsten Mal.
Aber in all den Jahren danach, als ich allein war und keine Mutter und keinen lieben Gott mehr hatte, denen ich ein paar Reue-Tränen vorweinen konnte – in all den Jahren hab ich viel üblere Dinge getan und doch kein schlechtes Gewissen gehabt. Zuckernaschen und Flunkern – was ist das schon! Aber Lügen, sich selbst und andere belügen, und intrigieren und all die kleinen Schweinereien – ich hab ja nicht mal das Format für große Schweinereien – die gefälligen, hübschen Gemeinheiten, die sich in einem 22jährigen Leben so allgemach ansammeln – keine Spur von schlechtem Gewissen.
Immer hat man eine Entschuldigung bei der Hand, eine ganz einleuchtende Entschuldigung: andere lügen ja auch, andere betrügen und intrigieren ja auch; wenn du hochkommen willst, mußt du deine Ellenbogen gebrauchen; wenn du bei dem oder jenem etwas erreichen willst, mußt du ihm schmeicheln und schöne Augen machen und deine Rivalen verleumden … Und immer wieder dies: die anderen sind ja auch nicht besser … Bloß nicht für dich allein die Anständigkeit pachten wollen – du kommst unter den Schlitten, Maria!
Ich glaube, man kann das Gewissen für eine Zeit mundtot machen, aber eben nur für eine Zeit. Und jetzt auf einmal plagt’s mich wieder und stachelt und quält, gerade jetzt, und ich weiß, ich müßte dem Joe ›adieu‹ sagen, und immer schieben wir’s hinaus, einen Tag und noch einen Tag und eine Woche und noch eine Woche. Ich muß weinen, wenn ich nur daran denke: einmal ist es zuende, und jeder geht seines Weges, Joe geht zu seiner Frau, ich – irgendwohin, ich weiß noch nicht, vielleicht zum Heiligen Georg, vielleicht – Herrgott, ich weiß doch nicht, was werden soll!
Behutsam schiebe ich mich aus dem Bett, Zoll für Zoll, daß Joe nicht aufwacht. Ich ziehe die Vorhänge zurück, das Morgenlicht blendet, ich wende mich zum Bett um und betrachte Joe. Der hat einen Arm unter den Nacken geschoben, der andere Arm hängt mit müd geöffneter Hand über den Bettrand hinab; unter der weißen Haut klopfen die Adern.
Ich betrachte das schlichte, gescheite Gesicht Joes: ein Netz von Runzeln ist um seine Augenlider gewebt, die Brauen zacken dreieckig in die zerfältete Stirn. Der Schlaf hat jede Verkrampfung gelöst und die Spuren von Bergmanns-Arbeit und Krieg und Gefangenschaft ausgelöscht und von den quälerischen Nächten, durchgewacht über Büchern.
Wenn er schläft, darf ich Joe sagen, daß ich ihn liebe.
Ich möchte seinen Mund küssen oder seine Hand, aber dann küsse ich seinen grün-weiß gestreiften Jackenärmel.
Ich fische nach meinen roten Pantöffelchen, rot mit einem weißen Pompom drauf, kokette Pantöffelchen; ich ziehe sie erst an der Tür über, weil die Absätze auf dem Linoleum klappern würden. Ich binde das Haar am Hinterkopf zusammen und werfe den Bademantel um die Schultern.
Vorsichtig klinke ich die Tür auf: der Korridor ist leer, wir wohnen hier oben im Dachgeschoß, da gibt es nur drei Zimmer, die Zimmer von Joe und Hendrik und von mir: Nr. 11 und 12 und 13.
Das Badezimmer ist schräg gegenüber. Hier, vor der Badezimmertür, bin ich Joe zum ersten Mal begegnet, das war am ersten Abend, ich wußte nur, daß in Nr. 11 ein Schriftsteller wohnt, Walter Z., ich kannte nur den Namen, gesehen hatte ich den Mann noch nicht.
Und wie ich eben über den Flur lief, im honiggelben Pyjama, den Bademantel hinter mir her schleifend – just in diesem Moment kam der Herr von Nr. 11 aus seinem Zimmer, prallte zurück und murmelte: »Oh, Pardon …«
»Guten Abend«, sagte ich und wurde, etwas verspätet, rot und flüchtete ins Badezimmer. Der Herr von nebenan, der heute Joe heißt – hieß er wirklich jemals anders? – hat ein Gesicht geschnitten, als gefährde mein honiggelber Pyjama die Sittlichkeit des ganzen Heims.
Ich male mir aus, was er wohl gesagt hätte, wenn ich ganz ohne über den Flur spaziert wäre …
Ich drehe die Dusche auf, das Wasser hat sich noch nicht recht erwärmt, ich fröstele unter dem kalten Anprall der Tropfen, aber die Kälte tut gut, ich muß all die dummen Gedanken abspülen, die dunkle Angst und das Spukbild des grauen Mannes, der Joe über die Schulter geblickt hat.
Ich bin nun ganz frisch, meine Haut ist kühl, und mein Kopf ist kühl, ich hab Hunger, und die letzte Nacht hab ich vielleicht nur geträumt. Sicher, ich hab geträumt, meine Träume sind oft so kraus und phantastisch, sinnloses Zeug; es lohnt nicht, darüber nachzudenken.
Ehe ich Joe wecke, schaue ich noch einmal in den Spiegel. Ich glaube, ich bin eitel geworden, seit ich Joe kenne, früher hab ich mir nicht viel daraus gemacht, ob ich gut ausseh oder nicht. Jedenfalls hab ich mir nicht sehr viel daraus gemacht, ein bißchen schon, keine Frau ist sich selbst ganz gleichgültig.
Manchmal finde ich mich hübsch, manchmal sehr hübsch, es gibt so Augenblicke, in denen man sehr hübsch ist – und gerade dann ist kein anderer dabei, der einen bewundern könnte. Oft spiele ich mit meinem Spiegelbild, ich hab viele Rollen, und es ist ein erregendes Spiel: für ein paar Sekunden ein anderer Mensch sein, ein fremdes Gesicht aufsetzen und diese fremden Züge durchforschen und plötzlich erschrocken zurückkehren in das vertraute Gesicht, ein bißchen verwirrt durch die Vielfalt der eigenen Gefühle, den ungeheuren Spielraum der Gedanken …
Mein Haar ist lang und glatt und rötlichbraun wie eine reife Kastanie, die eben aus der stachligen Schale gesprungen ist. Ich kämme mir das Haar übers Gesicht, ich lasse unendlich verächtlich die Mundwinkel sinken – ›pah, ich spucke aufs Leben, kein Laster ist mir fremd, ich kenne alle Höhen und Tiefen, mir können Sie nichts mehr vormachen, meine Herren!‹ – langsam, ganz schwer hebe ich die Lider, ein grünlich glitzernder Blick läuft über den Spiegel … Das ist mein Hurengesicht, mein Vampgesicht, mokant und traurig, aufreizend und stumpf; wenn Joe nicht im Zimmer wär, ich würde meine Stimme brunnentief machen und in den Spiegel sagen: »Na, Kleiner, wie wär’s denn mit uns beiden –?« Ich kann so wundervoll verworfen sein …
Ich streiche das Haar aus der Stirn und flechte zwei Zöpfe, zwei starre Zöpfe, sie stehen ein wenig vom Kopf ab, das sieht rührend unbeholfen aus, ich bin ein kleines Mädchen, ein unschuldiges Mädchen, groß und hilflos stehen die Augen im Gesicht: Die Nächte mit Joe hat es nie gegeben – und wer ist Hendrik? Wer ist der Heilige Georg? Was kümmern mich Männer – wo ich doch noch so klein und unschuldig bin, hab noch nicht ins Leben ’reingerochen, alle Menschen sind lieb und gut zu mir, lauter liebe und gute Onkels und Tanten …
Der Heilige Georg sagt, ich habe Augen wie altes Gold. Wenn dem Heiligen Georg nur nichts passiert ist … Die alte Stutzuhr auf der Diele schlägt sieben Uhr, es ist noch still im Haus, man hört jeden einzelnen der silbrig dünnen Glockenschläge bis hier hinauf ins Dachgeschoß. Ich muß Joe wecken. Das Kind im Spiegel gefällt mir ausnehmend gut, ich bin ganz gerührt von meiner eigenen Reinheit; ich beuge mich vor und sage zärtlich: »Komm, Liebling, ins Bettchen! Und vergiß dein Abendgebet nicht –«
Joe lacht laut auf. Ich schäme mich, sicherlich hat er schon seit Minuten beobachtet, wie ich mit mir kokettiert hab.
»Maja …«, sagt Joe, und ich gehe zu ihm wie gezogen. Ich heiße gar nicht Maja, ich heiße Maria, nur Joe darf Maja sagen, und er sagt es nur, wenn wir allein sind.
Er nimmt mich bei den starren, vom Kopf abstehenden Zöpfen, er zieht mich zu sich hinab und küßt mich. Morgens küssen wir uns wie Geschwister, mit geschlossenen Lippen, die Augen weit offen; wir sehen uns an, Joe hat wunderliche Augen: launisches Zusammenspiel von Grau und Grün, gefleckt mit rostbraunen Pünktchen. Wenn er jemanden aufmerksam mustert, werden seine Augen rund wie die einer Eule. Jedenfalls sagt das Hendrik, gleich am ersten Tag hat er zu mir gesagt, Joe habe Eulenaugen. Aber das war, glaube ich, eine Anerkennung; die Eule ist das Sinnbild der Weisheit, und Hendrik hat sofort gemerkt – kaum hatte er drei Sätze mit Joe gewechselt – , wie klug Joe ist, wie klar, so klug und klar wie kein anderer Mensch, den wir kennen, Hendrik und ich.
Mit der Morgenpost um 10 Uhr ist der Brief gekommen. Ich hab ihn auf dem Buffet liegen sehen, einen ganz gewöhnlichen Brief, ein langes, weißes Kuvert, darauf die Kanzleischrift des Braven Anton, eine Schrift wie gestochen, und der rote Klebstreifen: ›Durch Eilboten‹.
Da haben wir’s, Joe! Ich hab’s geahnt; nun wage ich den Brief nicht zu öffnen, ich gehe am Buffet vorüber, als warte das weiße Kuvert nicht auf mich, ausgerechnet auf mich, Maria D. Was hat der Brave Anton mir zu schreiben, noch dazu ›durch Eilboten‹? Der Brave Anton ist der schreibfaulste Mensch unter Gottes Sonne, und es gibt nur drei Lebewesen, um derentwillen er sich aufraffen würde, einen Brief zu schreiben: Nana, sein schwarzer Kater, und der Heilige Georg und ich.
Vielleicht ist Nana vom Dach gefallen oder hat Verdauungsstörungen – aber das hätte mir der Brave Anton ja auch später erzählen können. Und daß er nicht stirbt vor Sehnsucht nach mir, das ist mal sicher. Es kann sich nur um den Heiligen Georg handeln, weiß der Teufel, was der dumme Junge angestellt hat! Ich habe doch jetzt selbst Kummer genug, ich kann mir doch nicht die Sorgen anderer Leute auch noch aufbürden!
Ich setzte mich auf meinen Platz und beobachte scharf den Brief, der nicht für mich bestimmt sein soll: sehr harmlos liegt er da auf dem braunen, blanken Holz, ein weißes Rechteck, und der rote Klebestreifen blinzelt zu mir herüber. Just unter dem sterbenden Reh liegt er; solange ich hier bin, stirbt das Reh auf diesem scheußlichsten aller Ölgemälde.
Wie kann man solch ein Ölgemälde den Malern zumuten, die in diesem Heim wohnen? Hängen Sie das Bild ab, Herr Heimleiter, es beleidigt mein Auge; wenn ich die flüchtenden Hirsche sehe, die scheu äugenden Rehe im knallgrünen Gebüsch, möcht ich ein Luftgewehr nehmen und sie abschießen.
Auf die Wildschweine an der Wand gegenüber haben wir schon geschossen, Joe und ich, aber wir hatten nur eine Spatzenschleuder und dazu einen Schwips, und die solide Leinwand überlebte unser Attentat, die Eber blecken ihre Hauer unbeschädigt noch heute.
Joe kommt ein paar Minuten nach mir in den Speisesaal, er sucht nach Post, er sagt: »Maria, ein Brief für dich«, und legt ihn neben meine Kaffeetasse. Ich ignoriere den Brief. Ich nehme mein Frühstücks-Ei, drehe das spitze Ende nach oben, ein Schlag mit dem Messer, die Schale splittert; ich säge dem Ei den Hut ab – ein Kunststück, das mir nicht immer gelingt.
»Ein Eilbrief, Maria«, sagt Joe.
Ich streiche mir ein Butterbrot, streue eine Prise Salz auf das Ei und löffele bedächtig. Natürlich ist es wieder zu hart gekocht; wann wird die Köchin endlich lernen, ein Ei weich zu kochen? Der Brief muß gestern abend abgeschickt worden sein, kurz nach acht Uhr, möchte ich wetten.
»Guten Morgen, Maria«, sagt Hendrik.
»Guten Morgen«, murmele ich, ohne aufzublicken. Dieser Mensch ist von göttlicher Dreistigkeit: läuft seit vier Uhr auf und ab in seinem Zimmer und stiehlt mir meinen Schlaf und hat dann noch die Stirn, mir einen ›guten Morgen‹ zu wünschen. Ich fühle, daß Hendrik mich anschaut, und ich fühle, daß ich rot werde und bin zornig auf Hendrik, weil er weiß, Joe war heute nacht wieder bei mir.
Ich stülpe die leere Eierschale in den Becher und nehme den Brief und schlitze ihn auf, ganz gleichmütig; ich ziehe den Bogen heraus. Der ist eng beschrieben, das ist die akkurate Handschrift des Braven Anton, auch in seiner Schrift verleugnet sich nicht seine Bürovorsteher-Seele.
»Liebe Maria«, schreibt er, »du darfst nicht erschrecken –« Wie kann man einen Brief so ungeschickt beginnen? Natürlich bin ich nun erst recht erschrocken, und ich lese weiter, und auf einmal verschwimmen die brav gezirkelten Buchstaben, und erst als Joe mich umfaßt und hinausführt, wird mir bewußt, daß ich laut aufgejammert hab, geschrien vielleicht sogar, ich weiß nicht, und überhaupt ist es mir kein bißchen peinlich, ganz gleichgültig ist es mir, daß die anderen mich haben jammern oder aufschreien hören.
»Joe«, sage ich, »oh Joe – sie haben meinen Heiligen Georg blind geschlagen.«
Gestern abend geschah es, gegen acht Uhr, der Heilige Georg hatte den Braven Anton in dessen Atelier besucht, sie hatten eine Flasche Gin getrunken – der Heilige Georg hat bestimmt bloß ein Glas getrunken, er kann Alkohol nicht vertragen –, und der Brave Anton hatte ihn noch bis zur Tür begleitet, eine Ehre, die er allenfalls dem Heiligen Georg und mir erweist und vielleicht mal dem Falstaff.
Der Brave Anton wohnt über einer Kneipe, das ist nichts Aufregendes, ich wohne auch in einem Mietshaus mit einer Kneipe. In unserer Stadt – so eine mittelkleine Stadt, zwei Kinos, kein Theater, eine Menge Fabriken – gibt es allein in der Hauptstraße ein gutes Dutzend dieser handtuchschmalen Kneipen, die nach Feierabend gesteckt voll sind; die Luft ist zum Schneiden dick von Rauch, man ißt eine Bockwurst und trinkt ein paar Mollen und hält einen Schnack mit dem Wirt, und manche bleiben bis zur Polizeistunde hängen.
Dann ist hernach Gegröl auf den Straßen, Halbstarke brüllen zotige Lieder, und ziemlich oft – sonnabends bestimmt – gibt es Prügeleien: da genügt schon ein schiefer Blick, ein Stoß mit dem Ellenbogen – »he, willste was von mir?« – und wenn’s glimpflich abläuft, bleibt es bei zerrissenen Jackenärmeln und blutigen Nasen und Veilchen-Augen.
Ich hab oft nächtelang in meiner Kneipe gehockt und mir die Leute besehen und mich mit ihnen unterhalten. Mit den Männern über Vierzig läßt es sich leichter sprechen, die packen schon mal ihre Sorgen aus, wenn sie merken, man hört ihnen zu, und dann bestellen sie ein Helles und einen Harten für mich und sind beleidigt, wenn ich es ihnen abschlagen will.
Mit den Halbstarken ist schon schwerer ins Gespräch zu kommen; wenn sie ein paar Harte getrunken haben, fühlen sie sich furchtbar stark, richtige Männer, denken sie, und schielen einem Mädchen in den Ausschnitt und reißen dreckige Witze und prahlen, wieviel sie vertragen können: Zwanzig Helle, und du merkst mir noch nichts an, Ehrenwort!
Trotzdem kann man den Burschen nicht recht böse sein, eigentlich tun sie mir leid, weil ihnen nichts Gescheiteres einfällt, als die Abende in der Kneipe oder im Tanzlokal totzuschlagen. Was sollen sie schon mit sich anfangen? Sechsmal kann man nicht in denselben Film laufen, lesen mögen die meisten nicht sehr gern, und nicht jeder hat ein Mädchen, mit dem er am Gartenzaun oder unter dem Haustor stehen kann.
Ich glaube, man müßte sich mehr um diese Jungs kümmern; den ganzen Tag haben sie in der Fabrik gearbeitet oder auf dem Bau – da wollen sie doch abends was erleben, sie wollen ›mal was anderes‹ und wissen selbst nicht recht, was.
Ab und zu hab ich [ein] paar von ihnen mit ’raufgenommen in mein Atelier und hab ihnen Bilder gezeigt, und wenn sie erst ein bißchen aufgetaut waren, vergaßen sie, daß ich ein Mädchen bin und noch dazu ›Intelligenz‹, und die wußten allerhand Gescheites zu sagen und bewiesen zuweilen guten Geschmack und sicheres Urteil. Aber schließlich kann ich mich nicht jeden Abend der Kunst-Erziehung Halbstarker widmen, und überhaupt verspottet mich Falstaff schon seit langem: ich sollte lieber zur Heilsarmee gehen statt zu malen.
Gestern abend nun, als der Heilige Georg vom Braven Anton kam, war sich ein Rudel Jungen in die Haare geraten, gerad vor der Kneipe, und kein Polizist war in der Nähe. Der Brave Anton hat alles vom Fenster aus mitangesehen, aber er dachte nicht, daß der Heilige Georg in eine Schlägerei verwickelt werden könnte, weil der sonst allen lauten Menschen aus dem Weg geht und durch die Straßen läuft wie in einer Wolke. So hat der Brave Anton, wie er endlich merkte, es geht schief da unten auf der Straße, nicht mehr rechtzeitig eingreifen und dem Heiligen Georg helfen können.
Der Heilige Georg ging an dem Rudel vorüber, er kümmerte sich nicht um die Krakeeler; die Straße war fast menschenleer, abends um acht Uhr sind in unserer Stadt die Straßen meist schon menschenleer.
Der Heilige Georg ist ziemlich groß, gut sechs Fuß, schätze ich, und er blickte im Vorübergehen über die Kette Halbwüchsiger hinweg, ganz absichtslos, und er sah am Laternenpfahl einen Jungen stehen, ein verwachsenes Bürschchen, keine sechzehn Jahre alt, mit einer schiefen Schulter. Der Junge hatte die Hände vor das Gesicht gelegt und zwischen seinen Fingern quoll Blut hervor – der andere hatte ihm schon die Nase zerschlagen. Dieser andere muß dem Heiligen Georg als Teufel persönlich erschienen sein – »wie das Böse schlechthin«, sagte er später zum Braven Anton –: ein klotziger Kerl, breite Schultern, ein grobes Gesicht, ein Schlägergesicht, Blumenkohlohren wahrscheinlich und Boxernase, und in den schmalen Augen die böse Lust am Schlagen und Zerschlagen und Zerstampfen – irgendetwas Lebendiges zerschlagen und zerstampfen.
Und der Heilige Georg blieb stehen und hörte, wie der Klotzige sagte: »Nimm die Hände vom Gesicht, du! Los, nimm die Hände vom Gesicht!« Und der Kleinere mit der schiefen Schulter, der ließ die Hände fallen, und da sah der Heilige Georg sein blutverschmiertes Gesicht und sah, wie der andere ausholte und noch einmal in dieses Gesicht schlug und noch einmal, mit der bloßen Faust.
Der Heilige Georg hat kleine Hände, sicherlich bloß halb so groß wie die des Schlägers. Aber seine Hände sind kräftig wie Hände von Bildhauern sind, die Meißel und Hammer führen und das Bild aus dem spröden Stein lösen.
Der Heilige Georg durchbrach die Kette und stürzte sich auf den Klotzigen – »er war wie von Sinnen, ich dachte, er schlägt den Kerl tot«, schreibt der Brave Anton.
Vielleicht hätte er ihn wirklich totgeschlagen – der Heilige Georg muß furchtbar sein, wenn er einmal in Wut gerät –, aber da sprang dem anderen ein Kumpan bei und hieb dem Heiligen Georg eine Bierflasche über den Kopf. Wie der Brave Anton auf die Straße stürzte, fand er nur noch den Heiligen Georg, der lag verkrümmt unter der Laterne, und bei ihm war nur der kleine Bucklige, der wie ein Kind weinte und nicht wußte, was tun.
Die Kopfverletzung wäre nicht so schlimm, der Heilige Georg hat einen harten Schädel, der wäre bald wieder verheilt. Aber als die Flasche zersplitterte, haben die Scherben seine Augen verletzt, und der Arzt, der ihn untersuchte, meinte, vielleicht könnte man ein Auge retten, das andere bliebe sicherlich blind.
»Er wollte ja nicht, daß ich dir schreibe, Kind. Du sollst dir keine Sorgen machen. Ich dachte bloß, es wäre besser, wenn du mal nach ihm siehst. Er liegt im Krankenhaus.
Er mag Dich, Maria, das weißt Du doch.
Addio.
Anton«
Das ist der längste Brief, den der Brave Anton sein Lebtag geschrieben hat, und es muß schlimm stehen um den Heiligen Georg.
»Nicht weinen, Maria, nicht weinen«, sagt Joe.
»Er hatte so schöne Augen, Joe, die schönsten Augen, die du dir vorstellen kannst … Wunderbare schwarze Augen, Joe, schwarz wie Kohle – und so groß und strahlend …«
»Ja, Maria«, sagt Joe geduldig, »ich weiß, Maria. Ich kenne ihn doch, damals im September habe ich ihn kennen gelernt, du erinnerst dich –«
Sicher, ich erinnere mich; ein übles Spiel hab ich damals mit dem Heiligen Georg getrieben, um Joes willen, und um Joes willen hab ich mich wochenlang nicht um den Jungen gekümmert, und nun liegt er im Krankenhaus, und eigentlich müßte ich zu ihm fahren, ihn sehen, ihn trösten … Wie kann ich denn den Heiligen Georg trösten? Paar gute Worte – was ist das schon! Damit kann ich ihm seine Augen auch nicht wiedergeben, das bißchen Trost macht ihn auch nicht wieder sehend …
»Was willst du tun, Maria?«
»Was soll ich tun, Joe?«
»Vielleicht solltest du ihn besuchen, wenigstens für einen Tag solltest du ihn besuchen.«
»Glaubst du, es bleibt bei dem einen Tag, Joe?«
»Ich weiß nicht, Maria. Wenn es ihm sehr schlecht geht, wenn er dich braucht – Nein, vielleicht würde es nicht bei dem einen Tag bleiben, vielleicht müßtest du dort bleiben, bis er gesund ist.«
»Wenn er nicht wieder gesund wird, Joe, wenn er blind bleibt, sein Leben lang blind bleibt – oh Gott, das übersteht er nicht, er nicht, Joe …«
»Andere haben’s auch überstehen müssen, und haben Schlimmeres überstehen müssen, Maria. All die Kriegsblinden und die Krüppel, die Männer ohne Arme oder ohne Beine, die Männer mit zerfressenen Lungen oder mit Krankheiten, die sie nie wieder loswerden – alle haben sie es überstehen müssen und haben sich nicht aus dem Leben davonmachen dürfen, Maria.«
»Aber der Heilige Georg ist Künstler, Joe, der Heilige Georg ist Bildhauer, er braucht doch seine Augen, er hat eine Zukunft – Herrgott, was für eine Zukunft hat der Heilige Georg, so klug, so begabt … Wie soll er denn arbeiten ohne seine Augen, Joe?«
»Er hat noch seine Hände, Maria, und ich kenne einen blinden Bildhauer, von dem sehende Künstler das Sehen lernen können.«
Wenn ich denke: der Heilige Georg mit der schwarzen, gelbgepunkteten Binde der Blinden um den Ärmel; der Heilige Georg, geführt von einem Schäferhund, sich an einem Stock über den Damm tastend, Brennpunkt des Mitleids, Zielscheibe scheuer, bedauernder Blicke; jemand hilft ihm eine Treppe hinab …
»Ich würde ihm ein Auge von mir geben, Joe, wirklich, das würde ich tun: wenn ich könnte, würde ich mir ein Auge herausreißen und es ihm geben.«
Wer bin ich denn? Was kann ich denn? Kein Vergleich mit dem Heiligen Georg! Ich bin ja nur ein kleines Talent, guter Durchschnitt, nehme ich an, eine Statue vom Heiligen Georg ist mehr wert als ein Dutzend Bilder von mir, und nun werden all die Kunstwerke vom Heiligen Georg ungeschaffen bleiben – weil er einem kleinen Buckligen hat beispringen müssen, einem Bürschchen, Lehrling vielleicht oder Schüler, dem von einem Rohling das Gesicht zerschlagen wurde …
Trotzdem – der Heilige Georg hätte nicht vorübergehen dürfen, gewiß, das hätte er nicht tun dürfen; wenn ich wüßte, er wäre vorübergegangen, ganz unbewegt, als ein Rohling einem kleinen Buckligen die Faust ins Gesicht stieß – »Nimm die Hände vom Gesicht, du!« – ich hätte es dem Heiligen Georg nicht verzeihen können.
Es ist nicht jedermanns Sache, in ein Rudel Halbstarker einzubrechen und sich auf einen Faustkampf einzulassen mit einem Kerl, der groß und breitschultrig ist, mit Blumenkohlohren und Boxernase und mit Fäusten, doppelt so groß wie die Hände des Heiligen Georg. Nein, das ist nicht jedermanns Sache, aber es ist Sache des Heiligen Georg, und wenn ich nun um ihn weine, dann empfinde ich neben dem Schmerz des Mitleidens auch Stolz auf meinen Freund, der sonst durch die Straßen läuft wie in einer Wolke, dem sonst nichts widerwärtiger ist als Lärm und Rauferei und die brutale Kraft der geistig Armen.
Immer bin ich stolz gewesen auf den Heiligen Georg, meinen klugen, begabten, sanften Freund, der jetzt noch in einer kleinen Stadt wohnt und unbekannt ist und erst auf einer Ausstellung vertreten war – aber eines Tages, wußte ich, wird man seine Werke kennen und seinen Namen nennen und ihn rühmen als einen, der den Menschen Großes und Gültiges geschenkt hat …
»Wirst du abreisen, Maria?«
Wir sehen uns an, Joe und ich. Er hat sich über mich gebeugt, ich sitze zusammengekauert im Sessel, und wir sehen uns an. Wirklich, Joe hat Eulenaugen, rund und gefleckt mit rostbraunen Pünktchen. Ich weiß: wenn ich heute abreise, werde ich nicht wiederkommen, und alles ist zuende, mit einem Schlag ist der Abschied da, den wir um Tage und Wochen hinausgeschoben hatten.
Ich muß Joes Augen ausweichen, als ich sage: »Er will ja gar keinen Trost, ich würde ihn bloß kränken mit Gejammer und Mitleid, glaubst du nicht?«
Joe geht auf und ab im Zimmer, er bleibt am Fenster stehen, den Rücken mir zugekehrt, er murmelt: »Ich glaube, du solltest ihm Ruhe lassen, wenigstens ein paar Tage, daß er erst einmal mit sich selbst fertig wird. Ich glaube, du kannst jetzt nicht viel für ihn tun …«
Ich wollte, Joe redete mir zu abzureisen; ich wollte, Joe überredete mich zu bleiben.
Er sagt, nun sehr hastig: »Du kannst ja im Krankenhaus anrufen. Er darf bestimmt noch keinen Besuch haben, Maria, er wird doch erst einmal operiert, da lassen sie dich sowieso nicht zu ihm. Vielleicht wird sein Auge gerettet, aber dazu kannst du ja nichts tun, Maria, das mußt du schon den Ärzten überlassen; im Krankenhaus wird es einen tüchtigen Augenarzt geben, nehme ich an –«
Wirklich, ich kann jetzt sowieso nichts tun, das ist Sache der Ärzte, der Heilige Georg wird erstmal operiert, da lassen sie mich doch nicht zu ihm. Wirklich, ein paar Tage muß ich warten mit dem Besuch bei ihm, ein paar Tage noch, die Joe gehören werden, Joe und mir …
Ich wische mir mit dem Handrücken die Tränen vom Gesicht, ganz ruhig sage ich: »Ja, Joe, ich werde dann also noch hierbleiben.«