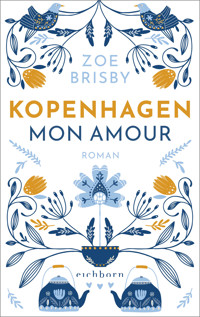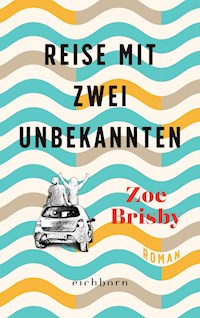19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Eichborn
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Ben arbeitet in einem renommierten Pariser Buchverlag und entdeckt eines Tages ein wahres Juwel im Stapel unverlangt eingesandter Manuskripte. Doch der Absender hat nur eine postalische Adresse angegeben, und so reist Ben in das 900-Seelen-Dorf Arnac-la-Poste - weltberühmt für seine märchenhafte Kulisse einer nostalgischen Weihnachtswelt. Dort erwarten ihn eine Schar liebenswert skurriler Bewohner und ein ungewöhnlicher Deal: Er soll Laly, der eigenwilligen Tochter des Autors, ein Lächeln ins Gesicht zaubern, erst dann klappt’s mit dem Verlagsvertrag. Doch Ben ist notorisch schüchtern, und Laly eine Frau, die alles, nur nicht gerettet werden will ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 361
Ähnliche
Inhalt
CoverÜber dieses BuchÜber die AutorinTitelImpressumWidmungZitat12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152Playlist von Laly und BenAufgaben zum WeihnachtsmarathonAnmerkungen der AutorinÜber dieses Buch
Ben arbeitet in einem renommierten Pariser Buchverlag und entdeckt eines Tages ein wahres Juwel im Stapel unverlangt eingesandter Manuskripte. Doch der Absender hat nur eine postalische Adresse angegeben, und so reist Ben in das 900-Seelen-Dorf Arnac-la-Poste – weltberühmt für seine märchenhafte Kulisse einer nostalgischen Weihnachtswelt. Dort erwarten ihn eine Schar liebenswert skurriler Bewohner und ein ungewöhnlicher Deal: Er soll Laly, der eigenwilligen Tochter des Autors, ein Lächeln ins Gesicht zaubern, erst dann klappt’s mit dem Verlagsvertrag. Doch Ben ist notorisch schüchtern, und Laly eine Frau, die alles, nur nicht gerettet werden will …
Über die Autorin
Zoe Brisby ist Kunsthistorikerin und literaturbegeistert. Ihre eigene schriftstellerische Karriere begann 2016, und REISE MIT ZWEI UNBEKANNTEN ist ihr erster Roman, der auf Deutsch erscheint. Sie schätzt Humor und Herzensweisheit und ist der Meinung, dass ungewöhnliche Lebenssituationen einen manchmal im besten Sinn über sich hinauswachsen lassen.
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Eichborn Verlag
Titel der französischen Originalausgabe:»La fille qui n’aimait pas Noël«
Für die Originalausgabe:Copyright © 2022 by Éditions Michel Lafon
Für die deutschsprachige Ausgabe:Copyright © 2024 byBastei Lübbe AG, Schanzenstraße 6 – 20, 51063 Köln
Vervielfältigungen dieses Werks für das Text- und Data-Mining bleiben vorbehalten.
Textredaktion: Christina Neiske, Haldenwang
Umschlaggestaltung: Kristin Pang
Umschlagmotiv: © Nadia Grapes /shutterstock
eBook-Produktion: hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-7517-6455-1
eichborn.de
Für alle Liebhaber des Weihnachtsfestes,für diejenigen, die Haarreife mit einem Rentiergeweih tragen,für diejenigen, die zu glauben wagen.Für dich, der du Weihnachten nicht magst,mir zuliebe aber so tust, als ob.
Ich werde Weihnachten in meinem Herzen ehren und versuchen, es das ganze Jahr hindurch aufzuheben.
CHARLES DICKENS
1
Ich weiß nicht, warum mir ausgerechnet dieses Manuskript so ins Auge stach. Vielleicht war es die Tatsache, dass der Autor nicht seinen Namen, sondern nur eine postalische Adresse angegeben hatte. Oder aber es lag am Titel: Die Versöhnung. Diese Worte übten auf mich eine geradezu magnetische Anziehungskraft aus. Es lag ein Versprechen darin, das mich zwang, auf der Stelle in diesen Roman einzutauchen.
Er zog mich so in seinen Bann, dass ich ihn die ganze Nacht über nicht aus der Hand legte. Es war eine schöne, eine bewegende Lektüre. Die Geschichte eines dichten, prallen Lebens auf dreihundertzweiundneunzig Seiten.
Ich bin Lektor. Das würde ich gern sagen können, aber im Augenblick ist es nur ein Traum, denn auch wenn ich für das angesehene Verlagshaus Delamare arbeite, bin ich weit davon entfernt, Lektor zu sein. Meine Aufgaben beschränken sich darauf, Kaffee zu kochen, am Kopierer zu stehen oder Ablehnungsbriefe zu verfassen. Den lieben langen Tag verschicke ich Schreiben, die ihre Empfänger auf Selbstmordgedanken bringen könnten.
Der typische Brief sieht mehr oder weniger immer gleich aus: Er ist nüchtern und versucht dennoch, auch etwas Menschliches, also eine gewisse Einfühlsamkeit vorzuschützen. Er beginnt stets mit »Trotz der ausgezeichneten Qualität Ihrer Arbeit …« und schließt mit »Ihr Roman passt leider nicht in die Verlagspolitik unseres Hauses«.
Aber ich hüte ein Geheimnis. Hin und wieder suche ich mir ein Manuskript aus dem Berg der abgelehnten Werke aus und lese es von vorn bis hinten. Ausschlaggebend kann der Titel, der Name eines Autors, das Begleitschreiben oder auch etwas ganz anderes sein. In jedem Fall aber liegt immer irgendwie etwas Magisches in dem Augenblick, in dem ich entscheide, welches Buch ausgewählt wird.
Bei meinen Rettungsaktionen bin ich bereits auf so manche Merkwürdigkeit gestoßen. Eine Abhandlung über Botanik, eine interstellare Liebesgeschichte, einen Steinzeitroman … Jedes Manuskript, mochte es noch so skurril sein, bescherte mir eine Menge neue Erkenntnisse.
Auch diesmal machte ich mich also wie so oft nach einer langen Lesenacht mit dunklen Augenringen auf den Weg ins Büro.
Es gibt Tage, die ein Leben verändern. Augenblicke, die einen Wendepunkt in unserem Dasein darstellen. Kleinigkeiten, die, zu einem Ganzen zusammengefügt, das Zeug dazu haben, dass etwas Großes aus ihnen erwächst.
An diesem Morgen wusste ich noch nicht, dass der 18. Dezember ein solcher Tag sein würde. In der Luft lag der muffige Geruch von warmen Radiatoren, draußen blendete der winterweiße Himmel und die Schneedecke dämpfte den üblichen Geräuschpegel der Großstadt.
Manche Tage beginnen schlecht. Ein Fuß, der sich in der Bettdecke verfängt und uns straucheln lässt, geschwollene Augen, eine widerspenstige Haarsträhne, ein Kopfkissenabdruck auf der Wange, eine leere Kaffeedose …
Mit einer großen Tasse Nesquik in der Hand schaltete ich das Radio ein. Weihnachtslieder! Sollte noch ein weiteres ertönen, würde ich ernsthaft in Erwägung ziehen, mich mit meinem Duschschlauch zu strangulieren.
Unter dem eiskalten Wasser in der Dusche begann ich zu japsen. Das Problem mit dem Boiler war immer noch nicht behoben. Ich musste mich endlich darum kümmern, aber da ich nicht gerade ein begnadeter Heimwerker bin, schwante mir, dass ich noch so manche eiskalte Dusche würde hinnehmen müssen. Bei der Wahl, ob ich meine Zeit lieber mit Lesen oder mit Heimwerken verbringen wollte, war die Entscheidung schnell getroffen. Ich ließ also das Shampoo links liegen und verließ frierend und mit feuchtem Haar mein Iglu.
Es war Hauptverkehrszeit, und in den Straßen herrschte dichtes Gedränge. Die Menschen bewegten sich ungeschickter als sonst fort, um nicht auf Eis und Schnee auszurutschen, und sahen dabei ein wenig aus wie eine Armee von Pinguinen im Packeis.
Ich klappte den Kragen meines Mantels hoch, um meinen Nacken warm zu halten und den scheußlichen Pullover vollständig zu verbergen, den ich mir wohl oder übel hatte kaufen müssen. Der 18. Dezember war im Büro zum »Tag des hässlichen Weihnachtspullovers« ausgerufen worden. Dieser frisch eingeführte Brauch sollte die Mitarbeiter »in festlicher Atmosphäre zwanglos zusammenkommen lassen«. Ein Einfall der Geschäftsleitung nach einer Fortbildung in Sachen Unternehmensführung.
Im Vorübergehen warf ich einen flüchtigen Blick auf mein Spiegelbild in einem Schaufenster. Ich sah einfach grauenhaft aus mit meinen zottligen Haaren, die einem verlassenen Vogelnest glichen. Immerhin harmonierten sie großartig mit meinem roten Pullover mit dem lächelnden Weihnachtsmann auf der Brust, der eher an den Killer-Clown aus der Verfilmung von Stephen Kings Es erinnerte.
Damit auch wirklich alle sich daran freuen können, enthält das Kleidungsstück eine kleine Fernsteuerung, die auf den Wangen des psychopathischen Väterchens ein paar bunte Lämpchen zum Leuchten bringt und ihm außerdem ein »Ho! Ho! Ho!« entlockt – in einer Lautstärke, die selbst einem Gehörlosen einen Schreck einjagen würde. Mit diesem Prunkstück hatte man den Horror ganz klar hinter sich gelassen und war im Reich des Grotesken angekommen.
Trösten konnte mich da nur die Vorstellung, auch Shanti, die Cheflektorin von Delamare, mit einem dieser absurden Oberteile ausstaffiert zu sehen. Die großartige und tyrannische Shanti im Rentier-Pullover und mit Rentier-Haarreif auf dem Kopf! Lächerlichkeit bringt zwar nicht um, stößt aber doch eine Führungskraft zumindest vorübergehend von ihrem Sockel. Dieser Gedanke zauberte mir für den weiteren Weg ein Lächeln ins Gesicht.
Erst als ich auf einer unvermutet vereisten Stelle ins Straucheln geriet und gerade noch einmal davonkam, ohne mir die Hüfte auszurenken, war es vorbei mit meiner spöttischen Miene. Abgesehen von diesem kleinen Zwischenfall verlief der Weg jedoch ohne weitere Störung.
Bei meiner Arbeitsstätte angekommen, schwappte mir die Wärme aus den Räumlichkeiten wuchtig entgegen. Man geizte bei Delamare nicht mit dem Heizen. Die Belegschaft hätte sich glatt auf den Karibischen Inseln wähnen können. Alle schwitzten in ihren bunten Pullovern.
Ich legte den Mantel auf meinem winzigen Schreibtisch ab, um das Fenster zu öffnen. Ein eisiger Windstoß fegte herein. Man hatte die Wahl zwischen Nordpol und Kleinen Antillen. Eine dicke Schweißperle rann in mein Auge. Schweiß war mir zuwider, also entschied ich mich für den Nordpol.
Ich atmete die eiskalte Luft tief ein, was zur Folge hatte, dass meine Lunge brannte und mir Tränen in die Augen stiegen. Trotzdem gelang es mir, die Wanduhr zu entziffern: Das morgendliche Meeting im Konferenzraum stand an. Zeit für einen Kaffee blieb mir nicht. Immerhin hatte ich bereits meinen Nesquik im Magen.
Im Konferenzraum herrschte eine ausgelassene Stimmung. Man nahm gegenseitig die Pullover in Augenschein und verstieg sich bereits zu Einschätzungen, welcher der hässlichste sei. Eine breite Palette von Weihnachtsmützen, Rentieren und Elfenohren stand zur Auswahl.
Das fröhliche Stimmengewirr kam zum Erliegen, als Shanti den Raum betrat. Die selbst ernannten Buchmacher des Hauses hatten bereits Wetten angenommen. Die Hälfte ging davon aus, dass sie den Brauch nicht achten und wie üblich streng und elegant gekleidet auftauchen würde. Die andere Hälfte setzte darauf, dass sie einen wirklich scheußlichen Pullover tragen würde, um mit gutem Beispiel voranzugehen. Ich selbst hatte mich noch nicht festgelegt.
Bei meiner ersten Begegnung mit der Cheflektorin von Delamare, nämlich während meines Bewerbungsgesprächs, hatte ich zunächst gedacht, ich hätte mich im Gebäude geirrt und würde für eine Assistentenstelle bei der Vogue vorsprechen.
Shanti war groß, sehr groß. Mindestens einen Meter achtzig. Was sie aber keineswegs daran hinderte, schwindelerregend hohe Absätze zu tragen. Geschickt wie eine Seiltänzerin bewegte sie sich durch die Flure und maß die kleinen Leute aus den niederen Rängen mit verächtlichen Blicken.
Sie war schmal, sehr schmal. Manchmal verschwand sie hinter dem Ficus in ihrem Büro. Sie war kaum breiter als einer seiner Äste. Seiner Zweige. Ein dünnes Zweiglein von einem Meter achtzig Länge.
Sie rauchte wie ein Schlot. Da herkömmliche Zigaretten gesundheitsschädlich sind, verschaffte sie sich ein reines Gewissen, indem sie zu E-Zigaretten griff, an denen sie so frenetisch saugte wie ein Baby an seinem Schnuller. Sprach man am Telefon mit ihr, wurde das Gespräch immer wieder unterbrochen von Atemgeräuschen, die nahelegten, man unterhielte sich gerade angeregt mit Darth Vader.
Sie war immerwährend von einer Duftwolke mit Popcorn-Note umgeben. Roch man eine Mischung aus Shalimar und Popcorn, dann wusste man, dass Shanti nicht weit sein konnte. Kultiviertheit schließt Abhängigkeit nicht aus.
Was mich betrifft, so bin ich winzig. Nicht im wörtlichen Sinn, denn ich bin einen Meter neunzig groß. Aber vom Kopf her fühle ich mich ganz klein. Ein Psychologe würde mit Sicherheit von einem Minderwertigkeitskomplex sprechen. Trotz meiner Körpergröße, die mich zwingt, beim Gespräch mit anderen den Kopf zu senken, fühle ich mich winzig, unbedeutend, farblos.
So lange ich mich erinnern kann, habe ich mich minderwertig gefühlt. Eine krankhafte Schüchternheit, die mir das Leben verflixt schwer macht. In meiner Jugend geriet ich ins Stottern, sobald die Lehrerin mich etwas fragte, was mir oft genug den Ruf des Klassentrottels einbrachte.
Leider wurde es später auch nicht besser. Sobald jemand das Wort an mich richtete, trieb meine Verwirrung mir die Röte ins Gesicht, und so zog ich mich schließlich immer mehr zurück, um bloß kein Risiko mehr einzugehen.
In langen Schulpausen und an einsamen Abenden flüchtete ich mich in Bücher. Die Romanhelden wurden meine Freunde, und ihre Abenteuer wurden zu den meinen.
Als es darum ging, eine Berufsrichtung einzuschlagen, wählte ich – da Leser kein offizieller Beruf ist – das Verlagswesen. Was für ein wunderbares Glück, jeden Tag von Büchern umgeben zu sein! Ich träumte davon, mich in die unzähligen Manuskripte zu vertiefen, die jeden Tag eintrafen, um das seltene Juwel unter ihnen ausfindig zu machen.
Mit meinem Masterabschluss in der Tasche bewarb ich mich bei dem Verlagshaus Delamare, das mich wider Erwarten einstellte. Aber mein Traum prallte rasch auf die harte Realität. Ein Verlagshaus war keineswegs die Höhle literarischer Freuden, die ich mir erhofft hatte. Zudem wurde ich damit beauftragt, die Ablehnungsbescheide zu verfassen.
Jetzt hatte Shanti also ihren mit Spannung erwarteten Auftritt, der von überraschten und zugegebenermaßen bewundernden Äußerungen begleitet wurde. Sie trug ein karminrotes Samtkleid mit einem so makellos weißen Pelzbesatz, dass selbst ein Polarfuchs vor Neid erblasst wäre.
Eine funkelnde Kristallbrosche in Form einer Zuckerstange war auf ihrer Brust befestigt, und ihr wunderschönes tiefschwarzes Haar wurde von einem zarten Seidenband mit dem gleichen Motiv zusammengehalten. Da konnte jede noch so schön kostümierte Weihnachtsfrau einpacken!
Um eine angemessene Reaktion zu zeigen, brachte ein Teil der Anwesenden einschließlich meiner Wenigkeit augenblicklich die Lämpchen ihrer Pullover zum Blinken und erzeugte damit ein wahres Feuerwerk von roten, grünen und blauen LED-Lichtern. Das »Ho! Ho! Ho!« meines psychopathischen Weihnachtsmanns setzte dem Ganzen die Krone auf. Man hätte sich in einer Disko am Nordpol wähnen können.
Trotz dieser lichterfüllten Sarabande zu Beginn verlief die Zusammenkunft ohne Zwischenfälle. Es wurde über die bevorstehenden wichtigen Neuerscheinungen, über das Marketing und über das Budget gesprochen. Mir wurde die höchst erfüllende Aufgabe zugedacht, eine große Anzahl von Fotokopien anzufertigen. Letztlich war es also ein ganz normaler Morgen.
Anschließend kehrte ich in mein Büro zurück, das sich während meiner Abwesenheit in Packeis verwandelt hatte. Ich war überrascht, dass sich noch keine Eisbären eingefunden hatten. Ich legte den neuen Stapel der abgelehnten Manuskripte ab, deren Autoren ich nun schreiben sollte.
Es war so weit. Gleich würde ich Shanti verkünden, dass ich unter einem dieser Stapel das seltene Juwel, den zukünftigen Goncourt-Preisträger aufgespürt hatte. Ich würde ihr den Lektor offenbaren, der in mir schlummerte.
An diesem 18. Dezember sollte mein Leben aus den Fugen geraten.
2
Zu meiner großen Überraschung entdeckte ich auf meinem Schreibtisch eine Nachricht von Shanti. Post-its verwendete sie nie. Nein, sie brauchte ein ganzes Blatt Papier. Mindestens DIN A4 musste es schon sein, um ihre großen Ideen auszudrücken.
Ich nahm mir die Zeit, meine Haare zu kämmen, aber die Mühe war umsonst. Das widerspenstige winterliche Gekräusel ließ sich nicht bändigen. Eilig riss ich mir meinen hässlichen Pullover vom Leib und schlüpfte in einen Cardigan aus Wolle, um mir ein ernsthaftes Aussehen zu geben. Ich zog ihn zwar hier und da zurecht, aber mochte er an der Schaufensterpuppe noch so perfekt ausgesehen haben – an mir wirkte er wie die Hausjoppe eines alten Mannes. Und meine von den überhitzten Räumen geröteten Wangen legten vermutlich den Verdacht nahe, dass ich meinen Nesquik mit Cognac aufgepeppt hatte.
Ich wusste genau, was ich ihr sagen würde: Shanti, wir müssen dieses Manuskript unbedingt veröffentlichen! Zum ersten Mal in meinem Leben war ich bereit zu kämpfen. Ich bürge dafür!
Vielleicht hatte ich einfach nur ein Ziel gebraucht. Und nun war ich endlich fündig geworden. Vertrau mir, dieses Buch ist ein Juwel …
Die Angelegenheit war heikel, denn seit dem »Vorfall« war mir die Cheflektorin alles andere als wohlgesonnen. Der größte Bestseller des Jahres, möglicherweise sogar des Jahrzehnts war uns durch die Lappen gegangen. Der vielfach ausgezeichnete Autor, der berühmte Côme de Balzancourt, hatte in mehreren Interviews kundgetan, dass er von dem angesehenen Verlagshaus Delamare abgelehnt worden war.
Wer trug dafür die Verantwortung? Keine Ahnung. Im Grunde hätte ich über jeden Verdacht erhaben sein müssen, da ich lediglich fürs Fotokopieren zuständig war und die Stapel von Manuskripten entgegennahm, die andere abgelehnt hatten. Nichtsdestotrotz kam das Gerücht auf, dass ich der Schuldige war – schließlich sei ich es, der den berühmten Ablehnungsbescheid verfasst habe.
Wie bei jedem Gerücht blieb auch hier alles vage, anonym und passte den anderen gut in den Kram. Da mochte ich noch so sehr darauf pochen, dass ich kein Entscheidungsträger und zu meiner eigenen Verwunderung noch immer nicht Lektor, sondern ein einfacher Assistent war – ein Sündenbock musste her. Also nahm ich die Schuld auf mich. Ist nicht genau das die Aufgabe der kleinen Angestellten? Den Kopf hinzuhalten und ihre Vorgesetzten aus solchen Ärgernissen herauszuhalten?
Hinzu kam, dass mich dieser Côme de Balzancourt auf die Palme brachte. Er stolzierte durch alle Literatursendungen, um in höchsten Tönen von seinem eigenen Werk zu schwärmen und sich selbst dazu zu gratulieren, »der neue Meisterschriftsteller des einundzwanzigsten Jahrhunderts« zu sein. Und auch wenn ich den Ablehnungsbrief zu seinem Manuskript nicht zu verantworten hatte, erfüllte es mich mit Genugtuung, ihn seine Selbstgefälligkeit nicht in den Fluren von Delamare spazieren führen zu sehen.
Heute würde alles anders sein. Ich war fest entschlossen, mich zu behaupten. Die Lektüre dieses wunderbaren Textes hatte etwas in mir geweckt, eine Art brachliegende Kraft, die nur darauf wartete, sich äußern zu dürfen. Ja, ab heute Morgen würde ich eine große Rolle in der Welt der Literatur spielen, davon war ich überzeugt.
An der Tür von Shantis Büro räusperte ich mich, um auf mich aufmerksam zu machen – jedoch vergeblich, denn sie blieb regungslos in eine Akte vertieft.
Es war einfach unmöglich herauszufinden, ob Shanti boshaft war oder nicht. Vielleicht war das aber auch das Problem großer Schönheiten. War Barbie bezaubernd oder grässlich? Der Perfektion wohnt etwas Kaltes, Unzugängliches inne. Steckte überhaupt ein fühlendes Herz hinter dieser traumhaften Plastik?
Jeder Versuch, sich mit Shanti zu verbrüdern, blieb wirkungslos. Ich wusste praktisch nichts von ihrem Privatleben. Auf ihrem Schreibtisch stand zwar das Foto eines Mannes, aber das Bild konnte genauso gut zusammen mit dem Rahmen erworben worden sein.
Sie hob den Kopf, und ihre Haare glitten, dieser Bewegung folgend, langsam und gleichförmig wie in einer Shampoo-Werbung nach hinten. Die sie umgebende Popcorn-Duftwolke verlieh ihr eine geheimnisvolle und süßliche Aura. Wie eine Drogenabhängige auf Entzug saugte sie an ihrer E-Zigarette und sprach mich dann mit ihrer rauen Stimme an:
»Ben, wie lange arbeitest du eigentlich schon für uns?«
Man beachte das »uns«, gerade so, als wäre sie die Besitzerin von Delamare.
»Fünf Jahre.«
Mit einer Handbewegung, die sich nicht darauf festlegen ließ, ob sie nun gnädig oder geringschätzig gemeint war, bot sie mir den Stuhl ihrem Schreibtisch gegenüber an.
»So lange schon! Wie die Zeit vergeht!«
Sie schenkte mir ein Lächeln. Ich versuchte, es ihr gleichzutun, aber mein Gesicht verzog sich lediglich zu einer Art Grimasse. Ihr perlendes Lachen glich einem munteren Wasserfall. Ich wollte einstimmen, aber meinem Mund entfuhr nur ein wieherndes Geräusch. Sie stieß sich nicht daran, und ich stellte beschämt fest, dass sie es ganz normal zu finden schien, ein Pferd vor sich zu haben.
Dann bohrte sie ihren Blick in meinen.
»Es ist mir nicht entgangen, welchen Einsatz du bei der Arbeit zeigst, und deshalb möchte ich dir gern mehr Verantwortung übertragen.«
Mein Herz machte einen Satz in meiner Brust. Endlich! Ich wartete schon so lange darauf. Drei Jahre als Assistent, dann endlich der Graal: die Erhebung zum Lektor. Das hätte mir angemessen geschienen. Aber so war es nicht gekommen, und ich wartete nun schon zwei weitere Jahre auf diese Beförderung. Seit 730 Tagen wartete ich geduldig in meiner Ecke neben dem Fotokopierer. Seit 63 072 000 Sekunden träumte ich davon, Lektor zu werden.
Heute war wirklich mein Glückstag! Außerdem hielt ich ein glänzendes Manuskript für meine erste Mission als Lektor in Händen. Wäre ich nicht so schüchtern gewesen, dann wäre ich ihr um den Hals gefallen.
»Das trifft sich gut, Shanti. Ich wollte dir von einem neuen …«
»Ich ernenne dich zum Verantwortlichen für die Weihnachtsfeier! Sie findet an Heiligabend statt und soll zeigen, dass wir alle eine große Familie sind.«
Sie öffnete die Arme wie eine Mutter, die ihren verlorenen Sohn an sich drücken will. Tatsächlich schien sie sehr stolz auf sich zu sein. Angesichts meiner nicht sehr offenkundigen Begeisterung fügte sie hinzu:
»Was ist los? Du siehst nicht so aus, als würdest du dich freuen. Das ist eine große Chance für dich.«
»Ach ja?«
»Natürlich! Das ist die Gelegenheit, uns zu zeigen, was in dir steckt.«
»Als Veranstalter eines gemütlichen Beisammenseins?«
Sie sah mich mit der gequälten Miene einer Lehrerin an, die zum zehnten Mal eine simple Grammatikregel wiederholt.
»Das Verlagswesen ist wie ein riesiges Fest. Viele fühlen sich berufen, nur wenige werden auserwählt. Man muss gut organisiert und zäh sein, das richtige Gespür haben, Probleme unter hohem Zeitdruck lösen können, ohne bei alldem ein gewisses künstlerisches Verständnis vermissen zu lassen. Wenn du irgendwann Lektor werden willst, wirst du all diese Qualitäten unter Beweis stellen müssen.«
Mit einem Schlag war ich hellwach. Das war meine Chance, groß herauszukommen. Sollte es mir gelingen, die schönste, jemals hier im Haus organisierte Weihnachtsfeier auf die Beine zu stellen, würde ich endlich mein Ziel erreichen und Lektor werden. Das war mit Sicherheit ein Test, Shanti wollte sehen, ob man mir nach dem »Vorfall« Vertrauen schenken konnte.
Ich war ganz nah dran, meinen Traum zu verwirklichen. Endlich würde ich die eingesandten Manuskripte lesen dürfen, ich würde meine Tage mit Lesen verbringen und die Autoren bei ihrem Schreiben begleiten. Einfach wundervoll!
Diese Weihnachtsfeier schien mir letzten Endes doch keine schlechte Idee zu sein. Shanti beobachtete mich durch ihren akkurat geschnittenen Pony. Sie wartete auf eine Antwort. Vielleicht sogar auf ein Danke.
Ich musste es tun. Zwischen den Zeilen gelesen, hing mein weiteres Fortkommen von diesem Abend ab. Er musste perfekt sein, Weihnachtsschmuck, Lichterketten, ein Feinkosthändler, Eierlikör, Lieder … Ja, perfekt!
Ich musste einfach von einer einzigen Sache abstrahieren: Ich verabscheute Weihnachten.
3
Shanti nahm einen Schluck ihres Minz-Schoko-Latte und strich mit katzenähnlicher Anmut den Schaum weg, der die Kühnheit besessen hatte, ihre Lippen zu benetzen. Ihre bezaubernden Nasenflügel bebten.
»Ich hoffe, du gehörst nicht zu diesen schrecklichen Miesepetern, die Weihnachten nicht mögen.«
Ihre dunklen Rehaugen ruhten auf mir. Ich saß in der Falle. Ein Hase in den Lichtkegeln eines Hundeschlittens. Ich zwang mich zu einem Lächeln. Was sein muss, muss sein.
»Ich liebe Weihnachten. Das ist die schönste Zeit im Jahr!«
Sie entblößte eine Reihe makellos weißer Zähne.
»Umso besser, ich finde es nämlich sehr anstrengend. All diese Geschenke, die eingepackt werden müssen, dazu diese kitschige Musik und die überfüllten Geschäfte.«
»Ich dachte, du magst Weihnachten!«
»Ich? Wer hat dir das denn weisgemacht?«
»Du hast diejenigen, die Weihnachten nicht mögen, gerade als Miesepeter bezeichnet.«
Sie fing an zu lachen.
»Ich liebe es ja auch! Was ich verabscheue, sind die ganzen Vorbereitungen. Ich habe wahrlich Wichtigeres zu tun, als mich um ein albernes Beisammensein im Büro zu kümmern. Nichts für ungut, das war natürlich nicht bös gemeint.«
War ich ihr auf den Leim gegangen? Die Weihnachtsfeier schien in Shantis Augen den gleichen Stellenwert zu haben wie die Ablehnungsbriefe. Und nun hatte ich die Organisation einer Veranstaltung an der Backe, aber noch kein Wort über das Manuskript verloren, das mich die Nacht über in Atem gehalten hatte.
Ich nahm mein Herz in beide Hände.
»Ich wollte noch mit dir über …«
»Die Details für das Fest besprichst du am besten mit den anderen Assistenten.«
Sie wies bereits mit einem manikürten Fingernagel zur Tür, um mich hinauszukomplimentieren. Ich wäre am liebsten im Boden versunken. Weil ich mich noch nie für irgendetwas ins Zeug gelegt hatte, war ich unsicher, wie ich vorgehen sollte. Ruckartig stand ich auf und verkündete:
»Ich habe ein Manuskript gefunden!«
»Auf dem Boden?«
»Nein! Im Stapel der abgelehnten.«
Sie warf mir einen gleichermaßen mitleidigen wie erzürnten Blick zu.
»Wie oft muss ich es dir noch sagen? Du wirst nicht dafür bezahlt, Texte zu lesen, die schon von anderen beurteilt wurden. Das ist verschenkte Zeit. Weitaus qualifiziertere Mitarbeiter als du haben bereits ihre Entscheidung getroffen.«
Ich war drauf und dran, klein beizugeben. Eine Stimme in meinem Kopf flüsterte mir zu, dass Shanti recht hatte. Für wen hielt ich mich eigentlich? Ich war schon immer derjenige gewesen, den man nicht bemerkte, derjenige, der keinen Ärger machte. Unscheinbar. Eine Figur, an der man achtlos vorübergeht.
Im Grunde hatte ich mich damit abgefunden. Ich hatte mich mit der Situation arrangiert und war mehr und mehr unsichtbar geworden … Aber sollte ich tatsächlich nichts anderes sein als ein Dekor? War ich nicht doch mehr wert?
Wenn man sich damit arrangiert, in Vergessenheit zu geraten, vergisst man sich am Ende selbst. Ich hatte das Wesentliche aus dem Blick verloren: Wer war ich eigentlich?
In diesem Augenblick kamen mir die Worte aus Die Versöhnung wieder in den Sinn. Sie waren Balsam für mein Herz gewesen. Die kraftvolle Botschaft, der feinfühlige Schreibstil. Die Hoffnung, die Seite für Seite aufkeimte. Ich beschloss zu kämpfen. Es war an der Zeit, weniger unscheinbar zu werden. Zeit, das Grau hinter mir zu lassen – vielleicht nicht gleich für ein Gelb oder Rot, aber zumindest für ein Dunkelblau.
»Hör zu, Shanti. Ich glaube, dass dieses Manuskript irrtümlich auf dem Stapel der abgelehnten gelandet ist. Man kann dieses kleine Wunder unmöglich übersehen.«
Sie wollte mich unterbrechen, aber ich ließ ihr keine Zeit dazu.
»Lass mich wenigstens den Autor treffen.«
»Warum denn?«
Las Shanti nur die Bücher, die sie veröffentlichte?
»Um ihn kennenzulernen. Um die empfindsame Seele zu entdecken, die einen solchen Text geschrieben hat.«
Ich machte einen Schritt auf den Schreibtisch zu, dem eine Entschlossenheit innewohnte, wie ich sie mir selbst nicht zugetraut hätte.
»Wir dürfen uns den nächsten Prix Goncourt nicht auch noch entgehen lassen …«
Für den Bruchteil einer Sekunde verzerrten sich die Lippen meiner Vorgesetzten zu einer wenig eleganten Grimasse. Eine gewisse Genugtuung stieg in mir auf.
Ich kam mir vor wie bei einer Runde Poker. Es ging darum, wer als Letzter noch am Tisch saß. Das war natürlich nur eine Metapher, denn schließlich saß ich hier in ihrem Arbeitszimmer und war ihr damit letztlich ausgeliefert.
Jetzt war der Zeitpunkt gekommen, um meinen Joker auszuspielen.
»Die Konkurrenz hat diesen Autor bestimmt schon auf dem Radar.«
Sie zog eine ihrer perfekt geschwungenen Augenbrauen hoch. Ich hatte ins Schwarze getroffen, also machte ich Nägel mit Köpfen:
»Lass es mich versuchen. Ich bin sicher, dass ich richtigliege.«
»Sicher?«
»Hundertprozentig.«
Noch nie in meinem Leben hatte ich mit solchem Nachdruck vorgetäuscht, von etwas überzeugt zu sein. Shanti schien zu zögern. Die Stärke von uns Unsichtbaren besteht darin, dass wir, wenn wir doch einmal wach werden, den Eindruck vermitteln können, etwas Großes zu vollbringen.
Ich hatte eine Bresche geschlagen und musste jetzt nur noch zügig voranschreiten, um zum Gnadenstoß auszuholen.
»Wenn das Manuskript kein Erfolg wird oder wenn ich es nicht schaffe, dass er bei uns unterschreibt, kannst du mich entlassen.«
Sie ließ ihre schwarzen Augen auf mir ruhen, sagte aber nichts.
Ich ließ mir nichts anmerken, aber in mir tobte das Chaos. In welchen Schlamassel manövrierte ich mich da hinein? Mit dem Handrücken fegte ich alle Bedenken weg, die sich in meinem Kopf auftürmten.
»Du hast nichts zu verlieren: Entweder ich komme mit einem Bestseller zurück, und die Lorbeeren fallen dir zu, oder du bist mich ein für alle Mal los.«
Sie dachte einen kurzen Moment nach und schwenkte ihren Bürosessel zu der großen Fensterfront hinüber, die einen beeindruckenden Blick über die Stadt bot. Sie drehte sich nicht einmal zurück, als sie mit strenger Stimme verkündete:
»Das ist deine letzte Chance.«
»Die Weihnachtsfeier oder das Manuskript?«
»Beides.«
Als ich die Tür hinter mir schloss, hatte ich das Gefühl, ein Meisterstück vollbracht zu haben. Die Olympischen Spiele der Kühnheit. Ich trug die Flamme des Mutes.
In meinem Nacken spürte ich den Atem des Sieges, die Entschlossenheit schoss durch meine Adern. Mein Herz schlug zum Zerspringen, als wäre es fest entschlossen, sich aus dem Gefängnis meiner Brust zu befreien. War das ein Adrenalinrausch oder ein beginnender Herzinfarkt?
Festen Schrittes marschierte ich über den Teppichboden, gedanklich immer noch im siebten Himmel. Erst in meinem Büro entfalteten Shantis Worte ihre ganze Tragweite in meinem Kopf. Das ist deine letzte Chance. Was, wenn ich mich irrte? Was, wenn dieses Manuskript gar nicht so gut war?
Mir schwindelte. Unterzuckerung oder eine Panikattacke? Fehlendes Selbstvertrauen ist ein Gift, das dem Erstbesten die Macht gibt, einen vollständig aus der Bahn zu werfen.
Mit weichen Knien sank ich ermattet auf meinen Bürostuhl.
4
So fuhr ich schon am nächsten Tag in das reizende Dörfchen Arnac-la-Poste1. Einwohnerzahl: 951. Allein das Gesicht, das der Bahnbeamte am Schalter machte, als ich eine Fahrkarte für dieses kleine Nest in der Region Haute-Vienne erstehen wollte! Er hielt mein Ansinnen für einen Scherz. »Klar doch, und anschließend geht’s dann nach ›Nique-la-Police‹2!«, hatte er geprustet, offensichtlich sehr zufrieden über seinen Scherz.
Nach den Vorgaben meines Arbeitgebers musste ich den Zug nehmen und hatte damit eine lange Fahrt vor mir, die noch dazu doppelt so teuer war wie mit dem Auto – aber egal. Im Bahnhofsgebäude musste ich pausenlos Weihnachtslieder über mich ergehen lassen, eines deprimierender als das andere. Ich stopfte mir grüne, nach Menthol riechende Papiertaschentücher in die Ohren, aber leider brachte das nur einen mäßigen Erfolg. Noch dazu verliehen mir die grünen Pfropfen das Aussehen eines Außerirdischen und das Menthol brannte in den Augen. Schließlich bewahrte mich der einfahrende Zug vor dem Selbstmord.
Ich hatte Shanti über meine Spritztour in Kenntnis gesetzt, aber sie schien sich nicht dafür zu interessieren. Gelassen wartete sie darauf, dass ich einen Fehler machte. Sie sah dem Flugzeug zu, wie es ein paar Loopings machte, bevor es am Boden zerschellte.
Ich nutzte die Fahrzeit, um mir Gedanken zu meinem Autor zu machen. Ich stellte mir einen traurigen jungen Mann vor. Eine alte Seele, die in einem jungen Körper steckte. Vielleicht schrieb er sogar mit einer Feder. Sein Haus war womöglich der Inbegriff einer verwunschenen Künstlerexistenz. Zusammengeknüllte, auf den Boden geworfene Blätter, Perserteppiche, ein Schreibtisch aus Mahagoniholz.
Über und über mit einer feinen und beinahe unleserlichen Schrift vollgekritzelte Zettel lägen auf dem Parkett. Bisher nicht von seinem Talent überzeugt, nie zufrieden mit sich selbst, wäre er unablässig auf der Suche nach der Vollkommenheit, ohne sich darüber im Klaren zu sein, dass er sie bereits zu Papier gebracht hatte. Das Privileg der ganz Großen.
Ja, er musste jung sein, denn der Text verströmte eine gewisse Zartheit, eine beinahe kindliche Lebensfreude. Er besaß die Kraft derer, die die Unbeschwertheit der Kindheit kennengelernt hatten. Aber er war ganz gewiss auch traurig, das Leben hatte ihn nicht geschont. Zwei tiefe Falten mussten sich auf seiner Stirn eingegraben haben, die er unter der Last intensiven Grübelns ständig in Falten legte.
Obendrein musste er sensibel sein. Feingefühl, Eleganz und Zärtlichkeit wohnten seinen Worten inne. Nur ein Mensch mit sehr großer Empathie vermochte die Abgründe des Lebens so gut zu beschreiben.
Bestimmt trug er eine ausgewaschene Jeans und dazu ein weißes T-Shirt. Schlicht und praktisch. Sein Haar war zerzaust – nicht aus Stilgründen, sondern einfach, weil er ihm keine Beachtung schenkte. Man kann nicht über das Böse in der Welt sprechen und zum Friseur gehen.
Ich weiß nicht, warum ich mir eine große Nase vorstellte. Vielleicht, weil Perfektion langweilig ist. Es braucht etwas Kantiges, um einem Gesicht Charakter zu verleihen, und mein Schriftsteller musste diesen im Überfluss besitzen. Ja, er konnte furchtbare Wutanfälle haben, aber sein Zorn richtete sich niemals gegen andere, sondern immer nur gegen sich selbst. Und obwohl er sich selbst nichts verzieh, entschuldigte er bei anderen alles.
Es war nicht sehr voll im Zug, und in Arnac-la-Poste war ich der Einzige, der ausstieg. Der Bahnhof, ein winziges Gebäude aus hellem Backstein, war menschenleer. Nicht einmal ein Kontrolleur war zu sehen, den ich nach dem Weg hätte fragen können. Ich gab die Adresse meines Schriftstellers ins GPS meines Handys ein. Erleichtert stellte ich fest, dass sein Haus nur etwa zehn Minuten zu Fuß entfernt war. Außerdem konnte es bei 951 Einwohnern nicht wirklich schwierig sein, den Schriftsteller des Dorfes ausfindig zu machen.
Ich fragte mich, wie man die Einwohner von Arnac-la-Poste wohl bezeichnete. Die Arnaqueurs? Ich stellte mir den Bürgermeister des Dorfes vor, wie er seine Reden folgendermaßen begann: »Arnaqueurs und Arnaqueuses …«3 Und warum La Poste? Was hatten sie bloß gegen unsere gute alte Postverwaltung? Waren die Einwohner am Ende bekannt für ihre Briefmarkenfälschungen?
Ich ging die Hauptstraße entlang, die den stolzen Namen Grand-route trug. Die Häuser mit ihren Strohdächern und ihren alten Steinmauern sahen hübsch aus. Der Kirchturm schien über die kleine Ortschaft zu wachen, die in jenes weiche Licht getaucht war, das nur der Winter zu spenden vermag. Hier und da gab es kleine, von Bäumen gesäumte Plätze. Ein alter Wasserturm war vollständig von Efeu und grünem Moos bewachsen – die ländliche Allegorie der Vergänglichkeit.
Mein erster Eindruck war, dass die Arnaqueurs ganz außerordentliche Liebhaber von Weihnachten waren. Alles war festlich geschmückt: die Straßen, die Häuserfassaden, die Bäume … Runde Glühbirnen im Vintage-Stil warfen ihren warmen gelben Lichtschein auf das Pflaster. Kleine bunte Lampions säumten den Weg. Eine echte Postkartenidylle.
Über der Straße hing eine breite Banderole, die schöne Festtage wünschte und auf bevorstehende Festivitäten hinwies: Wettstreite aller Art von Schneeballschlachten bis zur Fertigung des schönsten Weihnachtsgebäcks, Eislaufen, Rodeln, Kutschfahrten und natürlich die feierliche Zeremonie, wenn die Lichter der großen Tanne eingeschaltet wurden. Die Krönung des ganzen Spektakels schien der Besuch des Weihnachtsmannes zu sein, der auf seinem von echten Rentieren gezogenen Schlitten vorbeischaute.
Der absolute Horror für einen Weihnachtsphobiker wie mich. Ich hatte meine Gründe. Weihnachten machte mich traurig und einsam, es flößte mir Angst ein. Für mich war es unangefochten die schlimmste Zeit im Jahr. Zum Glück würde ich noch gerade rechtzeitig vor der anstehenden Lichterflut, den erleuchteten Tannen und dem zimtgeschwängerten Weihnachtsgebäck wieder abreisen.
Ich warf einen Blick auf mein Handy. Ging ich etwa im Kreis? Es kam mir so vor, als sei ich schon viel länger unterwegs als zehn Minuten, und ich war ganz sicher, an diesem Brunnen schon einmal vorbeigekommen zu sein.
Ich hatte keinen Empfang mehr. Es gab also tatsächlich in Frankeich noch Funklöcher! Mein Handy war zu nichts mehr nutze. Wütend versetzte ich dem tollen Brunnen einen Tritt, der das jedoch nicht schätzte und sich verteidigte, indem er die Sohle meines Schuhs dazu brachte, sich zu lösen.
Ich hatte nämlich Straßenschuhe angezogen anstatt meiner üblichen Turnschuhe, um auch ja professionell auszusehen! Jetzt ähnelte ich mit meinem Humpeln eher dem Glöckner von Notre-Dame als einem Geschäftsmann.
Ich steuerte ein schönes, schmiedeeisernes Ladenschild an, das das Lebensmittelgeschäft des Ortes zierte. Der Inhaber schien sich nicht weiter über mein Hinken zu wundern, als ich bei ihm eintrat. Offenbar kam es bei den Arnaqueurs häufiger vor, dass jemand in den schwankenden, gebückten Gang von Quasimodo verfiel.
Die Sonne ging bereits langsam unter. Ich hatte zwar eine Tasche gepackt für alle Fälle, aber ich hatte keine Lust, die Nacht im Dorf zu verbringen. Also kam ich auf schnellstem Wege zur Sache:
»Ich suche die rue de l’Écurie Nummer drei.«
»Guten Tag!«
Man legte Wert auf Höflichkeit hier in Arnac-la-Poste.
»Guten Tag, ich suche die rue de l’Écurie Nummer drei.«
Der Mann war gut fünfzig Jahre alt, trug ein kariertes Hemd, einen Filzhut und hatte einen wohlgenährten Bauch. Er fragte mich lächelnd:
»Wie geht es Ihnen?«
Da ich den Dorfbewohner, der meinen Schriftsteller mit Sicherheit kannte, nicht verärgern wollte, ließ ich mich auf das Spiel ein.
»Sehr gut, danke.«
»Ist ein schöner Tag heute, nicht wahr? Tolles Wetter.«
Mir wurde klar, dass ich es mit einer geschwätzigen Natur zu tun hatte. Er bekam vermutlich nicht oft Touristen zu Gesicht. Ich beschloss, ihn ins Vertrauen zu ziehen, möglicherweise gewann ich so einen Verbündeten, um den Schriftsteller davon zu überzeugen, bei dem Verlag Delamare zu unterschreiben.
»Großartig, in der Tat. Ich bräuchte Ihre Hilfe …«
Ich senkte die Stimme in der Hoffnung, die Situation mit etwas Geheimnis zu umwittern, und flüsterte:
»Ich suche den Schriftsteller.«
»Wie bitte?«
»Ich bin hier wegen …«
Ich sah kurz hinter mich, um mich zu vergewissern, dass wir allein waren.
»… des Schriftstellers.«
»Wegen wem?«
»Ich möchte den Schriftsteller des Dorfes aufsuchen, den Autor eines wunderbaren Romans …«
»Sprechen Sie doch bitte etwas lauter, ich verstehe Sie nicht.«
Jetzt verlor ich die Geduld und schrie:
»Den Schriftsteller!«
Er sah mich erschreckt an – vielleicht war ich doch etwas zu laut geworden. Ich fuhr mir mit der Handfläche über die Haare, um sie zu glätten.
»Ich suche jemanden.«
Seine Gesichtszüge hellten sich auf.
»Da sind Sie genau bei dem Richtigen gelandet. Ich bin Robert Courrier, der Bürgermeister.«
»Sie nehmen mich auf den Arm!«
»Aber nein, warum denn?«
»Sie heißen Robert Courrier, sind jedoch nicht Briefträger, wie der Name nahelegen könnte, sondern Bürgermeister von Arnac-la-Poste …«
Stolz lächelte er mich an.
»Das ist Schicksal.«
Er erhob sich von seinem Stuhl hinter der Kasse.
»Wie ich schon sagte, Sie sind an den Richtigen geraten. Mir gehört das einzige Taxiunternehmen im Dorf.«
»Abgesehen davon, dass Sie Bürgermeister und Lebensmittelhändler sind?«
»Man muss sich breit aufstellen.«
»Können Sie mich in die rue de l’Écurie Nummer drei fahren?«
»Aber gern.«
Er setzte seine Kopfbedeckung ab und kramte hinter dem Tresen, bis er eine schwarze Jacke, passende Handschuhe und eine Chauffeursmütze ausfindig gemacht hatte.
Entzückt über meinen erstaunten Gesichtsausdruck beteuerte er:
»Ich biete einen Vier-Sterne-Service.«
Die Fahrt dauerte insgesamt gerade einmal drei Minuten. Es stellte sich heraus, dass ich auf Höhe der Kirche nach rechts abgebogen war, anstatt mich links zu halten. Die rue de l’Écurie, die ihrem Namen übrigens in keinster Weise gerecht wurde, denn es gab keinen Pferdestall, sah ganz entzückend aus: Die Bäume auf beiden Seiten leuchteten in ihrem Lichterkleid.
Als wir vor der Hausnummer drei standen, reichte mir der Bürgermeister-Lebensmittelhändler-Taxifahrer eine Zuckerstange.
»Willkommensgeschenk. Sie werden sehen, Arnac-la-Poste ist der beste Ort, um Weihnachten zu verbringen.«
1 Übersetzt so viel wie »Zock die Post ab
2 Übersetzt so viel wie »Scheiß auf die Polizei«
3 Übersetzt so viel wie »Abzocker und Abzockerinnen«
5
Ein in solchem Übermaß geschmücktes Haus hatte ich noch nie zuvor gesehen. Der Bürgermeister hatte nicht gelogen. Hier liebte man Weihnachten, und dies war nun der krönende Abschluss. Wenn der Weihnachtsmann einen Zweitwohnsitz in der Region Haute-Vienne hatte, dann war er mit Sicherheit genau an diesem Ort zu finden.
Eine Unmenge an Lichtern war wohlüberlegt angebracht, um die Umrisse des hübschen Hauses zu betonen. Im Garten zeigten sich die Tannen in ihrem allerschönsten Schmuck. Riesige Nussknacker bewachten den Eingang. Wichtel, Sterne, Geschenke, Rentiere und sogar Eisbären bewegten sich in einer gut geölten Aufziehmechanik, um mich zu begrüßen.
Ich hätte am liebsten auf der Stelle kehrtgemacht. Aber ich hatte nicht diesen weiten Weg zurückgelegt, eine Schuhsohle im Kampf verloren und obendrein meine Anstellung in den Ring geworfen, um jetzt vor der Höhle des Weihnachtsmanns den Rückzug anzutreten.
Ich holte tief Luft und drückte auf die Klingel am Tor. It’s beginning to look a lot like Christmas tönte es mir entgegen. Ich musste auch noch die zweite Strophe des Liedes abwarten, bis das Tor sich öffnete. Allerdings war niemand zu sehen. Trotzdem schlug ich den Weg zum Haus ein und stapfte hinkend durch den künstlichen Schnee. Mein Schriftsteller war also schüchtern. Ein schüchterner Weihnachtsfan. Damit hatte ich nicht gerechnet, aber ich konnte durchaus nachgiebig sein. Er liebte diese Jahreszeit, na und? Niemand war vollkommen.
Als ich die einen Spalt breit geöffnete Haustür erreichte, umfing mich bereits der Duft von Bratapfel, Zimt und Lebkuchen. Das Paradies des weihnachtlichen Feinschmeckers. Die Hölle für mich. Ich nahm die Räumlichkeiten in Augenschein. Es war zwar ein Perserteppich vorhanden, aber es lag kein zusammengeknülltes Papier herum. Nirgendwo Papierknäuel, dafür aber überall Kugeln: rote, grüne, goldene …
Um die Garderobe herum waren Tannenzweige gewunden, hier und da verziert mit karminroten samtenen Schleifen. Perry Como hatte Bing Crosby die Bühne überlassen, der nun sein Santa Claus Is Coming to Town anstimmte.
Wider Willen ging ich weiter, getrieben von einer seltsamen Neugier. Wer konnte in einer solchen Umgebung leben? Ein Wichtel? Mein Schriftsteller musste sich bei der Angabe seiner Adresse verschrieben haben. Er wohnte überhaupt nicht in Arnac-la-Poste. Am Ende hätte ich vielleicht tatsächlich nach »Nique-la-Police« fahren müssen.
Der Salon verströmte eine gemütliche und arbeitsame Atmosphäre. Ein wunderschöner Eichenschreibtisch beherrschte den Raum. War ich letztlich doch am rechten Ort? Eine irrwitzig große Tanne erhob sich in einer Ecke. Ihr Funkeln reichte bis zum Kamin hinüber. Der Geruch nach brennendem Holz mischte sich mit dem von Weihnachtsgebäck.
»Was kann ich für Sie tun?«
Ich fuhr herum, stieß an ein Rentier – wie hinterhältig! – und taumelte auf das Sofa.
Mir gegenüber stand ein Mann. Er hatte ein gewisses Alter, weißes, lockiges Haar, trug eine runde Brille mit dünner Metallfassung und hatte einen langen weißen Bart. Ein Doppelgänger des Weihnachtsmanns! Der einzige Unterschied war die Kleidung. Er trug nicht das übliche rot-weiße Gewand, sondern einen zinnoberroten Kaschmirpullover und eine beigefarbene Cordhose. Darüber hatte er eine Schürze im Schottenmuster gebunden, auf deren Vorderseite eine Schneelandschaft zu sehen war.
Eilig rappelte ich mich wieder hoch.
»Entschuldigen Sie bitte, ich wollte nicht unerlaubt hier eindringen. Die Tür war offen und …«
Er fegte meine Entschuldigungen mit einer Handbewegung beiseite.
»Bei allen Wichteln dieser Welt! Sie scheinen mir sehr gestresst zu sein.«
Gebieterisch forderte er mich auf, mich wieder zu setzen, und ließ mich dann allein. Was sollte ich tun? Ihm folgen? An Ort und Stelle bleiben? Fotos machen für die nächste Weihnachtsausgabe der Zeitschrift Kunst und Dekoration?
Als er zurückkam, trug er ein hübsches goldenes Tablett vor sich her. Darauf standen zwei gläserne Tassen, die mit einer cremefarbenen Flüssigkeit gefüllt waren. Obenauf türmte sich ein Berg Sahne, der mit Schokoladensplittern bestreut war. Statt eines Löffels steckte eine Zimtstange darin. Und als wäre diese Kalorienbombe noch nicht ausreichend, hatte er ein paar stern- oder tannenförmige Weihnachtskekse dazugelegt.
»Ich bin glücklich, Sie empfangen zu dürfen.«
Der Mann war gastfreundlich. Er setzte sich in den Schaukelstuhl dem Sofa gegenüber und reichte mir eine der Tassen.
»Eierpunsch. Das wird Ihnen guttun.«
Ich griff nach dem Getränk. Er nahm seine Tasse und hob sie in meine Richtung.
»Auf die letzten Festtage des Jahres!«
Ich rechnete mit einem »Ho! Ho! Ho!«, aber das blieb aus. Das heiße Glas gab seine Wärme wohltuend an meine Hände ab. Jeder wusste, dass man keinen Eierpunsch von einem Unbekannten annimmt. Aber hier herrschte eine so friedvolle Atmosphäre, und der Mann wirkte unglaublich sanftmütig. Ich ließ mich etwas tiefer in das Sofa sinken und führte das Gebräu an meine Lippen. Es war eine Explosion süßer Geschmacksnoten. Milch, Zucker, Muskatnuss, noch einmal Zucker, ein Hauch alter Rum und erneut Zucker.
Es tat gut. Das Weihnachtsgebäck erfüllte den Raum mit seinen würzigen Aromen, das im Kamin knisternde Feuer beruhigte mich und der Rum benebelte angenehm meine Sinne. Der Mann wartete, bis ich meinen Eierpunsch halb geleert hatte, bis er das Wort an mich richtete, als seien wir alte Bekannte.
»Ich hoffe, Sie hatten keine Schwierigkeiten herzufinden?«
»Ich bin mit dem Zug gekommen.«
»Sehr gut.«
»Und dann mit dem Taxi.«
»Dann haben Sie bereits Bekanntschaft mit unserem Bürgermeister geschlossen?«
»Ja.«
»Ein reizender Mann.«
Ich nickte zustimmend und fügte hinzu:
»Und ein Multitasking-Talent.«
Ich nahm einen weiteren Schluck. Die Muskatnuss kitzelte mich in der Nase. Was versprach ich mir von dieser Unterhaltung mit dem Weihnachtsmann von Arnac-la-Poste? Irgendetwas stimmte nicht in meinem Leben. Ich mochte noch so sehr versuchen, die richtigen Entscheidungen zu treffen, stets lag ich unweigerlich daneben. Ich hatte mein Schicksal mutig in die Hand nehmen wollen und sah mich nun einem skurrilen Weihnachtsmann hilflos ausgeliefert. Was für eine Ironie!
Plötzlich fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Was, wenn das Ganze eine Falle war? Aber natürlich! Wie konnte ein so schöner Roman wie Die Versöhnung überhaupt auf meinem Schreibtisch gelandet sein? Mit einem Mal war alles klar – Shantis fehlende Begeisterung, das anonyme Manuskript, Arnac-la-Poste … Sie hatten mich schön reingelegt! Was für ein Idiot war ich doch! Und dieser arme Mann, der mich empfing, als gehörte ich zu seiner Familie. Und der mich zudem gerade schon wieder etwas fragte:
»Sind Sie hierhergekommen, um die Festtage in unserem Dorf zu verbringen?«
»Nein, ich bin beruflich hier.«
»Was machen Sie denn?«
»Ich bin Lektor, genau genommen, Assistent in der Lektoratsabteilung. Ich arbeite für das Verlagshaus Delamare.«
Für einen Moment funkelten seine Augen, aber er sagte nichts. Ich fuhr fort:
»Ich sollte wohl eher sagen, ich habe für das Verlagshaus Delamare gearbeitet.«
»Sind Sie nicht mehr dort angestellt?«
»Ich weiß nicht genau.«
Ein geheimnisvolles Lächeln huschte über sein Gesicht, bevor er sich bequem in seinen Schaukelstuhl zurücklehnte und ein mit einer Elfe verziertes Kissen hinter seinen Rücken schob.