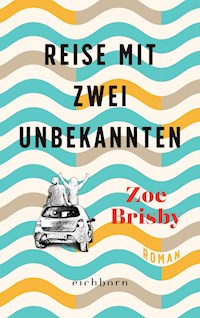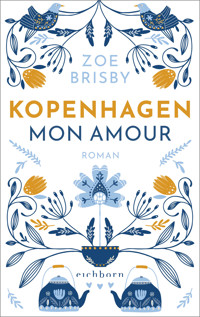
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Eichborn
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Ein großer Traum und eine verheißungsvolle Reise nach Kopenhagen
Kinderwunsch - ja! Aber wie erfüllen ohne Partner? Nach mehreren gescheiterten Beziehungen beschließt die 35-jährige Brune, die Familienplanung ohne Mann in Angriff zu nehmen. Begleitet von ihrer besten Freundin Justine reist sie nach Dänemark, um dort eine Kinderwunschklinik aufzusuchen. In einem am Wasser gelegenen Häuschen in Kopenhagen nimmt ein ungewöhnliches Abenteuer seinen Anfang. Denn vor ihrem Termin hat Brune das dringende Bedürfnis, sich ein Bild vom natürlichen Umfeld eines möglichen Spenders aus dem Hygge-Land zu machen. Dabei kommt es zu manchem Missverständnis und einigen skurrilen Begegnungen, bis ein überraschendes Ereignis nicht nur Brunes Leben völlig auf den Kopf stellt...
»Balsam für die Seele - dieser charmante Roman voller Humor und Zärtlichkeit sprüht nur so vor Lebensfreude« Version Femina
»Lebensklug, lustig - eine Lektüre, die einfach glücklich macht« Freundin über Reise mit zwei Unbekannten
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 370
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über das Buch
Über die Autorin
Titel
Impressum
Zitat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
Anmerkung der Autorin
Über das Buch
Ein großer Traum und eine verheißungsvolle Reise nach Kopenhagen
Kinderwunsch – ja! Aber wie erfüllen ohne Partner? Nach mehreren gescheiterten Beziehungen beschließt die 35-jährige Brune, die Familienplanung ohne Mann in Angriff zu nehmen. Begleitet von ihrer besten Freundin Justine reist sie nach Dänemark, um dort eine Kinderwunschklinik aufzusuchen. In einem am Wasser gelegenen Häuschen in Kopenhagen nimmt ein ungewöhnliches Abenteuer seinen Anfang. Denn vor ihrem Termin hat Brune das dringende Bedürfnis, sich ein Bild vom natürlichen Umfeld eines möglichen Spenders aus dem Hygge-Land zu machen. Dabei kommt es zu manchem Missverständnis und einigen skurrilen Begegnungen, bis ein überraschendes Ereignis nicht nur Brunes Leben völlig auf den Kopf stellt ...
»Balsam für die Seele – dieser charmante Roman voller Humor und Zärtlichkeit sprüht nur so vor Lebensfreude« VERSION FEMINA
»Lebensklug, lustig – eine Lektüre, die einfach glücklich macht« FREUNDIN über Reise mit zwei Unbekannten
Über die Autorin
Zoe Brisby ist Kunsthistorikerin und literaturbegeistert. Ihre eigene schriftstellerische Karriere begann 2016, und nach Reise mit zwei Unbekannten ist Kopenhagen mon amour ihr zweiter Roman, der auf Deutsch erscheint. Zoe Brisby schätzt Humor und Herzensweisheit und ist der Meinung, dass ungewöhnliche Lebenssituationen einen manchmal im besten Sinn über sich hinauswachsen lassen.
ZOE BRISBY
KOPENHAGENMON AMOUR
ROMAN
Übersetzung aus dem Französischen von Monika Buchgeister
Vollständige E-Book-Ausgabedes in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Eichborn Verlag in der Bastei Lübbe AG
Titel der französischen Originalausgabe:»Bons baisers de Copenhague«
Für die Originalausgabe:Copyright © Mazarine/Librairie Arthème Fayard, 2020
Für die deutschsprachige Ausgabe:Copyright © 2022 by Bastei Lübbe AG, KölnUmschlaggestaltung: U1berlin/Patrizia Di StefanoUmschlagmotiv: © Dariia Baranova/shutterstock (2)eBook-Erstellung: two-up, Düsseldorf
ISBN 978-3-7517-2895-9
luebbe.delesejury.de
Fordere dein Glück ein, halt es fest und scheue kein Risiko. Sie werden sich schon daran gewöhnen,dich so zu sehen.
René Char, Les Matinaux
1
Ihrem Namen zum Trotz hatte Brune kein braunes Haar. Nicht einmal kastanienfarbenes Haar. Brune war blond.
Eine erste Komplikation schon bei der Geburt. Ein echter Fremdkörper in ihrer Familie, die zu einhundert Prozent braunes Haar hatte.
Offensichtlich hatte Brune von Beginn an – vielmehr von den Haaren an – beschlossen, ihre Eltern zu ärgern. Es hatte zwar einen Urgroßvater gegeben, der annähernd blond gewesen war, aber abgesehen von diesem war in der gesamten Ahnenreihe keine weizenfarbene Haarpracht zu finden.
Es wird immer wieder behauptet, dass unsere Vornamen über unseren Lebensweg entscheiden: In diesem Fall hatte Brune einen schlechten Start gehabt. Und bis heute, mit fünfunddreißig Jahren, hatte sich nichts gefügt. In ihrem Leben ging ziemlich viel schief.
Sie saß auf der Bordsteinkante und tauschte ihre hochhackigen Schuhe gegen bequeme Sneakers. Warum sollte man seine Wirbelsäule durch solche Stelzen misshandeln, allein um der männlichen Spezies zu gefallen? Nur ein Mann konnte solche Folterwerkzeuge erfinden. Und nur eine Frau willigte ein, sie zu tragen.
Das Rendezvous von heute Abend hatte in seinem Internet-Profil angegeben, 1,95 Meter groß zu sein. Also hatte sie aus dem Kleiderschrank ihre angestaubten Absatzschuhe hervorgeholt, die nur bei seltenen Gelegenheiten zum Einsatz kamen. Selbst wenn man die Grundregel des Onlinedating in Anschlag brachte und zehn Zentimeter von der angegebenen Größe als Lügenpuffer abzog, war 1,85 Meter immer noch ganz schön groß!
Vorsichtshalber hatte Brune noch rasch ein gelbes Post-it unübersehbar mitten auf ihren Kühlschrank geklebt, mit dem Hinweis: Derjenige, der mich entführt und/oder getötet hat, heißt Christopher Allen. Danke.
Beim Danke hatte sie gezögert. Aber für den Fall, dass diese Nachricht ihr letztes Lebenszeichen auf dieser Erde gewesen sein sollte, wäre sie immerhin höflich geblieben.
Christopher Allen – schon der Name klang falsch. Er hätte ihr Misstrauen wecken sollen. Hinter einem amerikanisch klingenden Familiennamen steckt oft ein kleiner Dicker oder, noch schlimmer, ein Jugendlicher, der irgendwo in einem winzigen Dorf im abgelegensten Winkel Frankreichs immerzu vor seinem Bildschirm hängt.
Als Brune in die Bar kam, suchte sie augenblicklich nach Ryan Reynolds. Kein Ryan weit und breit. Dann vielleicht Leonardo DiCaprio? Auch kein Leonardo in Sicht. Möglicherweise doch eher Bradley Cooper? Auch nicht.
Sie wollte sich gerade fragen, ob sie sich mit dem Treffpunkt vertan hatte, als sich eine Hand erhob. Wer sich bemerkbar machte, war auch kein George Clooney. Eher Jean-Claude Clooney, ein entfernter Cousin. Weit entfernt. Um die fünfzig, dickbäuchig, höchstens 1,70 Meter groß, lichtes Haar und ein etwas krummer Rücken. Der Schwindel des Jahrhunderts. Keinerlei Ähnlichkeit mit dem Foto. Wer war das eigentlich auf dem Foto gewesen? Sein Fitnesscoach? Nein, bei dem Bauch hatte er unmöglich so etwas wie einen Fitnesscoach.
In einer solchen Situation gab es zwei Möglichkeiten. Man konnte so tun, als hätte man nichts gesehen, und die Flucht ergreifen. Oder man sagte sich, dass nur die innere Schönheit zählt, um dem anderen eine zu Chance geben.
Brune dachte ein paar kurze Augenblicke nach.
Einerseits flüsterte ihr ihr gutes Herz zu, dass er sicher ein netter Kerl war, andererseits hatte er sie angelogen. Er hatte eine falsche Identität benutzt, um sie zu ködern. Vermutlich war er ein Psychopath, der ihr eine Droge ins Glas schütten würde, um Brune anschließend in einem Verlies einzusperren und ihr nichts anderes als hier und da ein paar gefriergetrocknete Mahlzeiten hineinzuwerfen.
Sie warf einen skeptischen Blick auf die Wampe, die zwei Knöpfe des blassen Hemds gesprengt hatte. Vermutlich handelte es sich schlicht um einen armen Kerl, der mit seinem eigenen Foto nicht die Richtige fand und deshalb für seine Verführungskünste sein geistiges Vermögen in die Waagschale warf.
Letztendlich hatte sie beschlossen, dem potenziellen psychopathischen Lügner eine Chance zu geben, und in der Folge einen schrecklich langweiligen Abend verbracht. Der Gipfel seiner Verfehlungen war dann, dass er bei der Rechnung halbe-halbe gemacht hatte.
Jetzt saß sie hier allein auf diesem Bordstein und wechselte grübelnd ihre Schuhe. Was stimmte nur nicht mit ihr? Zu dick? Zu dünn? Zu laut? Zu leise? Zu komisch? Zu düster? Zu intelligent? Zu dumm?
Sie dachte darüber nach, wie es so weit hatte kommen können.
»Willst du Kinder?«
»Ähh.«
All ihre Probleme hatten mit dieser schicksalsschweren Frage begonnen und mit ihrer – gelinde gesagt – vagen Antwort. Daraufhin hatten sich die Ereignisse überschlagen: Auseinandersetzungen, Versöhnungen, Auseinandersetzungen, Trennung.
Das Idiotischste an der ganzen Sache war, dass sich Brune diese Frage damals noch nie gestellt hatte. Kinder kriegen? Ja. Nein. Vielleicht. Irgendwann einmal.
Sie hatte in der Gegenwart gelebt und die gemeinsam verbrachte Zeit genossen, sich vom sanften Fluss des Glücks tragen lassen. Aber jetzt hatte sie sich einen Tsunami in ihrer Brust eingefangen.
Über das Vergehen der Zeit hatte sie sich bislang keine Gedanken gemacht, zu ihrem Glück war das Thema an ihr abgeprallt. Er aber hatte sie auf die unaufhaltsam tickende Uhr aufmerksam gemacht. Tick-tack, unerbittlich wie ein Metronom. Der Sensenmann kam näher, das stand ihr jetzt vor Augen. Selig sind die Unwissenden!
Davor hatte sie in einer süßen Unbeschwertheit ohne Blick auf die verrinnenden Jahre gelebt. Aber das, ja, das war davor gewesen.
Er hatte ihr durchaus aufrichtiges »Ähh« nicht gut gefunden. Er hatte es für unreif gehalten und war sogar so weit gegangen, ihr mangelnde Entscheidungsfähigkeit vorzuwerfen. Er hatte auf Abstand gehen wollen. Jenen famosen Abstand, der nie etwas Gutes verheißt.
Inzwischen hatte Brune nachgedacht, und in ihrem Kopf war ein Bild aufgetaucht. Zunächst verschwommen, dann klarer, und schließlich ließ es sie nicht mehr los. Kleine Strümpfchen, ein helles Lachen, Fingerchen, die nach ihrer Hand griffen … Sie wollte ein Baby.
Sie hatte versucht, ihn zurückzuerobern, wollte ihm alles erklären, aber er glaubte ihr nicht. Es war zu spät.
Er war ausgezogen, hatte sie allein in einer leeren und zu teuren Wohnung zurückgelassen, mit verrücktspielenden Hormonen und einer tickenden biologischen Uhr.
Ein tiefes Tal der Tränen musste durchschritten werden. Nach zahllosen romantischen Komödien auf dem Sofa und der erschöpfenden Lektüre aller Jane-Austen-Romane hatte sie versucht, ihr Leben wieder in die Hand zu nehmen.
Jetzt wusste sie, dass sie ein Baby wollte. Sie hatte sich auf allen möglichen Plattformen angemeldet und ein Rendezvous nach dem anderen vereinbart – aber alle verliefen gleichermaßen niederschmetternd.
Sie musste unbedingt aufhören, darüber nachzudenken. Nicht jetzt, nicht hier auf diesem feuchten Bordstein, beschwor sie sich. Aber sie konnte nicht anders. An jedem verlorenen Abend, bei jeder verpassten Gelegenheit dachte sie daran. Und jetzt regnete es auch noch! Sie hasste es, im Regen unterwegs zu sein. Die eisigen Tropfen machten sie traurig, ließen sie frösteln und brachten sie am Ende womöglich noch zum Weinen. Der Regen ist ein Feind nicht nur der Haare, sondern auch der Moral. Diese himmlischen Tränen sind ansteckend.
Wütend stopfte sie die Absatzschuhe in ihre Tasche. Dieses verunglückte Treffen brachte das Fass endgültig zum Überlaufen! So konnte sie nicht weitermachen. Sie musste handeln, das Ruder herumreißen.
Ihr glasklarer Geist ertrug Niederlagen nicht und noch weniger ein zeitliches Ultimatum. Fünfunddreißig, damit hatte sie eine Grenze erreicht.
Fünfunddreißig – da tut sich ein Abgrund auf, wenn es um das Thema Mutterschaft geht: Entweder man springt mit beiden Beinen hinein, oder man bleibt auf ewig außen vor.
Sie richtete sich wieder auf und suchte nach einem Notizbuch in ihrer Tasche. Sie machte gerne Listen – überall und für alles. So gelang es ihr, ihre Gedanken zu ordnen und sich vorzugaukeln, sie habe die Dinge im Griff. Sie kaute auf dem Bleistift herum und dachte angestrengt nach. Zwei Dinge standen fest, mit denen sie sich auseinandersetzen musste.
1. Sie wollte ein Baby.
2. Sie hatte keinen Mann parat.
Versonnen kaute sie auf ihrer Lippe, bis ihr die Erleuchtung kam. An Letzerem durfte es nicht scheitern, sie würde sich auch allein zu helfen wissen!
Sie erinnerte sich an einen Artikel, den sie über Kinderwunschkliniken in Dänemark gelesen hatte. Ein Baby aus dem Katalog, warum eigentlich nicht? Es war zwar ein wenig traurig, aber … Nein! Es war mutig! Sie würde zu jenen Pionierinnen zählen, die für ihr Baby keinen Vater brauchen.
Außerdem hatte sie noch nie gern Dinge aus der Hand gegeben.
2
Als Justine mit einer grünen Mixtur in der Hand die Wohnung betrat, war Brune bereits im Internet unterwegs.
»Alles in Ordnung? Ich habe mir gerade einen Smoothie gemacht mit Chia, Grünkohl, Agar-Agar und Kiwi. Möchtest du was davon?«
Brune sah kaum von ihrem Bildschirm auf.
»Außer Kiwi habe ich nicht so wirklich verstanden, was drin ist.«
Endlich löste sie ihren Blick doch vom Laptop in Richtung ihrer Etagennachbarin, die bereits dabei war, Brunes Küchenschränke zu durchforsten.
»Hast du Kaffee da?«
Brune wies mit dem Finger auf den Kapselhalter neben der Kaffeemaschine.
»Diese schrecklichen Dinger? Danke, nein! Ökologisch gesehen das reinste Desaster, diese Plastikkapseln! Und dann der Kaffee, der da drin ist! Wenn man das überhaupt Kaffee nennen kann … Dahinter stehen riesige, mega umweltschädliche Betriebe, die Flora und Fauna gnadenlos vernichten. Bald gibt es keine Papageien mehr, und dafür wirst du mitverantwortlich sein. Willst du das wirklich?«
Aufgebracht machte Justine kehrt und warf die Tür hinter sich zu.
Brune war die dramatischen umweltbewussten Ausbrüche ihrer Nachbarin gewohnt. Justine war militante Umweltschützerin, Veganerin und überzeugte Aktivistin für das Tierwohl. Manchmal bedauerte Brune ein wenig, ihr die Schlüssel zu ihrer Wohnung gegeben zu haben.
Aber hinter diesem kämpferischen Auftreten verbarg sich ein Herz aus Gold. Justine gehörte zu jenen aufrichtigen und standhaften Wesen, die immer und überall für ihre Überzeugungen eintreten. Anders als die meisten Leute beschränkte sie sich nicht darauf, traurig, aber resigniert Statements abzugeben wie »Die Abholzung des Regenwalds am Amazonas ist eine Tragödie«. Justine kettete sich in ihrem Viertel an einen Baum, der der Säge zum Opfer fallen sollte, um Platz für einen Parkplatz zu schaffen. Sie dachte und handelte konsequent. Sie war ein Mensch, wie man ihn nur selten trifft.
Sie war in die Nachbarwohnung gezogen, kurz bevor es zu der schicksalsschweren Frage kam, und Brune eine große Unterstützung gewesen. Seither standen sie einander sehr nah.
Die Tür wurde weit aufgestoßen, und Justine erschien erneut, diesmal mit einem abgenutzten weißen Gegenstand im Arm.
»Hier. Eine gute alte Filterkaffeemaschine. Keine Sorge, ich habe noch eine andere, die ich im Secondhandladen erstanden habe.«
Sie stellte das Gerät auf die Arbeitsplatte, schloss es an und zog dann aus der Tasche ihrer Latzhose ein Paket Arabica-Kaffee hervor. Sie wartete, bis die Maschine aus zweiter oder sogar dritter Hand in Gang kam und wühlte derweil im Wandschrank.
»Wo hast du denn den Zucker hingeräumt? Sag bloß, du hast all deine Schränke neu geordnet!«
»Da, im Regal«, sagte Brune und wies mit dem Finger in die entsprechende Richtung.
»Das war aber gestern noch nicht da!«
»Ich habe es heute Nacht aufgebaut. Ich konnte nicht schlafen.«
Nach der Trennung hatte Brune sich, in Ermangelung weiterer romantischer Komödien und unveröffentlichter Jane-Austen-Romane, auf handwerkliche Tutorials im Internet gestürzt. Getrieben von der Lust, etwas zu bauen, ihr Leben wieder in die Spur zu bringen, Ordnung zu schaffen in der vorhandenen Unordnung. Vielleicht hatte sie auch einfach nur das Bedürfnis gehabt, ihre Hände zu beschäftigen und ihren Geist im Zaume zu halten.
Das Leben glich dem Bausatz für ein Möbelstück: Ein paar Schrauben zu wenig, eine Befestigungsmutter zu viel, und alles fügte sich zu einem etwas wackligen Ganzen.
Die tränenverhangenen Sonntage waren auf diese Weise zu Sonntagen in den großen Baumärkten der Stadt geworden. Mittlerweile fand sie sich bestens in jeder beliebigen Abteilung zurecht, duzte sich mit den Verkäufern und kannte bisweilen ihre Vornamen. Geräte wie die Schleifmaschinen von Black & Decker bargen keinerlei Geheimnis mehr für sie.
Justine hatte Brune aus reiner Gutmütigkeit mehrmals auf ihren Streifzügen durch das Labyrinth der Baumärkte begleitet. Ihre Unterstützung hatte sich allerdings im Wesentlichen auf das Schieben des Einkaufswagens beschränkt. Dem Heimwerken selbst konnte sie wahrlich nichts abgewinnen.
Brune hatte mit kleinen Veränderungen begonnen: ein Bausatz für eine Kommode hier, ein Wandhaken dort. Dann fühlte sie sich zu Größerem befähigt: Sie tapezierte und pinselte, baute auseinander und leimte zusammen … Und schließlich hatte sie sich an umfassende Neugestaltungen gewagt.
Ständig stellte sie ihr Mobiliar um, was Justine ganz außerordentlich auf die Nerven ging, da sie nie etwas wiederfand.
Heute Morgen war also der Zucker von Brunes Heimwerkertrieb betroffen gewesen. Justine griff nach der Zuckerdose und ließ zwei gehäufte Löffel in die Tasse ihrer Freundin rieseln.
»Hier, das ist ein guter, echter Kaffee. Fair gehandelt außerdem. Geerntet von Kleinbauern, die achtsam mit der Natur umgehen.«
»Die Papageien werden es dir danken!«
Brune ließ ihre Freundin in der Küche schalten und walten, während sie sich erneut in ihre Studien vertiefte. Sie war auf die Seite einer dänischen Klinik gestoßen und ging nun den Katalog der Spender durch.
Das Geräusch einer mit dem Feingefühl eines Elefanten neben ihr abgestellten Tasse ließ sie aufschrecken.
»Wie war eigentlich deine Verabredung von gestern Abend?«, wollte Justine wissen und warf einen vielsagenden Blick zu dem Post-it hinüber, das immer noch am Kühlschrank klebte.
Brune schob seufzend ihren Computer zurück und legte ihre Hände um die warme Tasse.
»Wie immer.«
»So schlimm?«
»Das war der letzte. Mit den Männern bin ich fertig. Ein für alle Mal!«
»Das sagst du nach jedem Date.«
»Aber diesmal ist es mir ernst. Das war’s, ehrlich! Ich höre auf mit dem Onlinedating. Man stößt immer nur auf Sexbesessene oder Depressive. Und manchmal auch auf beides zugleich.«
Justine lächelte. Sie kannte diese Reden.
»Willst du immer noch ein Baby?«
»Natürlich.«
»Na ja, ohne Mann kannst du den Plan mit dem Baby wohl knicken.«
Brune nahm sich die Zeit für einen genüsslichen Schluck heißen Kaffee, bevor sie mit geheimnisvoll leuchtenden Augen erwiderte:
»Nicht zwangsläufig.«
Die Umweltschützerin verschluckte sich beinahe an ihrem Kaffee.
»Biologie zählt natürlich nicht zu deinen Spezialgebieten, aber …«, sie nahm eine Kinderstimme an und spottete: »… damit Mama ein Baby bekommt, muss der Papa der Mama seinen Samen geben.«
»Nicht immer.«
»Hmm, jetzt machst du mir aber langsam wirklich Angst! Dir fehlen ja sogar die allereinfachsten Grundkenntnisse …«
Brune schnitt ihr das Wort ab, indem sie ihr den Computer hinüberreichte.
Das Bild eines hübschen, pausbäckigen Babys mit kristallblauen Augen hieß die Besucher der Internetseite willkommen.
»So eines will ich haben!«
»Ich glaube nicht, dass man es online bestellen kann, tut mir leid. Seine Eltern wären garantiert nicht einverstanden damit.«
»Doch!«
Justine sprang entsetzt hoch und stürzte sich auf ihr Handy.
»Die Eltern wollen es verkaufen?! Wie grauenhaft! Das ist Menschenhandel. Man muss sie anzeigen. Das darf man nicht zulassen. Das ist ja fast wie bei diesen indischen Kindern, die entführt werden, um reichen Kunden als Organlieferanten zu dienen. In meiner Organisation gibt es jemanden, der in Verbindung mit den Sozialämtern steht, den werde ich sofort anrufen.«
Justine konnte hochgehen wie eine Rakete. Brune konfiszierte ihr Handy, bevor sie auch nur einen ihrer Gutmenschen-Freunde dieser Erde auf den Plan rufen konnte.
»Nicht doch! Dieses Baby ist nicht zu verkaufen! Es ist eine Werbung, ein Beispiel, um zu zeigen, wie mein Baby aussehen könnte.«
»Bist du schwanger? Seit gestern Abend? Das ging aber schnell. Ich dachte, deine Verabredung wäre ein Desaster gewesen.«
Brune streichelte das Babygesicht auf dem Bildschirm.
»Noch nicht. Aber ich habe die Lösung.«
»Könntest du mir das vielleicht genauer erklären?«
»Das ist die Internetseite einer Kinderwunschklinik in Dänemark. Ich werde mich um einen Samenspender bemühen.«
»Ach so! Aber in Dänemark? Warum so weit weg? Warum kein französischer Spender? Ich hab dir doch schon tausendmal gesagt, dass regionaler Konsum besser ist. Hast du mal an deinen ökologischen Fußabdruck gedacht?«
»Diese Art von Geschäftsmodell ist in Frankreich verboten. Jedenfalls im Augenblick noch. Und ich kann es mir nicht leisten, länger zu warten. Ich bin fünfunddreißig und …«
»… das ist das Verfallsdatum, das auf deinen Eierstöcken steht, ich weiß.«
Justine war vier Jahre jünger als Brune und hatte einen Freund in Costa Rica, den sie während eines Ökovolontariats zur Rettung von Schildkröten kennengelernt hatte. Ein dringlicher Kinderwunsch hatte sich bei ihr noch nicht eingestellt.
Rasch überflog sie die Seite. Der Internetauftritt war gut gestaltet, die französische Übersetzung enthielt klare Angaben, das Ganze war gespickt mit Fotos von hübschen, blonden Babys.
Justine, selbst noch nicht vom Ticken der biologischen Uhr beunruhigt, zog besorgt die Augenbrauen hoch.
»Findest du es nicht seltsam, dass sie alle blond und superhübsch sind? Man könnte meinen, es sind allesamt Babys von Brad Pitt!«
»Die Dänen sind mehrheitlich blond. Und außerdem werden sie natürlich nicht gerade superhässliche Babys auf ihrer Seite präsentieren.«
»Genau. Du könntest aber genauso gut auch ein hässliches Baby bekommen. Wenn du weniger bezahlst, bekommst zu vielleicht ein ganz scheußliches Kind. So funktioniert das Gesetz von Angebot und Nachfrage – genau wie bei allen multinationalen Unternehmen. Für Extras muss man immer mehr bezahlen.«
Justine setzte ihre Argumentation fort, aber Brune hörte ihr nicht mehr zu. Sie biss sich auf die Lippen. Daran hatte sie nicht gedacht. Als sie dieses postkartentaugliche hübsche, pausbäckige Baby gesehen hatte, hatte sie sofort genauso eines haben wollen.
Aber vielleicht hatte ihre Freundin recht. Vielleicht würde sie eins bekommen, das hässlich wie die Nacht war. Ein Baby, das die anderen Kinder mit Kieselsteinen bewerfen würden. Ein Baby, über das sich die anderen Eltern lustig machen würden.
Sie wäre dann ganz allein, um es zu beschützen. Es gäbe keinen Papa, der es verteidigen könnte. Sie wollte ein Baby, ja, aber sie wollte ein genauso schönes wie auf dem Foto. Plötzlich ertappte sie sich tatsächlich dabei, dass sich ein leichtes Bedauern in ihr regte: Eigentlich schade, dass dieses nicht zu verkaufen war …
Justine kam zum Ende ihrer Ausführungen.
»Man kann sein Kind nicht auswählen. Mit den Babys ist es wie mit der Lotterie – man kann Glück haben oder Pech.«
»Man kann sein Baby nicht auswählen«, wiederholte Brune nachdenklich.
Doch. Genau das konnte man!
»Auf der Seite gibt es einen Spenderkatalog. Es ist möglich, denjenigen auszusuchen, der uns anhand einer Beschreibung seines Äußeren und eines Fragebogens am meisten zusagt. Man kennt seine Vorlieben, seinen Beruf, seine familiäre Herkunft. Man erfährt, ob er bereits Kinder hat …«
Sie klickte auf einen Reiter, und eine Namensliste tat sich auf, die sie nun herunterscrollte.
»Schau dir mal den hier an, Askur. Hellhäutig, blond, blaugraue Augen, 1,90 Meter groß, 86 Kilogramm schwer, Student. Es gibt sogar Fotos von ihm, als er klein war. Total süß!«
Justine betrachtete die Aufnahmen von einem kleinen Jungen, der wahlweise in der Badewanne saß, im Garten herumhantierte oder Ball spielte.
»Warum gibt es keine Erwachsenen-Fotos von ihm? Er könnte doch im Lauf der Jahre total widerlich geworden sein …«
»Die Anonymität muss schließlich gewahrt werden.«
Die Skeptikerin kniff die Augen zusammen.
»Wenn man anonym handelt, dann hat man etwas zu verbergen. Da stimmt was nicht mit deinem Askur.«
Die ›werdende Mutter‹ wischte das Argument vom Tisch.
»Aber nein! Das ist die Regel. Außerdem möchte er sicher nicht, dass die Leute über seine Samenspendertätigkeit Bescheid wissen.«
»Er spendet sein Sperma ja nicht, sondern verkauft es …«
»Wahrscheinlich braucht er Geld für sein Studium.«
»Ist es dir nicht unangenehm, dass er gezwungen ist, einen Teil von sich selbst zu verkaufen, um ein Bildungsniveau zu erreichen, das ihm erlaubt, ein würdiges Leben zu führen und seine armen kranken und bedürftigen Eltern zu unterstützen?«
Brune schaute sie mit großen Augen an.
»Seine Eltern sind krank? Woher weißt du das? Oje, das ist gar nicht gut. Meinst du, es ist eine Krankheit, die sich vererbt?«
Sie begann aufgeregt, das Profil nach Hinweisen auf eine ernste Erkrankung zu durchforsten, aber da legte Justine ihr eine Hand auf den Arm.
»Das war doch bloße Spekulation. Ich gebe nur zu bedenken, dass dieser arme Junge, wenn er sich verkaufen musste, sicher nicht aus Spaß gehandelt hat.«
Erleichtert rappelte Brune sich wieder hoch.
»Man kann da aber nicht gerade von einem großen Opfer reden. Es ist ja nicht so, als würde er eine Niere oder eine Lunge spenden.«
Justine gönnte sich einen weiteren Schluck Kaffee, um Zeit zum Nachdenken zu gewinnen. Das Argument war nicht von der Hand zu weisen, aber sie konnte nicht umhin, dieses ganze System suspekt zu finden. Sie sah noch einmal auf den Bildschirm.
»Ethisch gesehen bin ich gegen eine so genaue Auswahl der Merkmale eines zukünftigen Kindes. Überleg mal – du bestimmst die Farbe der Haut, der Haare, das Gewicht, die Größe …«
Brune zog die Augenbrauen hoch.
»Das macht man aber doch eigentlich auch, wenn man einem Mann begegnet. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass Frauen einen Partner mit dem genetischen Profil suchen, das ihren Vorstellungen am ehesten entspricht und ihnen die bestmögliche Nachkommenschaft sichert. Gegen diesen Instinkt ist nichts zu machen. So funktioniert unser Reptiliengehirn nun einmal.«
Justine schob ihre Tasse energisch von sich.
»Bei einer Verabredung ist keineswegs allein das Äußere ausschlaggebend. Du unterhältst dich mit der Person, du merkst, ob ihr euch gut versteht, ob sie dich zum Lachen bringt …«
Justine hielt einen Augenblick inne und verlor sich in Gedanken an ihre eigene Begegnung mit Pedro in Costa Rica. Aber sie schob die glücklichen Erinnerungen rasch beiseite, um sich wieder auf das Hier und Jetzt und das nicht gerade konventionelle Vorhaben ihrer Freundin zu konzentrieren. Mit strengem Blick nahm sie diese ins Visier.
»Was sie in dieser Klinik anbieten, nennt man Eugenik. Weißt du, wer das betrieben hat? Die Nazis!«
Brune verdrehte die Augen. Immer gleich diese scharfen Geschütze.
»Die Wissenschaft macht Fortschritte. Heute ist man in der Lage, Stammzellen zu klonen. Bald wird man einen Arm im Labor züchten und ihn dann einer Person einpflanzen können, der ein Arm fehlt. Fortschritt muss nicht immer etwas Negatives bedeuten. Wenn man bei seinem Baby Kriterien auswählen kann, die ihm ein gesundes Leben garantieren, dann bin ich jedenfalls dabei!«
»Aha, ein potenzieller Aldous Huxley! Vielleicht erinnerst du dich auch, wie seine Schöne, neue Welt endet?«
Beide schwiegen. Die im Raum spürbare Spannung musste sich erst einmal legen. Justine kannte die Besessenheit ihrer Freundin bezüglich eines Babys, doch die heutigen Ideen gingen ihr eindeutig zu weit. Sie war kein echter Freund von Onlinedates, aber immerhin spielten sich diese zwischen Menschen ab und verlagerten das Problem nicht auf das Feld des rein Biologischen. Die Vorstellung hingegen, im Internet die Zutaten für ein Baby zu bestellen, behagte ihr ganz und gar nicht.
»Vielleicht ist er krank.«
»Wer?«
»Askur!«
»Nein, er wurde untersucht. Schau her, hier ist die Liste der Erbkrankheiten. Er hat keine einzige.«
Justine kniff die Augen zusammen.
»Vielleicht hat er irgendwelche versteckten Laster. Das Unternehmen gibt mit Sicherheit nicht alles preis. Sie könnten dich anlügen.«
Brune schüttelte den Kopf.
»Ich habe Erfahrungsberichte gelesen. Alle Kundinnen sind zufrieden. Diese Klinik ist absolut seriös. Die Ärzte dort praktizieren seit über dreißig Jahren.«
Brune scrollte die lange Liste der Kommentare von überglücklichen Müttern hinunter. Justine sah sie gerührt an, konnte sich aber einen Anflug von Spott nicht verkneifen.
»Erfahrungsberichte, die sie selbst auf ihrer Seite platziert haben. Darauf kannst du dich absolut nicht verlassen. Sie werden wohl kaum die Aussagen einer Mutter veröffentlichen, die den Rolls Royce unter allen zur Auswahl stehenden Babys bestellt, stattdessen aber nur einen Twingo bekommen hat. Die meisten dieser Frauen existieren vermutlich überhaupt nicht!«
Justine hatte ihren Kaffee ausgetrunken. Sie stellte die Tasse in die Spüle und drückte ihrer Freundin rasch ein Küsschen auf die Wange, bevor sie ging und Brune in abgrundtiefer Verwirrung zurückließ.
Brunes Entschlossenheit bröckelte. Auch wenn sie grundsätzlich weiterhin überzeugt war von ihrem Vorhaben. Sie war voller Hoffnung zu Bett gegangen und wieder aufgestanden, musste aber zugeben, dass Justines Argumente ihre Berechtigung hatten. Was, wenn die Internetseite Unwahrheiten enthielt? Wenn das Ganze ein Riesenschwindel war?
Brune war von Natur aus eher vertrauensselig, möglicherweise ein wenig zu sehr, daher beherzigte sie oft die Ratschläge ihrer weitaus misstrauischeren Freundin. Was, wenn Justine tatsächlich recht hatte? Sie durfte sich nicht einfach auf die Angaben einer Internetseite verlassen. Aber man würde schon herausbekommen, ob dort die Wahrheit gesagt wurde.
Um Klarheit zu gewinnen, musste sie allerdings Nachforschungen anstellen. Zunächst über die Klinik und anschließend über Askur.
3
Brune brauchte frische Luft. Sie musste ein paar Schritte gehen, um ihre Gedanken zu sortieren. Also verließ sie die Wohnung und streifte aufs Geratewohl durch die Straßen.
Justines Argumente gingen ihr nicht aus dem Kopf. War sie im Begriff, eine Dummheit zu begehen? War diese Idee mit der Kinderwunschklinik vollkommen verrückt? War sie stark genug, um sich allein um ein Baby zu kümmern? Was würden ihre Eltern sagen? Was würden ihre Kollegen sagen? Was würde die Gesellschaft sagen? Wenn Frankreich diese Vorgehensweise für ledige Mütter untersagte, musste es doch einen Grund dafür geben, oder etwa nicht?
Auch ihr einsamer, ruhiger Spaziergang konnte sie nicht in Einklang mit dem Rest der Welt bringen. All diese »normalen« Menschen mit ihren »normalen« Beschäftigungen. Fast acht Milliarden menschlicher Wesen und Brune. Ein ganzer Planet und Brune. Es war nicht die Welt von Brune, sondern die Welt und Brune. Zwei getrennte Entitäten, die die Präsenz des jeweilig anderen ertrugen.
Anfangs hatte sie es versucht. Nach der Trennung musste sie schließlich ein neues Kapitel aufschlagen und nach vorne schauen. Aber wie sollte sie das alte Kapitel abschließen, das sie eben erst angefangen hatte? Ihre Beziehung hatte gerade erst begonnen. Es hatte keinerlei Warnsignale gegeben. Keine Schmerzen im linken Arm, keine Gesichtslähmung, kein blasses, fahles Aussehen, keine Verwirrtheit. Gelähmt war in ihrem Fall nur ihr Herz, blass und fahl war nur ihr Selbstwertgefühl, und verwirrt waren nur ihre Empfindungen.
Sie hatte sich lange treiben lassen. Eine Jammergestalt, die durch öde Landstriche irrt, nach Luft ringt und doch nicht zu Atem kommt. Sie hatte versucht, den Kopf frei zu bekommen, ihre Gedanken zu ordnen. Was für eine bescheuerte Idee! Als könnte die abgestandene Stadtluft ihr zu einem Baby verhelfen. Schwanger durch einen Luftzug, das wäre mal was ganz Neues. Eine windige unbefleckte Empfängnis.
Ihre Schritte führten sie zum Park. Quälerei für junge Mütter, Folterstätte für alle Kinderlosen.
Sie setzte sich auf eine Bank, die ebenso in die Jahre gekommen war wie ihre Eierstöcke und ebenso ungemütlich wie ihr derzeitiges Leben. Sie ließ ihren Blick über all die Glücklichen mit blassen Gesichtern und dunklen Ringen unter den Augen schweifen, die um sie herum mit ihren lebhaft herumfuchtelnden Zwergen unterwegs waren.
Sie war eifersüchtig. Schrecklich eifersüchtig. Sie wollte auch einen Kinderwagen schieben, jede Rutschpartie mit einem aufmunternden Winken begleiten oder schimpfend verbieten, Sand zu essen.
Früher hatten Babys sie kaltgelassen. Natürlich waren sie wirklich niedlich mit ihren blauen Kulleraugen, ihren niedlichen, knubbligen Füßchen und ihrem glockenhellen Lachen, aber sie blieben doch vor allem kleine Vampire, die einem die Jugend aussaugten. Zeitfressende Monster, die sich an der Energie ihrer Mütter labten. Diebe der besten Jahre. Sie weinten, schrien, und vor allem kotzten sie. Sie hatte nie zu denjenigen gezählt, die beim Anblick einer schwangeren Frau in Begeisterung ausbrachen und ihr mit bewundernder Miene über den Bauch strichen.
Aber das war davor gewesen. Damals konnte sie noch spazieren gehen, ohne sich vom Anblick eines Kinderwagens unter Druck gesetzt zu fühlen. Jetzt war sie zu einem regelrechten Radargerät für Babys geworden, die sie im Umkreis von mehreren Kilometern aufspürte. Eine immerwährende Folter. Sie sah die gewölbten Bäuche werdender Mütter und betastete ihren eigenen, den flach zu halten sie sich so lange bemüht hatte.
Ein Ball plumpste an ihr Bein. Ein kleiner, etwa fünfjähriger Junge kam angerannt, um ihn zu holen, und entschuldigte sich freundlich, bevor er kehrtmachte und wieder zu dem Bolzplatz hinüberflitzte. Ein Elektroschock hätte sie nicht schlimmer treffen können. Sie konnte nicht ihr ganzes Leben auf einer Bank herumsitzen und die Kinder der anderen anstarren. Zum einen, weil man sie für eine Geisteskranke halten würde, die eine Entführung plant – es hatte schließlich immer etwas Verdächtiges, wenn ein Erwachsener ohne Kinder in einem Park herumlungerte –, und zum anderen, weil sie nicht das Leben einfach so für sie entscheiden lassen wollte.
Sie konnte mit ihrem Leben anstellen, was sie wollte, unter der Bedingung, dass sie die nötigen Mittel dafür hatte. Natürlich war ihr Vorgehen nicht gewöhnlich, aber was war schon dabei? Hätte der Mensch sich stets mit dem ihm Vertrauten begnügt, dann würde man heute noch glauben, die Erde sei eine Scheibe. Die Dinosaurier hatten sich nicht anpassen können, und man wusste ja, welches Ende es mit ihnen genommen hatte …
Sie war vielleicht naiv, wie Justine sagte. Und wahrscheinlich war sie auch viel zu vertrauensselig. Aber war es denn schlecht, an die Menschheit zu glauben? Ganz sicher nicht!
Aus diesem Optimismus musste sie ihre Kraft schöpfen. Natürlich war die Welt nicht die von Walt Disney, aber man musste doch daran glauben, dass das Leben eine positive Wendung nehmen würde. Wozu sollte man denn sonst überhaupt weitermachen?
Brune spürte neue Energie in sich aufkeimen, Hoffnung strömte wieder durch ihre Adern. Das beruhigende Gefühl, etwas tun zu können, stellte sich ein. Die Gewissheit, ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Sie war nicht auf den Kopf gefallen und wusste, dass diese Stimmung nicht von Dauer sein würde, dass sie weiterhin Höhen und Tiefen erleben würde. Umso mehr musste sie ihre neue Entschlossenheit auf der Stelle ausnutzen.
Sie warf sich in die Brust und sah herausfordernd um sich. Leider war niemand in der Nähe, der ihrem Wandel beigewohnt hätte. Ach, egal!
Die Farben erschienen ihr jetzt bunter, die Sonne strahlender, die Düfte intensiver. Außerdem hatte sie bisher gar nicht bemerkt, wie schmutzig und übel riechend dieser Sandkasten dort war. Nie im Leben würde sie ihr Kind in diesem riesigen Katzenklo spielen lassen.
Sie lächelte: Sie war schon jetzt eine gute Mutter.
4
Die Trächtigkeit einer Elefantenkuh dauert zwei Jahre.
5
Jetzt ging es darum, nichts dem Zufall zu überlassen.
Brune beschloss deshalb, die Apotheke an der Ecke aufzusuchen. Sie war stolz auf sich, sie war auf dem richtigen Weg – auf dem Weg zu diesem Baby, das ihr seine Ärmchen entgegenstreckte. Ein leichtes Lächeln legte sich auf ihre Lippen. Das wissende Lächeln all derjenigen, die ihr Schicksal in die Hand nehmen.
In der Apotheke war es voll. Umso besser, so hatte sie Zeit, die Ecke mit den Kinderpflegeprodukten in Augenschein zu nehmen. Sie wollte diesen Moment genießen, in dem ihr Leben einen Sinn bekommen hatte. Sie fühlte sich wie ein kleines Mädchen, das ein Weihnachtsgeschenk auspacken möchte, vor Aufregung ganz zapplig und zugleich bereits ein kleines bisschen enttäuscht darüber ist, dass die Überraschung gleich vorbei sein wird. Sie verweilte bei den fluoridhaltigen Zahnpasten, nahm kurz einige der Cremes für atopische Haut in die Hand, kam an Halspastillen vorüber, um dann endlich ans Ziel zu gelangen. Sie hatte ihren Apotheken-Gral erreicht, beim Babysortiment hatte die Suche ein Ende.
Sie atmete den Geruch von Talkpuder und wohlduftenden Reinigungstüchern ein. Düfte, die ihr in absehbarer Zeit völlig vertraut sein würden, schließlich war sie schon so gut wie schwanger …
Bei den Milchpulvern, die mit Magnesium, Calcium und anderen Mineralstoffen angereichert waren, hielt sie inne und tat so, als würde sie zögern. Bald würde sie einen kleinen Mund füttern und ein kleines Händchen halten. Bald würde sie voller Stolz ihre dunklen Augenringe und Spuren von Erbrochenem auf der Schulter zur Schau tragen.
Ihr Blick fiel auf die Fieberthermometer. Brauchte sie eines? Welches sollte sie nehmen? Eines für die Stirn oder für das Ohr? Ein digitales oder ein klassisches? War das klassische mit Quecksilber nicht gefährlich? Wurde eine Bleivergiftung durch Blei oder durch Quecksilber verursacht? Hatte sie nicht vielleicht schon ein Thermometer zu Hause? Sie musste unbedingt eines haben!
Außerdem würde ihr Baby sich mit Sicherheit einen Schnupfen in der Kita oder der Schule einfangen. Gruppenhaltung war schließlich die schlimmste Quelle aller Krankheiten.
Als gute, verantwortungsvolle Mutter musste sie wissen, ob ihr Kind Fieber hatte oder nicht. Es gab Mütter, die sich auf ihren Instinkt verließen, die inkonsequent handelten oder ganz arglos lediglich eine Hand auf die glühende Stirn legten. Zu diesen unvorsichtigen Müttern zählte Brune jedoch nicht. Sie wollte Präzision und Kontrolle.
Sie griff nach zwei Thermometern und legte beide in den Korb, den sie vorsichtshalber am Eingang mitgenommen hatte. Schluss mit dem Herumtrödeln, jetzt war es an der Zeit, zur Sache zu kommen. Sie war mit einer sehr genauen Absicht hierhergekommen. Da durfte sie sich nicht ablenken lassen. Trotzdem schnappte sie im Vorbeigehen noch nach Schnullern, Fläschchen, Milchpulver, Lätzchen, Babylöffeln, Feuchttüchern, Wundcreme, Windeln, Flaschenbürste, Desinfektionsmittel, Beißring, Talkpuder und einem wunderhübschen kleinen Flakon mit einem Babyduft in Form eines Bärchens. Ihr Korb war randvoll, als sie sich an einen Apotheker wandte und fragte:
»Wo bitte sind die Ovulations- und Schwangerschaftstests?«
»Rechts, gleich neben den Sonnencremes.«
Brune war enttäuscht, dass der Apotheker ihre Begeisterung nicht teilte, bedankte sich aber als Dame von Welt trotzdem bei ihm für die Auskunft.
Sie nahm jetzt Kurs auf das eigentliche Ziel dieses Ausflugs ins Land der allumfassenden pädiatrisch-pharmazeutischen Wunderdinge. Es gab eine beeindruckende Anzahl von Modellen, deren Anzeige von einem diskreten blauen Strich, der die so ersehnte Phase ankündigte, bis zum höchst befremdlichen violetten Teddybär reichten. Brune hatte keine Lust auf Plüschtiere, sie vertraute dem violetten Teddy nicht. Bei solchen Produkten versteckte sich hinter einem einfallsreichen Äußeren oft eine mangelhafte Ausführung.
Sie wählte den ersten Test und platzierte ihn vorsichtig in ihrem Korb: Sie wollte unbedingt verhindern, dass ausgerechnet jener Gegenstand Schaden nahm, der ihr die Vorzeichen ihrer Schwangerschaft anzeigen würde.
Anschließend begutachtete sie die Schwangerschaftstests. Auch hier gab es eine große Bandbreite an Ausführungen. Eine Wahl zu treffen war für Brune von jeher eine Qual gewesen. Welchen sollte sie kaufen? Manche Tests rühmten sich damit, auch das Geschlecht des Kindes anzuzeigen. Ein rosa Strich für ein Mädchen, ein blauer für einen Jungen. Suspekt. Und für Anhänger der Genderdebatte ein wahres Fest.
Sie war noch nicht einmal schwanger, und schon ahnte sie, wie schwierig die Verantwortung eines alleinerziehenden Elternteils werden könnte. Es gab so viele Entscheidungen, die man allein treffen musste …
Brune gab der Zuverlässigkeit des gewöhnlichen Tests den Vorzug vor der Originalität der neuartigen Ausführung. Ihr Vorgehen war für sich genommen bereits ungewöhnlich genug.
Zufrieden bewegte sie sich in Richtung Kasse, wo sie stolz den Inhalt ihres Korbs aufs Laufband packte.
Zwischen zwei Scans von Fläschchen, Windeln und Schnullern fragte die Apothekerin:
»Wann ist es denn so weit?«
Brune lächelte.
»Bald.«
6
Wieder zu Hause räumte Brune ihre Einkäufe sorgsam weg und kochte sich einen Kräutertee, um dann ihre Erkundigungen über die Klinik fortzusetzen. Mochte das Internet auch lügen, es lieferte doch eine beeindruckende Menge an Informationen. Eine Klinik mit dem Namen CryoBaby gab es tatsächlich. Brune hatte die angegebene Adresse in Street View gesucht, um sich Fotos vom Eingangsbereich anzusehen.
Der Gebäudekomplex sah nicht sehr einladend aus. Rote Backsteine, ungefähr sechs Etagen, im Erdgeschoss ein Supermarkt. Ein Supermarkt für Babys? Wie großartig war das denn! In Dänemark waren sie den anderen Ländern wirklich um einiges voraus. Beim Heranzoomen der Aufnahme waren dann allerdings enttäuschende Konservendosen und Brotpackungen zu erkennen. Ganz offensichtlich war das ein absolut gewöhnlicher Supermarkt.
Die Klinik befand sich vermutlich in den darüberliegenden Stockwerken oder in einem Hintergebäude. Die zukünftige Mutter sah bereits vor sich, wie sie mit flachem Bauch durch einen begrünten Innenhof schritt, von einer freundlichen Krankenschwester im rosa Kittel empfangen wurde und mit einem leicht gewölbten Bauch wieder davonging.
Schluss mit den Träumen! Sie durfte sich jetzt nicht in Schwärmereien verlieren. Vielmehr galt es nachzuforschen, zu überprüfen, infrage zu stellen und auf der Hut zu sein. Sie musste sich Laura Ashley aus dem Kopf schlagen und Hercule Poirot hereinbitten.
Die Klinik lag drei Fährstunden von der Hauptstadt Kopenhagen entfernt. Eine kleine Kreuzfahrt, bei der ihr Haar im Wind wehen würde, während sie zwischen all den dänischen Inseln entlangschipperte …
Brune biss sich auf die Lippen. Sie musste konzentriert bleiben, vor allem aber auf der Hut sein. Hercule Poirot war kein Mann der Kreuzfahrten. Außer in Tod auf dem Nil, aber das war eine Ausnahme.
Warum war die Klinik nicht in Kopenhagen? Die besten medizinischen Zentren finden sich doch meistens in den Hauptstädten. Sie hielt diese Überlegung in ihrem kleinen Notizbuch fest. Stolz auf diesen neuartigen inquisitorischen Blick setzte sie ihre Untersuchungen fort.
Nach dem Ort widmete sie sich der Methode. Sie musste sich ein genaues Bild von den Abläufen in der Klinik verschaffen. Natürlich fand sie es schade, mittels einer Spritze schwanger zu werden. Sie hatte immer geglaubt, dass ihr Baby die Frucht einer bedingungslosen Liebe zwischen ihr und einem guten, sanften, intelligenten, lustigen und freundlichen Mann sein würde. Im Radio einen Song hören, sich zu dem Lebensgefährten umwenden, einen verschworenen Blick mit ihm tauschen in dem Wissen, dass bei genau diesem Song das perfekte Baby gezeugt worden war.
Es würde schwierig werden, dem Kind zu erklären, warum es keinen Papa hatte. Sollte sie es anlügen? Ihm sagen, dass sein Vater ein für das Vaterland gestorbener Held war? Ein Feuerwehrmann? Ein in Amazonien verschollener Forscher? Ein Astronaut auf interstellarer Langzeitmission? Wie der berühmte Raumfahrer Thomas Pesquet?
Nein, sie konnte ihr Kind nicht belügen, auch wenn Eltern das bei allen möglichen Gelegenheiten taten, allein schon, um ihre Kleinen zu schützen. Gibt es den Weihnachtsmann denn überhaupt? Ja. Kommt die Zahnfee wirklich? Aber natürlich. War der Osterhase schon da? Ganz sicher. Ist Thomas Pesquet mein Papa? Nein. Wer ist denn dann mein Papa? Ein Reagenzglas.
Brune schüttelte den Kopf. Es war vollkommen unnütz, derlei Probleme zu wälzen, zumindest jetzt. Sie musste auf ihr Ziel fokussiert bleiben, sonst würde sie nie zur Tat schreiten. Anschließend hätte sie neun Monate Zeit, um Antworten auf all diese Fragen zu finden.
Sie vertiefte sich erneut in die Internetseite der Klinik und klickte auf den Reiter »Unsere Methode«. Zum Glück gab es eine Übersetzung ins Französische. Die machten das wirklich gut, diese Dänen. Ihr Kind würde von Anfang an polyglott sein!
Hier kam man zum Kern der Sache. Es ging um »Motilität«, »Stickstoff«, »Fertilisation« … Unheimliche und deprimierende Worte! Viel zu biologisch, viel zu technokratisch. Wie schön wäre es, wenn die Babys einfach vom Storch gebracht würden. Wer diese Idee gehabt hatte, war ein Genie. Vielleicht sogar ein Däne …
Brune war es jetzt schon leid. Wut packte sie. Warum musste sie die Abläufe einer gelungenen Fertilisation auswendig lernen, während das erstbeste Dummchen mal eben schwanger wurde? Stellten sich denn Paare, die ein Kind zeugten, Fragen über »Motilität« oder Ähnliches? Sie hatte noch gar kein Kind, aber schon jetzt spürte sie ein enormes Gewicht auf ihren einsamen Schultern lasten.
Justine platzte ins Zimmer.
»Er ist depressiv!«
»Wer?«
»Askur!«
»Wer?«
»Dein Spender.«
»Aha!« Brune seufzte.
Sie war erstaunt, dass ihre Freundin den Namen des jungen Mannes behalten hatte, den sie doch rein zufällig auf der Seite angeklickt hatten.
»Woher willst du das wissen?«
»Ich habe mich über Dänemark informiert. Es zählt zu den Ländern mit den höchsten Selbstmordraten weltweit.«
»Ich glaube nicht, dass ein suizidaler Charakter vererbt wird.«
Justine zog ein schiefes Gesicht.
»Willst du ein Baby, das die ganze Zeit einen Flunsch zieht? Das nie zufrieden ist, ständig herumheult und dabei apathisch ist?«
Brune war nicht wirklich überzeugt und gab zu bedenken:
»Ich würde eher sagen, dass das Tageslicht eine große Rolle spielt. Es regnet dort häufig, und die Sonnenstrahlung im Winter ist schwach. Das wird sich auf die Psyche auswirken.«
Sie zuckte mit den Schultern und fuhr fort:
»Ich werde mein Baby hier in Frankreich großziehen. Es besteht also keinerlei Gefahr.«
Justine hob warnend den Finger.
»Baby Askur wird depressiv sein, ich sage es dir!«
Brune musste lachen. »Baby Askur« – diese Worte aus dem Mund ihrer Freundin zu hören gefiel ihr irgendwie.
»Seltsam, ich habe gelesen, dass Dänemark eines der glücklichsten Länder weltweit ist.«
Das reichte keineswegs aus, um Justine, die sich bereits auf dem Sofa niedergelassen hatte, in ihrer Argumentation zu erschüttern.
»Vielleicht sind sie so glücklich, dass sie sich umbringen.«
Brune stand auf, um sich einen Keks aus der Küche zu holen.
»Das ist doch Blödsinn.«
Justine ging ihr nach.
»Keineswegs! Die Dänen sind so erfüllt von ihrem Dasein, dass sie nichts mehr vom Leben erwarten. Wahrscheinlich wird sich Baby Askur zu einer blasierten Person entwickeln.«
Die zukünftige Mutter eines depressiven Kindes griff nach einer Dose süßer Leckereien.
»Eine Überdosis Glück – da gibt es in meinen Augen aber Schlimmeres. Außerdem wird das Baby in Frankreich geboren, da ist es wichtig, dass es mental gut drauf ist.«
Justine zuckte mit den Schultern und nahm ihr die Dose ab, um ihr stattdessen getrocknete Biofrüchte zu reichen.
»Das stimmt allerdings – angesichts der Verschuldung des Staates, der Erderwärmung, der landwirtschaftlichen Übernutzung, der gentechnisch veränderten Organismen, der schädigenden hormonaktiven Substanzen, der krebserregenden Auswirkungen der neuen Technologien, der Arbeitslosigkeit, der sinkenden Kaufkraft, der Luftverschmutzung durch Feinstaub …«
Brune runzelte die Stirn, nicht nur wegen des idyllischen Bilds, das die Aktivistin entwarf, sondern auch wegen des Snacks, den sie ihr anbot.
»Wow, du bist ja echt eine Stimmungskanone! Du wirst seine liebe Depri-Tante sein.«
Justine schien nichts gehört zu haben. Sie hing ihren Gedanken nach.
»Anstatt ein weiteres unglückliches Geschöpf in diese übervölkerte und ausgebeutete Erde zu setzen, könntest du doch ein schon jetzt unglückliches Kind retten, oder?«
»Meinst du etwa eine Adoption?«
»Ja, genau.«
»Du verstehst es wirklich, meinen Träumen auf die Sprünge zu helfen«, beschwerte sich Brune und malte Anführungszeichen in die Luft, als sie noch rasch hinterherschob: »Da steckt ganz schön viel ›Unglück‹ in deinem Satz.«
Justine stopfte sich eine getrocknete Aprikose in den Mund.
»Es gibt so viele Kinder ohne Eltern, warum willst du da noch ein weiteres in die Welt setzen? Pedro und ich werden es auf jeden Fall so machen, sollten wir uns jemals für ein Kind entscheiden.«
Brune ließ die verschrumpelten, zähen Früchte liegen und nahm eine Tafel Schokolade in Angriff.
»Du kannst mit deinem Freund am anderen Ende der Welt tun und lassen, was du willst. Aber ich habe keine Zeit, noch zehn Jahre zu warten, bis irgendeine obskure Kommission entscheidet, ob eine ledige Frau ein Kind adoptieren darf oder nicht.«
Sie wartete ab, bis der süße Kakao ihren hochkochenden Ärger ein wenig besänftigt hatte, bevor sie fortfuhr:
»Ich bin ja durchaus deiner Meinung und würde diesen armen Waisenkindern auch gern helfen. Vielleicht werde ich tatsächlich einen Adoptionsantrag stellen, wenn ich erst einmal Baby Askur habe.«
»Warum hast du es denn so eilig? Du bist jung und hast noch Zeit.«
Brune seufzte.