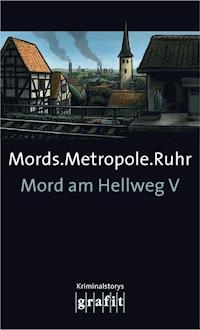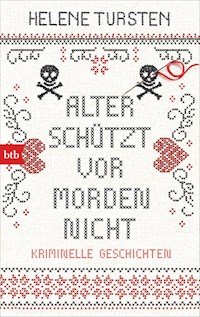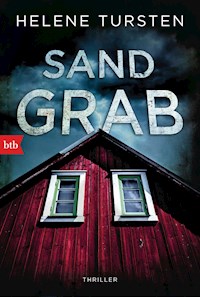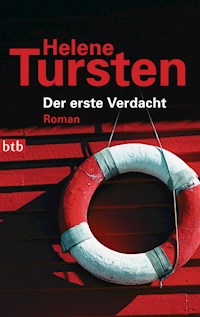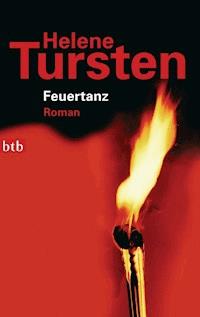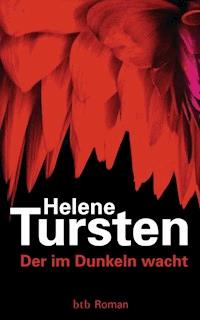6,99 €
Mehr erfahren.
Eine Frau auf der Flucht vor ihrem Mann, der sie augenscheinlich misshandelt. Bevor sie ausziehen kann, stürzt sie auf der Treppe ihres Einfamilienhauses zu Tode. Ein klarer Fall, oder? Ein junges Paar, das sich auf der Hochzeitsreise verfährt und schließlich bei einem einsam gelegenen Hof und dessen mysteriöser Besitzerin landet. Ein Witwer, vor dessen Tür plötzlich zwei Rettungssanitäter stehen, die er nicht bestellt hat. Zehn unheimliche Geschichten und eine Inspektor-Irene-Huss-Erzählung hat btb-Bestsellerautorin Helene Tursten in diesem Buch versammelt: höchst spannend und voller Raffinesse.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 193
Ähnliche
Buch
Eine Frau auf der Flucht vor ihrem Mann, der sie augenscheinlich misshandelt. Bevor sie ausziehen kann, stürzt sie auf der Treppe ihres Einfamilienhauses zu Tode. Ein klarer Fall, oder? Ein junges Paar, das sich auf der Hochzeitsreise verfährt und schließlich bei einem einsam gelegenen Hof und dessen mysteriöser Besitzerin landet. Ein Witwer, vor dessen Tür plötzlich zwei Rettungssanitäter stehen, die er nicht bestellt hat. Zehn unheimliche Geschichten und eine Inspektor-Irene-Huss-Erzählung hat btb-Bestsellerautorin Helene Tursten in diesem Buch versammelt: höchst spannend und voller Raffinesse.
Autorin
Helene Tursten wurde 1954 in Göteborg geboren und arbeitete selbst lange Jahre als Krankenschwester. Deutschen Leserinnen und Lesern ist sie vor allem durch ihre Irene-Huss-Kriminalromane bekannt.
DEM ANDENKEN MEINER ELTERN
Liebe Leserinnen und liebe Leser!
Vermutlich wissen nicht viele von meinem Hobby. Ich sammle Gespenstergeschichten.
Am liebsten solche, die jemand selbst erlebt hat. Ich schreibe sie immer genau so nieder, wie sie mir erzählt wurden. Einige der Geschichten spielen im Krankenhaus, denn sie wurden mir in den Jahren zugetragen, in denen ich als Krankenschwester gearbeitet habe.
Eine besonders lange Erzählung handelt von der Kriminalinspektorin Irene Huss.
Dass Sie eine richtige Gänsehaut bekommen, wünscht Ihnen
Ihre
Helene Tursten
Inhaltsverzeichnis
Die Frau im Fahrstuhl I
Aus meinen vielen Jahren als Krankenschwester habe ich unzählige Erinnerungen. Gewisse Episoden sind lustig, andere traurig. Aber es gibt eine Erinnerung, die mich niemals losgelassen hat. Sie begleitet mich jetzt schon seit fast fünfzig Jahren.
Bevor ich die Schwesternschule besuchte, arbeitete ich ein Jahr nachts als Schwesternhelferin. Ich dankte dem Schicksal, das mir eine langfristige Vertretung in der neu gebauten und gut ausgestatteten Hautklinik des Sahlgrenska Krankenhauses beschert hatte.
Wir waren zu dritt im Nachtdienst, die Krankenschwester Ellen, die Schwesternhelferin Marianne und ich. Wir waren ungefähr im selben Alter, und von Anfang an verstanden wir uns gut. Mein Dienst begann im August. Bereits nach ein paar Nächten fiel mir auf, dass Schwester Ellen und Marianne tuschelnd in die schwarze Augustnacht starrten. Ich hörte nur Fetzen:
»Jetzt ist bald Vollmond ...«
»Sie kommt sicher dieses Mal auch ...«
Schließlich konnte ich meine Neugier nicht länger bezwingen, sondern fragte, was es da zu tuscheln gab.
Meine Kolleginnen sahen sich an und nickten sich dann zu. Schwester Ellen ergriff das Wort:
»Ein Jahr nach Eröffnung der Klinik fiel uns Nachtschwestern auf, dass sich bei Vollmond seltsame Dinge ereigneten. Genau um Mitternacht fährt der Fahrstuhl ins oberste Stockwerk.«
»Aber da oben ist doch nur die Verwaltung. Dort arbeitet doch niemand mitten in der Nacht! Und außerdem ist dort dann abgeschlossen«, wandte ich ein.
Schwester Ellen nickte viel sagend.
»Genau. Aber wenn der Fahrstuhl wieder nach unten kommt, steht eine Frau darin. Sie ist vielleicht ein paar Jahre älter als ich. Sehr hübsch gekleidet. Seltsam ist nur, dass sie immer dieselben Kleider trägt.«
»Hast du sie mit eigenen Augen gesehen?«, fragte ich.
»Klar. Mehrmals. Nächstes Mal, wenn wir wieder Dienst haben, ist Vollmond. Dann stellen wir uns in den Korridor und schauen sie uns an.«
Damit war das entschieden.
Es war spannend und etwas kribbelig, kurz vor Mitternacht im dunklen Treppenhaus zu stehen. Der Vollmond schien durchs Fenster, und die Treppenstufen badeten in seinem kalten Licht. Vor der Fahrstuhltür war es jedoch vollkommen dunkel. Dort standen wir zu dritt, die Köpfe dicht an dicht vor dem schmalen schwarzen Fahrstuhlfenster.
Kurz vor der zwölften Stunde glitt der leere Aufzug auf dem Weg nach oben an dem Fenster vorbei. Schwester Ellen drückte immer wieder auf den Knopf, aber der Fahrstuhl fuhr einfach weiter.
Der leuchtende Pfeil, der anzeigte, dass sich der Aufzug auf dem Weg nach oben befand, erlosch. Fast unverzüglich leuchtete der Abwärtspfeil auf. Meine Spannung nahm zu, als ich hörte, wie sich der Fahrstuhl unserem Stockwerk näherte.
Als Erstes sah ich ein Paar schwarze, funkelnde, spitze Damenschuhe mit wahnsinnig hohen Pfennigabsätzen. Dann kamen ein Paar schlanke Unterschenkel in Nylonstrümpfen. Auf Kniehöhe begann der Rocksaum. Der Rock war eng und gerade geschnitten und aus einem grob gewebten, tannengrünen Stoff. Mit ihren Händen, die in schwarzen Handschuhen steckten, presste die Frau eine schwarze Lederhandtasche gegen die Oberschenkel. Ihre Kostümjacke mit den blitzenden Goldknöpfen reichte ihr knapp bis zur Taille. Zu dem Kostüm trug sie eine weiße Bluse und eine Bernsteinkette. Ihre rot geschminkten Lippen in ihrem bleichen Gesicht waren vollkommen bewegungslos. Sie war sehr ernst und sah uns durch eine Brille, Modell Fünfzigerjahre, an. Das grüne Gestell passte zu dem eleganten Kostüm. Sie stand so da, dass sie durch das Fenster in der Fahrstuhltür deutlich zu sehen war. Ihr kupferrotes Haar glänzte im Licht des Aufzugs. Sie trug einen ordentlichen Pagenschnitt. Wäre ihr Gesichtsausdruck nicht so nichts sagend gewesen, hätte man sie als eine strahlende Schönheit bezeichnen können.
Der Fahrstuhl verschwand nach unten, und im Fenster der Fahrstuhltür wurde es wieder schwarz. Niemand von uns sagte etwas. Schweigend kehrten wir auf die Station zurück und begaben uns in die kleine Küche. Ellen stellte Tassen auf den Tisch und goss aus einer Thermoskanne Kaffee ein. Erst dann sagte sie:
»Na, was hältst du von der Dame im Fahrstuhl?«
»Ehrlich gesagt weiß ich das nicht«, entgegnete ich.
Sowohl Marianne als auch Ellen starrten mich an, als erwarteten sie eine schlüssigere Antwort. Da mir jedoch nichts weiter dazu einfiel, meinte Schwester Ellen:
»Ich finde es merkwürdig, dass sie immer zur gleichen Zeit auftaucht und immer dieselben Kleider trägt. Der Aufzug bleibt nicht stehen, obwohl man den Knopf drückt. An ihrem Aussehen hat sich nichts verändert, seit wir sie zum ersten Mal gesehen haben. Sie steht immer in derselben Positur da und hat dieselbe Frisur und dieselbe ausdruckslose Miene ... alles ist immer genau gleich!«
In der Küche trat eine lange Stille ein, und ein kalter Schauer lief mir den Rücken hinunter.
Die Dame im Fahrstuhl war geheimnisvoll, und sie machte mir Angst.
Im folgenden Monat sprachen wir oft über die Fahrstuhlfrau. Wir konnten uns nicht darüber einigen, was die geheimnisvolle Frau wohl für Anliegen und Absichten haben mochte, wollten das Rätsel aber gemeinsam lösen. Als es nur noch wenige Nächte bis zum nächsten Vollmond waren, hatten wir einen Plan ausgearbeitet.
Es war eine schöne Vollmondnacht. Die Temperatur betrug einige Grade unter null, und der Mond schien durchdringend von einem wolkenlosen Himmel.
Kurz vor zwölf traten wir ins Treppenhaus und stellten uns so auf, wie wir es abgesprochen hatten. Marianne hielt einen kleinen Hammer in der Hand und hatte sich neben dem Notschalter aufgebaut. Ihre Aufgabe war es, das Glas zu zerschlagen und den Knopf zu drücken, sobald sich die Frau auf unserem Stockwerk befand. Ich selbst hielt den Griff der Fahrstuhltür mit meiner schweißnassen Hand umklammert. Wenn der Fahrstuhl zum Stillstand kam, war es meine Aufgabe, die Tür aufzureißen. Schwester Ellen stand direkt vor dem Aufzug. Sie wollte die Frau ansprechen und ausfragen.
Nervös überlegte ich mir, ob man das wirklich tun durfte. Hatte die Frau nicht jedes Recht dazu, wann und wo immer sie wollte, Fahrstuhl zu fahren? Ich wurde aus meinen Überlegungen gerissen, als der Lift auf dem Weg zum obersten Stockwerk vorbeifuhr.
Als der Abwärtspfeil aufleuchtete, hob Marianne den Arm. Sie stand bereit, das Glas zu zerschlagen. Ich spannte jeden Muskel an, um die Tür aufzureißen, wenn der Lift stehen blieb. Schwester Ellen räusperte sich nervös in der Dunkelheit.
Jetzt sah ich die Schuhe mit den hohen Absätzen. Dann kamen ihre Schienbeine, der Rocksaum, die Handtasche. Marianne holte zum Schlag aus.
Da ging auf einmal auf unserer Station der Alarm los.
Alle, die jemals im Krankenhaus gearbeitet haben, wissen, dass man dann alles stehen und liegen lässt.
Es ist ein Reflex. Bei Herzstillstand können ein paar Sekunden den Unterschied zwischen Leben und Tod bedeuten.
Wir drei am Fahrstuhl zuckten zusammen. Erst trauten wir unseren Ohren nicht. Alarm! Eine Sekunde später rannten wir bereits auf die Station. Die Lampe über der Tür eines Patientenzimmers ganz hinten am Gang blinkte. Wir rannten, so schnell wir konnten. Das Zimmer war nur mit einem Patienten belegt, einem Fünfunddreißigjährigen mit schwerer Psoriasis.
Als wir die Tür aufrissen, lag er bleich vor uns. Er hatte keinen Puls mehr. Schwester Ellen warf sich über den Patienten und begann mit der Herzmassage. Ohne auch nur eine Sekunde zu zögern, machte Marianne Mund-zu-Mund-Beatmung. Nach nur einem Atemstoß und einigen kräftigen Stößen auf den Brustkorb erwachte der Patient wieder zum Leben. Ellen bat mich, den Dienst habenden Arzt zu rufen. Ich rannte ins Schwesternzimmer und piepste ihn an.
Nach nur wenigen Minuten hörten wir schon die eiligen Schritte des Arztes auf der Station. Er wirkte verschlafen, seine Haare waren verstrubbelt, und sein Kittel war falsch zugeknöpft. Es war einer der jüngeren Assistenzärzte. Mich beschlich ein Verdacht: Hatte sich unsere Rothaarige oben in der Verwaltung mit ihm getroffen? Als ich länger darüber nachdachte, erkannte ich, dass es so nicht gewesen sein konnte, denn er arbeitete erst seit weniger als einem Monat bei uns.
Der Arzt war sich unschlüssig und beriet sich lange mit dem Kollegen von der Inneren. Schließlich wurde entschieden, den Mann auf die kardiologische Intensivstation zu verlegen, um ihn dort eingehender zu untersuchen. Dort sollte er dann einige Stunden zur Beobachtung bleiben.
Deswegen dauerte es auch bis zur nächsten Nacht, bis der Patient uns erzählen konnte, was vorgefallen war.
Wir drei saßen in der Küche und tranken Kaffee. Plötzlich klopfte es schüchtern. Der Mann, der in der Nacht zuvor den Herzstillstand gehabt hatte, stand in der Tür. Verlegen sagte er:
»Ich kann nicht schlafen nach dem, was gestern vorgefallen ist, und habe den Kaffee gerochen. Ich dachte, dass ich von Ihnen vielleicht einen Schluck bekommen kann?«
»Natürlich«, erwiderte Schwester Ellen.
Wir gaben ihm eine Tasse, aber er blieb in der Tür stehen. Unentschlossen wippte er auf seinen karierten Filzpantoffeln. Es schien, als ob er etwas ganz anderes wollte.
»Darf ich meinen Kaffee vielleicht bei Ihnen trinken?«, fragte er vorsichtig.
Sein Blick war so flehend, dass Schwester Ellen ihm das gestattete, obwohl es eigentlich gegen die Regeln verstieß.
Der Patient setzte sich. Geistesabwesend rührte er in seiner Tasse, den Blick auf das Dunkel der Nacht jenseits des Fensters gerichtet. Ein feiner Nieselregen prasselte gegen das Fenster.
»Ich muss mit Ihnen reden. Es war so merkwürdig gestern, als ... das passierte«, sagte er schließlich.
»Wir sind mit unserer Arbeit fertig, und die anderen Patienten schlafen. Wir haben Zeit zum Zuhören. Erzählen Sie ruhig«, meinte Schwester Ellen.
Der Mann lächelte sie dankbar an.
»Ich lag im Bett und las, weil ich nicht schlafen konnte. Der Ausschlag juckte so. Vielleicht hatte ich auch leichtes Fieber ... Ich weiß es nicht. Kurz gesagt ging es mir nicht gut. Aber das Buch war wahnsinnig spannend, und ich war ganz darin vertieft, als mir plötzlich bewusst wurde, dass jemand im Zimmer stand. Ich schaute auf und sah eine Frau nur etwa einen Meter von meinem Bett entfernt. Sie war grün gekleidet und trug eine Brille. Sie war ... fein angezogen, fand ich.«
»War sie rothaarig?«, unterbrach ihn Marianne.
Der Mann nickte.
»Schönes dunkelrotes Haar. Pagenkopf«, sagte er. »Ich hatte keine Gelegenheit, mit ihr zu reden. Plötzlich lag so etwas wie dunkler Nebel im Zimmer. Um mich herum wurde es immer dunkler, aber die ganze Zeit hörte ich ihre beruhigende Stimme und bekam es wohl nie mit der Angst zu tun. Die Frau sprach in der Dunkelheit zu mir.«
Er verstummte und sah uns verlegen an. Wir hörten aufmerksam zu, und niemand schien an seinen Worten zu zweifeln.
»Ehe ich bewusstlos wurde, sah ich noch, wie sie die Hand ausstreckte und den Alarmknopf drückte. Seltsamerweise erinnere ich mich ganz deutlich, dass sie schwarze Handschuhe trug und dass eine schwarze Handtasche von ihrem Handgelenk baumelte. Dann erinnere ich mich an nichts mehr, bis ich wieder erwachte und Sie alle sich an mir zu schaffen machten.«
In der Küche wurde es ganz still, als er seine Geschichte beendet hatte. Schwester Ellen gewann als Erste die Fassung wieder. Mit so viel Autorität und Ruhe, wie sie aufbringen konnte, sagte sie:
»Sicher hatten Sie Fieberträume, bevor Sie in Ohnmacht fielen. Die Halluzination lässt sich durch Sauerstoffmangel erklären.«
Ich ertappte mich dabei, dass ich zustimmend nickte. Schließlich konnten wir dem Mann nicht von der Frau im Fahrstuhl erzählen! Es war besser, ihm einzureden, er habe an einer Fieberfantasie gelitten.
Als er in sein Zimmer zurückgekehrt war, einigten wir uns darauf, nie wieder zu versuchen, den Fahrstuhl anzuhalten. Die Frau sollte ihre Ausflüge bei Vollmond nach Belieben fortsetzen können.
Und das tat sie dann auch.
Die Erbin des Wirtshauses
Ende der dreißiger Jahre trat meine Großmutter auf dem Jahrmarkt als Zigeunerin namens Madame Roza auf. Akuter Geldmangel zwang sie dazu. Sie war Witwe geworden und hatte zwei kleine Kinder. Sie konnte aus der Hand lesen. Offenbar war sie sehr talentiert, denn die Leute drängten sich in ihrem Zelt. Im Laufe der Zeit gelangte sie mit ihrer Wahrsagerei zu relativem Wohlstand und wurde Teilhaberin einer Bonbonfabrik, die erkleckliche Gewinne abwarf. Am besten verkauften sich »Rozas Ingwerpastillen gegen Heiserkeit und Erkältung«. In den frühen siebziger Jahren verkaufte Großmutter ihren Anteil an der Fabrik und zog sich in ihrem zentral in Umeå gelegenen Haus aufs Altenteil zurück.
Von Letzterem erzählt meine Mutter mit Vorliebe. Davon, dass Großmutter früher Weissagerin war und sich als Zigeunerin ausgab, will sie jedoch nichts wissen.
»Alles üble Nachrede. Dafür gibt es keinerlei Anhaltspunkte!«, faucht meine Mutter immer dann, wenn die Rede darauf kommt, und presst die Lippen zusammen. Sie hat’s gerne ein wenig vornehm.
Größere Sensibilität für die Geisterwelt hat sie nie an den Tag gelegt. Dafür ist sie viel zu erdverbunden. Bei näherem Nachdenken würde sie sich allerdings eingestehen müssen, dass Großmutters Vermögen, das Mutters Bruder und sie freudig in Reisen, große Autos und Häuser umgesetzt haben, aus dem Jahrmarktszelt stammt, in dem Roza aus der Hand gelesen hat.
Großmutter besaß das zweite Gesicht. In ihrem kleinen Zelt stand sie in Kontakt mit dem Jenseits. Deswegen trafen ihre Vorhersagen immer ein. Das hat sie meiner Schwester Marie und mir mehrfach erzählt.
Meine Schwester und ich haben Großmutters Gabe geerbt, obwohl wir sie im Gegensatz zu ihr nicht so weiterentwickelt haben. Wir sehen und spüren Dinge, können aber nicht die Zukunft vorhersagen.
Ob diese Gabe eher ein Geschenk oder eine Strafe ist? Ein fantastisches Talent oder eine Plage? Beides, würde ich sagen. Urteilen Sie selbst! Die folgende Erzählung handelt davon, was meine Schwester und ich bei einem gemeinsamen Urlaub vor fast sechzehn Jahren erlebten.
In diesem Sommer mieteten unsere Familien zusammen ein Haus auf Gotland. Mein Mann Olof und ich hatten zwei Sommer hintereinander Fahrradurlaub auf der Insel gemacht, aber Marie und Lasse waren noch nie dort gewesen.
»Die falsche Seite von Schweden«, pflegte mein Schwager zu sagen.
Typisch Göteborger! Schließlich ließ Lasse sich aber doch dazu überreden, seine Ferien an der exotischen Ostküste zu verbringen. Über das Fremdenverkehrsamt mieteten wir das Obergeschoss des Gasthofes in Ljugarn.
Meine Tochter Cecilia war damals drei Jahre alt und ihre Cousinen Karin und Sara zwei Jahre sowie drei Monate.
Mit diesen drei jungen Damen und zwei voll gepackten Autos brachen wir in der ersten Juliwoche Richtung Gotland auf.
Nach einer anstrengenden Reise – die Fähre war überfüllt und glich einem Sklavenschiff – trafen wir in Visby ein. Es regnete in Strömen, und wir erfuhren, dass es in Roma im Inneren der Insel geschneit hatte! So hatten wir uns den Auftakt unserer Ferien nicht vorgestellt.
Am Spätabend trafen wir in Ljugarn ein. Immer noch war es feucht und kühl, aber es regnete nicht mehr. Wir fanden den Gasthof problemlos. Er lag am Meer, und zwischen Haus und Strand führte nur ein schmaler Weg entlang.
Ich klopfte an die Haustür, und nach einer Weile öffnete mir ein magerer älterer Mann. Abweisend starrte er mich durch den Türspalt an. Ich brachte unser Anliegen vor. Woraufhin er die Tür wieder schloss. Ich hörte ihn in Pantoffeln herumschlurfen. Es kam mir wie eine Ewigkeit vor, bis sich die Türe wieder öffnete. Unser mürrischer Gastgeber reichte uns den Schlüssel durch den Türspalt und murmelte, wir würden uns hoffentlich wohl fühlen.
Durch eine altertümliche, geräumige Glasveranda, die als Küche diente, betraten wir das Haus. Zwei Kochplatten, ein uralter, winziger und laut brummender Kühlschrank, ein wackliger Campingtisch mit fünf Klappstühlen und ein Hängeschrank voll mit angeschlagenem Porzellan bildeten die Einrichtung. Ein großer gelber Plastikeimer für Brunnenwasser und eine kleine Plastikschüssel zum Spülen vervollständigten sie. Sehnsüchtig dachte ich an meine große Küche zu Hause.
Hinter der Veranda führte eine Treppe ins Obergeschoss. Die Treppe mündete auf eine große, unmöblierte Diele mit mehreren Türen, von denen eine, die nicht richtig schloss, auf einen Balkon zum Meer führte. Schon allein die Aussicht war die Miete wert. Er sah allerdings so baufällig aus, dass man ihn wahrscheinlich nicht betreten konnte. Von der Diele ging auch eine kleine Toilette mit Waschbecken ab. Neben der Toilette war eine verschlossene Tür, die wohl auf einen Gang führte. Da das Haus sehr groß war, lagen dahinter vermutlich viele Zimmer. Diese wurden aber offenbar nicht vermietet. Während der zwei Wochen, die wir hier wohnten, waren wir die einzigen Mieter im Haus.
Unsere beiden Schlafzimmer waren so groß wie normale Wohnzimmer. Die alten Möbel schienen direkt aus einem Antiquitätengeschäft zu kommen. Dunkle Hölzer, roter Samt und Stoffe mit düsteren, grünlichen Blumenmustern dominierten. In jedem Zimmer standen drei Betten, ebenfalls sehr alt, aber beim Probeliegen fand ich meines erstaunlich bequem. Ich hätte gern die Augen geschlossen und wäre auf der Stelle eingeschlafen, aber die Kinder waren aus ihrem Schlummer erwacht und hungrig. Wir schleppten unsere Siebensachen nach oben und stellten gleichzeitig Brei auf den Zweiplattenherd in der eiskalten Küche in der Glasveranda. Nach einer chaotischen Stunde lagen die Kinder schließlich im Bett. Erschöpft ließen wir uns auf die wackligen Stühle am Campingtisch sinken, um ein Bier zu trinken und eine Kleinigkeit zu essen, ehe wir selbst in die Falle gingen.
ENDE DER LESEPROBE
Die schwedische Originalausgabe erschien 2003 unter dem Titel »Kvinnen i hissen« bei AlfabetaAnamma, Stockholm.
Der btb-Verlag ist ein Unternehmen der Verlagsgruppe Random House.
1. Auflage Genehmigte Erstveröffentlichung November 2004 Copyright © 2003 by Helene Tursten Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2003 by Verlagsgruppe Random House GmbH, München. Published by agreement with AlfabetaAnamma, Stockholm, und Leonhardt & Høier Literary Agency, Copenhagen. Umschlaggestaltung: Design Team München Umschlagfoto: Ute Klaphake Satz: IBV Satz- und Datentechnik GmbH, Berlin RK · Herstellung: Augustin Wiesbeck
eISBN 978-3-641-17033-2
www.btb-verlag.de
www.randomhouse.de