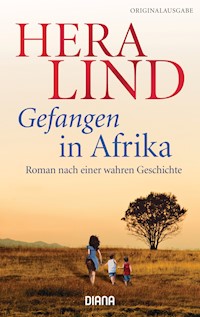10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diana Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die junge Ella erfährt mit brutaler Härte, was es heißt, nach 1945 als Tochter einer Deutschen in der Tschechoslowakei aufzuwachsen. Revolutionsgarden erschlagen ihren Vater, die Mutter muss sich mit ihrem neugeborenen Sohn in einem tschechischen Dorf verstecken. Ella erträgt immer neue Schicksalsschläge: Klosterschule, Kommunismus, die Ehe mit einem Egozentriker, Psychiatrie – bis sie endlich in Prag der großen Liebe begegnet. Mit dem jüdischen Arzt Milan ist sie zum ersten Mal glücklich. Beide haben nur noch einen Wunsch: zusammen mit Ellas kleiner Tochter in den Westen fliehen. Doch der Geheimdienst ist ihnen dicht auf den Fersen …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 491
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
ZUMBUCH
Als Zwölfjährige erfährt Ella mit brutaler Härte, was es heißt, nach 1945 als Tochter einer Deutschen in der Tschechoslowakei aufzuwachsen. Revolutionsgarden erschlagen ihren Vater, die Mutter muss sich mit ihrem neugeborenen Sohn in einem tschechischen Dorf verstecken. Ella ist auf sich allein gestellt, erträgt immer neue Schicksalsschläge: Klosterschule, Kommunismus, Ehe mit einem Egozentriker, Psychiatrie – bis sie endlich in Prag der großen Liebe begegnet. Mit dem jüdischen Arzt Milan ist sie zum ersten Mal glücklich und fühlt sich geborgen. Beide haben nur noch einen Wunsch: zusammen mit Ellas kleiner Tochter in den Westen fliehen. Doch der Geheimdienst ist ihnen dicht auf den Fersen …
Von Hera Lind sind im Diana Verlag bisher erschienen:
Die Champagner-Diät – Schleuderprogramm – Herzgesteuert – Die Erfolgsmasche – Der Mann, der wirklich liebte – Himmel und Hölle – Der Überraschungsmann – Wenn nur dein Lächeln bleibt – Männer sind wie Schuhe – Gefangen in Afrika – Verwechseljahre – Drachenkinder – Verwandt in alle Ewigkeit – Tausendundein Tag – Eine Handvoll Heldinnen – Die Frau, die zu sehr liebte – Kuckucksnest – Die Sehnsuchtsfalle – Drei Männer und kein Halleluja – Mein Mann, seine Frauen und ich – Der Prinz aus dem Paradies – Hinter den Türen – Die Frau, die frei sein wollte – Über alle Grenzen – Vergib uns unsere Schuld – Die Hölle war der Preis – Die Frau zwischen den Welten – Grenzgängerin aus Liebe – Mit dem Rücken zur Wand – Für immer deine Tochter
HERA
LIND
Die Frau zwischen
den Welten
Roman nach einer wahren Geschichte
Vorbemerkung
Dieses Buch erhebt keinen Faktizitätsanspruch. Es basiert zwar zum Teil auf wahren Begebenheiten und behandelt typisierte Personen, die es so oder so ähnlich gegeben haben könnte. Diese Urbilder wurden jedoch durch künstlerische Gestaltung des Stoffs und dessen Ein- und Unterordnung in den Gesamtorganismus dieses Kunstwerks gegenüber den im Text beschriebenen Abbildern so stark verselbstständigt, dass das Individuelle, Persönlich-Intime zugunsten des Allgemeinen, Zeichenhaften der Figuren objektiviert ist.
Für alle Leser erkennbar erschöpft sich der Text nicht in einer reportagehaften Schilderung von realen Personen und Ereignissen, sondern besitzt eine zweite Ebene hinter der realistischen Ebene. Es findet ein Spiel der Autorin mit der Verschränkung von Wahrheit und Fiktion statt. Sie lässt bewusst Grenzen verschwimmen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2020 by Diana Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Covergestaltung: t.mutzenbach design, München
Covermotive: © Shutterstock.com (lunamarina; Stokkete; vectorfusionart;
Creative Travel Projects); © Lee Avison/Trevillion Images
Fotos der Autorin: © Erwin Schneider, Schneider-Press
Herstellung: Helga Schörnig
Satz: Leingärtner, Nabburg
Alle Rechte vorbehalten
ISBN 978-3-641-24545-0V004
www.diana-verlag.de
Für Ellas Tochter Alina
Manchmal muss man an Orte der Vergangenheit zurückkehren, damit Frieden einkehren kann. Damit nimmt man den Erinnerungen die Schärfe.
Ich wuchs in zwei Sprachen auf, lebte zwischen zwei Kulturen, zwischen zwei verfeindeten Nationen, die bis heute nach einer Aussöhnung suchen. Ich war fast mein ganzes Leben lang zwischen den Welten.
(Ella Berner, 87)
Anmerkung des Verlages:
Einige Kapitel spielen in Hillemühl, einem Dorf im Lausitzer Gebirge in Nordböhmen. Bis 1918 gehörte es zu Österreich-Ungarn (Amtssprache deutsch), ab 1918 war es Teil der neu gegründeten Tschechoslowakei (Amtssprache tschechisch), ab 1939 gehörte es zum Deutschen Reich und wurde Sudetengau genannt (Amtssprache deutsch), seit 1945 zählt es zur Tschechoslowakischen Republik (Amtssprache tschechisch).
1
Hillemühl im Lausitzer Gebirge, Nordböhmen,
Deutsches Reich, seit 1939 Sudetengau,
Ende März 1945, 6 Wochen vor Kriegsende
Nebenan wackelte der kleine Ziegenstall. Das Vieh schrie und meckerte, dass ich mir die Ohren zuhalten musste. Irgendwas lag in der Luft, das mein Idyll im Haus meiner Großmutter bedrohte, das spürte ich. Auch die bucklige Tante Berta, genannt Bertl, die wegen ihrer Behinderung genauso klein war wie ich, hockte blass und verstört auf ihrem dreibeinigen Hocker in der rustikalen Wohnküche und hörte Radio.
»Was soll nur aus uns werden, vor allem aus dem Kind!«, murmelte sie.
Das Kind war ich. Elf Jahre alt und hier auf dem Land bei Großmutter und Tante Bertl in Sicherheit gebracht.
Großmutter Auguste, die nach der Ziege geschaut hatte, stand kopfschüttelnd in der Tür.
»Wenn der Krieg aus ist, werden uns die Tschechen an den Kragen gehen«, knurrte sie und wischte sich die Hände am Küchenhandtuch ab. »Wir Deutschen werden hier um unser Leben fürchten müssen!«
Erst jetzt schien mich Großmutter richtig zu bemerken.
»Oje, Ella, da bist du ja …« Sie trank einen Schluck Wasser und straffte sich. »Ich werde wieder nach der Ziege schauen, lange kann es nicht mehr dauern.«
»Tante Bertl, wieso müssen wir Deutschen jetzt um unser Leben fürchten?«
»Ach, Kleines, die Welt ist schon lange aus den Fugen geraten!« Tante Bertl sah mich aus ihren tief liegenden Augen traurig an. »Aber du bist jung, du hast dein Leben doch noch vor dir.«
»Aber wir Deutschen leben doch mit den Tschechen friedlich zusammen? Papa ist Tscheche, Mama Deutsche!« Ich schaute Tante Bertl fragend an. »Die können doch nicht plötzlich Feinde sein?«
»Ach Liebes!« Tante Bertl tätschelte mir den Kopf. »Es tut mir nur so leid um deine arme Mama, die in diesen wirren Zeiten ein Baby bekommt! Gut, dass sie nicht hier ist – wer weiß, ob wir nicht bald aus unserem Haus vertrieben werden!«
Ich verstand das alles nicht. In Großmutters beschaulichem Hillemühl sollte sich plötzlich alles ändern? Wieso waren die Deutschen plötzlich unbeliebt? Sie sollten aus Böhmen und Mähren vertrieben werden? Wohin denn nur? Heim ins Reich? Sudetenland war doch unser Reich! Das hatte der Herr Hitler doch laut genug im Radio herumgeschrien!
»Unsere Vorfahren leben doch schon lange hier! Schon seit sie vor knapp zweihundert Jahren unter Kaiserin Maria Theresia hier angesiedelt wurden, das habe ich im Geschichtsunterricht gelernt!«
»Geh der Großmutter helfen, Liebes!« Tante Bertl wollte nicht mehr darüber reden.
Ich tat wie geheißen und wartete unschlüssig vor dem Stall. Mit der bissigen Ziege war nicht zu spaßen, außer Großmutter durfte sich dem bockigen Tier niemand nähern, aber jetzt war sie völlig außer Rand und Band. Das Tier zerrte an dem Strick, mit dem es am Pflock angebunden war, zielte mit den Hörnern auf jeden, der sich ihr näherte, und stieß Töne aus, die ich einer Ziege nie zugetraut hätte.
»Ella!« Großmutter steckte den Kopf aus dem Stall. »Es ist so weit. Die Ziege bekommt Nachwuchs! Magst du zuschauen?«
Mein Herz polterte. »Ich trau mich nicht …«
Oh Gott! Machte meine Mama etwa gerade dasselbe durch? Jeden Moment sollte doch mein Geschwisterchen auf die Welt kommen!
Mama, Papa und ich wohnten eigentlich in Prag in einer geräumigen Wohnung unweit des Denis-Bahnhofs, aber der stand möglicherweise unter Beschuss, und die tschechische Schule war vermutlich längst geschlossen.
Deshalb hatte Papa meine hochschwangere Mama in ein nahe gelegenes tschechisches Dorf namens Zahořany verfrachtet, wo er ihr ein winziges Zimmerchen an der Durchgangsstraße gemietet hatte. Dort sollte Mama »in Ruhe« ihr Baby bekommen.
Irritiert stand ich da, wusste nicht, was ich tun sollte.
»Komm ruhig rein! Die Ziege hat etwas anderes zu tun, als dich zu beißen!« Großmutter winkte mich näher. Unter ihrem roten Kopftuch sahen ihre roten Wangen aus wie kleine verschrumpelte Äpfelchen. »Das ist deine Chance, eine Ziegengeburt mitzuerleben!«
Wollte ich das wirklich? Hätte ich gewusst, was mir in meinem jungen Leben bald noch alles bevorstehen würde, wäre das hier ein Klacks für mich gewesen! Aber ich wusste es nicht. Zum Glück.
An der Hand meiner lieben Großmutter Auguste stapfte ich tapfer in den kleinen Stall. Mit energischen Griffen band Großmutter mir eine Schürze um.
»So. Hier hinter dem Gitter bleibst du stehen. Ich reiche dir die Zicklein dann, und du trägst sie nacheinander vorsichtig in die Küche, einverstanden?«
Oh Gott, was war ich aufgeregt. Fasziniert beobachtete ich meine gebückte Großmutter und die sich windende Ziege, die in meinen Augen beide hochprofessionell ans Werk gingen. Mit geübten Griffen befreite Großmutter das schreiende Tier von drei zuckenden Wesen, die nacheinander ins Stroh plumpsten. Sie machten einen hilflosen, verstörten Eindruck. So war das also, wenn man auf die Welt kam!
»Hier, kleine Hebamme. Das Erste. Vorsichtig, es ist ganz glitschig.«
Respektvoll nahm ich mit meinen Kinderhänden das winzige Ding entgegen, dessen Augen noch verklebt waren, das aber schon mit seinen stangenähnlichen Beinchen strampelte. Es war überraschend leicht und zart, und mich durchströmte ein nie gekanntes Glücksgefühl. Es lebte! Und ich durfte es tragen!
Ehrfürchtig trug ich es in die Küche.
Tante Bertl drehte mit ihren knotigen Fingern das Radio ab. Sie hatte inzwischen eine Kiste mit Stroh ausgelegt und neben den aufgeheizten Ofen gestellt.
»Na bitte, kleine Ella! Das hat doch hervorragend geklappt.«
Nach kurzer Zeit zappelten drei kleine langbeinige Wesen in der Kiste herum, und Großmutter wusch sich lachend die Hände über dem Waschtrog. Auch Tante Bertls Augen lagen nicht mehr so tief in ihren Höhlen, sondern hatten einen warmen Glanz.
»Schau mal, Ella, die denken, du bist ihre Mama! Sie lecken dir die Hände!«
»Aber ihre Mama ist doch im Stall!«
»Wir bringen sie ihr gleich, sie muss sich noch ein bisschen ausruhen.« Großmutter nahm ein Bündel Stroh und machte sich daran, die feuchten Wesen trocken zu reiben.
Fasziniert sah ich zu, wie die drei Zicklein immer wieder versuchten, zum Stehen zu kommen. Doch ihre Beinchen waren so dünn, dass sie jedes Mal einknickten.
»Sie haben noch wenig Kraft, aber warte nur – bald springen sie herum!« Großmutter schenkte sich einen Kaffee ein und wärmte die rissigen Hände an der blauen Blechtasse. »Ella-Kind, das hast du großartig gemacht.«
Die Zeit bei meiner deutschen Großmutter war für mich, das Stadtkind aus Prag, wirklich das reinste Paradies gewesen. Mein um mich besorgter Papa hatte mich schon vor einem halben Jahr aus den Kriegswirren des hundert Kilometer entfernten Prag hierhergebracht, wo ich von den ganzen Irrungen und Spannungen der letzten Kriegsmonate nicht viel mitbekam.
Es war ein wunderschöner Winter gewesen, mit sehr viel Schnee. So viel weiße Pracht hatte ich in Prag noch nie gesehen, da waren die Straßen eher verharscht und schmutzig, wenn Autos, Pferdefuhrwerke und die Straßenbahn ein paarmal über den frisch gefallenen Schnee gerumpelt waren.
Aber hier, im weiß glitzernden Winterparadies im Sudetenland, war alles wie verzaubert und mit Puderzucker bestäubt. Riesige Baumstämme wurden von Waldarbeitern mit schnaubenden Kaltblütern, denen vor Anstrengung der Schaum vor dem Maul stand, von den Bergen heruntertransportiert und hinterließen tiefe Spuren im Schnee. Darin glitten wir Kinder jubelnd hinterher. Oft hielten wir uns sogar an den Enden der Baumstämme fest und ließen uns ziehen. Angst kannten wir nicht, und unsere Mütter und Großmütter hatten etwas anderes zu tun, als uns zu beaufsichtigen.
Ich durfte die deutsche Dorfschule besuchen, was ich unglaublich spannend fand! In Prag wäre ich unter normalen Umständen schon im ersten Schuljahr eines tschechischen Gymnasiums gewesen. Aber hier, in diesem mollig warmen Klassenzimmer, in dem wir unsere nassen Jacken am Bollerofen wärmten, saßen gleich vier Klassen auf abgewetzten Holzbänken im selben Raum. Ich konnte genug Deutsch, um dem Unterrichtsstoff mühelos zu folgen. Ich half sogar den i-Männchen mit dem ABC und dem kleinen Einmaleins. Und nach der Schule zogen wir alle zu Großmutters Gemischtwarenladen, wo ich meinen Mitschülern je eine lila Lakritzpastille aus dem bauchigen Glas spendieren durfte.
Eine Grundschule, eine Gaststätte mit Metzgerei, ein Sägewerk und der kleine Gemischtwarenladen meiner Großmutter – genau das war Hillemühl, das liebliche Fleckchen im Lausitzer Gebirge. Anders als in Prag lebten in diesem böhmischen Dorf fast nur Deutsche. So wie meine Mama Marie Kochel, die auch hier aufgewachsen war. Sie war eine sehr attraktive Frau und wurde von allen um ihre Lockenpracht beneidet. Mein Vater Jakob war wiederum Tscheche. Er hatte meine Mama bei einem Dorffest kennengelernt. Sie sang damals im Chor und war die Schönste von allen Mädchen, die unter der Linde Volkslieder zum Besten gaben und dazu tanzten. So erzählte es mir mein Vater immer wieder. Doch weil sie eine Deutsche war, wurde seine Liebe zu ihr von seiner sehr national eingestellten Familie nicht begrüßt. Trotzdem heiratete er seine Marie vom Fleck weg, die ihm nach Prag folgte. Dort arbeitete mein Vater als Prokurist in einer jüdischen Weinfirma. Er war extrem kurzsichtig. Deshalb beugte er sich mit seiner runden Nickelbrille stets tief über seine Akten. Im ersten Stock des Weinhandels schuftete er bis spät in die Nacht. Richard Stein, sein Arbeitgeber, vertraute ihm voll und ganz. Mein Papa war die optimale Besetzung für den Job, denn er sprach perfekt Tschechisch und Deutsch.
Mama hatte nach ihrer Heirat sofort Tschechisch gelernt, aber es war mehr so ein Umgangstschechisch und ihren deutschen Akzent konnte sie einfach nicht verstecken. Ich hingegen sprach neben Deutsch fließend Tschechisch, war ich doch in Prag geboren und auch dort eingeschult worden. Richard Stein nannte mich liebevoll »Springinsfeld«, weil ich so ein aufgewecktes Mädchen war. Wenn ich an sein Fenster im Erdgeschoss klopfte, legten der alte Mann und ich immer an der Scheibe die Hände aneinander. Das war unser Begrüßungsritual. Richard Stein liebte uns, wir gehörten mehr oder weniger zur Familie.
Als im März 1939 die deutschen Truppen in Prag einmarschierten, war die Lage in der jüdischen Firma extrem angespannt. Bald darauf gab Richard Stein meinen Eltern diverse Gegenstände zur Aufbewahrung. Es dauerte nicht lange, und der jüdische Unternehmer wurde abgeholt. Kurz danach erschienen einige deutsche Wehrmachtssoldaten und ein großer grauhaariger Mann in der Firma. Letzterer war der neue Chef, der sich als Hitlers Freund vorstellte und mit dem Parteibuch Nummer 6 prahlte – so lange war er schon Nationalsozialist. Ein Mann aus Linz, wie Mama mir später erzählte. Von nun an war der Betrieb »arisiert« und für Lieferungen an die Wehrmacht zuständig.
Im Frühjahr 1945, während ich gerade sorglos bei meinen Verwandten in Hillemühl weilte, wurde das mobile jüdische Vermögen, das Richard Stein hatte zurücklassen müssen, auf den Firmenlaster geladen. Zweimal wurde mit Bildern, Möbeln, Teppichen, Silber und teurem Porzellan nach Linz gefahren. Mein Papa, der Prokurist, musste den Fahrer bezahlen. Das sollte ihm noch zum Verhängnis werden. Doch von alldem ahnte ich zu diesem Zeitpunkt noch nichts. Woher sollte ich auch wissen, dass es mit Hass und Grausamkeit noch lange nicht vorbei war?
Ich wusste nur, dass ich ihn vermisste: Mein Papa trug uns auf Händen. Und nun würde er bald auch noch ein Brüderchen oder Schwesterchen auf Händen tragen! War der Krieg erst einmal vorbei, würden wir hoffentlich wieder eine richtige Familie sein, das war mein sehnlichster Wunsch an diesen letzten Kriegstagen.
2
Hillemühl, 8. April 1945
»Ella-Kind! Gott sei Dank, dein kleiner Bruder Alex ist geboren!«
Großmutter wischte sich mit dem Zipfel ihrer Kittelschürze gerührt die Augen. In ihren vor Aufregung zitternden Händen hielt sie ein Telegramm, das ihr gerade der Postbote aus dem Nachbardorf mit dem Fahrrad gebracht hatte.
»Er ist noch ganz winzig, und deine Mama braucht dich jetzt!«
Verschreckt klammerte ich mich an die knotige Hand meiner Tante Bertl, die aus dem Radio immer neue Schreckensnachrichten hörte.
»Die arme Kleine«, flüsterte sie bedrückt. »Was soll nur werden! Die Tschechen werden uns Deutschen alles zurückzahlen, was Hitler und seine Bande ihnen angetan haben! Wo soll die arme Marie mit dem Baby nur hin? Und das arme Ella-Kind!
Ich hatte überhaupt keine Lust, von hier fortzugehen. Konnten die Eltern mit dem neuen Brüderchen nicht einfach hierherkommen? Hier war doch alles schön? Gerade hatte der Frühling in Hillemühl Einzug gehalten, und Großmutter werkelte unentwegt in unserem kleinen Vorgarten herum. Üppige gelbe Forsythien zierten unser schmuckes kleines Grundstück, und in den blitzblank geputzten Fenstern spiegelte sich die Sonne.
»Du musst jetzt ganz tapfer und vernünftig sein, hörst du?«
Großmutter schüttelte mich sanft an den Schultern. »Du musst jetzt zu deiner Mama. Wie gesagt, sie braucht dich. Und dein Brüderchen braucht dich auch!«
Dass man so auf mich zählte, erfüllte mich schon mit Stolz. »Holt der Papa mich ab?« Hoffnungsvoll blickte ich meine liebe Großmutter an.
»Das ist unmöglich! Der kommt nicht mehr über die Grenze.« Großmutter hatte ganz rote Flecken im Gesicht. »Die Tante Bertl bringt dich mit dem Zug nach Prag.«
»Aber in Prag ist es doch gefährlich, habt ihr gesagt? Ich kann doch nicht nach Hause zurück?«
Sie ging in die Hocke und hob mein Kinn. »Schau mich an, Ella. Was ich dir jetzt sage, ist ganz wichtig: Tante Bertl und du dürft kein Wort Deutsch sprechen! Weil ihr beide so klein seid, fallt ihr in dem überfüllten Zug hoffentlich nicht auf und könnt unbemerkt über die Grenze schlüpfen.«
»Und der Papa?«
»Der wartet in Prag an einem bestimmten Treffpunkt auf euch. Die Tante Bertl weiß Bescheid.«
Mit einem Blick auf meine Tante, die zusammengesunken auf ihrem Hocker saß, klammerte ich mich an sie.
»Aber Großmutter, ich habe Angst. Ich will lieber hierbleiben.«
»Das geht nicht, Liebes. Hier sind wir demnächst auch nicht mehr sicher!« Großmutter schnäuzte sich in ein großes weißes Taschentuch. »Du musst jetzt ganz stark sein!«
»Aber im Sommer komme ich wieder zurück und bringe die Mama, den Papa und mein Brüderchen mit!«, beschwor ich sie.
Nie werde ich den vielsagenden Blick vergessen, den Tante Bertl ihr kopfschüttelnd zuwarf. Und tatsächlich: Diesen Sommer sollte es nie geben. Auch das Haus und uns sollte es so nicht mehr geben …
»Ihr beiden schafft das schon!« Großmutter steckte das zerknüllte Taschentuch in ihren Jackenärmel. »Jammern bringt uns auch nicht weiter.« Sie legte das Telegramm auf den blank gescheuerten Küchentisch und stapfte in ihren Gummistiefeln wieder hinaus in den Garten.
»Weint die Oma?« Irritiert wirbelte ich zu meiner kleinen Tante herum, die in ihrer typisch krummen Haltung vor dem Radio hockte. »Tante Bertl, was passiert denn jetzt?«
Die kleine Tante war von der Natur zwar nicht mit einem gesunden Körper gesegnet, hatte aber ein goldenes Herz und war wie eine zweite Mutter zu mir.
»Wir müssen uns beeilen, kleine Ella. Packen wir schon mal dein Köfferchen.« Kurzbeinig hinkte sie in ihre Kammer, wobei sie ihre Atemnot kaum verbergen konnte. »Der Krieg wird bald vorbei sein«, flüsterte sie düster.
»Aber dann ist doch alles gut?«
»Ach, kleine Ella.« Sie seufzte und rückte ihr Korsett zurecht, das sich ihr immer in die Rippen bohrte. »Du musst jetzt ganz vernünftig sein und deiner Mama in Zahořany zur Hand gehen, hörst du? Und dich um dein kleines Brüderchen kümmern!«
»Aber natürlich!« Ich nickte eifrig. »Ich habe hier so viel im Haushalt gelernt, ich schaffe das!«
»Dann ist es gut.« Tante Bertl rang sich ein Lächeln ab und drückte mich mit ihren knochigen Armen an sich. »Ich werde mich um Großmutter kümmern und du dich um deine Mama, ist das ein Wort?«
Bereits am nächsten Tag standen wir in unseren schwarzen Mänteln eng aneinandergedrängt in dem völlig überfüllten Zug zur Grenze. Alle Menschen hatten diesen ängstlichen Ausdruck im Gesicht, den ich schon an Großmutter und Tante Bertl bemerkt hatte.
Plötzlich bremste der Zug und hielt quietschend auf freier Strecke.
»Bombenalarm«, brüllte jemand, und die panische Menge strömte zu den Ausgängen. »Springt in die Böschung, bringt euch in Sicherheit!«
Im Gewühl der schreienden Menschen, die bei der Notbremsung gegeneinander geschleudert worden waren, standen die kleine Tante Bertl und ich an der offenen Zugtür. Wir trauten uns nicht zu springen, denn die Böschung war zu tief. Bestimmt wären wir auf die Gleise geraten, wenn nicht hilfreiche Hände zugepackt und uns ins hohe Gras gehievt hätten.
»Los, schnell Kinder, krabbelt dort hinüber und versteckt euch unter dem Busch!«
Der Mann, der uns herausgehoben hatte, hielt uns beide für Kinder!
In Windeseile robbten Tante Bertl und ich zitternd unter ein Gebüsch, das kaum Schutz bot. »Komm her, Ella-Kind, schlüpf unter meinen Mantel!« Tante Bertl beugte sich schützend über mich. Das Herz hämmerte mir in der Brust, und ich war sicher, unser letztes Stündlein hatte geschlagen. Mit unfassbarem Lärm rasten die amerikanischen Düsenjäger über uns hinweg und warfen ihre Bomben ab. Am Horizont brannte die Stadt Aussig. Der Himmel färbte sich rot, das Pfeifen und Jaulen der Geschosse zerriss uns fast das Trommelfell.
»Tante Bertl, müssen wir jetzt sterben?«
»Nein, Ella, du musst doch dein Brüderchen noch kennenlernen! Mach die Augen zu und zähl bis hundert!«
»Nicht bewegen!«, schrie ein Mann. »Alles was rennt, ist sofort tot!«
Ich zählte mindestens bis tausend!
Die Lok stieß noch weißen Dampf aus, was die Piloten dieser Kampfflieger hoffentlich nicht auf uns aufmerksam machen würde.
Nach einer endlosen Zeit rappelten sich die Leute schluchzend und stöhnend wieder auf und schleppten sich zurück zum Zug. Einige Menschen blieben auch reglos liegen. Ich sah Gestalten mit verdrehten Augen, denen das Blut aus dem Mund lief. Zitternd folgte ich Tante Bertl.
»Kinder, hier rüber!«
Wieder waren es fremde hilfreiche Hände, die uns in den Waggon zurückhievten. Irgendwann ruckelte der Zug langsam wieder an. Wir »Kinder« starrten weiß wie die Wand ins Leere. Dass ich aus meinem friedlichen Hillemühl dermaßen abrupt in eine solche Kriegshölle geschleudert wurde, konnte ich nicht verarbeiten.
Quietschend hielt der Zug am Grenzübergang Leitmeritz. Auf den Bahnsteigen herrschte grenzenloses Chaos.
»Los, alle raus aus dem Zug, aber schnell!«
Bewaffnetes Militär polterte mit schweren Stiefeln durch die Abteile.
»Alle raus, Papiere vorzeigen, Taschen öffnen!«
Tante Bertls Miene war völlig versteinert. Wir hatten keine gültigen Papiere! Wir durften kein Wort sagen! Was sollten wir nur tun? Wo war nur mein Papa?
Wieder wurden wir »Kinder« von starken, unbekannten Männerhänden aus dem Zug gehoben. Unmengen von Menschen schoben und drängten sich in beide Richtungen – »Heim ins Reich« oder ins Protektorat Böhmen und Mähren. Zivilisten, Soldaten, Gesunde und Verwundete. Ich sah blutige Verbände, Krücken, verstümmelte Arme und Beine. Ich hörte Schreien und Schluchzen, verzweifelte Rufe nach Angehörigen.
Ich hielt mir die Ohren zu und drückte mich an meine Tante Bertl, die wiederum unseren gemeinsamen kleinen Koffer an sich drückte.
»Wo wollen die nur alle hin?« Ich hing an ihrem Arm wie eine Klette.
»Pssst!« Schon hatte ich ihren schwarzen Handschuh auf dem Mund. »Kein Wort Deutsch!«
Sie legte meine kleine Hand auf den Kofferhenkel und schleifte mich mit wie ein Gepäckstück. Da vorn war der Schlagbaum! Die Grenze! Was für Papiere sollten wir denn zeigen? Wir hatten keine! Ob dahinter mein Papa stand? Ich konnte ihn nicht sehen!
Zielstrebig hängte sich Tante Bertl an einen Mann, der seine Familie bei sich hatte und eine Menge von Papieren bereithielt. Wir »Kinder« schlüpften im Pulk einfach mit hinter den Grenzschlagbaum.
Dann waren wir im Protektorat Böhmen und Mähren und rannten um unser Leben. Wieder bestiegen wir einen Zug, wieder tauchten wir im Gewühl unter. Wir wurden langsam Profis im Unsichtbarsein.
Am Bahnhof von Prag nahm uns mein geliebter Papa in Empfang. Unauffällig stand er hinter einer Litfaßsäule und stürzte erleichtert auf uns zu, als er uns in der Menge entdeckte. Er war besorgt, denn die Situation war in Prag für Deutsche bereits sehr brisant.
»Da seid ihr ja, Gott sei Dank!« Rasch schleuste er uns in den Bus, der uns nach Zahořany brachte, in das Dorf, in dem meine Mutter sich mit dem Baby versteckt hielt.
»Kein Wort Deutsch!«, sagte auch Papa, als wir immer noch unter Schock auf einer Bank nebeneinanderhockten. Tante Bertl schwieg, sichtlich verstört. Der Bus ratterte aus der Stadt hinaus und kämpfte sich mühsam über Schotterstraßen. Während in Prag fast alle Straßen asphaltiert waren, sah es hier auf dem Land ganz anders aus: Ärmlich und trist duckten sich die Gehöfte am Straßenrand, und tiefe Schlaglöcher ließen den Bus rumpeln und ächzen.
»Wie geht es dir, Kleines?«, richtete Papa schließlich das Wort auf Tschechisch an mich.
Die Leute im Bus waren zwar alle mit ihren eigenen Problemen beschäftigt, aber wenn jemand Deutsch gesprochen hätte, wären sie sicher hellhörig geworden. Damals begriff ich das noch nicht, aber die selbst ernannten Revolutionsgarden – bestehend aus wild gewordenen Jugendlichen, aber auch aus »ganz normalen« Bürgern mit roten Armbinden – hätten uns möglicherweise bespuckt und sogar geschlagen. Der Hass der Tschechen auf die Deutschen gärte schon während des Krieges und entlud sich nun in primitiven Übergriffen auf Unschuldige.
»Freust du dich schon auf dein Brüderchen?«, versuchte Papa mich abzulenken.
Ich nickte verwirrt. Gab es denn in all dem Horror noch so etwas wie ein lebendes kleines Brüderchen? Und wie es meiner armen Mama wohl ging?
Sie hatte das Baby ja nicht in einem Krankenhaus bekommen, sondern in einem fremden Dorf in einem Zimmer! Eine fremde tschechische Hebamme war bei ihr gewesen. Und Papa, zum Glück.
»Gleich, wir sind gleich da.«
Wir atmeten hörbar aus. Tante Bertl war am Rande der Erschöpfung. Jeder Schritt tat ihr weh, sie kam kaum zu Atem.
»Wie sieht er aus?«, fragte ich ungeduldig.
Um Papas Augen bildeten sich feine Lachfältchen. »Alex ist noch sooo klein!«
Papa zeigte es mir: nicht viel größer als eine Puppe!
Endlich stiegen wir in einem ärmlichen Dorf aus dem Bus. »Wir müssen noch vier Kilometer laufen!« Papa half uns beiden Kleinen die Stufen hinab. »Zahořany hat keine Busverbindung.«
Mamas Versteck sollte so abgelegen wie möglich sein.
Aufgeregt trippelte ich neben ihm her, während Tante Bertl beim Gehen schwankte wie ein Boot auf unruhiger See. Bei jedem Schritt musste sie ihr gesamtes Körpergewicht verlagern und konnte sich nur schaukelnd fortbewegen. Trotzdem lächelte sie mich aufmunternd an, als wir uns auf der Schotterstraße vorwärtskämpften.
»Wie komme ich nur wieder nach Hause?«, fragte sie Papa leise auf Deutsch.
Verängstigt schaute sie ihn von der Seite an.
»Wir müssen unbedingt eine Lösung finden, du musst so schnell wie möglich zurück«, gab Papa auf Deutsch zurück. »Pssst, da kommen Leute!«
Wie die Erwachsenen Tante Bertls Rückkehr nach Hillemühl letztlich regelten, entzieht sich meiner Kenntnis. Mein einziger Wunsch war, endlich wieder bei meiner Mama zu sein und den kleinen Alex in die Arme nehmen zu dürfen.
3
Hillemühl, Ende April/Anfang Mai 1945
Einige Wochen später wurden die Großmutter und Tante Bertl von tschechischen Revolutionsgarden aus dem Haus gejagt. Aus einem Haus, das meine Großeltern mit eigenen Händen gebaut hatten. Alles, auch Gemüsegarten und Gemischtwarenladen, den sie sich seit dem Ersten Weltkrieg in vielen Jahren hart erarbeitet hatten, war verloren.
Bereits im Oktober 1943 hatte der tschechische Präsident Edward Beneš aus seinem Londoner Exil in einer Rundfunkrede verkündet: »Den Deutschen wird mitleidlos und vervielfacht all das heimgezahlt werden, was sie in unseren Ländern seit 1939 begangen haben. Die ganze Nation wird sich an diesem Kampf beteiligen, es wird keinen Tschechoslowaken geben, der sich dieser Aufgabe entzieht, und kein Patriot wird es versäumen, gerechte Rache für die Leiden der Nation zu nehmen.«
Auch der Militärbefehlshaber der tschechischen Exilregierung Serge˘j Ingr brüllte hasserfüllt im Radio: »Schlagt sie, tötet sie, lasst niemanden am Leben!«
Die Deutsche-Hasser plünderten und zerstörten Häuser in Hillemühl und vielen anderen böhmischen Dörfern. »Raubritter des 20. Jahrhunderts« nannten sie sich selbst. Dass man Millionen von unschuldigen Menschen in die Fremde jagte, wo sie dementsprechend verarmt nicht willkommen waren, wo sie gezwungen waren, Kartoffeln und Äpfel zu stehlen, um mit ihren Kindern nicht zu verhungern, das war den selbst ernannten tschechischen Revolutionsgarden egal. Junge Leute, meist aus dem Landesinnern, die in ihrer Kindheit und Jugend die Kriegsgräuel am eigenen Leib erlebt hatten, wollten nur eines: brutale Rache. An allen Deutschen. Egal, ob alt, behindert oder jung und unschuldig.
Alle Deutschen, die schon seit Jahrhunderten auf tschechischem Gebiet siedelten und in ihren deutschen Dörfern lebten, wurden für die Verbrechen Hitlers und seiner Schergen mitverantwortlich gemacht. Die Deutschen mussten von nun an eine weiße Armbinde tragen wie vormals die Juden ihren Judenstern. Jetzt waren die Deutschen das Freiwild.
In Prag schlugen Passanten auf ihre deutschen Nachbarn ein. Ihnen wurden auf der Straße die Haare abgeschnitten, sie wurden bespuckt und gedemütigt. Zu Hunderttausenden wurden sie auf brutalste Weise vertrieben, die Frauen und Mädchen wahllos vergewaltigt. Viele unschuldige Deutsche wurden geschlagen, gefoltert und umgebracht.
Diese Tschechen waren eifrige Vollstrecker. Wie ich erst viel später durchschauen sollte, oft auch nur um die eigene Haut zu retten: Hatten sie zu Kriegszeiten durchaus noch zum eigenen Vorteil mit den Deutschen kollaboriert, wollten sie jetzt, wo sich das Blatt gewendet hatte, vor den russischen Besatzern als Opfer dastehen. Wer einen Deutschen verriet oder ans Messer lieferte, wer ihn ausraubte, schlug und verjagte, ja sogar wer einen Deutschen umbrachte, sammelte Pluspunkte.
Schon am 15. Mai, also wenige Wochen nachdem ich mein Kinderparadies Hillemühl verlassen hatte, kam der Befehl zur »Säuberung« und militärischen Besetzung des Sudetenlandes. Denn Präsident Beneš schrie auch:
»Unsere Deutschen müssen ins Reich weggehen, und sie werden in jedem Fall weggehen. Sie werden wegen ihrer eigenen großen moralischen Schuld, ihrer Vorkriegswirkung bei uns und ihrer ganzen Kriegspolitik gegen unseren Staat und unser Volk weggehen.«
Die Großmutter und Tante Bertl wurden in einen Schuppen gesperrt, um dort auf ihre Vertreibung zu warten. Von dort aus musste meine deutsche Familie mit ansehen, wie all ihr Hab und Gut abtransportiert oder zerstört wurde. Sie hatte Hausarrest und durfte die winzige Behausung nur noch zum Wasserholen am Brunnen und zum Verrichten ihrer Notdurft auf dem Plumpsklo verlassen. Eine Tortur, die mein Großvater zum Glück nicht mehr miterleben musste. Nachdem er schwer versehrt aus dem Ersten Weltkrieg gekommen war, war er schon zu Anfang des Zweiten gestorben.
»Wir Deutschen werden hier um unser Leben fürchten müssen«, hatte Oma ahnungsvoll gesagt.
Aber wir hatten Glück, weil Papa Tscheche war: Papa und nun auch der kleine Alex hießen mit Nachnamen Vojan und Mama und ich dementsprechend mit der weiblichen Endung Vojanová. Das würde uns doch hoffentlich vor solchen Gräueln bewahren? Das war die Hoffnung, an die wir uns klammerten.
4
Zahořany, ein tschechisches Dorf bei Prag, Mai 1945
»Papa, was hat das zu bedeuten?« Angsterfüllt stand ich im Nachthemd am Fenster. Inzwischen war ich seit wenigen Wochen bei Mama und Alex in der angemieteten Kammer im Erdgeschoss eines ärmlichen Hauses an der Durchgangsstraße nach Prag. Es war als Altenteil für die Bauersleute gedacht und hatte einen eigenen Eingang. Zwei schmale Betten, ein Tisch, zwei Stühle und ein Ofen, mehr war nicht darin. Papa hatte es von einer Tschechin gemietet und ihr viel mehr Geld gegeben, als die schäbige Behausung eigentlich wert war. Mit den letzten Wein- und Sektreserven aus Richard Steins Firma hatte er sie zusätzlich bestochen, damit sie uns nicht an die Revolutionsgarden verriet. Das erfuhr ich alles erst sehr viel später.
Mama erholte sich nur langsam von der Geburt, und ich musste sämtliche Hausarbeiten verrichten. Das bedeutete, Wasser vom Brunnen zu holen, Alex’ Windeln im Dorfbach zu waschen und die vier Kilometer ins Nachbardorf zu laufen, um die nötigsten Besorgungen zu machen.
An den Wochenenden kämpfte sich Papa mit dem Fahrrad zu uns in die dörfliche Abgeschiedenheit. Da konnte ich endlich aufatmen: Er war da und würde uns beschützen.
Und jetzt stand ich, vom Lärm aufgeweckt, am Fenster und war unendlich froh, nicht mit Mama und Alex allein zu sein. Was war da los?
Draußen auf der Straße legten aufgeregt schreiende Leute Baumstämme und Holzlatten quer über die Fahrbahn. Anscheinend versuchten sie, Barrikaden zu errichten. Frauen kreischten, rissen ihre Kinder an sich, rannten panisch in ihre Häuser, um gleich darauf mit Sack und Pack wieder daraus hervorzukommen und in die entgegengesetzte Richtung zu rennen.
Auch Papa war von dem Geschrei aufgewacht. Er musste erst seine Nickelbrille suchen. Nervös zwinkerte er mit den Augen. Mama saß verstört im Bett und presste den schlafenden Alex an sich.
Das Herz schlug mir bis zum Hals. Die Leute da draußen waren sowieso nicht nett zu uns, wir waren unerwünscht und gerade mal geduldet. Sie würden uns nicht helfen, egal was passieren würde!
Papa hatte seine Brille gefunden und sich in Windeseile angezogen. »Ich weiß nicht, Ella, bleib ganz ruhig. Ich gehe nachschauen.«
Vorsichtig öffnete er die knarrende Tür unserer Kammer zur Straße hinaus und peilte die Lage. Ich stand am Fenster wie ein zartes Vögelchen und wäre so gern davongeflogen, zurück zu Großmutter und Tante Bertl.
Doch unser Kontakt zu Hillemühl war schlagartig abgebrochen. Telefone standen nicht zur Verfügung, die Post funktionierte nicht, und keiner von uns wusste, wer wo war und wie es wem ging.
Hitler war seit drei Tagen tot, und die Welt war für uns mehr denn je aus den Fugen geraten.
Alles war sehr verwirrend für mich: Die fremden Menschen, die so ganz anders waren als die netten Leute in Hillemühl. Der zerknautschte Säugling Alex, der mehr schrie als schlief. Meine einst so starke Mama, die so erschöpft war, dass sie nun selbst auf Hilfe angewiesen war – das war schon mehr als ich verkraften konnte. Irgendwie hatten wir die Rollen getauscht: Fast war nun ich die Mutter und sie das Kind!
Papa!, flehte ich innerlich, lass uns hier nicht allein. Meine kleine Hand war schweißnass vor Angst und hinterließ einen Abdruck an der Scheibe
Da sah ich ihn zum Glück zurückkommen.
»Jakob, was ist da draußen los?« Mit angstgeweiteten Augen lehnte Mama an der feuchten Wand, den schlafenden Alex im Arm.
Ganz außer Atem nahm Vater die beschlagene Brille ab und rieb sich die Augen. Ratlosigkeit lag in seiner Stimme, gleichzeitig versuchte er die Fassung zu bewahren.
»Manche sagen, die russische Armee rückt an, andere glauben, es sind die Deutschen. Wer immer es auch ist: Wir müssen hier sofort weg!« Papa riss den kleinen Alex von Mamas Brust und gab ihn mir. »Hier, Ella, du bist jetzt für deinen Bruder verantwortlich.«
Mama weinte vor Angst, als Papa ihr aus dem Bett und in die Kleider half. Dann packte er das Bettzeug und ein paar Habseligkeiten, die er in Alex’ Kinderwagen verstaute. Alles, was wir besaßen, passte dort hinein. »Los, lauft!«
Mit dem winzigen Alex im Arm kämpfte ich mich hinter meinen Eltern durch das Gewühl panisch flüchtender Menschen.
»Wohin?«, rief Papa auf Tschechisch einem Mann zu, der sich mit einer Mistgabel bewaffnet hatte.
»Am anderen Ende des Dorfes ist eine Scheune, versteckt am Waldrand«, rief der Mann zurück. Er hatte keine Zeit mehr für weitere Erklärungen. Hastig scheuchte er seine eigenen Töchter vor sich her, um sie in Sicherheit zu bringen.
Schon hörten wir aus der Ferne Donnergrollen. Waren es russische Panzer? Die Frauen und Mädchen stoben kreischend auf groben Schnürschuhen über die nasskalten Felder Richtung Waldrand.
Wir rannten einfach mit der Menge mit, und ich lief gebückt neben dem Kinderwagen und hielt mein Brüderchen mit beiden Händen fest. Es wäre sonst von dem kunstvollen Hochbau aus Lebensmitteln und Decken gekullert. Mama kämpfte sich unter Schmerzen an Papas Hand durch Dornen und Gestrüpp. Endlich erreichten wir den Waldrand und dahinter die besagte Scheune.
Inmitten fremder Leute, die uns feindselig anstarrten und angewidert das Wort »Deutsche« murmelten, saßen wir dort einen Tag und eine Nacht lang auf dem Fußboden. Vierundzwanzig lange Stunden hockten wir da und kamen uns vor wie Aussätzige.
Mama versuchte, unter all den bösen Blicken den kleinen Alex zu stillen, und ich hielt schützend den Zipfel der Bettdecke vor ihre Brust. Trotzdem vernahm ich deutlich die Wörter »deutsche Sau« und »kleiner Bastard«.
Was hatten wir diesen Menschen nur getan?
Ich verstand das alles nicht. Warum waren diese Leute so hässlich und gemein zu uns? Was hatten wir ihnen Böses getan? Meine Mama ganz bestimmt nicht, die war das liebste und sanftmütigste Wesen auf der Welt! Und der gerade erst vier Wochen alte Alex erst recht nicht. Papa gelang es, mit seiner Liebenswürdigkeit die Wogen auf Tschechisch zu glätten.
Als am nächsten Morgen immer noch keine Panzer gekommen waren, schleppten wir uns in unser Quartier zurück. Mama weinte, Alex weinte, und ich hätte am liebsten auch geweint.
»Deutsche Sau! Da kommt die deutsche Sau!«
Inzwischen war das Wasserholen am Brunnen der reinste Spießrutenlauf für mich. Die Dorfkinder warfen mit Steinen nach mir, während ich mich mit den schweren Kannen abmühte.
Seit unserer Nacht in der Scheune hatte sich im Dorf herumgesprochen, dass hier eine Deutsche mit ihren zwei Bastarden wohnte. Alle Radiosendungen verkündeten, dass Deutsche der letzte Abschaum und deshalb zu vernichten seien wie Ungeziefer! Selbst die kleinsten Dorfkinder waren vom Hass-Virus infiziert.
»Lasst mich in Ruhe, ich bin Tschechin!« In perfektem Tschechisch stellte ich mich mutig meinen Angreifern. »Ich komme aus Prag! Wenn das hier vorbei ist, gehe ich dort wieder zur Schule!«
»He, die kann wirklich Tschechisch!« – »Lasst sie in Ruhe! Sie ist eine von uns!«
Tatsächlich ließen sie die Steine fallen.
»Nur die Mutter ist Deutsche«, gab der Älteste den Ton an. »Das Mädchen kann nichts dafür.«
»Ist doch alles Dreckspack«, giftete ein Mädchen in meinem Alter. »Mein Vater hat gesagt, die Deutschen gehören alle mit der Mistgabel erschlagen oder im Brunnen ertränkt.« Sie drohte mir mit der Faust, und unwillkürlich zog ich den Kopf ein, während ich die schweren Kannen aus dem Wasser zog.
Diskutierend und ausspuckend zog die Meute ab.
Mit weichen Knien schleppte ich die beiden schweren Kannen nach Hause. Fließendes Wasser gab es in der winzigen Kammer leider nicht.
Plötzlich kreischten die Dorfkinder: »Die Russen! Die Russen kommen!«
War das ein neues Spiel, oder kamen sie wirklich?
»Ella«, flüsterte meine Mama. »Ich habe keine Milch mehr!« Der kleine Alex schrie wie am Spieß. Mamas Brüste waren leer und schlaff.
»Wie? Aber was machen wir denn jetzt?« Ich wollte mir die Ohren zuhalten!
»Lauf zur Vermieterin«, bat sie mich verzweifelt. »Sie soll einen Topf Milch rüberbringen! Papa wird sie bezahlen, wenn er wiederkommt!«
»Aber die Russen kommen, sagen die Kinder.«
Alex’ Gesichtchen war ganz rot angelaufen, und er ballte zitternd die Fäuste. »Bitte, Ella! Ganz vorsichtig.«
Mit dem Mut einer fast Zwölfjährigen, die ihre Mutter und ihren Bruder schützen muss, klopfte ich an der benachbarten Tür, hinter der die nicht sehr nette Vermieterin wohnte.
»Das Baby braucht Milch, die Mama hat keine mehr …«, piepste ich verzweifelt.
»Schleich dich, du deutsche Göre!« Sie griff nach dem Besen.
»Bitte, Frau Poláková! Mein Papa bezahlt es auch! Er kommt am Wochenende wieder!«
»Verschwinde. Niemand soll mich mit einem deutschen Bastard sehen, die Russen kommen!«
Sie verscheuchte mich wie einen räudigen Hund.
Mit leeren Händen stand ich wieder vor unserer Tür, als ich erneut dieses Donnergrollen vernahm.
Die Kinder hatten recht gehabt! Es war kein Spiel! Diesmal kamen sie wirklich!
»Alex, hör auf zu schreien!« Mutter hielt dem kleinen Kerl verzweifelt den Mund zu, damit er einen Moment Ruhe gab.
Hufgeklapper drang von der Straße herein. Ich presste das Gesicht gegen die Scheibe. Unzählige Planwagen, von müden Pferden gezogen und von noch müderen Soldaten kutschiert, suchten in den umliegenden Wäldern nach einem Quartier.
Das Herz wollte mir schier zerspringen vor Angst, als der Oberbefehlshaber mit den vielen Orden auf der Brust auf dem größten Wagen direkt in unseren Hof fuhr.
Auch wenn ich zurückwich, wusste ich doch: Sie hatten mich gesehen. Mich, das schwarzlockige Mädchen mit den braunen Augen.
Obwohl ich keine Ahnung hatte, was »vergewaltigen« war, wusste ich doch, dass es etwas unsagbar Schreckliches war. Sie taten es mit Frauen. Vor allem mit wehrlosen, schwachen Frauen wie Mutter, mit jungen Mädchen wie mir. Das Wort hatte ich in letzter Zeit oft gehört.
Schwere Stiefel traten gegen die Haustür. Mein Herz setzte einen Schlag aus. Ich stand da ganz allein! Was sollte ich tun?
Russische Befehle wurden gebrüllt. Ich stemmte meinen kleinen Körper von innen gegen die Tür zu unserer Kammer. Nein, sie würden meine Mama nicht belästigen und auch mich nicht erwischen! Mit letzter Kraft versuchte ich, den Tisch vor die Tür zu schieben, aber er war zu schwer mit den Kochplatten, den Töpfen und der Wasserschüssel.
Die Vermieterin stürzte aus der Wohnung nebenan und schrie hasserfüllt: »Jetzt hast du sie angelockt mit deinen schwarzen Locken!«
»Nein, habe ich nicht. Ich wollte doch nur …«
Wieder schwere Stiefeltritte gegen die Haustür. Als ich unsere Tür einen Spalt öffnete, sah ich, wie der Vermieterin der Angstschweiß in den Ausschnitt lief.
»Wir brauchen Quartier für den Kommandanten!« Ein russischer Soldat, behangen mit unzähligen goldenen Orden und noch mehr goldenen Uhren, trat erst die Haustür und dann unsere so weit auf, dass der Tisch krachend umfiel. Mich kleines Mädchen, das sich schon unter das Bett verkrochen hatte, beachtete er kein bisschen.
»Was ist los, Frau?«, herrschte er die Vermieterin an. »Was stehst du hier rum? Wem gehört das Haus?«
»Ähm … mir.«
»Dann mach deine Wohnung frei. Dieses Zimmer hier ist zu klein! Und da ist Frau und Baby drin!« Mutter lehnte leichenblass an der Wand, Alex an sich gepresst. Selbst Alex hatte vor Schreck aufgehört zu schreien.
Der Vermieterin blieb nichts anderes übrig, als dem russischen Militär ihre gesamte Wohnung zur Verfügung zu stellen. Sie bezog ein noch kleineres Zimmer als unseres, eigentlich ein Abstellraum unter der Treppe.
Nun wohnte ausgerechnet die russische Militärkommandantur in unserem Haus, Tür an Tür mit uns. Und wir waren Deutsche! Was sie hoffentlich nie bemerken würden! Wir hörten die Soldaten reden und lachen, und wenn sie betrunken waren, fielen sie krachend gegen die Wand.
Stundenlang spähte ich angstvoll aus dem Fenster. Unser kleines Radio kündete von der Tschechischen Revolution! Nun war alles außer Rand und Band. Papa!, flehte ich innerlich. Bitte komm doch, wir schaffen das hier nicht mehr allein!
Endlich sah ich ihn mit seinen wehenden Knickerbockerhosen auf dem Fahrrad. Es war, als hätten Mama und ich eine Ewigkeit auf ihn gewartet. Er lehnte das Rad an die Hauswand, und schon riss ich erleichtert die Tür auf.
»Papa!«
Aufgeregt stürzte er zu uns in die kleine Stube.
»Ist euch was passiert?«
»Jakob, es ist nicht mehr auszuhalten!« Unter Tränen warf sich meine blasse Mama in seine Arme. Der kleine Alex war schon halb verhungert. »Ich habe keine Milch mehr, und die Vermieterin hilft uns nicht.«
»Das darf doch nicht wahr sein!« Verärgert raufte sich Vater die spärlichen Haare. »Ich habe der Poláková doch extra die dreifache Miete gegeben, damit sie sich um euch kümmert!«
»Seit die Russen da sind, tut sie so, als gäbe es uns nicht.« Mama sah ihn aus ihren großen traurigen Augen hilflos an. »Sie macht sich bei ihnen lieb Kind, damit ihr nichts passiert.«
»Na, die kriegt was zu hören!« Schon wollte Vater hinauseilen, um die Frau zur Rede zu stellen, als es bei uns klopfte. Nein, es klopfte nicht, es hämmerte. Schwere Stiefel traten gegen unsere Zimmertür. Auf Russisch wurde Einlass verlangt.
»Aufmachen! Militärkontrolle! Dawai, dawai!«
Mama und ich drückten uns verängstigt in die hinterste Ecke. Sie hatten Papa kommen hören, und jetzt würde es erst richtig Ärger geben!
Ich war bereit, mein Brüderchen mit Zähnen und Klauen zu verteidigen.
»Da drin!«, hörte ich die Vermieterin mit sich überschlagender Stimme kreischen. »Da wohnen Deutsche! Ich habe mit denen nichts zu tun!«
Frau Poláková stand sensationslüstern hinter dem russischen Trupp und zeigte mit dem Finger auf uns.
Wie Mäuse, vor deren Bau der Fuchs wütet, standen wir da. Und die schnatternde Gans Frau Poláková flatterte mit den Flügeln, um von sich abzulenken. »Ich habe mit denen nichts zu schaffen!«
Es waren drei Soldaten, alle bewaffnet. Einer mit einem Knüppel, die anderen beiden mit Pistolen. Der Anführer richtete seine Waffe auf uns.
Papa reagierte sehr überlegt. Er öffnete die Tür und bat die drei Russen mit freundlichen Gesten herein. Als die neugierige Vermieterin auch hereinkommen wollte, schlug er ihr die Tür vor der Nase zu. Die schmuddeligen Uniformen der Russen waren mit Orden überladen. Erst traute ich mich gar nicht, genau hinzusehen, aber dann stellte ich fest, dass einer kaum älter war als ich! Ein Vierzehnjähriger, der sich selbst ängstlich in die Ecke drückte. Er starrte Mama aus großen Augen an. Vielleicht sah er seine eigene Mutter in ihr und hatte schreckliches Heimweh?
Papa bot dem Kommandanten und dem anderen Erwachsenen sofort unsere Stühle und einen Sekt an. Auf Russisch machte er eine launige Bemerkung, die er wahrscheinlich irgendwo aufgeschnappt hatte. Die Soldaten entspannten sich zusehends.Außer einer verstörten Frau, einem winzigen Baby und einem ebenso verstörten, knapp zwölfjährigen Mädchen war hier nichts zu holen.
Papa zauberte die Flasche hervor, die er für Alex’ Taufe mitgebracht hatte. »Na, meine Herren, dann würde ich erst mal sagen: Nasdarovje!« Er ließ den Korken knallen. Dieser flog mit einem satten Plopp gegen unser Fenster. Es knallte heftig.
Draußen standen die Dorfbewohner und drückten sich die Nasen platt.
»Die Deutschen! Sie haben die Deutschen erschossen!«
»Kommt und schaut! Die Deutschen sind tot.«
Schon kreischte auch Frau Poláková die sensationelle Nachricht über die Dorfstraße.
»Die Russen haben die Deutschen kaltgemacht! Recht geschieht ihnen!«
Vater öffnete das Fenster, und alle Köpfe stoben auseinander.
»Nee, geht mal nach Hause«, rief Vater gutmütig. »Hier wurde niemand erschossen. Wir feiern nur die russisch-tschechische Freundschaft!«
Nie werde ich vergessen, wie sich die Dorfbewohner enttäuscht zerstreuten.
Die Russen fragten Papa kurz aus, ob es hier wirklich Deutsche gebe, und Papa radebrechte freundlich zurück, dass er hier nur lauter Tschechen sehe. Hilfsbereit zeigte er unsere Pässe und Alex’ Geburtsurkunde vor. Auf allen vier Dokumenten stand unser tschechischer Nachname. Zweimal Vojan und zweimal Vojanová.
Zum Glück! Mutter sagte kein Wort, Alex konnte noch nicht sprechen, und ich bestätigte Papas Aussage beflissen auf Tschechisch. »Wir sind eine tschechische Familie aus Prag!«
»Wie kann die Frau da draußen dann so einen Schwachsinn erfinden?«, wunderte sich der Russe.
»Ach, Frauen giften halt gern«, scherzte Papa, den erbärmlichen Zustand meiner Mama ignorierend.
»Wir beschützen euch«, beschied der Kommandant. »Und Ivan kann aufpassen auf Mädchen! Was, Kleiner?!« Er schüttelte den schmächtigen Knaben am Kragen, dass diesem Hören und Sehen verging. Ivan, der geradezu schmachtend meine trotz ihrer Blässe immer noch schöne Mama anstarrte, wurde rot und nickte. Plötzlich mussten die Männer alle lachen.
»Wo habt ihr denn den Knaben her?«, fragte Papa und füllte die Gläser nach.
»Den haben wir elternlos am Straßenrand aufgelesen«, radebrechte der inzwischen leicht betrunkene, aber keinesfalls gewaltbereite Kommandant. »Da haben wir ihn mitgenommen, wir konnten ihn ja schlecht zwischen Leichenbergen und Trümmern zurücklassen.« Er haute dem schwächlichen Jungen auf die Schulter, dass der fast in die Knie ging. »Wir wurden hierher abkommandiert, der Krieg ist zu Ende! Chittler …« – er machte eine waagrechte Handbewegung vor seiner Kehle – »… Deutschführer kaputtsky!« Der Russe lachte so sehr, dass seine Blechabzeichen schepperten.
Papa lachte auch, obwohl ich ihm ansah, dass er nicht wirklich fröhlich war. Vor lauter Nervosität zwinkerte er ständig, was die Russen wohl für Übermut hielten.
Nach diesem feuchtfröhlichen Nachmittag zogen die Russen wieder in ihre Behausung nebenan, und tatsächlich ist Mama und mir nie etwas geschehen – im Gegenteil! Unsere neuen Nachbarn waren uns besser gesonnen als Frau Poláková. Der schmächtige Ivan klopfte dann und wann schüchtern an unsere Tür. Er bot Mama an, sie nach Moskau mitzunehmen. Übrigens hatte Papa der Vermieterin nach diesem Vorfall gründlich die Leviten gelesen. Von nun an musste ich nur mit einem Besenstil vor ihrem Fenster herumfuchteln, und schon stand ein gefüllter Milchkrug auf unserem Fensterbrett.
5
Zahořany, einige Tage später im Mai 1945
Und dann klopfte es schon wieder! Ängstlich starrten wir aus dem Fenster.
»Es ist Paul!« Vater öffnete erleichtert die Tür. »Paul, mein Freund! Was machst du denn hier?«
Paul Gutmann war Deutscher, der mit einer Jüdin verheiratet war. Wir hatten sie vor dem Krieg in Prag oft mit dem Fahrrad besucht, ich noch auf dem Kindersitz: Sie hatten im Stadtteil Veitsberg in ihrer bescheidenen Wohnung eine kleine Puppenwerkstatt gehabt. War das für mich ein Paradies gewesen! Während die Eltern sich bei Kaffee und Kuchen unterhielten, durfte ich damals ungestört in den Regalen stöbern, wo Puppenköpfe, -arme, -beine, Kleidchen und Schühchen ordentlich nebeneinanderlagen. Bei jedem Besuch waren neue Puppen fertig, und mit allen hatte ich spielen dürfen. Sie hatten auch einen Sohn, Peter Gutmann, der allerdings sieben Jahre älter war als ich. Ich kann mich nicht erinnern, dass er sich je mit mir beschäftigt hat, doch er war ein netter Junge, der sich an meinem kindlichen Spiel erfreute. Insofern glaubte ich zu träumen, als dieser Herr Gutmann aus meiner heilen Kindheit überraschend vor uns stand, auch wenn er inzwischen sichtlich gealtert war.
Er umarmte Vati etwas unbeholfen, wie Männer sich eben umarmen, die früher mal gemeinsam die Schulbank gedrückt haben. Dann gab er Mama einen flüchtigen Handkuss, und mich kniff er liebevoll in die Wange.
»Gott, Ella-Kind, was bist du groß geworden … aber auch so dünn!«
Papa legte den Arm um mich. »Sie musste von einem Tag auf den anderen erwachsen werden.« Er berichtete seinem Schulfreund von den Dingen, die sich ereignet hatten.
»Meine Güte, so könnt ihr doch nicht hausen!« Herr Gutmann sah sich in unserem winzigen Zimmer um, in dem unsere wenigen Habseligkeiten durcheinanderlagen. »Wie kann man denn hier mit einem Säugling und einer heranwachsenden Tochter leben?«
Herr Gutmann drehte sich um die eigene Achse.
»Im Moment bleibt uns nichts anderes übrig.« Papa fegte die beiden Stühle frei. Ich hockte interessiert auf der Bettkante und starrte Herrn Gutmann an, der eine weiße Armbinde trug so wie seine Frau früher einen Judenstern. Ich erinnerte mich noch daran, wie Frau Gutmann immer die Handtasche gegen die Brust gedrückt hatte, damit man ihn nicht sah.
Paul Gutmann war nicht grundlos hier.
»Ihr seid hier nicht sicher! Ich beschwöre euch, kommt mit uns in den Westen! Wir haben auch einen Plan, irgendwie muss es gelingen! Peter und Judith packen schon zusammen. Sie haben mir befohlen, euch zu holen!«
Mein Herz begann zu rasen. Schon wieder weg? Aber wohin denn? Draußen tobte der Mob!
»Aber wo wollt ihr denn hin? Deutschland ist komplett zerbombt und zerstört!« Papa nahm die Brille ab und kaute nervös auf dem Bügel herum. Das tat er oft, wenn er sich auf etwas konzentrierte.
»Jakob!« Herr Gutmann spielte mit seinen Hosenspangen, die er klirrend auf und zu schnappen ließ. »Judith und Peter sind gerade erst aus Theresienstadt zurück! Meinst du, ich mache Spaß?«
»Was? Sie waren im KZ?« Papa schlug die Hände vors Gesicht. Der Junge auch?!«
»Ja, in den letzten Kriegswochen hat es sie noch erwischt. Man hat Judith und den Jungen lange verschont, aber dann wurden sie doch noch abgeholt.«
»Das tut mir so wahnsinnig leid, Paul!« Papa wischte sich über die Augen. »Wie geht es ihnen jetzt?«
»Sie haben überlebt.« Paul Gutmann vergrub die Hände in den Hosentaschen. Sein Kiefer mahlte. »Und jetzt sind nicht mehr sie als Juden, sondern ich bin als Deutscher gefährdet!« Er warf die Hände in die Luft. »Wir müssen die Tschechoslowakei unbedingt verlassen. Und ihr müsst mit! Marie ist Deutsche, eure Kinder sind Halbdeutsche!«
Umständlich setzte Papa die Brille wieder auf. Wegen der dicken Gläser wirkten seine Augen doppelt so groß. »Ihr steht unter Schock, Paul. Ich verstehe euch. Aber ist das nicht alles ein bisschen unüberlegt?«
Paul unterbrach ihn: »Jakob! Eine weiße Armbinde besagt: Dieser Mann darf geschlagen und getreten werden!« Er raufte sich verzweifelt die Haare. »Kaum ist der Krieg aus, dreht sich der Wind wieder zu unseren Ungunsten!« Er schüttelte vehement den Kopf. »Es muss einen Weg für uns geben, raus aus der Tschechoslowakei, egal wohin, und ihr müsst mitkommen! Ihr seid genauso Freiwild wie wir!«
»Aber Paul! Ich sehe keinen Grund zur Panik.« Papa räusperte sich. »Ich habe in Prag immer noch meine Stellung als Prokurist bei Stein und kann meine Familie auf diese Weise ganz gut versorgen. Ich bin Tscheche, mir passiert nichts, wir haben tschechische Pässe, und Marie ist mit den Kindern hier im Moment sicherer als auf der Flucht. Sie ist geschwächt, Alex unterernährt, die kriege ich nie heil über die Grenze. Ella passt gut auf sie und Klein-Alex auf.« Er zerzauste mir liebevoll das Haar.
»Jakob!« Paul Gutmann sprang auf und schüttelte Papa am Arm. »Richard Stein und seine gesamte Familie waren im KZ und dürften längst tot sein! Was ist mit seinen Besitztümern passiert? Wenn du etwas davon weißt, kann das gegen dich ausgelegt werden! Du weißt ja, auf Kollaboration mit den Deutschen steht die Todesstrafe!«
Mein Herz raste. Was redete der Herr Gutmann denn da? Papa hatte sich doch nichts zuschulden kommen lassen?
»Aber ich habe doch nur meinen Job gemacht«, wiegelte Papa ab.
Paul Gutmann schlug mit der flachen Hand auf den Tisch. »Die haben Beweise gegen dich, Jakob! Du hast in deren Augen mit den Nazis zusammengearbeitet und die Juden geschädigt!«
»Nein, habe ich natürlich nicht, Paul, und das weißt du! Ich habe Richard Stein immer verehrt, wir gehörten sozusagen zur Familie. Sie haben uns vertraut!«
»Die drehen die Tatsachen doch so, wie es ihnen gerade in den Kram passt!« Paul Gutmanns Stimme wurde schrill. »Kapierst du das denn nicht?! Du hast bei diesem Werttransport nach Linz unterschrieben!«
»Weil ich es musste! Der Nazi-Mensch stand doch mit seinen bewaffneten Leuten daneben!«
»Aber das ist doch den tschechischen Revolutionsgarden egal!« Paul Gutmann schrie inzwischen so laut, dass ich den Kopf einzog.
»Schrei doch nicht so, Paul«, flehte Vater. »Nicht vor den Kindern!«
Paul Gutmann sprang von seinem Stuhl auf. »Leute, ihr steckt tiefer drin als ihr denkt!«
»Dieser Mann aus Linz hat Richard Steins Privatvermögen mit zwei Lastwagen abholen lassen«, gab Mama nun verstört zu bedenken. »Antiquitäten, Teppiche, Silber, kostbare Bilder, wertvolle Weine: Alles ging nach Linz, in die Lieblingsstadt von Hitler.«
»Das Kriegsende war abzusehen …« Paul Gutmann steckte die Hände zurück in die Hosentaschen und starrte aus dem Fenster. »Da wollten die Nazis noch schnell alle jüdischen Wertsachen in Sicherheit bringen.«
Vati nickte vielsagend. »Aber was sollte ich denn machen? Zweimal fuhr der tschechische Lkw-Fahrer, Herr Liska, nach Linz! Und ich als Prokurist der Firma, musste die Fahrt genehmigen und den Mann entlohnen.«
»Und seine Frau, die Hausmeisterin, hat alles mit angesehen. Die ist eh so ein Tratschweib«, fügte Mama besorgt hinzu.
»Sag ich doch! Das könnte euch zum Verhängnis werden.« Paul Gutmann sah wirklich sehr besorgt aus.
Ich verstand nur die Hälfte, spürte aber deutlich, dass wir in einer Zwickmühle steckten.
Erst hatte Papa für einen Juden gearbeitet und sich damit zu Nazi-Zeiten auf Messers Schneide begeben, dann hatte er nach der Arisierung von dessen Firma an Unrecht mitwirken müssen, das ihm jetzt in die Schuhe geschoben werden sollte.
»Jakob, was sollen wir nur tun? Lass uns doch mit den Gutmanns gehen!« Mutters Hände zitterten. Ich schaute verängstigt von einem zum anderen. Der kleine Alex spürte die Anspannung im Raum, und aus kläglichem Weinen wurde verzweifeltes Schreien.
»Paul, nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird«, versuchte Vater die Wogen zu glätten. »Ich finde es lobenswert, dass du dich extra herbemüht hast, dass du uns mitnehmen willst. Aber ich kann weder Marie noch den Säugling noch meine fast zwölfjährige Tochter mit ins Ungewisse nehmen. Überall treiben russische Soldaten ihr Unwesen und vergewaltigen die Frauen. Und wenn es nicht die Russen sind, dann die tschechischen Revolutionsgarden. Wir haben hier noch den sichersten Unterschlupf. Nein, Paul, wir bleiben.«
Mir war schwindlig vor Angst. Ich verstand nur, dass es keine Lösung gab: Weggehen bedeutete etwas Grässliches und Bleiben auch. Ich schaute ratlos zwischen den Erwachsenen hin und her. Es war, als spielten sie ein Spiel, bei dem die Figuren beliebig ausgetauscht wurden, ein Spiel, bei dem es auf allen Seiten nur Verlierer gab.
Doch noch ließ Paul Gutmann nicht locker. Heftig rüttelte er an Vatis Schultern. »Jakob! Wieso steckst du den Kopf in den Sand? Hast du in Prag nicht selbst miterlebt, wie die Revolutionsgarden über die Deutschen herfallen? Du hast es doch mit eigenen Augen gesehen!«
»Ja, aber wir sind Tschechen.«
»Sie prügeln die Leute aus ihren Wohnungen und schlagen sie öffentlich halb tot, Männer, Frauen, Kinder – ganz egal!« Jetzt überschlug sich die Stimme von Paul Gutmann. »Hast du nicht mitbekommen, wie sie fünfzig Leute auf einen Todesmarsch geschickt haben? Die Züge, die angeblich für Frauen und Kinder am Bahnhof Bubny bereitstanden, konnten Prag nicht mehr verlassen!« Weinte er etwa? »Sie haben die deutschen Frauen und Kinder vierundzwanzig Stunden im Regen auf dem Bahnhof sitzen lassen, und als am frühen Morgen ein paar Dreizehnjährige aufstehen wollten, um für ihre Mütter und jüngeren Geschwister ein paar Äpfel von benachbarten Bäumen zu organisieren, wurden sie erst ausgepeitscht und dann vor den Augen ihrer Mütter erschossen!«
»Bitte Jakob! Nicht vor dem Kind!« Vati hielt mir die Ohren zu. Ich hatte aber alles genau mitbekommen. Schockiert starrte ich sie an. Ich war wie versteinert.
»Wir sitzen das aus«, entschied Papa. »Paul, ich danke dir, dass du dich herbemüht hast. Aber meine Entscheidung steht fest. Wir bleiben!«
6
Zahořany, kurz danach im Mai 1945
Wieder polterten schwere Stiefel auf der Treppe, wieder donnerten Tritte gegen unsere Zimmertür. Eng aneinandergekuschelt lagen wir zu viert im Bett und schreckten aus dem Schlaf.
»Jakob, was ist das?« Ängstlich klammerte sich meine arme Mama an Papa.
Tschechisch gebellte Befehle mischten sich unter die harschen Schläge. Holz splitterte. Jeden Moment würden sie die Tür eintreten!
»Jakob Vojan? Sofort aufmachen!«
»Die Revolutionsgarden!« Papa fuhr hoch. »Das muss ein Missverständnis sein! Ich kläre das. Wir sind Tschechen.«
Mama und ich krochen mit dem Baby vollends unter die Decke. Automatisch presste ich dem kleinen Alex die Hand auf den Mund, und wie durch ein Wunder hörte er auf zu schreien und begann, an meinem kleinen Finger zu saugen.
Diese jungen Männer wirkten wesentlich aggressiver und kompromissloser als die Russen. Ich konnte nur unter der Decke hervorspähen. Das waren also die Leute, vor denen Paul Gutmann sich so gefürchtet hatte!
»Meine Herren, beruhigen Sie sich, wir sind Tschechen!« Vati kramte geistesgegenwärtig unsere Ausweispapiere hervor und hielt sie ihnen mit zitternden Fingern entgegen.
Doch die jungen Männer waren voller Wut und Hass und nicht zu Diskussionen bereit. Sie hielten ihre Gewehre auf meinen armen Papa gerichtet.
»Jakob Vojan? Als Kollaborateur mit den Deutschen werden Sie zu Zwangsarbeit auf Gut Radlik abkommandiert. Sofort mitkommen!«
»Aber das muss ein Missverständnis sein …« Papa stand wehrlos in Unterhosen und barfuß da, suchte panisch nach seiner Brille. »Wir sind Tschechen, das habe ich doch schon erklärt.«
Papas Einwände wurden durch einen dumpfen Schlag mit dem Gewehrkolben erstickt. Entsetzt musste ich mit ansehen, wie seine runde Nickelbrille auf den Boden fiel, begleitet von Blutstropfen. Unter schweren Stiefeln zerbrach sie zu tausend Scherben.
»Halt’s Maul, Nazi.«
Einer von ihnen riss die Decke weg, unter der wir wie zitternde Vögelchen im Nest hockten.
Er war jung, höchstens siebzehn, achtzehn. »Und du deutsche Sau …« – er zeigte auf meine Mutter, die schutzlos im Nachthemd auf dem Bett kauerte – »… hast Hausarrest. Jeder, der dich auf der Straße sieht, ist berechtigt, dich totzuschlagen. Dich und deine Bastarde!«
Ich konnte vor Angst nicht atmen. Bestimmt würden sie uns jetzt zu Brei schlagen. Andererseits hatten sie gesehen, wie wehrlos wir waren, und sie hatten das Baby bemerkt.
Der blutrünstige Mann mit der roten Armbinde packte Papa, der aus der Nase blutete. »Wird’s bald, Deutschen-Freund!«
Ein anderer schrie: »Das Fahrrad und das Radio sind hiermit beschlagnahmt.«
Die Männer rissen das Radio, das Papa aus Prag mitgebracht hatte, an sich und nahmen auch sein Fahrrad, das draußen an der Hauswand lehnte.
Papa, inzwischen blind wie ein Maulwurf, hatte kaum Zeit, in seine Hose zu steigen und in sein Hemd zu schlüpfen. Sie schleiften ihn regelrecht aus der Tür, hinaus aus dem Haus. Mit dem Diebstahl von Radio und Fahrrad nahmen sie uns den letzten Kontakt zur Außenwelt.
Mama und ich lagen bestimmt noch Stunden wie erstarrt unter der Decke, das Baby an uns gepresst.
Papa war weg! Unser geliebter, zuverlässiger Papa, der immer die Ruhe bewahrt hatte!
Ich wurde das Bild nicht los, wie sie ihn wegschleiften, wie er sich vor Schmerzen krümmte und uns noch nicht mal mehr winken konnte.
Alles, wovor uns Paul Gutmann letzte Woche gewarnt hatte, war eingetroffen!
Ich konnte es nicht fassen. Papas Fehlentscheidung war unsere Schicksalsentscheidung.
Papa kam nicht mehr. Niemand sorgte für uns, wenn ich es nicht tat.
Die Kinder warfen zwar nicht mehr mit Steinen nach mir, behandelten mich aber wie Luft.
Keiner half mir, wenn ich mit meinen Besorgungen aus dem Nachbardorf über die staubige Schotterstraße wankte. Lebensmittelmarken bekamen wir nicht. Auch nicht für Alex, denn in ihren Augen war er ein deutscher Säugling.
»He, du! Bist du nicht die kleine Vojanová aus Prag?«