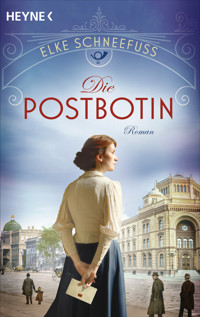9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
Berlin im Aufbruch: Drei Frauen. Drei Schicksale. Drei Wege, die sich kreuzen.
Berlin 1918: Das Land ist erschüttert von den Folgen des Ersten Weltkrieges. In Berlin tobt die Novemberrevolution. In diesen Tagen begegnen sich der Matrose Benno und die Schneiderstochter Vera und verlieben sich sofort ineinander. Was Benno nicht ahnt: Seine Jugendliebe Fritzi ist auf der Suche nach ihm und will ihn zurückholen. Auch die Fabrikantentochter Hanna reist in diesen Tagen in die verschneite Hauptstadt und schmiedet Pläne für eine selbstbestimmte Zukunft. Die drei Frauen sind davon überzeugt, dass endlich besser Zeiten vor ihnen liegen und sie sind bereit, alles dafür zu tun, ihre Träume zu verwirklichen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 502
Ähnliche
Das Buch
Der Krieg hat den Berlinern viel genommen und der Winter 1918 ist hart, doch das Weihnachtsfest soll für drei junge Frauen der Wendepunkt in ihrem Leben werden. Die junge Mutter Fritzi macht sich aus ihrem kleinen Dorf in Schleswig-Holstein auf den Weg in die große Stadt Berlin, um den Vater ihrer Tochter zu finden. Währenddessen gewährt in Friedrichshain Schneiderin Vera einem Matrosen Unterschlupf in der Werkstatt ihres Vaters, wo die beiden sich bald näherkommen. Und die Krankenschwester Hanna kehrt zurück von der Front zu ihrer Familie nach Dahlem. Ihre Eltern wünschen sich eine gute Partie für sie. Doch Hanna hat ganz andere Pläne.
Das Glück scheint unerreichbar in diesen düsteren Tagen, aber die drei Frauen erkennen: Sie müssen nur lernen, auf eigenen Beinen zu stehen und mutig ihrem Herzen zu folgen. Dann kann sie nichts aufhalten.
Die Autorin
Elke Schneefuß wurde 1960 in Lüneburg geboren. Sie hat Rechtswissenschaft studiert und schreibt für regionale und überregionale Tageszeitungen. Mit ihrer Familie lebt sie in Lüneburg und begeistert sich seit Jahren für die spannenden historischen Umbrüche in der Zeit der Weimarer Republik, besonders in Berlin und Umgebung.
ELKE SCHNEEFUSS
Die
FRAUEN
vom
ALEXANDERPLATZ
WILHELM HEYNE VERLAGMÜNCHEN
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Originalausgabe 02/2020
Copyright © 2020 dieser Ausgabe by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Susann Rehlein
Umschlaggestaltung: Nele Schütz Design, München,
unter Verwendung von adobeStock (holger.l.berlin) und Richard Jenkins
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN: 978-3-641-24740-9V001
www.heyne.de
1. Kapitel
Heiligabend 1918
Zum ersten Mal in ihrem Leben steckten ihre Beine in zwei engen Röhren aus Stoff: Komisch sah das aus. Trotzdem, Georgs Hose anzuziehen war eine gute Idee gewesen. Die Beine fühlten sich überraschend warm darin an. Ärgerlich waren nur die Hosenträger, die Vera dauernd von den Schultern rutschten. Energisch rückte sie die Dinger ein weiteres Mal gerade, dann schob sie die Haare zurück unter die Schiebermütze. Natürlich waren ihr die Kleider ihres Bruders zu groß, aber sie fiel hoffentlich nicht auf in der Montur. Es war ohnehin kaum jemand unterwegs. Sie ließ die Blicke schweifen, doch in der gesamten Gertraudenstraße rührte sich nichts.
Ob sie wirklich alleine war hier draußen?
Vera spitzte die Ohren, die Stille fühlte sich eigenartig und bedrückend an. Vielleicht lagen Soldaten in den Hauseingängen, die sie aus ihren Verstecken heraus beobachteten? Möglich war es, Soldaten waren inzwischen überall. Vor Kurzem hatten Truppen der ehemaligen Reichswehr das Stadtschloss unter Beschuss genommen, um die sogenannte Volksmarine zum Teufel zu jagen. Die Kerle hatten sich im Schloss verschanzt, Meuterer aus dem Norden, versprengte Matrosen aus Kiel und Wilhelmshaven waren das. Konnten diese Idioten nicht wenigstens über die Weihnachtsfeiertage Frieden halten? Die Berliner hatten genug vom Krieg, trotzdem stand zu befürchten, dass die Soldaten mit ihren Schießereien das noble Viertel rund ums Schloss dem Erdboden gleichmachen würden. Schade drum. Früher war in der Gertraudenstraße immer etwas los gewesen. Spaziergänger, Fuhrwerke und mittendrin die Elektrische. Jetzt unheilvolle Stille, die Winterluft eisig und ungewohnt klar. War diese Leere nicht verdächtig? Da konnte man froh sein, wenn man etwas weiter im Norden zu Hause war, in den Gassen hinter dem Alexanderplatz war es bisher ruhig geblieben. Natürlich konnte sich das jederzeit ändern. Die instabile Regierung hatte die Lage nicht im Griff. Aufruhr, Straßenschlachten zwischen den Kommunisten und der Reichswehr, die Roten gegen die Regierung Ebert, die Oberste Heeresleitung gegen die Roten, jeder gegen jeden. Eine Schande war das.
Schluss jetzt, die Zeit drängte, sie musste sich sputen. Noch konnte Vera sich im Windschatten der Häuser halten, aber wenn sie gleich die Straße betrat, wurde sie zum Freiwild für Heckenschützen. Es war gefährlich weiterzugehen, aber umkehren konnte sie auch nicht. Mutter hatte es mal wieder am Herzen und brauchte einen Arzt. Die letzte Nacht war furchtbar gewesen, dieses Würgen, das Japsen nach Luft, so lange, bis sie blau wurde im Gesicht. Nicht zum Aushalten, zumal, wenn man nur danebenstand und nichts tun konnte. Vera musste zum Doktor und zumindest Mutters Tabletten besorgen, jetzt gleich. Einmal noch tief durchatmen, dann rannte sie los, auf die Straße hinaus. Das Echo ihrer Schritte hallte in ihren Ohren. Hastig und mit großen Schritten überquerte sie das Kopfsteinpflaster, doch schon nach ein paar Metern keuchte sie. Schweiß stand ihr auf der Stirn, der Kälte zum Trotz. Zum Glück kam endlich das Haus des Doktors in Sicht. In gebückter Haltung eilte sie darauf zu und war gerade am Zigarrenladen vorbei, da knallte es plötzlich – war das ein Schuss gewesen? Die Angst packte sie, doch sie durfte nicht stehen bleiben, auch wenn ihre Beine sich anfühlten wie Fahrradschläuche ohne Luft. Vielleicht besser Schutz suchen in einem Hauseingang? Die Lage überprüfen, bevor sie weiterhastete? Eine Toreinfahrt tat sich rechts von ihr auf, die kam wie gerufen. Mit einem großen Satz ging Vera hinter dem Torpfosten in Deckung. Ihr Herz pochte, sie versuchte, nicht drauf zu achten, sie lauschte angestrengt: Kam da wer, waren Bewaffnete in der Nähe? Zum Glück blieb es still auf der Straße, vielleicht hatte sie sich den Schuss bloß eingebildet. Vielleicht war nur ein Aschekübel umgefallen. Oder irgendwer hatte heftig eine Tür zugeschlagen. Vorsichtig spähte sie am Torbogen vorbei, auf die Straße hinaus. Niemand zu sehen. Verlassen lag das Viertel im bleichen Winterlicht. Falscher Alarm vermutlich, aber trotzdem würde sie noch einen Augenblick abwarten und versuchen, zu Atem zu kommen. Die Gertraudenstraße war im Moment ein heißes Pflaster. Früher war sie gerne hier gewesen, hatte die eleganten Geschäfte und Cafés bestaunt, heute jedoch waren die Schaufenster mit Gittern verrammelt, die Türen zugesperrt. Wozu auch die Läden öffnen? Zu kaufen gab es nach vier Jahren Krieg sowieso nichts mehr, nicht mal an Weihnachten.
Vera richtete sich auf, alles ruhig, immer noch, also schlich sie zum Bürgersteig zurück, sie lief weiter und huschte kurz darauf die Freitreppe vor dem Haus des Doktors hinauf. Das Messingschild seiner Praxis blinkte wie frisch poliert, schon drückte sie den Klingelknopf. Sie wartete, doch es blieb still im Haus, niemand kam. Erstaunt trat sie einen Schritt zurück und musterte die Fassade des Hauses: Alle Fensterläden waren verrammelt. Das Gebäude wirkte verlassen, nur eine große, rote Fahne hing schlapp von einem Balkon im ersten Stock. Was sollte das denn, seit wann war der Doktor bei den Roten? Komisch, und wie weiter jetzt?
Während Vera noch grübelte, näherten sich auf dem Pflaster hinter ihr auf einmal Schritte. Sie fuhr herum und entdeckte zwei Männer, der eine noch jung, der andere schon grauhaarig. Ein Matrose und ein Feldgrauer, beide mit roten Armbinden an den Ärmeln ihrer Joppe. Der Seemann hatte ein Gewehr dabei, es baumelte an einem Riemen über seiner Schulter. Revolutionäre, ohne Frage. Musste das sein, ausgerechnet jetzt? Hätten diese Kerle nicht ein paar Minuten später hier auftauchen können? Die Männer blieben am Fuß der Treppe stehen und starrten zu ihr herauf. Der kalte Schweiß brach ihr aus beim Anblick der beiden, ihre Knie zitterten, aber zeigen durfte sie ihre Angst jetzt nicht.
Der Feldgraue tippte sich grüßend an die Mütze.
»Frohe Weihnachten, Kamerad. Willste auch zum Doktor?«
Sie nickte bloß.
»Haste schon geklingelt?«
»Ja, hab ich, aber es macht keiner auf.«
»So, so.«
Der ältere der beiden Soldaten musterte sie forschend. Recht hatte er, ihre Stimme musste tiefer klingen, wenn sie als Knabe durchgehen wollte. Darum ging es schließlich bei dieser Maskerade, wozu sonst hatte sie Georgs Klamotten aus dem Schrank geholt? Der Feldgraue kam die Treppe herauf.
»Bei Körner musste klingeln.«
»Weiß ich.«
»Na, denn geh mal beiseite, und lass Vatern machen.«
Der Uniformierte grinste, im nächsten Moment gab er ihr einen sanften Schubs. Vera griff eilig nach ihrer Kopfbedeckung, während der Feldgraue sich zum Klingelbrett vorbeugte. Seine Montur stank nach dem Schmutz der Straße, nach Zigarettenrauch und billigem Fusel. Mit krauser Stirn inspizierte er die Klingeltafel an der Wand. Sein Zeigefinger wanderte langsam über die Namensschilder, bis er plötzlich innehielt. Er wirkte verärgert, war wohl mit der Geduld schon am Ende. Auf einmal holte er mit dem rechten Bein aus, sein Stiefel knallte gegen die Haustür, einmal und noch einmal, das Holz ächzte, doch die Tür gab nicht nach. Erschrocken klammerte sich Vera an das Treppengeländer, sie wollte hier nur noch weg, der Kerl war anscheinend gefährlich. Mehrfach hatte sie in den letzten Tagen von Kriegsheimkehrern gehört, die nicht wiederzuerkennen waren, roh und gemein waren sie an der Front geworden, gerieten im Nu in Rage. Auch mit diesen beiden Kerlen hier war offensichtlich nicht gut Kirschen essen. Bloß weg, sie drehte sich um und wollte gerade die Treppe hinunter, als sie sich plötzlich dem Matrosen gegenübersah. Er hob seine Waffe an und lud sie durch, schon krachten Schüsse. Glas splitterte, der Geruch nach Schießpulver erfüllte die Luft, es regnete Glasscherben. Die Scheibe im oberen Teil der Haustür war geborsten, das Türschloss zerstört, sein Messingbeschlag hing nur noch an einem einzigen Nagel.
»Na also, geht doch. Schönen Dank auch, Kamerad.«
Der Feldgraue grinste, dann gab er der Haustür einen Stoß, quietschend öffnete sie sich, schon war der Soldat im Gebäude verschwunden. Fassungslos starrte Vera ihm hinterher: Der Weg zum Doktor war nun frei, aber sollte sie dem Soldaten wirklich ins Haus folgen? Was, wenn die beiden Burschen drinnen weiter randalierten und um sich schossen? Am liebsten hätte sie auf dem Absatz kehrtgemacht und wäre getürmt, doch Mutter brauchte ihre Medikamente. Wie zur Salzsäule erstarrt stand Vera an ihrem Platz vor der Türschwelle, als plötzlich der Matrose sie beim Arm nahm.
»So, Kleiner, das hätten wir. Jetzt verkrümeln wir uns. Du kommst mit mir, verstanden?«
Vera riss die Augen auf: Was redete der Matrose da, sie sollte mit ihm gehen? Wohin denn wohl? Vielleicht hatte er ihre Maskerade durchschaut – wenn er bemerkt hatte, dass sie eine Frau war, war sie geliefert. Ihr Körper zitterte, am liebsten hätte sie losgeheult, doch sie biss die Zähne zusammen und hielt dem Blick des Matrosen stand. Er zwinkerte ihr zu, doch sie konnte sein Getue nicht deuten, es machte ihr nur Angst – auch wenn er nicht schlecht aussah, der Revolutionär. Schlank, hochgewachsen, obendrein blonde Haare, wie es sich für einen Seemann gehörte. Nun gut, sein Aussehen war das eine, aber was für eine Sorte Mensch war er wohl? An seiner Gutmütigkeit durfte man Zweifel haben, so wie der eben mit der Flinte auf die Tür des Doktors gefeuert hatte. Ihr Blick tauchte ein in das tiefe Blau seiner Augen, suchend und tastend, nur nicht untergehen darin. Gleich darauf gab er ihr einen Wink.
»Komm schon, wir beide hauen ab.«
Vera schüttelte den Kopf, sie musste dagegenhalten, doch sie bekam kein Wort heraus. Hatte er eben nicht noch zum Doktor gewollt, der Matrose? Warum türmte er dann jetzt, wo die Haustür doch offen stand?
»Was ist los? Hast du Bohnen in den Ohren? Abmarsch, habe ich gesagt.«
Er nahm ihren Arm, fester als beim ersten Mal, er zerrte sie mit Gewalt die Treppe hinunter. Schon standen sie auf dem Gehsteig vor dem Haus, Vera warf einen Blick in die Runde, doch sie waren allein auf weiter Flur, nirgendwo Hilfe in Sicht. Vera schluckte, verzweifelt auf der Suche nach den richtigen Worten.
»Wollen Sie – wollen Sie denn nicht mehr zum Doktor? Die Tür ist jetzt offen.«
»Wenn ich das wollte, hätte ich dich nicht die Treppe runtergeschubst, oder? Los, wir ziehen Leine.«
»Aber ich muss noch …«
»Musst du nicht. Du tust, was ich dir sage, verstanden?«
Sie schüttelte den Kopf, doch bevor sie lauthals protestieren konnte, hatte der Matrose ihr auch schon eine Kopfnuss verpasst. Ihr wurde schwindelig, der Schädel dröhnte, doch der Matrose packte sie am Ärmel ihrer Jacke und zerrte sie, das Gewehr in der anderen Hand, ein Stück die Straße hinunter. Sie stolperte ihm hinterher, es ging nicht anders, der Bursche hatte ja schon gezeigt, wozu er fähig war. Endlich fasste Vera Tritt und richtete sich auf, tapfer marschierte sie weiter, auch wenn sie sich noch immer wie betäubt fühlte. Im Gänsemarsch liefen sie eine Weile, sie noch unsicher und ein wenig taumelnd, ihr schmerzte der Kopf. Der Fremde blieb ihr dicht auf den Fersen, bis er irgendwann aufschloss zu ihr. Die Bänder seiner Matrosenmütze flatterten im Wind.
»Wo wohnst du, mein Junge?«
»Palisadenstraße. Hinterm Alexanderplatz.«
Ihr Seemann schwieg – kannte er diese Ecke der Stadt, oder warum sonst guckte er so misstrauisch? Der Alexanderplatz war ein raues Pflaster. Ein paar Straßen weiter begann das Scheunenviertel. Viele arme Leute lebten dort, Juden, Zuwanderer aus dem Osten, an jeder Ecke gab es schmutzige Kneipen mit billigen Huren. Die Palisadenstraße dagegen war noch in Ordnung, da lebten kleine Handwerker, auch Arbeiter, dort war es längst nicht so armselig wie um die Münzstraße herum. Wusste er das, der Matrose? Wahrscheinlich nicht, wenn er doch Seemann war und von der Küste kam, da konnte er sich nicht auskennen.
Er schob die Mütze ein Stück in den Nacken. »Palisadenstraße also. Und wie weit ist das von hier?«
»Kommt drauf an, wie schnell man geht, aber mindestens zwanzig Minuten braucht man zu Fuß.«
»In Ordnung. Du bringst mich zu dir nach Hause, verstanden? Und keine Mätzchen unterwegs, sonst wird es ungemütlich.«
Sie nickte, aber in ihrem Kopf arbeitete es fieberhaft. Sie musste ihn loswerden, den roten Matrosen, sie konnte doch keinen Soldaten mit nach Hause bringen. Mutter hatte es am Herzen, sie durfte sich nicht aufregen, hatte der Doktor gesagt. Vera trug die Verantwortung für die Familie und den Haushalt, sie allein hielt alle Fäden in der Hand. Georg noch im Krieg und Vater tot, auf dem Totenbett hatte sie ihm versprochen, auf die Mutter gut aufzupassen. Dass alles wieder werden würde wie früher, sie hatte Vater ihr Wort gegeben. Leider sah es im Moment nicht danach aus, als wenn sie ihr Versprechen würde halten können. Wenn sie mit einem Revolutionär nach Hause kam, noch dazu ohne Mutters Tabletten, was würde Mutter sich da aufregen. Andererseits, was konnte sie schon gegen einen Bewaffneten tun? Davonlaufen? Aber der Matrose hätte sie schnell eingeholt. Um Hilfe schreien? Weit und breit keiner da, der sie hören würde. Nein, sie kam vorerst nicht raus aus dieser Geschichte.
Veras Blick glitt zu Boden. Wie schrecklich das alles war. Hatte die Familie nicht seit Vaters Tod vor zwei Jahren genug durchgemacht? Mutters Krankheit, der Niedergang der Firma und Georg Gott weiß wo an der Front – es waren ja noch längst nicht alle Männer wieder zu Hause. Bei ihnen daheim der Hunger, die Kälte, die Schießereien in der Stadt, und jetzt der Matrose mit seinem Gewehr. Warum war sie so dämlich gewesen und hatte an Heiligabend zum Doktor laufen müssen? Weil sie alleine war mit allem, seitdem Vater nicht mehr da war, deshalb. Einer musste die Familie zusammenhalten. Es war keiner mehr da außer ihr.
Ein Blick aus dem Augenwinkel, aber der Matrose blieb an ihrer Seite, er schien sie seinerseits zu beobachten. Es gab kein Entkommen. Tränen stiegen in ihr auf, doch das würde sie dem Matrosen nicht gönnen, dass sie seinetwegen zu heulen anfing, noch dazu auf offener Straße. Für einen kurzen Moment schloss sie die Augen: Wie sollte ein Tag enden, der mit einer solchen Katastrophe begonnen hatte?
***
Hanna Münchow ließ sich gegen die Rückenlehne des Automobils sinken. Draußen zogen zwei Revolutionäre vorbei, der eine im Matrosenanzug, der andere in Zivil und mit Schiebermütze. Sah aus, als würden die beiden miteinander spazieren gehen, taten sie aber nicht, denn der Matrose hatte sein Gewehr im Anschlag. Ein seltsames Bild – gingen sie jetzt etwa schon gegenseitig aufeinander los, die Roten? Weihnachten und die Stadt im Chaos. Schon am Lehrter Bahnhof hatte sie gehört, dass die Kaiserlichen mit Gewalt versuchten, die Volksmarine aus der Stadt zu jagen. In der Innenstadt wurde gekämpft, Aufruhr in den Straßen. Der erste Taxifahrer hatte sie nicht fahren wollen deswegen, ein zweiter hatte die Fahrt übernommen, natürlich zu einem überhöhten Preis, von dem sie auch noch die Hälfte hatte vorab bezahlen müssen. Ärgerlich, das Ganze, ärgerlich und gefährlich, doch wie sollte sie sonst nach Hause kommen? Wohl war ihr nicht dabei. Musste der Fahrer denn auch eine Route mitten durch die Innenstadt wählen? Wozu im Osten rumkurven, wenn sie doch nach Südwesten wollte? Das Taxi ratterte und hustete, hoffentlich schaffte die alte Karre es überhaupt bis nach Dahlem. Vieles hatte der Krieg ihnen genommen, auch etliche Automobile. Jede Menge Fahrzeuge waren zu Kriegszwecken von den Herren im Reichswehrministerium beschlagnahmt worden. Was jetzt noch auf den Straßen unterwegs war, hatte häufig die besten Zeiten hinter sich.
Hanna beugte sich zum Fahrer vor. »Können Sie bitte einen anderen Weg nehmen? Weiter weg vom Stadtschloss?«
Ihr Fahrer warf ihr im Rückspiegel einen kurzen Blick zu, würdigte sie aber keiner Antwort, er setzte seine Fahrt einfach fort. Der holperte mit seiner Karre mitten über den Alexanderplatz, so ein Idiot, was sollte das denn? Womöglich gab es einen Grund dafür, aber warum nannte er ihr den nicht? Wieder so einer, der sich von einer Frau nichts sagen lassen wollte. Mit Männern wie ihm hatte sie an der Front oft zu tun gehabt. Schwester hier, Schwester da – wenn es ihnen dreckig ging, waren sie so klein mit Hut, aber wehe, es wurde besser. Prompt blickten sie herab auf die Frauen, die für ihr Wohlergehen sorgten. Kopfschüttelnd saß sie auf ihrem Platz und sprach sich Mut zu: Das Beste war, sich nicht aufzuregen. Draußen dünnten allmählich die Häuserzeilen aus, die Bebauung wurde spärlicher. Hatten die Fassaden der Vorstädte vor dem Krieg auch einen so armseligen Anblick geboten? Hanna empfand ihre Heimkehr schon jetzt als verpfuscht. Vielleicht lag es am Wetter oder allgemein an der Stimmung, in der sie sich befand. Ein bisschen Enttäuschung, ein bisschen Liebeskummer, daraus entstand eine gewisse Melancholie. Erst der traurige Abschied von Cora, dann die unendlich lange Fahrt aus dem Osten hierher, eingepfercht zwischen Kriegsheimkehrern. Eiskalt war es in den Waggons gewesen, die Reichsbahn bot ihren heimkehrenden Helden und Vaterlandverteidigern nur Plätze in der Holzklasse an. Einer der Männer war unterwegs zudringlich geworden, musste erst von den Kameraden zur Raison gebracht werden, und keine Schwesternuniform mehr da, die sie beschützte. Hanna hatte gehofft, dass wenigstens ihr Vater heute zum Bahnhof kommen würde, um sie abzuholen, aber das hatte er nicht getan. Vielleicht hatte er ihr Telegramm nicht bekommen, vielleicht war ihm der Weg zum Bahnhof zu gefährlich erschienen. Jedenfalls hatte sie zusehen müssen, wie sie allein nach Hause kam.
Mit einem Ruck zog sie den Mantel enger um den Leib, auch im Taxi war es frostig. Die Augen fielen ihr beinahe zu – die lange Reise, die Erschöpfung. Noch bis vor Kurzem war sie im Krankenhaus unermüdlich auf den Beinen gewesen, Tag für Tag, bis die Oberschwester plötzlich im Stationszimmer aufgetaucht war und die Auflösung aller Lazarette verkündet hatte. Anfangs hatte es niemand so recht glauben wollen, doch diesmal war wirklich Schluss gewesen: Eine Schwester nach der anderen hatte das Reservelazarett in Bromberg verlassen. Aus und vorbei, für immer. Ein komisches Gefühl.
Das Automobil stoppte. Der Taxifahrer, ein unauffälliger Mann in den mittleren Jahren, drehte sich zu ihr um und hielt die Hand auf.
»Da wär’n wir. Ich krieg noch drei Märker, junge Frau.«
Hanna bezahlte schweigend und stieg aus, der Fahrer machte sich nicht die Mühe, ihr mit der Reisetasche zu helfen. Schon knirschten die Reifen im Kies, die Taxe verschwand. Frierend musterte Hanna das Haus vor sich. Da war sie also wieder. Ihr Blick glitt über die helle Fassade der elterlichen Villa. Das Gebäude schien unverändert, die prachtvollen Säulen am Portal, die hohen Fenster, alles noch da, aber es brannte nirgendwo Licht – dabei musste doch jemand da sein, heute, an Heiligabend? Hanna klingelte, doch niemand kam, sie musste mit ihrem eigenen Haustürschlüssel aufsperren. Das Foyer war dunkel, es wirkte verlassen und leer, kein Weihnachtsbaum wie sonst all die Jahre. Endlich ein Geräusch aus dem Wohnzimmer: Perlendes Gelächter, da war scheinbar jemand höchst amüsiert. Irene war zu Hause, aber mit wem scherzte sie da? Hanna setzte ihre Tasche ab, sie ging zur Wohnzimmertür und lauschte: War vielleicht eine ihrer Schwestern eingetroffen, Amelie aus Breslau oder Lilli aus Erfurt, mit der ganzen Sippe im Schlepptau? Nichts dergleichen, stattdessen eine fremde Männerstimme hinter der Tür, definitiv jemand, den Hanna nicht kannte. Eine böse Vorahnung überkam sie, unangenehm, auch nur daran zu denken, aber bei Irene musste man mit allem rechnen. Es war eine Bürde, die eigene Mutter nicht zu mögen, doch Hanna trug diese Last seit vielen Jahren. Eine freudlose Kindheit hatte sie hinter sich, auch wenn wenn Irene als Mutter und Ehefrau zumindest scheinbar genau das getan hatte, was von ihr erwartet worden war. Vier Kindern hatte sie das Leben geschenkt, kurz hintereinander waren ihre Töchter zur Welt gekommen. Victoria-Luise, Amelie-Henriette und Elisabeth-Christine, schließlich, zu guter Letzt: Hanna. Danach keine Schwangerschaften mehr, Irene hatte ihre Pflicht getan. Ihre Töchter bedeuteten ihr offenbar wenig, sie kümmerte sich kaum um die Mädchen. Nachdem ihre älteren Schwestern in Internate abgeschoben worden waren, hatte Hanna sich zu Hause oft allein gefühlt. Wenn Papa keine Zeit für sie hatte aufbringen können, waren es Kindermädchen und Gouvernanten gewesen, die allerdings kamen und gingen. Irene lebte ihr Leben anderswo, auf Bällen, Empfängen und in der Oper.
Und womit vertrieb die gnädige Frau sich heute die Zeit? Kurz entschlossen drückte Hanna die Türklinke und betrat das Wohnzimmer, das ihr im ersten Augenblick fremd vorkam. Dunkel war es, nur die Flammen der Kerzen, die in dem großen Silberleuchter am Fenster brannten, zitterten leicht in der Zugluft. Im Sessel daneben, wo sonst Hannas Vater seine Zeitung las, saß ein unbekannter junger Mann in Uniform. Irene strahlte ihn an, wahrscheinlich hatte sie sich vorgenommen, mit ihrem Funkeln und Strahlen den Weihnachtsbaum zu ersetzen, der fehlte nämlich. Stille im Raum, endlich wandte Irene sich ihrer Tochter zu, die Stirn leicht gekraust, der Fältchen zum Trotz, die eine solche Mimik verursachte. Es war nicht zu übersehen, sie fühlte sich gestört, dabei hätte sie wissen müssen, dass ein Rendezvous mit einem Verehrer an Heiligabend nicht ohne Störungen ablaufen konnte. Der Uniformierte immerhin stand auf. Er deutete eine Verbeugung an.
»Guten Tag, gnädiges Fräulein. Ich wünsche ein besinnliches Fest. Fröhliche Weihnachten.«
Endlich erhob sich auch Irene aus ihrem Sessel. Sie trug etwas eng Geschnittenes in Nachtblau, tief dekolletiert. Die Pailletten am Ausschnitt des Kleides glitzerten wie Sterne in einer klaren Winternacht – so eine große Robe war eindeutig unpassend für diese Gelegenheit, zu aufwendig und zu aufsehenerregend, auch wenn Hanna zugeben musste, dass das Dekolleté ihrer inzwischen 48 Jahre alten Mutter immer noch sehenswert war.
»Hanna, was für eine Überraschung.« Irene lächelte nicht, sie machte auch keine Anstalten, ihre Tochter zur Begrüßung zu umarmen. »Ich wusste nicht, dass du kommen würdest. Warum hast du uns nicht geschrieben?«
»Ich habe euch ein Telegramm geschickt. Wo ist Papa, wenn ich fragen darf?«
Keine Antwort, Irenes Schweigen wirkte feindlich. Natürlich, im Grunde war die letzte Frage überflüssig, Hanna konnte sich denken, was hier vor sich ging. Während Papa arbeitete, empfing Irene einen Verehrer. Sie ließ sich gern und häufig von Männern hofieren, die ihre Söhne hätten sein können. Das war albern und peinlich, aber sie brauchte wahrscheinlich immer wieder neue Beweise dafür, wie schön und verführerisch sie doch war, der Zahl ihrer Jahre zum Trotz. Ihre Schamlosigkeit und ihr Egoismus waren zwei der Gründe, warum Hanna ihre Mutter nicht mochte.
Irene strich ihre Robe glatt. »Dein Vater ist im Büro, aber er wird zum Abendessen zu uns stoßen.«
»Und Gustav? Wo ist Gustav?«
»Ich habe ihm über Weihnachten freigegeben, damit er seine Familie besuchen kann. Ich darf dir Herrn Leutnant Christoph Vogler vorstellen. Er kommt geradewegs von der Front, genau wie du.«
»Sehr erfreut, gnädiges Fräulein.«
Der Herr Leutnant deutete erneut eine Verbeugung an und senkte dabei den Kopf. Ihr Blick glitt über sein gestriegeltes, glänzendes Haar. Der junge Mann wirkte wie frisch gewaschen und gebügelt, so sauber, dass sie ihn sich überhaupt nicht an der Front vorstellen konnte. Was hatte er während der grausamen Kampfhandlungen getan, dieser aalglatte Bursche? Den Herren Offizieren die Bleistifte angespitzt? Ihnen Tee gekocht und ihre Stiefel gewichst? Im Feld herrschte außer dem Schmutz nur die Verzweiflung, zu einem Herrn Vogler passte beides nicht. Hanna schenkte ihm dennoch ein kurzes Lächeln.
»Die Freude ist ganz meinerseits, Herr Leutnant.«
Das war’s, damit war die Begrüßung erledigt, keiner von ihnen dreien schien noch etwas sagen zu wollen. Hanna schwieg beharrlich. Diesen Lackaffen von einem Offizier an Heiligabend hierher einzuladen war unverschämt, Weihnachten war ein Fest der Familie. Wie viel Bitterkeit ihr diese Heimkehr doch bereitete. Wenigstens der Kummer über das Betragen ihrer Mutter war an der Front weit weg gewesen. Als Hilfsschwester in den Lazaretten zu schuften war nicht leicht gewesen, doch dort war sie herzlichen, wunderbaren Menschen begegnet, denen ihre Mutter nicht das Wasser reichen konnte.
»Sie haben als Schwester im Westen gearbeitet?« Der Leutnant suchte ihren Blick, wahrscheinlich empfand er die Stille als peinlich, dennoch, seine Stimme klang höchst gelangweilt. Es war Heiligabend, sie wollte höflich bleiben, was konnte dieser Mann dafür, dass Hanna ihre eigene Mutter nicht mochte? Sie nickte langsam.
»Ich war zuletzt in einem Reservelazarett in Westpreußen. Aber ich möchte Sie nicht an einem so festlichen Tag mit Geschichten von Tod und Elend langweilen.«
Der Leutnant stutzte, der höhnische Unterton in ihrer Stimme war kaum zu überhören. Irene kniff die Augen zusammen, die unter der großzügig aufgetragenen Schminke von einem Kranz aus Fältchen umrahmt wurden. Hanna wandte sich ab und hielt auf die Tür zu. Mochten die beiden Turteltauben sich weiter miteinander vergnügen, sie wollte nichts mehr davon wissen.
»Ich bin müde von der Reise und möchte nicht länger stören. Ich gehe auf mein Zimmer und lege mich ein wenig hin.«
Ohne Irenes Tadel abzuwarten, verließ Hanna den Raum.
Wie ungeheuer anstrengend es doch war, zu Hause zu sein. Mit einem Schlag waren sie alle wieder da, die alten Schwierigkeiten und Sorgen. Von heute an würde sie bestimmt tagein, tagaus die Klingen mit Irene kreuzen, genau wie früher. Mutter und Tochter, gefangen in einem endlosen, erbitterten Streit, und kein Ende in Sicht. Diese Feindschaft war einer der Gründe, warum Hanna seinerzeit als eine der ersten Frauen in dieser Stadt freiwillig Hilfsschwester geworden war.
Sie schloss die Wohnzimmertür und blieb für einen Moment in der Halle stehen, den Blick auf ihre abgenutzte Reisetasche gerichtet, die noch auf dem Fußboden neben der Garderobe stand. Jetzt war ihr ganz und gar nicht mehr weihnachtlich zumute, doch in diesem Moment drehte sich ein Schlüssel in der Haustür, und Papa trat ein, an seiner Seite Wolfgang Hartwig, der junge Ingenieur, den er vor dem Krieg eingestellt und zum Leiter seiner Konstruktionsabteilung gemacht hatte. Papa war endlich zu Hause, das war ein Lichtblick. Hanna breitete die Arme aus, strahlend flog sie ihm entgegen, so stürmisch, dass er gerade noch Zeit hatte, seine schwere Aktentasche auf den Fußboden gleiten zu lassen. Lachend fielen sie einander in die Arme, während Wolfgang Hartwig einen Schritt beiseite machen musste, um ihnen nicht im Weg zu stehen. Hanna klammerte sich an ihren geliebten Papa, sie küsste ihn auf beide Wangen und hielt ihn fest, bis er sie lächelnd ein Stück beiseiteschob.
»Hanna, mein Kind, wie schön, dass du wieder da bist. Und das an Weihnachten. Du erinnerst dich an Herrn Hartwig, nicht wahr?«
»Herzlich willkommen daheim, gnädiges Fräulein. Und frohe Festtage.«
»Danke, Herr Hartwig. Das wünsche ich Ihnen auch.«
Hanna bemühte sich um ein Lächeln, auch wenn sie die Gegenwart dieses jungen Mannes im Moment eher als störend empfand, was vielleicht ungerecht war, denn Hartwig besaß durchaus etwas Helles, Strahlendes. Er konnte einem in Gesprächen unter vier Augen sehr nahekommen. Vor dem Krieg hatte sie sich manchmal gefragt, ob da mehr beabsichtigt war von seiner Seite, ob er vielleicht auf behutsame, altmodische Weise um sie warb.
Papa griff nach seiner Aktentasche. »Tut mir leid, mein Kind, aber wir sprechen uns später. Im Moment habe ich noch mit Herrn Hartwig zu arbeiten.«
»Was denn, jetzt? An Heiligabend?«
Vater nickte, erst jetzt fiel ihr auf, wie blass er wirkte. Sicher war er überarbeitet, niemand in diesem Haus achtete auf sein Wohlergehen. Das würde sich ändern müssen.
»Willst du dich nicht ein wenig ausruhen? Ich kann hinuntergehen und der Köchin Bescheid geben, bestimmt können wir gleich essen.«
Vater schüttelte den Kopf.
»Wir haben Dringendes zu besprechen, Kind, deshalb ist Herr Hartwig hier. In einer Stunde gibt es Abendessen, vorher nicht. Wir unterhalten uns bei Tisch, ja?«
Vater wandte sich ab, Hartwig zuckte bedauernd mit den Schultern und folgte seinem Chef ins Herrenzimmer. Hanna blieb allein zurück, schweigend sah sie zu, wie sich die Tür hinter den beiden Männern schloss. Sie war enttäuscht, aber wie sollte es auch anders sein, hier in Dahlem hatte sich nichts verändert. Irene tanzte Papa weiter auf der Nase herum, und er bemerkte es nicht, weil er von früh bis spät arbeitete. Sein Fleiß ermöglichte Irene den unmoralischen Lebenswandel, den sie führte. Eine Zumutung, aber es half nichts, vorerst würde Hanna sich fügen müssen. Immerhin brachte sie die Erinnerung an Cora mit nach Hause, das war ihre Zuflucht und ihr Trost. Die Zeit mit Cora konnte ihr niemand nehmen – diese Liebe trug sie in sich, auch wenn es nicht einfach gewesen war für sie beide. Das Lazarett war überschaubar, die Angst, entdeckt zu werden, war groß gewesen. Im Keller, in den Abstellräumen oder auf dem Dachboden des Krankenhauses hatten sie sich versteckt – manchmal bloß für ein paar Minuten, bis eine von ihnen beiden wieder auf Station sein musste. Unsere Sterne funkeln nur für uns beide, hatte Cora zum Abschied gesagt, und es stimmte. Ihre Liebe existierte bisher nur im Geheimen, doch das sollte sich bald ändern.
Hanna bückte sich, sie nahm ihre Reisetasche und stieg die Treppe hinauf. Gleich nach Weihnachten würde sie den Kampf um ihre Freiheit beginnen, furchtlos und mutig wollte sie sein. Sie musste an ihr Ziel glauben, ganz fest, darauf kam es an.
***
»Verflucht, ist das dunkel. Wo sind wir hier?« Der Matrose nahm sein Gewehr von der Schulter, während Vera sich darum bemühte, Licht zu machen. Es war wirklich düster in der alten Schneiderwerkstatt, selbst tagsüber fiel kaum ein Sonnenstrahl in das Gebäude auf dem Hinterhof – kein Wunder, gleich nach dem Tod des Vaters hatten sie die Fenster mit Säcken verhängt, und dabei war es geblieben. Ein Zeichen der Trauer, ein Zeichen dafür, dass etwas zu Ende gegangen war, auch wenn Vera ihrem Vater auf dem Totenbett versprochen hatte, die Schneiderei eines Tages zu neuem Leben zu erwecken. Bisher war in dieser Richtung allerdings nichts geschehen. Während des Krieges hatte sie nicht die Möglichkeiten dazu gehabt, sie hätte das Geschäft alleine wiederaufnehmen müssen, wie hätte das gehen sollen? Schweigend tastete sie nach der Packung mit den Streichhölzern, die immer hier gelegen hatte. Nach ein paar Sekunden fanden sich Zündhölzer und auch ein Kerzenstummel, eine mickrige Flamme flackerte auf. Der Matrose kam näher, jetzt ohne Gewehr, das hatte er neben dem Eingang an die Wand gestellt.
Inzwischen wirkte er ruhiger, friedlicher, sogar einigermaßen freundlich. War wohl gut, dass er weg war vom Stadtschloss, weit fort von seinen Kumpanen. Noch war er ihr nicht ganz geheuer, wegen seiner Waffe und auch der roten Armbinde wegen. Jeder, der ihn sah, wusste sofort, dass er bei der Volksmarine mitmischte, ein Revolutionär, ein Unruhestifter. Auf dem Weg hierher immerhin hatte er sich vernünftig betragen.
»Wem gehört dieser Schuppen?«
Sie drehte sich zu ihm um, das abgebrannte Streichholz in der Hand. »Das ist kein Schuppen, das ist die ehemalige Schneiderwerkstatt meines Vaters.«
»Ganz schön groß.«
»Vor dem Krieg haben hier vierzehn Leute gearbeitet.«
»Vierzehn? Donnerwetter.«
»Ja. Wir haben Uniformen geschneidert, auf Bestellung und nach Maß. Ist leider vorbei, das Ganze. Inzwischen lohnt es sich nicht mehr.«
»Der Krieg ist schuld, wie immer.«
»Und ob. An der Front wurde nur Massenware gebraucht, schnell und billig hergestellt, große Mengen zu niedrigen Preisen. Das schaffen nur die Fabriken in Westfalen und anderswo. In der Schlacht kommt es eben nicht auf Schönheit an.«
»Deshalb musste Ihre Firma schließen.«
»Ja. Als mein Vater verstarb, haben wir dichtgemacht.«
»Und was soll jetzt aus dem Gebäude werden?«
»Weiß ich noch nicht. Es wird sich was finden.«
Vera zuckte mit den Schultern – wozu das alles einem Fremden erklären, der nur auf der Durchreise war? Eigentlich wollte sie ihn bloß loswerden, den Matrosen, nur wusste sie noch nicht, wie. Ganz plötzlich machte der Seemann einen Schritt auf sie zu, er grinste, gleich darauf hatte er ihre Schiebermütze in der Hand. Ihre Haare lösten sich, wie eine Welle glitten sie hinunter auf die Schultern.
»Schöne Haare haben Sie, Fräulein.«
»Ich?«
»Ja, Sie, ist ja sonst keiner da. Hab Sie von Anfang an nicht für einen Knaben gehalten, trotz der Hose und der Mütze.«
»Hört, hört. Und trotzdem haben Sie mir eine Kopfnuss verpasst.«
Er blickte nur kurz zu Boden, dann grinste er schon wieder.
»Tut mir leid, aber es ging nicht anders. Wir mussten da weg, oder?«
Eine Antwort konnte sie sich sparen, er hatte sich schon abgewandt, sein Blick glitt suchend durch den Raum.
»Ist wirklich gut ausgestattet, Ihre Werkstatt. Jede Menge Platz, Gaslicht ist auch da. Haben Sie fließend Wasser hier?«
»Natürlich.«
»Aus all dem lässt sich bestimmt was machen.«
»Ja, die Einrichtung war kostspielig seinerzeit. So was hätten Sie hier nicht vermutet, oder?«
»Wieso, was meinen Sie damit?« Er guckte verständnislos.
»So ein solides Gebäude in dieser Gegend, das ist nicht selbstverständlich. Wegen dem Scheunenviertel nebenan, meine ich.«
»Scheunenviertel?« Er nahm die Matrosenmütze vom Kopf, die Augen groß, er hatte keine Ahnung, wovon sie redete. Der war wirklich nicht von hier. Dass tief im Osten der Stadt ganz andere Menschen lebten als im Rest von Berlin, hatte er noch nicht bemerkt. Die Männer, die in den Straßen nebenan in ihren langen, schwarzen Mänteln umherwanderten, in Kaftanen und mit Rauschebärten, sie waren ein seltsamer Anblick, bis man sich daran gewöhnt hatte. Hier gab es viel buntes Volk, von der Münzstraße an konnte man alle möglichen Sprachen zu hören bekommen, wenn man eine Runde drehte. Nichts, was es nicht gab, Dirnen, Zuhälter, Taschendiebe. Die Näherinnen von Novak und Söhne waren fast alle aus dem Scheunenviertel gekommen, aber wozu es umständlich erklären, es hatte keinen Zweck im Augenblick.
Sie zuckte mit den Schultern. »Jedenfalls, was die Schneiderei anbelangt, der Betrieb ruht im Moment. Sobald mein Bruder aus dem Krieg zurückkommt, fangen wir wieder an.«
»Sie wollen wieder Uniformen schneidern? Offen gesagt, glaube ich nicht, dass sich das in Zukunft noch lohnt.«
»Wir werden sehen. Vor dem Krieg hatte unsere Firma einen guten Ruf. Novak und Söhne, schon mal gehört?«
»Nein. Ich bin kein Berliner, tut mir leid.«
»In der Hauptstadt kannte man uns. Mein Vater belieferte den kaiserlichen Hof.«
»Tatsächlich? Alle Achtung, ich bin schwer beeindruckt.«
Ihr Besucher rollte die Augen, den Blick zur Decke gehoben, Vera konnte nicht anders, sie musste lachen. Sie wusste nur zu gut, was gemeint war: Kaisers Zeiten waren passé, das ganze Brimborium von einem Tag auf den anderen hinfällig. Trotzdem, für ihre Familie war es eine große Zeit gewesen.
»Wir konnten gut von den Aufträgen aus dem Stadtschloss leben.«
»Verstehe ich. War bestimmt nicht leicht für Sie, der Krieg.«
Sie nickte, hatte aber auf einmal keine Lust mehr, weiter zu erzählen. Vaters Tod, Georgs Einberufung, der Niedergang der Firma – lauter bittere Pillen, die sie hatte schlucken müssen. Dauernd darüber nachzudenken brachte sie nicht weiter, das hatten die letzten vier Jahre ihr gezeigt. Sie war nicht mehr gerne hier unten, die leere Werkstatt schien ihr wie eine Anklage. Dabei war es noch gar nicht lange her, dass das Geplapper der Näherinnen zusammen mit dem Surren der Maschinen den Raum erfüllt hatte.
Der Matrose kam näher, er suchte ihren Blick.
»Im Krieg haben wir alle geblutet. Wir müssen jetzt zusammenstehen, damit es wieder aufwärtsgeht.«
»Ja, ja, natürlich. Nun wissen Sie jedenfalls Bescheid über das Gebäude. Und was ist mit Ihnen? Woher kommen Sie?«
»Ich bin in Eckernförde geboren, das liegt oben an der Ostsee. Mein Vater hat dort eine kleine Bäckerei, ich war sein Geselle. Als der Krieg ausbrach, haben sie mich eingezogen und nach Kiel geschickt.«
»Und da sind Sie den ganzen Krieg über geblieben?«
»Ja, ich war auf einer Werft als Fahrer.«
Unwillkürlich musste sie lächeln, in einem Fischerdorf geboren, das passte, so sah der Matrose auch aus. Er war unglaublich blond und sehr schlank, dazu passten die tiefblauen Augen. Himmel noch eins, so ein Blau hatte sie noch nicht oft gesehen, die Farbe schien ihr leuchtend wie das Meer. Schon wegen seiner Augen musste sie immer wieder hingucken zu ihrem Revolutionär, auch wenn sie wusste, dass es ihm auffallen würde, irgendwann.
Plötzlich streckte er die Hand aus. »Benno Funke ist übrigens mein Name.«
Sie ergriff seine Hand. »Ich bin Vera Novak.«
Er nickte, ein merkwürdiger Moment, sie wagte kaum, sich zu rühren. Er schien ihr Gesicht genau zu betrachten – gefiel ihm, was er sah? Ihre Augen waren eher grau, nicht so schön blau wie die seinen, aber auf ihre dichten Haare war sie stolz, schulterlang, das trug man jetzt. Eine Nachbarin hatte ihr geholfen, die altmodischen Zöpfe zu kappen, auch wenn die Mutter darüber gejammert hatte. Der Matrose jedenfalls lächelte, sie war ihm dankbar dafür, sie nahm es als Kompliment. Langsam entzog sie ihm die Hand, endlich deutete er hinauf, zu den Kandelabern an der Decke.
»Funktioniert das Licht noch?«
»Nein, wir konnten die Gasrechnungen nicht mehr bezahlen.«
»Verstehe. Trotzdem, die Werkstatt scheint mir gut in Schuss zu sein. Wo sind die Nähmaschinen alle hin?«
»Hab ich verkauft. Von irgendwas mussten wir im Krieg ja leben.«
»Was denn, Sie haben die Maschinen verkauft? Ich denke, Sie wollen wieder anfangen mit der Schneiderei.«
»Ja, schon. Sobald mein Bruder aus dem Feld zurück ist, besorgen wir uns eine neue Ausstattung für die Werkstatt. Wenn Georg zurückkommt, geht es aufwärts.«
Benno Funke runzelte die Stirn, scheinbar glaubte er ihr kein Wort. Wahrscheinlich wollte er als Nächstes etwas über Georg wissen, aber sie sprach nicht gern über sein Ausbleiben. Warum genau er noch nicht zu Hause war, wusste sie nicht, und außerdem hatte sie jetzt anderes zu tun. Oben in der guten Stube wartete Mutter darauf, dass endlich Weihnachten wurde. Da störte der Matrose nur.
Vera verschränkte die Arme vor dem Oberkörper.
»Wie gesagt, mein Bruder ist noch an der Front. Mehr ist dazu nicht zu sagen.«
Benno lächelte, auf seiner Wange zeigte sich ein Grübchen, es stand ihm gut. Er sah wirklich nicht übel aus, ihr Revolutionär, nur der Zustand seiner Uniform ließ zu wünschen übrig. Der Stoff war schlecht zugeschnitten, die Abnäher waren falsch gesetzt, etliche Nähte nachlässig ausgeführt. Schlampige Arbeit. Kein Wunder, dass die deutsche Armee den Krieg verloren hatte.
»Hören Sie, Herr Funke, ich muss jetzt rauf zu meiner Familie. Es ist Heiligabend.«
»Na klar, gehen Sie ruhig, ich bleibe solange hier.«
»Was denn, Sie wollen hier unten bleiben? Nein, das kann ich nicht erlauben.«
»Nur für eine Nacht. Ich brauche einen Platz zum Schlafen. Draußen ist es eisig kalt, Fräulein Vera. Ich mache Ihnen keine Scherereien, das verspreche ich.«
»Wollen Sie denn nicht zurück zu Ihren Leuten ins Stadtschloss?«
»Nee, will ich nicht. Wenn ich das gewollt hätte, dann hätte ich mir das Theater beim Doktor vor der Tür wohl schenken können, oder?«
Er verstummte, er sah sie mit flehenden Blicken an, fast wie ein Hund, der um einen Leckerbissen bettelte. Unbehagen breitete sich in ihr aus, einen Revolutionär zu verstecken, das war nicht ohne. Vielleicht suchten seine Leute ihn schon? Auch wenn nicht, es konnte böse Folgen haben. Was, wenn Mutter ihn entdeckte oder einer der Nachbarn, alles Mögliche konnte geschehen, was dann? Außerdem, wenn sie ihn hier unterbrachte, musste sie ihn ja auch versorgen, und es gab doch nichts zu kaufen. Lebensmittel nur auf Karte, und auch dann immer viel zu wenig. Matschige Rüben, pappiges Brot, gestreckte Milch und manchmal ein bisschen angeschimmelten Kohl, das war alles, was sie im Haus hatten, auch an Weihnachten. Die Portionen waren knapp bemessen, häufig gingen sie mit leerem Magen zu Bett.
Der Matrose kam ein Stückchen näher, noch immer bettelten seine Augen sie an.
»Es ist nur für eine Nacht, Fräulein Vera. Das fällt niemandem auf, glauben Sie mir.«
»Warum gehen Sie nicht zurück zu Ihren Leuten?«
»Das sind nicht mehr meine Leute. Ich habe eine Weile bei denen Dienst geschoben, aber nun ist es gut. Von einem Bürgerkrieg war nicht die Rede, als sie uns aus Kiel nach Berlin geholt haben.«
»Wovon war denn die Rede? Von einem Betriebsausflug?« »Nein. Wache stehen sollten wir für die neue Regierung, die Volksbeauftragten beschützen, ihre Gebäude sichern. Das ist doch wohl nicht dasselbe wie Schießereien mit den Kaiserlichen, oder?«
»In der Stadt wird erzählt, dass die Matrosen das Stadtschloss plündern und die Einrichtung verscherbeln. Nicht sehr nobel, oder?«
»Damit habe ich nichts zu tun. Fassen Sie mir mal in die Tasche, da ist nichts. Außer ein paar Äpfel in Nachbars Garten habe ich in meinem ganzen Leben noch nichts geklaut.«
Sie nickte, wie ein Dieb sah er nicht aus, dieser Benno Funke, auch wenn sie nicht wirklich verstanden hatte, warum er sich ausgerechnet heute Nacht von seiner Truppe entfernen wollte. Weshalb hatte er sich den Roten überhaupt angeschlossen, wenn er sie jetzt gleich wieder im Stich ließ? Merkwürdig, aber wahrscheinlich hatte es keinen Zweck, da nachzuhaken. Sollte er mal machen, der Matrose, das war seine Sache. Ein wenig hilflos deutete sie in die Runde.
»Wenn Sie unbedingt bleiben wollen, meinetwegen, aber das hier ist kein Hotel. Wo wollen Sie schlafen? Hier ist nichts, wo man sich ausruhen könnte. Und lausig kalt ist es auch.«
»Das lassen Sie mal meine Sorge sein. Ich komme zurecht. Es geht ja bloß um zwei Tage. Ich verschwinde, sobald ich sicher sein kann, dass sie nicht hinter mir her sind.«
»Ich denke, Sie bleiben nur für eine Nacht?«
»Seien Sie nicht so kleinlich. Sie sind doch eine Frau mit Herz, das sehe ich Ihnen an.«
Der Matrose war jetzt genau neben ihr, plötzlich legte er eine Hand auf ihre Schulter. Sie fühlte sich warm an durch den Stoff ihrer Jacke, warm und fest. Er senkte die Stimme, er war ihr ganz nah.
»Ich mach Ihnen keinen Ärger. Ins Stadtschloss zurück kann ich nicht, das müssen Sie verstehen. Für die bin ich jetzt ein Deserteur.«
Sie fuhr herum – Deserteur, hatte er Deserteur gesagt? Das klang nach Ärger, und noch mehr Ärger konnte sie wahrhaftig nicht gebrauchen.
»Sie meinen, Ihre Kameraden könnten sich an Ihnen rächen? Die sind hinter Ihnen her, weil Sie abgehauen sind?«
»Ach was, nein, das nicht. Derzeit hat die Volksmarine Besseres zu tun, als nach mir zu suchen. Solange die Kanonade der Kaiserlichen auf das Stadtschloss anhält, haben die Jungs alle Hände voll zu tun. Nur ich habe eben keinen Ort, an den ich gehen kann.«
Sie nickte langsam. »Also gut, dann über Weihnachten. Aber danach müssen Sie verschwinden, geben Sie mir Ihr Ehrenwort. Es kann nicht mehr lange dauern, bis mein Bruder …«
»Nach Weihnachten bin ich weg, ich verspreche es. Sie werden keinen Kummer haben meinetwegen.«
»Wenn meine Mutter erfährt, dass ich hier unten einen roten Matrosen verstecke …«
»Aber das ist es doch gerade, Fräulein Vera. Es soll keiner wissen, dass ich hier bin. Ich werde mich ganz ruhig verhalten. Und außerdem, ich bin kein Roter mehr.«
»Na ja, wenn Sie das sagen.«
»Dann stimmt es auch. Liebknecht hat mich beeindruckt, aber da war ich ja nicht der Einzige. Waren Sie dabei, als er vor dem Reichstag die Republik ausgerufen hat?«
Sie schüttelte den Kopf, während er daranging, die rote Armbinde vom Ärmel seiner Uniform zu streifen.
»Das Volk hat ihm zugejubelt, der Platz war schwarz vor Menschen. So was haben Sie noch nicht gesehen, diese Begeisterung. War an der Zeit, dass der Kaiser seinen Hut nimmt.«
»Wir haben immer ganz ordentlich verdient bei Hof. Und andere auch. Es ging den Leuten gut. Sie liebten ihren Kaiser. Und was ist jetzt? Ist das etwa ein Fortschritt?«
»Nein, ist es nicht, jedenfalls noch nicht. Wenn der Kaiser den Krieg nicht angefangen hätte, wäre alles beim Alten geblieben. Es mit England, Frankreich und Russland auf einmal aufzunehmen, heilige Scheiße, das war so was von dämlich. Und das alles wegen einem österreichischen Thronfolger, den hier kein Mensch kennt. Nur ein Dummkopf geht so ein militärisches Risiko ein, glauben Sie mir.«
»Die Oberste Heeresleitung hat aber …«
»Flachpfeifen.«
»So? Sie wissen offenbar gut Bescheid in der großen Politik.«
»Was man so hört, wenn man viele Leute trifft.«
»Ich gehe jetzt rauf in die Wohnung und hole Ihnen ein paar Decken und etwas Warmes anzuziehen. Damit Sie nicht erfrieren heute Nacht.«
»Danke, Fräulein Vera. Das ist nett von Ihnen.«
»Nur weil Weihnachten ist.«
»Und weil Sie mit einem erfrorenen Matrosen, der tot in Ihrer Werkstatt liegt, noch viel mehr Ärger hätten als mit einem, der lebendig ist, stimmt’s?«
Er griff nach ihrer Hand und hielt sie einen Moment fest – ein paar Sekunden standen sie sich so gegenüber und schauten sich an, schweigend, sie mit klopfendem Herzen. Im nächsten Augenblick machte sie sich los, sie wollte zur Tür, doch Benno setzte ihr nach, gleich darauf war er wieder neben ihr.
»Vielen Dank noch mal. Ich wusste, dass ich auf Sie zählen kann, Fräulein Vera.«
»Ich hoffe bloß, ich werde für meine Gutmütigkeit nicht bestraft.«
»Was denn, meinetwegen? Niemals. Sie werden sehen, auf Benno Funke ist Verlass.«
»Sie haben keine Ahnung, was einem alles zustoßen kann, wenn man einen Fehler macht.«
»Einen Fehler? Sie machen keinen Fehler, wenn Sie mich aufnehmen.«
»Das sagen Sie. Aber man kann nicht alles vorhersehen im Leben. Gerade die Katastrophen nicht.«
»Das klingt bitter. Gibt’s da was, das ich wissen sollte?«
Sie zuckte bloß mit den Schultern, das ging zu weit. Sie wollte im Moment nicht an dieser alten Geschichte aus ihrer Kindheit rühren.
»Warten Sie ab, bis Sie mich besser kennenlernen. Sie werden nicht bereuen, mir einen Gefallen getan zu haben, liebes Fräulein, das verspreche ich Ihnen.«
Sie zögerte, wollte etwas erwidern und ließ es dann doch. Sie wandte sich ab, eilig und ohne ein weiteres Wort verließ sie die Werkstatt. Draußen auf dem Hof dämmerte es bereits, der Weihnachtsabend begann. Ein Weihnachtsabend, wie noch keiner gewesen war zuvor, voller Armut, Kälte und Mühsal, aber auch getragen von einer Spur Hoffnung – und sie urplötzlich mittendrin in einem Abenteuer. Leichtsinn zahlte sich meistens nicht aus, aber andererseits, was sollte sie sonst tun? Den Revolutionär in die Kälte schicken, noch dazu an Heiligabend? Das würde sie nicht fertigbringen. Er war interessant, ihr Matrose. Ganz anders als die jungen Offiziere, die sie vor dem Krieg in Vaters Laden kennengelernt hatte, wenn sie zur Anprobe kamen. Die hatten zwar schön mit ihr getan, aber sie auch immer wieder spüren lassen, dass sie was Besseres waren. So einer war Benno nicht, der war nicht von oben herab, sondern geradeheraus, das wusste sie zu schätzen. Benno besaß etwas Draufgängerisches, trotzdem hatte sie schon jetzt Vertrauen zu ihm. Die Sache beim Doktor vor der Tür war nicht eben nobel gewesen, aber auch schon fast vergessen.
Und nun hinauf zu Muttern. Ohne die Tabletten, leider Gottes. Würde nicht leicht werden, eine Geschichte dazu zu erfinden, in der Benno Funke nicht vorkam. Vera lächelte dennoch, als sie zum Haus hinüberging.
***
Himmel, wie sehr sie es hasste, die kleine Christel allein zu lassen. Obendrein hinterging sie ihren Vater, der ganz bestimmt nicht damit rechnete, sie morgen früh nicht mehr im Haus vorzufinden – aber hatte sie denn eine andere Wahl, als sich heimlich auf den Weg zu machen?
Fritzi stand am Kinderbettchen, sie konnte sich nicht sattsehen am Anblick ihrer Tochter. Die Kleine schlief friedlich dem ersten Weihnachtstag entgegen. Ihre neue Puppe, die sie vorhin unter dem Weihnachtsbaum gefunden hatte, saß am Fußende des Gitterbettchens und bewachte den Schlaf des Kindes. Christels blonde Locken kringelten sich auf dem weißen Kopfkissen. Die Kleine war ein Ebenbild ihres Vaters. Einerseits empfand Fritzi das als wundervoll, erinnerte ihre Tochter sie doch jeden Tag aufs Neue an die Liebe, die sie mit Benno geteilt hatte. Andererseits war es furchtbar, das Kind ohne seinen Vater aufwachsen zu sehen, der bisher nicht einmal von der Existenz seiner mittlerweile fast vierjährigen Tochter wusste. Benno fehlte, bei Tag und bei Nacht. Die Zeit verging, mittlerweile konnte sie sich nicht mehr ausruhen auf der Gewissheit, dass Benno von ganz allein wiederkommen würde. Der Glaube an seine Rückkehr war marode geworden, ihre Hoffnung schwand von Tag zu Tag ein wenig mehr. Ja, der Krieg war zu Ende, und ja, Benno stammte aus Eckernförde und hatte hier Familie, das alles hätte ihn an die Heimat binden sollen, und doch fand sich keine Spur von dem Mann, den sie so sehr liebte.
Sie musste los und ihn suchen. Sie musste ihn zurückholen in das Leben, das für ihn vorgesehen war – ihr blieb keine andere Wahl. Erfolglos hatte sie um Bennos Rückkehr gebetet, sie hatte ihm Briefe geschrieben, die ohne Antwort geblieben waren. Auch seine Mutter wartete seit Monaten vergeblich auf Nachrichten von ihrem Sohn. Bennos Schweigen machte ihnen beiden Angst, sie wussten nicht, warum er sich nicht mehr meldete. Da überstand einer heil den Krieg und verschwand dann plötzlich aus der Welt, das konnte nicht sein. Es war an der Zeit, sein Verschwinden aufzuklären.
Fritzi nahm das Köfferchen vom Fußboden, das neben dem Kinderbett stand. Leichtes Gepäck, viel mitnehmen würde sie nicht. Wozu auch, schließlich wollte sie an Silvester wieder hier sein. Fünf Tage waren es bloß bis dahin, aber die konnten es in sich haben. Schon jetzt brach ihr der Gedanke, so lange ohne Christel zu sein, beinahe das Herz. Die Kleine brauchte ihre Mutter, aber einen Vater brauchte sie schließlich auch.
Ein letzter Seufzer, dann wandte Fritzi sich ab und schlich auf den Flur hinaus. Im Gebälk des alten Hauses arbeitete es, der Wind strich heulend und jammernd durch das Reetdach. Sie lauschte: Manchmal konnte sie die Käuzchen hören, die dort oben rumorten, ihr Ruf brachte Glück, sagten die Leute, doch heute blieb es still.
Auf Zehenspitzen schlich sie zur Haustür, nicht dass sie auf den letzten paar Metern ihren Vater aufweckte. Sein Schlaf war leichter geworden in den letzten Jahren. Schlimm genug, dass Casanova draußen wie wild kläffte, der Hofhund war bei Vollmond zu nichts zu gebrauchen. Hoffentlich machte er kein solches Spektakel, wenn sie gleich das Tor zur Straße öffnete.
Fritzi nahm ihren Mantel vom Haken an der Garderobe und zog ihn an. Der Schal, die Handschuhe, die Handtasche und zuletzt die Kappe mit der roten Blüte, die sie sich kurz vor dem Fest in Schleswig hatte machen lassen. Der neue Hut war Vaters Weihnachtsgeschenk, nicht so groß und ausladend wie die Hüte vor dem Krieg, stattdessen mit einer Blüte als Hingucker. Es bedrückte sie, dass sie ihrem lieben Papa diese gute Gabe so schlecht vergelten würde. Sich einfach davonzumachen bei Nacht und Nebel, das gehörte sich nicht. Er würde ihr grollen, doch wie sie ihn kannte, würde er verstehen, was sie dazu getrieben hatte, ihn ohne Ankündigung zu verlassen. Wenn sie gemeinsam mit Benno zurückkehrte, war alles gut. Und genau das würde sie tun: Sie würde ihren Verlobten finden, sie musste einfach. Eine Weihnachtskarte an seine Mutter, aus der Hauptstadt Berlin, war ihr einziger Anhaltspunkt. Es musste genügen.
Noch einmal horchte Fritzi ins Haus hinein, doch da war nichts. Eine tiefe Ruhe lag über allem. Die Haustür war abgesperrt, aber das hielt sie nicht auf, sie besaß einen eigenen Schlüssel. Der Vater vertraute ihr in allem. Sie konnte sich nicht lösen von dem Gedanken, wie enttäuscht er sein würde von ihr. Die Familie zu verlassen war ein Wagnis, aber als ledige Mutter auf dem Dorf zu leben war auch kein Zuckerschlecken. Das mit Benno war Liebe pur. Wusste man denn, ob einem so etwas mehr als einmal widerfuhr? Das Leben war kurz, manchmal kam das Ende überraschend früh. Der Tod ihrer Mutter war ein warnendes Beispiel. Genau deshalb würde sie Benno zurückholen. Sie würde ihn nach Hause bringen, zu seinen Leuten.
Draußen auf dem Hof hob Fritzi den Blick zum sternenklaren Himmel und stapfte los, die Anhöhe zur Straße hinauf. Das Eis der Pfützen brach unter ihren Stiefeln, es klirrte leise bei jedem Schritt. Der Hund rührte sich nicht mehr, in aller Stille verließ sie die heimatliche Mühle.
Jetzt war sie wirklich unterwegs. Zuerst der Fußmarsch bis Eckernförde, fast vier Kilometer weit – nicht ganz einfach mit dem Koffer und bei dem auflandigen Wind, der böse und wild an ihrer Kleidung zerrte. Trotzdem, bis nach Eckernförde musste sie es schaffen, dorthin hatte sie sich eine Mietdroschke bestellt, die am Ortseingang auf sie warten würde. Der Fahrer kam eigens aus dem Nachbarort, um sie zum Bahnhof in Schleswig zu bringen. Seine nächtliche Fahrt würde er sich mit einem hübschen Aufschlag bezahlen lassen, doch in diesen sauren Apfel musste sie eben beißen. Der Mann sollte keinen Anlass haben, schlecht über sie zu reden. Schließlich konnte er sich denken, dass etwas nicht in Ordnung war mit seinem nächtlichen Fahrgast. Eine junge Frau, die am Heiligen Abend nach zweiundzwanzig Uhr zum Bahnhof gebracht werden wollte, obwohl kein Zug mehr ging – man musste kein heller Kopf sein, um dabei Verdacht zu schöpfen. Ach was, und wenn schon, eigentlich konnte es ihr egal sein. Die Mäuler zerrissen sie sich ja sowieso im Dorf, zum einen, weil sie eine ledige Mutter war, zum anderen, weil der Vater ihres Kindes nicht wiederauftauchte. Im Dorf wussten sie alle etwas dazu zu sagen, das meiste davon war grober Unfug. Dem Gerede würde sie ein Ende machen. Diese Nacht musste sie im Warteraum des Bahnhofs verbringen, aber am frühen Morgen ging es dann weiter, mit dem ersten Zug, der nach Hamburg fuhr.
Sie stapfte eine Anhöhe hinauf, sie fror ganz elendig. Der Koffer wurde schwer und schwerer, obwohl doch fast überhaupt nichts drinnen war. Sie ahnte, wie sehr sie das alles hier vermissen würde. Fritzi war eben ein Kind vom Lande und schämte sich nicht dafür. Bisher hatte sie ihre Heimat geliebt, Sehnsucht nach der Großstadt kannte sie nicht. Wäre Benno nicht in Berlin gewesen, dann wäre sie niemals auf die Idee gekommen, freiwillig dorthin zu fahren.
Einmal tief durchatmen, dann marschierte sie weiter durch die Nacht, bemüht darum, unterwegs keine Gedanken an das zuzulassen, was in der Fremde auf sie zuzukommen drohte.
2. Kapitel
»Darf ich dir etwas zeigen, Papa?«
Hanna schloss die Tür des Arbeitszimmers, in dem der Vater mit seinen Papieren am Schreibtisch saß. Sie mochte diesen Raum, sie mochte die andächtige Stille und den Geruch nach Tabak, den die Möbel ausdünsteten. Ihr gefielen die hohen Bücherregale und der alte Ohrensessel am Fenster mit der Palme daneben. Der altbackene Plüsch der Kaiserjahre dominierte diesen Ort, aber diese Atmosphäre passte zu ihrem Vater, dessen sogenanntes Herrenzimmer Ruhe und Beständigkeit vermittelte. Auch heute, am ersten Weihnachtstag, hockte er hinter dem mächtigen Schreibtisch und studierte Unterlagen. Er hob den Kopf, als sie den Raum betrat.
»Komm rein, mein Kind. Was hast du mir mitgebracht?«
Hanna trat näher, sie klappte einen kleinen, dunklen Pappkarton auf und legte ihn vor ihrem Vater auf den Tisch. Das also war sie, ihre Auszeichnung für Tapferkeit im Felde. Man hatte sie mit der Samaritermedaille der Kaiserin Auguste Viktoria geehrt, sie war stolz darauf. Nicht dass Hanna eine Verehrerin der ehemaligen Kaiserin gewesen wäre. Niemals wäre sie um der Aussicht auf eine Auszeichnung willen in den Krieg gezogen. Aber dass man ihren Einsatz an der Front überhaupt gewürdigt hatte, obwohl sich die Oberschwester im Lazarett dagegen ausgesprochen hatte, das machte dieses Stückchen Blech zu etwas Besonderem. Einer ihrer Patienten hatte sie für die Ehrung vorgeschlagen, wegen Tapferkeit vor dem Feind. Und hier war er nun, der Orden.
Ihr Vater nahm die Schachtel in die Hand und betrachtete den silbernen Anhänger mit dem Bildnis von Auguste Victoria.
»Donnerwetter, mein Kind. Darauf kannst du dir etwas einbilden. Geschrieben hattest du uns davon, aber die Medaille vor sich zu haben ist noch beeindruckender.«
Er hob den Kopf und sah sie mit leuchtenden Augen an.
Es war schön, dass er sich für ein Stück Blech so begeistern konnte. Ihn endlich mal wieder lächeln zu sehen war auch für sie ein Grund zur Freude. Schmaler war er geworden. Diese tiefen Schatten unter seinen Augen, waren die bei ihrem letzten Besuch auch schon da gewesen?
»Ich erinnere mich noch gut daran, wie ich dich als kleines Mädchen zum ersten Mal auf ein Pferd gesetzt habe, mein Kind. Du hast geweint und wolltest sofort wieder herunter. Und jetzt kutschierst du zwei schwer verletzte Soldaten mitten durch die feindlichen Linien. Wer hätte gedacht, dass aus dir eines Tages eine so tapfere Frau werden würde?«
»Jedenfalls eine, die keine Angst mehr hat vor Pferden.«
»Eine, die ihr Leben einsetzt, um Verwundete zu retten. Einen Sanitätswagen unter Beschuss vom Verbandsplatz zum Lazarett zu fahren, das nenne ich Courage.«
»Um ehrlich zu sein, ich hatte Angst.«
»Das glaube ich dir, das ist keine Schande. Einer der Schwerverletzten, die du ins Lazarett gefahren hast, war ein hohes Tier?«
»Ein Oberst aus pommerschem Adel, er kennt die kaiserliche Familie persönlich.«
»Durch dich hat er überlebt.«
»Ich hätte für einen einfachen Feldgrauen dasselbe getan.«
»Natürlich, mein Kind. So oder so, es war eine Heldentat.«
»Wir haben alle unser Bestes gegeben. In Flandern haben wir die Hölle erlebt, Papa.«
»Ich habe darüber gelesen und bin umso mehr stolz auf dich. Du hast dir deine Medaille wirklich verdient. Zumal es nicht viele Auszeichnungen dieser Art gegeben hat, wie ich gehört habe.«
»Schon gar nicht für Hilfsschwestern.«
»Ich kann mir gut vorstellen, dass du anderen ein Vorbild warst.«
Hanna nickte, während sie sich auf einen der beiden Stühle vor dem Schreibtisch gleiten ließ. Die Gelegenheit war günstig, ihr Vater war guter Laune, das musste sie ausnutzen.
»Ich habe viel gelernt an der Front.«
»Ganz bestimmt. Und du bist erwachsen geworden.«
»Die Krankenpflege hat meinem Dasein einen Sinn gegeben, weißt du?«
»Natürlich, das leuchtet ein.«
»Ich möchte nicht, dass mein Wissen nutzlos in der Versenkung verschwindet, verstehst du? Anderen helfen zu können ist das Schönste für mich.«
Ihr Vater nickte, doch er schwieg. Was ging wohl in ihm vor? Seit ihrem letzten Besuch hatte er sich seinen Vollbart abrasieren lassen, das gefiel ihr gut, es machte ihn jünger. Diese monströsen Großvaterbärte, die die Männer vor dem Krieg getragen hatten, fand sie abscheulich. Ohne Bart sah er viel besser aus, nur blass war er noch immer.
Er beugte sich zu ihr vor. »Hilfsbereitschaft ist eine ehrenwerte Eigenschaft, mein Kind. Dein zukünftiger Ehemann wird das zu schätzen wissen. Ganz bestimmt wirst du eine großartige Mutter und Ehefrau.«
»Danke für dein Vertrauen, genau deshalb will ich mit dir sprechen. Weißt du, ich kann inzwischen viel mehr, als einen Schnupfen auszukurieren. Ich habe eine Begabung für die Medizin, Papa. Ich möchte mein Wissen und meine Kenntnisse sinnvoll einsetzen.«
»So? Nun, der Krieg ist zu Ende, aber wenn du unbedingt ehrenamtlich tätig sein möchtest, vielleicht findet sich etwas. Deine Mutter hat Beziehungen zum Roten Kreuz …«
»Nein, ich möchte kein Ehrenamt. Ich will eine Ausbildung zur staatlich geprüften Krankenschwester machen, mit Lehrzeit und Schwesternexamen. Ich will in Zukunft berufstätig sein, Papa.«
»Berufstätig?«
Seine Augenbrauen schnellten in die Höhe, mit dieser Wendung hatte er nicht gerechnet. Skepsis lag jetzt in seiner Miene, Hanna wusste, von nun an musste sie behutsam vorgehen.
»Ja, ich will Schwester werden, mit allem Drum und Dran.«
»Aber Kind, wozu denn? Du verschwendest deine besten Jahre.«
»So sehe ich das nicht.«
»Du stehst unter dem Eindruck der jüngsten Ereignisse, das ist nachvollziehbar, aber der Krieg ist eine Ausnahmesituation. Dort wurden andere Dinge von uns verlangt als jetzt, im Frieden.«
»Auch im Frieden wird eine gute Pflege gebraucht.«
»Warte, bis du dich wieder eingewöhnt hast, dann siehst du die Dinge anders. Eine Ausbildung zur Schwester wäre Zeitverschwendung.«
»Nein, Papa, das Gegenteil ist richtig. Es ist das Gebot der Stunde, dass Frauen sich nützlich machen.«
»Nützlich machen kannst du dich auch zu Hause. Es ist an der Zeit, dass du dich nach einem Ehemann umsiehst.«
»Vielleicht möchte ich gar nicht heiraten.«