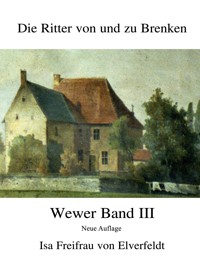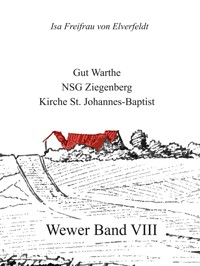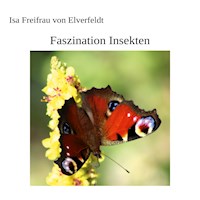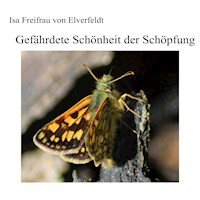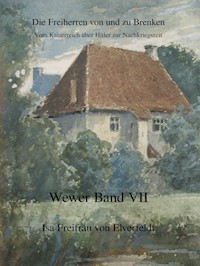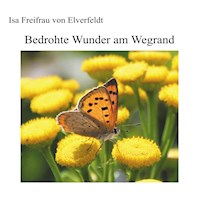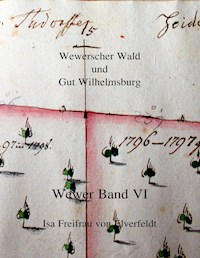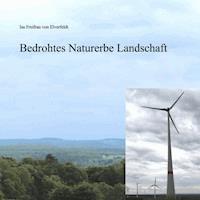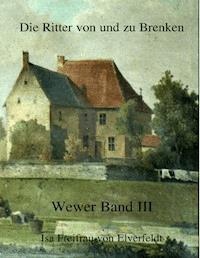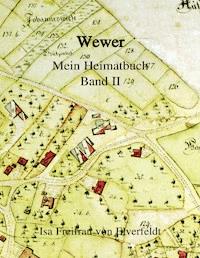Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Wewer
- Sprache: Deutsch
Erstmalige Gesamtdarstellung der Geschichte der Freiherren von Imbsen in Schloss Wewer mit ihren Domherren und Äbtissinnen als bedeutender Adelsfamilie des Hochstifts Paderborn, vom Mittelalter bis zu ihrem Ende 1833. Reich bebildert auch zu den Nachkommen in anderen Adelsfamilien. Mit ausführlicher Betrachtung der die Bauernhöfe und Adelsgüter gleichermaßen treffenden wirtschaftlichen Probleme der Landwirtschaft nach der Säkularisation und der sogenannten Bauernbefreiung in der 1. Hälfte des 19. Jhdt.s., die zum Niedergang der Familie von Imbsen führten. Unter Berücksichtigung der Imbsenschen Nebenlinie in Dörenhagen und Mähren, mit der bemerkenswerten Geschichte vom Unfreien zum Freiherrn. Zusammen mit den vorangegangenen Bänden 3 und 4 zu den Freiherren von und zu Brenken liegt damit ein Gesamtüberblick über die Wewerschen Adelsfamilien vor.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 214
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Zur Erinnerung an 400 Jahre
Freiherren von Imbsen in Wewer
1 Inhaltsverzeichnis
Inhalt
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
2.1 Die Freiherren von Imbsen (auch Ymmessen) im Warburgschen und in Wewer – ein Überblick
2.1.1 Ende der von Clostere und der von Wefere und Beginn der von Imbsen
2.2 Wieder zwei Adelsgeschlechter in Wewer
Melchior von Imbsen
Cordt II. von Imbsen
4.1 Cordt II. von Imbsen streitet sich mit Liborius Wichardt – und andere Episoden aus Cordts II. Leben
Walter Adrian von Imbsen
5.1 Hexenwahn auch in Wewer?
5.2 Der Dreißigjährige Krieg bringt große Not
Jobst Gottfried von Imbsen
6.1 Die Oldenborg
6.2 Ein Wewersches Unikum: Der Sandsteinbogen
6.3 Jobst Gottfried von Imbsen baut das Schloss Wewer
Das Salzwerk und der Klinkenhof
Gerichtsbarkeit
Familienmitglieder in Kirche und Stiften
9.1 Domherr Johann Alhard von Imbsen
9.2 Domherr Johann Werner von Imbsen
9.3 Eine Priorin in Gehrden und weitere Imbsen
9.4 Die Paderborner Domherrenkurien
9.5 Ein Imbsenhof in Paderborn
Wilhelm Ludwig von Imbsen
Friedrich Walter Elmerhaus von Imbsen
Der Imbsensche Liborius-Stein
Vom Unfreien zum Freiherrn
Franz Arnold I. von Imbsen in Brünn
14.1 Bittbrief einer misshandelten Ehefrau
Philipp Moritz von Imbsen
Franz Arnold II. von Imbsen
16.1 Kinder des Franz Arnold II.
Wilhelm Anton von Imbsen
17.1 Hochzeit und Haushaltsbuch
17.2 Bernhardine, die letzte Imbsen in Wewer
17.3 Wilhelm Antons Rechtfertigung
17.4 Wilhelm Antons Kinder
17.5 Was bleibt
17.6 Samuel und das Imbsenarchiv
Nachwort
Literatur und Manuskripte
Archive
2 Einleitung
Am 15.5.1790 erfolgt in dem bald untergehenden Hochstift Paderborn zum letzten Mal die Belehnung eines Mitglieds der Familie von Imbsen durch einen Paderborner Fürstbischof, nämlich Franz Egon von Fürstenberg.1 Nach dem Ende des kleinen Fürstbistums, im Jahr 1803, tritt als Rechtsnachfolger dann der preußische König Friedrich Wilhelm III. als Lehnsgeber auf.2 Doch dann ist das Lehnswesen nicht nur im bäuerlichen Bereich Vergangenheit, auch für die Adelsfamilien wird aus den jahrhundertelangen Lehen freier Besitz.
Nach der Abschaffung des Ständestaates alter Art mit seinen besonderen Adelsprivilegien im Domkapitel sind auch die Aufschwörungen nicht mehr erforderlich, mit denen vor der Ritterschaft und dem Domkapitel über Jahrhunderte der Nachweis der 16 adeligen Ahnen (also vier Generationen) erbracht worden war. Mit Wilhelm Anton von Imbsen aus Wewer erlischt im Jahre 1833 dann die männliche Linie einer der bekannten Adelsfamilien des Hochstifts Paderborn. Sein hinterlassener Grundbesitz wird von seinem Gutsnachbarn und Vetter, dem Freiherrn von und zu Brenken, aufgekauft.
Dieses Buch will nach beinahe 200 Jahren einige Bruchstücke der Geschichte dieser früher in verschiedenen Gegenden bekannten und auch den Ort Wewer prägenden Familie zusammenstellen, der selbstbewussten Erbauer des Schlosses Wewer, deren so tragisches Ende zu Beginn des 19. Jahrhunderts uns alle Probleme dieser Umbruchzeit dramatisch vor Augen führt. So ist die Familiengeschichte zugleich ein Teil der Geschichte Wewers und ein Teil der Geschichte des Hochstifts Paderborn
Wer ist dieser Ritter? Ist es Cord von Imbsen aus der Oldenborg oberhalb der Alme oder sein Schwiegersohn Reineke (Reinhard) von Brenken aus der Burg, die noch heute die Alte Burg genannt wird?
2.1 Die Freiherren von Imbsen (auch Ymmessen) im Warburgschen und in Wewer – ein Überblick
Die Geschichte der im Warburgschen reich begüterten Familie von Imbsen beginnt für Wewer im Jahr 1449 mit der Belehnung des durch die Pest verwaisten Lehens. Durch teilweise Beerbung der ausgestorbenen Familie von Krevet (Krewet) in Verne kommt später der Klinkenhof in Alfen hinzu und ebenso das Erbe der Familie von Juden.
Möglicherweise lebt die Familie von Imbsen dennoch im 18. Jahrhundert über ihre Verhältnisse, während sie noch durch die für den Schlossbau aufgenommenen Schulden belastet ist. Im 19. Jahrhundert erholt sie sich zwar noch einmal durch einige Ablösungszahlungen der Bauern und ist sogar in der Lage, das Gut Wilhelmsburg mit der Ziegelei hinzuzukaufen, doch führt eine Mischung aus unglücklichen Ereignissen und ständiger Krankheit des letzten Eigentümers schließlich zum finanziellen Ruin.3
Wahrscheinlich liegen die sterblichen Überreste des Ritters, dessen Grabplatte zur Alten Burg gerettet wurde, noch in oder an der Wewerschen „Dorff Kirge“ begraben. Ausschnitt aus einer Zeichnung um 1700. (Abb.: LAV NRW W, Wewer 8.567).
Die Familie von Imbsen (oder Ymedeshusen) gehört als Lehnsnehmerin von Bischöfen (bei den Krevetschen Gütern), Grafen von Waldeck, und Klöstern (Gaukirch – Abdinghof – Corvey) zu den ältesten und sehr begüterten Familien Westfalens und ist hier seit dem 13. Jahrhundert nachweisbar.
Teilweise wird behauptet, der Ursprung der Familie liege in der Nähe von Dörenhagen, in dessen Nähe es einen Ort Imminchusen gegeben habe, der dann Imbsen genannt worden sei.4 Andere Quellen vermuten, dass die Familie aus der Borgholzer Gegend gekommen sei, und zwar von der Wüstung Immessen zwischen Frohnhausen und Tietelsen. Dazu werden die noch heute dort vorhandenen Flurbezeichnungen Imbserberg (bei Natingen) und Imbsen-Stätte angeführt.5
Zu einer dieser Ortsbestimmungen würde ein Kaufvertrag von Palmarum 1340 oder 1348 passen, als Albert und sein Sohn Friedrich (Famuli) von Ymmessen zusammen mit ihren Ehefrauen Yda und Gertrud ihren Hof in Ymmessen mit allen ihren Gütern an den Herrn Hermann, Dekan der Kirche von St. Peter in Höxter und ebenso in Gehrden, verkaufen.6 Es gibt aber auch frühmittelalterliche Quellen zu einem Ort nordöstlich von Kassel als eigentlichem Ursprung des Geschlechts.7
Dem widerspricht jedoch der Autor des handschriftlich geführten Heftchens „Zur Geschichte der Familie von Emminghausen“8, der der Meinung ist, dass die Familie im 11. Jahrhundert schon unter verschiedenen Namensvariationen weit verbreitet gewesen sei. Er selbst bevorzugt als Ursprung einen Ort Imminghausen zwischen Korbach und Sachsenberg im Waldeckschen.
Jedenfalls wird ein umfangreicher und von Nordthüringen bis Westphalen verstreuter Grundbesitz genannt, der sich auf verschiedene Linien aufteilt. Bei dem unbekannten Autor der Geschichte der Familie von Imbsen9 heißt es dazu: „Unter dem Schutz des Paderborner Krummstabs10, in dessen Gebiete ihre Güter zumeist lagen, war sie verhältnismäßig gesichert gegen Vergewaltigung und Beraubung durch mächtigere Nachbarn, als wenn sie ihre Unmittelbarkeit hätten behaupten wollen und dieses Schutzes zu entbehren gehabt hätte. Freilich erkaufte sie diesen mit Aufgabe ihrer Dynasten-Qualität, denn sie erkannte schon im XIII. Jahrhundert die Lehnshoheit des Stifts an und erscheint unter den Vasallen-Geschlechtern desselben.“
Und weiter:
„
Gründer dieser Linie war Gebhard von Immenhusen, der Bruder des Burggrafen Dudo von Rusteberg,
(…)
welcher 1154 einer Gaugerichts-Verhandlung über einen Gütertausch
(…)
beiwohnte
.
11
Berthold, sein Sohn, war 1194 mit bei der vom Erzbischof von Köln veranstalteten Versammlung westphälischer Edeln zu Paderborn, welche die Beilegung der Fehden mit dem Grafen von Waldeck
(…)
zum Gegenstande hatte. Noch in höherem Alter nahm er als Verbündeter der Herren von Brakel teil an dem von 1200 – 1213 dauernden Grenzkriege der westphälischen und hessischen Dynasten im Diemellande und starb 1206 vor Volkmarsen.
12
Friedericus de Ymmesen, miles – wohl ein Enkel des Vorigen – kommt 1281 als Zeuge in einer Urkunde des Dynasten von Büren vor.
13
Heinricus de Immessen, famulus, ist 1292 Zeuge bei einem Verkauf
.
14
Hermann v. Imshusen, famulus, erscheint 1336 als Zeuge in einem Reverse
.
15
Henricus de Immessen ist 1472 Domherr in Paderborn und wohnte der damaligen Synode bei
.
Johann v. Immesen erscheint 1503 als Domherr in Paderborn. Er nahm damals an der Errichtung eines Statuts teil, durch welches Bestimmungen wegen der Entfernung der Domherren aus der Stadt während der eingetretenen Pestseuche getroffen wurden.
16
Johann v. Imbsen – sein Neffe – war 1528 ebenfalls Domherr in Paderborn. Derselbe führte einen üppigen Haushalt und der Übermut seiner Dienerschaft führte im genannten Jahre eine Katastrophe herbei, welche sowohl für das Stift wie für die Stadt großen Schaden brachte
.“
17
Cord von Imbsen habe 1569 außer seinem Besitz in Wewer auch das Burglehen zu Borgholz besessen.
18
Nach neueren Forschungen kommen noch die folgenden Namensträger hinzu:
1213 erscheint im Kloster Lamspringe bei Hildesheim ein "Conradus de ymessem", und zwar als Zeuge des Hildesheimer Bischofs (Calenberger UB, Stift Loccum, Bd. 1, Nr. 37).
1249 gibt es in Harste (Bovenden/Niedersachsen) zwei Brüder, die dort unter den Bürgern erscheinen: Degenhard und Heinrich von Immissen (NLA-HStA, Urk. des Kl. Bursfelde, Nr. 16).
1254 tritt im Kontext einer Gütertransaktion derer von Padberg vor Ort ein "Conrado de Ymighusen" auf (WUB VII, Nr. 841).
Um 1260 war "Olricus dictus de Ymmessen" Vogt zu Winzenburg (Calenberger UB, Abt. 4: Marienroder UB, Nr. 30).19
In einer Urkunde des Klosters Gehrden aus dem Jahr 1273 wird ein Fredericus de Ymmesen miles genannt und zehn Jahre später sein Sohn Henricus.20
Fredericus de Ymmessen, Anno domino 1346
In der ältesten Urkunde des Imbsenarchivs ist zu Allerheiligen (1. November) des Jahres 1346 ein Fredericus de Ymmessen, Sohn des Fredericus, erwähnt, der mit Zustimmung seines Bruders Henricus seinen Zehnt in Honbaddenhusen, den er von ihnen zu Lehen trägt, der Elizabet, Witwe des Bertoldus de Ymmessen, und ihren Söhnen Bertoldus, Henricus und Fredericus verkauft hat. (Abb.: LAV NRW W Urkunden, Or. Nr. 2).
Stammtafel der Familie v. Imbsen. (Lagers, Tafel XIX, S. 562).
Die Liste der Imbsenschen Besitzer des Wewerschen Adelsgutes, die zunächst vermutlich den Vorgängerbau der heute noch so genannten Alten Burg, dann die Oldenborg oberhalb der Alme und schließlich das Schloss Wewer bewohnen, beginnt mit Arnd, dem Sohn des Johann, der möglicherweise Burgmann zu Borgholz war.
Arnold (Arnd, Arndt) von Imbsen
(1427 – 1476), Knappe, heiratet in 1. Ehe Gertrude von Bennighausen, Beringhausen oder Monnychhausen (genannt 1445, 1454), in 2. Ehe Gertrud von Bliver (gestorben vor 1504). Arnd wird 1449 nach den von Wefer und von Closter als erster Imbsen mit dem Lehen in Wewer belehnt und lebt vermutlich in der Alten Burg. Sein Bruder Hinrich ist Domherr zu Paderborn und (1476) Oboedientiar zu Wewer.
21
Cordt I. (Conrad) von Imbsen
(gest. 1543), Sohn von Arnd und seiner 2. Frau, Knappe, verh. in 1. Ehe mit Anna von Klencke und in 2. Ehe mit Margarete von Erwitte. Seine Tochter aus 1. Ehe, Anna, verh. mit Reineke von Brenken, erhält die Alte Burg.
Melchior (Melchisedech) v. Imbsen
(1527 – 1571), Halbbruder von Anna von Imbsen aus 2. Ehe, Besitzer der anderen Hälfte der Wewerschen Adelsgüter, verh. 1. mit Anna von Westphalen und 2. mit Emerentia von Krevet zu Vernaburg. Melchior lebt in der Oldenborg auf der Anhöhe.
Sein Sohn aus 2. Ehe,
Cordt (Conrad) II. von Imbsen
(1552 – 1611 oder 10 in Speyer), verh. mit Elisabeth von Ense zu Westernkotten.
Walter (oder Wolter) Adrian von Imbsen
(um 1593/95 – 1636), verh. mit Odilia von Krevet zu Vernaburg und Alfen.
Jobst Godefried (Gottfried) von Imbsen
(um 1630 – 12.10.1693), verh. in 1. Ehe mit Catharina Margarethe von Voß und in 2. Ehe mit Elisabeth Cath. von Westphalen zu Fürstenberg, Erbauer des Schlosses Wewer.
Sein Sohn aus 1. Ehe,
Wilhelm Ludwig von Imbsen
(geb. um 1663, kinderlos gest. 1713), verh. mit Amalia Sophia von Wendt zu Papenhausen (gest. 1752).
Dessen Bruder
Friedrich Walter Elmerhaus von Imbsen
(gest. vor 1723), verh. mit Bernhardine Sibilla Rosina von Raesfeld zu Ostendorf.
Sein Sohn
Franz Arnold I. von Imbsen
(1717 – 1756), kinderlos verh. mit Maria Antonia von Imbsen (gest. 1784), lebt in Wien und Brünn. Seine westfälischen Güter gehen an seinen Vetter Werner Philipp Moritz von Imbsen.
Werner Philipp Moritz von Imbsen
(1704 – 1760), Sohn des Wilhelm Raban von Imbsen (gest. vor 1723?) und der Maria Anna von Bergknecht (geb. 1672, verh. 1698?), verh. mit Sophie Antonie Viktoria von Juden zu Borgholz und Freienhagen.
22
Sein Sohn
Franz Arnold II. von Imbsen
(1753 – 1831), verh. in 1. Ehe mit Maria Agnes von Weichs zur Wenne (1762 – 1787 oder 1788) und in 2. Ehe mit Marie Luise von Westphalen zu Heydelbeck (gest. 1791).
Als letzter seines Geschlechtes sein Sohn aus 1. Ehe,
Wilhelm Anton von Imbsen
(1782 – 1833), verh. mit Bernhardine von Korff-Schmising (1786 – 1866). Die drei Söhne sterben vor dem Vater.
Aufschwörung des Wilhelm Ludwig von Imbsen, Sohn von Jobst Gottfried von Imbsen und seiner ersten Frau, Catharina Margarethe von Voss. Aus dem Aufschwörungsbuch der Paderborner Ritterschaft, das nach dem Ende des alten Ständestaates von der Familie von und zu Brenken gehütet wird. (Privatbesitz).
Aufschwörungstafel des Franz Arnold I. von Imbsen. (Privatbesitz).
2.1.1 Ende der von Clostere und der von Wefere und Beginn der von Imbsen
Nicht mehr als ein paar Erwähnungen in alten Urkunden ist von der Familie von (vom) Kloster23 geblieben, von der anzunehmen ist, dass sie im Mittelalter die Alte Burg zu Wewer bewohnte.
So kauft Bischof Balduin von Steinfurt im Jahr 1355 einem Nolte van deme Clostere Güter ab, mit denen er Hermann von Brenken und dessen Sohn Volmar zusammen mit zwei Teilen der Burg Fürstenberg ausstattet.24 Am 24.7.1366 und am Dreikönigstag des Folgejahres tritt der Knappe Nolte van deme Clostere dann als Zeuge bei einem Kaufvertrag des Volmar von Brenken auf. Auch 1367 siegelt er zusammen mit dem Ritter Frederik van Brenken und dem Knappen Volmar van Brenken, ebenso erscheint 1371 sein Name in einem Vertrag. Im Jahr 1372 schließt er mit den Edelherren von Büren einen Vertrag über das ihm von deren Vater verpfändete Gut vor Büren. Bei der Erbteilung des Friedrich von Brenken am 1.7.1373 wird Nolte van deme Clostere der Neffe der Brüder Olrich, Volmar und Frederich von Brenken genannt. Am 1.5.1393 versetzt Nolte van dem Clostere ein Gut zu Kedinchusen, das er von den Brenken zu Lehen hat. 1399 schreibt Nolte von dem Kloster an seinen Schwager van Smerlyke. Am 22.2.1399 erwähnt Nolte van dem Clostere seinen Vater gleichen Namens, seine Mutter Berte und seinen Bruder Johannes.25 Im Jahr 1516 wird noch einmal ein Ludolf vom Kloister als Amtmann zu Dringenberg erwähnt.26
Am ersten Tag in den Fasten des Jahres 1449 belehnt Stephan von der Malsborch als Oboedientiar zu Wewer Arndt (Arnd, Arnold) von Ymmessen und all seine Erben mit dem Amt Wewer, mit allen seinen Zubehörigen, mit Hute, Acker, Holz, Wassern, Weiden und Triften. Am Samstag nach Oculi folgt die Bestätigung durch den Dompropst und das Domkapitel.27
Unter einer Oboedienz ist ein Sondervermögen des Domkapitels zu verstehen. Demnach ist das Domkapitel Lehnsherr des Amtes Wewer und Arndt von Imbsen wird im Jahr 1449 Lehnsmann des Domkapitels.
Mit dem Knappen Arndt (Arnold) von Imbsen (gest. vor 1478) und seiner Frau Gertrud von Bennighausen, Beringhausen oder Monychhausen (gen. 1445) beginnt damit in Wewer die Ära der Familie von Imbsen. Arndt ist in zweiter Ehe mit Gertrud von Bliver verheiratet. Als Wohnung für den Wechsel der vom Kloster zu den von Imbsen ist die Alte Burg anzunehmen und als Wohnort der von Wewer die obere „Oldenborg“, die spätestens 1515 mit der Einheirat des Reineke von Brenken in die Familie von Imbsen von dieser übernommen wird. Im Jahr 1462 attestiert Stephan von der Malsburg, dass „der seelige Wilhelm van dem Closter“ für sich und seine Erben das Amt zu Wewer ohne jeden Vorbehalt dem Arndt von Imbsen abgetreten und ihn damit zu belehnen gebeten habe.28
Doch im Jahr 1567 gibt es einen Prozess vor dem Reichskammergericht. Die Brüder Wolf, Dietrich und Ludolf vom Kloster klagen gegen Melchior von Imbsen auf Wiederlöse des angeblich im Jahr 1440 verpfändeten Amtes und Schlosses Wewer.29 Wilhelm vom Kloster habe Arnd von Imbsens Schwester zur Frau gehabt. Da sich Wilhelm vom Kloster als Hofmarschall am Jülischen Hof aufgehalten habe, habe er durch Vertrag seinem Schwager von Imbsen das Amt Wewer überlassen. Dessen Enkel Melchior von Imbsen dagegen behauptet, das Amt rühre von Menke und Friedrich30 von Wewer her. Friedrich habe es noch 1440 in Besitz gehabt und es sei 1452 an Arnd von Imbsen gekommen. Dem widerspricht die Seite von Kloster und behauptet, der Urgroßvater Wilhelm von Kloster habe das Amt 1452 von Erzbischof Dietrich und Stephan von der Malsburg zu Lehen erhalten. Wilhelm von Kloster habe das Gut dann nur pfandweise seinem Schwager von Imbsen überlassen. Nach seinem Tod habe sein Sohn, Wilhelm d. J., oft bei der Witwe von Imbsen und den Söhnen Johann, dem Domherrn zu Paderborn, und Cord I. angehalten, ihm sein väterliches Gut einzuräumen. Besonders 1478/79 habe er dem Johann gegenüber darauf gedrungen. Wie es damals unter Verwandten üblich gewesen sei, habe man die Verpfändung nicht schriftlich abgemacht. Doch 1498 habe Cord I. von Imbsen auf der Neustadt Bielefeld die Ansprüche vor einem öffentlichen Gericht anerkannt, worüber ein Gerichtsschein ausgestellt worden sei. Melchior von Imbsen erwidert, sein Vater sei ein melancholischer, unsinniger und irrender Mensch gewesen. Die Kläger behaupten, der Domscholaster Philipp von Twiste habe die Briefe über das Haus Wewer in einer Kiste unter seinem Bett gehabt, doch nach dessen Tod im Jahr 1551 habe Melchior von Imbsen die Dokumente an sich genommen. Melchior habe selbst erklärt, dass die Pfandsumme nur 1.400 Gulden betragen habe.31 Doch schließlich obsiegt Melchior von Imbsen und das Lehen bleibt in Imbsenscher Hand.
Auf die Familie von Wewer32 stoßen wir, als am 28.5.1347 ein Wylhelmo de Wevere als Zeuge auftritt. 1363 wird W. v. Wevere in einem Schiedsspruch im Streit der Familie von Etteln erwähnt. 1373 siegelt ein Knappe Henrich van Wevere. 1375, 1378 und 1379 treten die Knappen Hinrich und Werner van Wevere als Zeugen auf. Am 25.3.1376 wird bescheinigt, dass der Knappe Volmar von Brenken dem „religioso viro domino Johanni de Wevere, coventuali monasterii santorum Petri et Pauli Paderbornensis“ eine Kornrente gewährt. 1395 ist von einer von Wewerschen Eigenbehörigen in Nordborchen die Rede. Am 21.3.1399 bekundet Frederik van Wevere, dass er seine Brüder Henrike und Wernere van Wevere und seinen Vetter Menken gebeten habe, mit ihm in ihren gemeinsamen Meygerhof zu Wevere 2 Mk. Geldes für 28 Mk. den Altaristen des h. Leichnams in dem Dome zu Palborne (Anm.: Paderborn) zu verpfänden. Allerdings habe er das Geld zu seinem eigenen Nutzen verwendet und verspricht, es zurückzugeben.33
Ein Kaufbrief von 1418, „am Mondag nach oculi“34 erwähnt verschiedene Familienmitglieder des Geschlechts von Wewer. So hätten Friederich von Wewer, der Ältere, „und Gysela, seine rechte Hausfraw“, sowie ihre Kinder Friederich und Johann von Wewer ihren auf der Alme gelegenen Baumgarten und den Gosewinkel mit all ihren Rechten und „Thobehörigen“ an ihren Vetter Mencko von Wewer und „Gerdrude, seine eheliche Hausfrawen“ verkauft. Weiter ist dort von Henrich von Wewer und seinem seligen Gedächtnis die Rede.
Bevor die von Imbsen nach Wewer kommen, geht im 14. und 15. Jahrhundert auch im Paderborner Land die Pest um, was einen schweren Rückschlag in der Entwicklung der Gegend bedeutet. In Wewer wird es dabei ähnlich aussehen wie anderswo, wo die Bevölkerung so stark dezimiert wird, dass viele Bauernstellen nicht mehr besetzt werden können und die Wirtschaft zusammenbricht.
Doch der Tod verschont auch die Gutsherren nicht. So fällt im Jahr 1439 auch Menko von Wevere mit seiner 2. Frau Gertrud von Amelunxen und seinem Vetter Henricus de Wevere der Pest zum Opfer.35 Neben vielen Häusern der Armen wird damit auch eine der Wewerschen Burgen zum Leichenhaus.
Die von Wewer führten zehn Rosen in ihrem Wappen (4 : 3 : 2 : 1).36 Im Jahr 1545 findet eine Belehnung statt. Eine Urkunde, „am sonnavende na purificationis Marie virginis“ verfasst, berichtet, dass der 1439 der Pest erlegene Mencke von Wever früher mit acht Morgen Land im „Giersvelde“ vor Paderborn belehnt gewesen sei. Der Lehnsherr Graf zur Lippe fordert nun, nach Aussterben des Mannesstammes derer von Wever37, Melchisedech von Immessen als Erbfolger auf, das Lehen zu empfangen.38
Im Jahr 1476 scheint Arndt von Imbsen, der erste Wewersche Burgherr nach den Schrecken der Pestzeit, an sein Seelenheil zu denken. Er schenkt den Paderborner Franziskanern39 Land, um sich eine Memorie, ein immerwährendes Gedächtnis in der hl. Messfeier, zu erwerben. In der Urkunde vom 5.2.1476, „des anderen dages na sant Blasii des hilligen mertelers“,40 bekunden der Guardian, der Lesemeister, der Schreiber und die gemeinen Brüder des Franziskanerklosters zu Paderborn, dass der Knappe Arndt van Immessen mit Einwilligung seines Bruders Henrikes (Heinrich), des jetzigen Oboedientiars zu Wever, Söhne des Johann v. Imbsen, und Cordes ihnen Land an der Sunderen zu einer Memorie geschenkt habe. Das spitzovale Siegel zeigt eine stehende Madonna, die auf dem linken Arm das Kind trägt, während die rechte Hand eine Lilie hält.
Weitere zwei Jahre später scheint Arndt von Imbsen tot zu sein, denn seine Söhne Cordt I. und Johann, der Domherr und Archidiakon zu Paderborn und Propst zu Hameln, treten am 21. August 1478 für sich und ihre verwitwete Mutter Gertrud als Vertragspartner bei einem Landverkauf auf.41 Am 11. Juni 1501 teilen die Brüder dann das väterliche Erbe unter sich auf.42
Cordt I. (Conrad) von Imbsen (1478 nach dem Tod Arndts zusammen mit seinem Bruder Johann als Besitzer des Amtes Wewer genannt, gest. Februar 1543), Knappe, heiratet in 1. Ehe Anna von Klencke (gen. 1501, 1515) und in 2. Ehe Margarete von Erwitte, verwitwete von Grafschaft (gen. 1520, 1533). Er wohnt, wie schon sein Vater Arndt, in der Alten Burg an der Alme. Seine Tochter aus 1. Ehe, Anna, heiratet 1515 Reineke (Reinhard) von Brenken und erhält die Alte Burg mit der Hälfte des Imbsenschen Besitzes. Damit wird sie zur Stammmutter der Brenken in Wewer, und aus der Imbsenschen Burg wird nach nur 66 Jahren eine Brenkensche Burg. Melchisedech, Cordts I. Sohn aus 2. Ehe, wird sein Nachfolger, nun aber in der nicht weit entfernten Oldenburg.
2.2 Wieder zwei Adelsgeschlechter in Wewer
Mit der Heirat von Anna, der Tochter von Cordt I. von Imbsen, mit Reineke von Brenken im Jahr 1515 erscheint nun in Wewer das Geschlecht der von Brenken. Annas geistlicher Onkel Johann, Besitzer einer Hälfte des Imbsenschen Gutes, belehnt im Jahre 1517 Reineke von Brenken und seine Abkömmlinge mit seinem Teil des Amtes Wewer.43 Johann von Imbsen wird als Domherr und Kämmerer der Kirche zu Paderborn bezeichnet, aber auch als Propst zu Hameln und Besitzer der Oboedienz zu Wewer. Derselbe Onkel unterzeichnet dann 1519 einen Kaufbrief für den „erbarn Reineke von Brenken und Anne seine eheliche Hausfrau“ für 120 Rheinische Goldgulden mit Vorbehalt des Rückkaufs über seine Hälfte des Platzes mit Haus, Scheune, Backhaus, Viehhaus und Fischerei, des Vorhauses und des Zugbrückenplatzes.44 Es folgen bis 1526 weitere Übertragungen, nämlich von Korn und Geldforderungen aus Wewer, der Fischerei und der Fischteiche, des Gartens und des Hamelbergs45, der Schaftrift und des Schafstalles, des Holzes (Waldes) und der Geld- und Kornzinsen. Weitere Verträge betreffen die Mühle und ein neu zu erbauendes Haus46, eine Brücke über die Alme, die Brüchte zu Wewer und eine Obligation.47
Von ihrem Vater Cordt I. erhält Anna im Jahr 1520 ein Viertel seines Anteils übertragen.48 Das weitere Viertel behält er sich bis zu seinem Tode vor, dann soll es sein Schwiegersohn Reineke von Brenken erhalten.
Doch die Verhältnisse ändern sich, als Annas Vater nach dem Tod ihrer Mutter mit Margarete von Erwitte ein zweites Mal heiratet und weitere Kinder, so auch den Sohn Melchior (Melchisedech), bekommt. Nun bereut die Familie die Übergabe an die Tochter und es beginnt ein langer Streit mit den Brenken-Nachbarn. In der nächsten Generation, um 1550, ist man schließlich so zerstritten, dass auch das beiderseitige Hausgesinde in einer Schlägerei mitmischt.49
Von den zwei Wewerschen Burgen wird die schon damals schlicht „Alte Burg“ genannte Burg von Arndt von Imbsens Enkelin Anna und ihrem Mann Reineke von Brenken bewohnt. Annas Bruder Melchior von Imbsen lebt dagegen in der „Oldenborg“, die allerdings in einem Schriftstück des Jahres 1564 durchgehend als „Schloß zu Wefer“ oder auch „Weffer“ bezeichnet wird.50
Den entstandenen Streitigkeiten verdanken wir die einzige Abbildung der beiden Burgen, die für die Gerichte angefertigt wird, um ihnen die Örtlichkeiten zu erläutern.51 Nach dieser Zeichnung wirkt die auf einem hohen Sockel stehende obere Burg bereits wesentlich größer als die untere Burg. Melchiors Nachkomme, der Droste Jobst Gottfried von Imbsen, ersetzt – entsprechend dem gestiegenen Ansehen der Familie – um 1684/86 diese obere Burg schließlich an gleicher Stelledurch den neuen Schlossbau.
Die berühmte Wewersche Karte. (Abb.: LAV NRW W, Karten A Nr. 47.745).
Auf der Zeichnung heißt es zur Alten Burg: „die Brenkenwonnung worauff mein Großvatter Curdt von Ymmessen und seine Vorfatteren gewonet“.52
Durch die Einheirat von Reineke von Brenken und die Überlassung der Alten Burg gibt es also spätestens seit 1515 (wieder) zwei Adelsgüter in Wewer, sehr dicht beieinander – mit vielen Gelegenheiten, sich zu streiten.
In einer Rückschau aus dem Jahr 1747 werden, wohl wegen der unterdes entstandenen „Irrungen“, die wichtigsten Verträge noch einmal kurz zusammengefasst.53 Danach hatten der Domherr Johann und sein Bruder Cordt I. (Conrad) von Imbsen im Jahr 1504 ihren Besitz untereinander aufgeteilt. Die Wiesen sollten mit Pfählen gezäunt werden, damit das Vieh nicht gegenseitig Schaden mache. Johann hatte einige Güter außerhalb Wewers versetzt, sein Bruder Cordt I. hatte die Hälfte der Revenuen erhalten.
Grund für den handfesten Streit mit den Brenken ist also aus Imbsenscher Sicht die Tatsache, dass die Hälfte des Wewerschen Lehens über Cordts Tochter Anna vererbt und damit aus der Familie geraten war – an Reineke von Brenken. In einem undatierten Schriftstück54, wohl aus dem 17. Jahrhundert, wird die Verärgerung der Imbsen zu Papier gebracht. Gleichzeitig wird versucht zu erklären, warum aber erst im Jahr 1591 darum ein Prozess geführt wurde.
Neben der Zeichnung zur Abstammung wird die Imbsensche Position dargestellt (die sich jedoch nicht mit den Urkunden deckt). „Arndt von Imbsen war 1449 primus acquirens des Lehns v. Amt Wewer womit er vom Thumcapitel ohne alle Ausnahme ist belehnt worden. Er besaß dieses Lehen wirklich und zeugte mit seiner ersten Frauen 4 Töchter u. 2 Söhne Johann und Cordt v. I. Die Töchter wurden teils ausgesteuert, teils geistlich. Ein Sohn Johann aber wurde Thumherr u. Oboedienziar d. Amts Wewer; sein Bruder Cordt hingegen blieb in Wewer, verehelichte sich mit Anna Klenken u. zeugte mit dieser eine