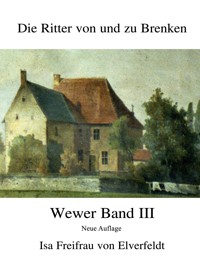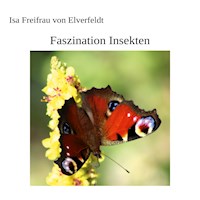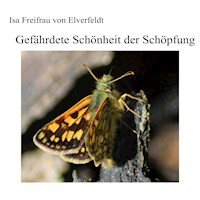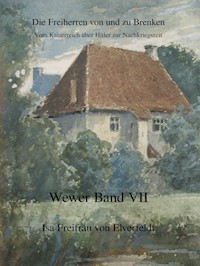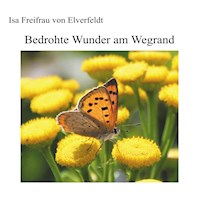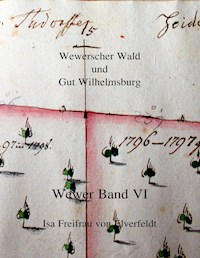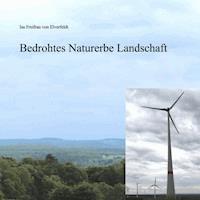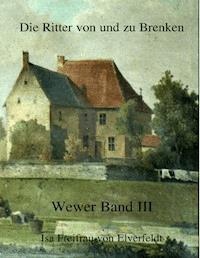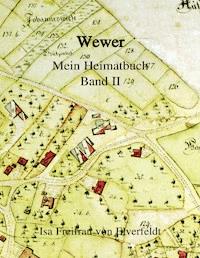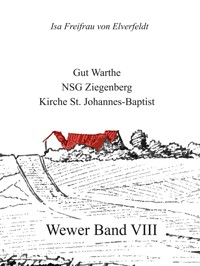
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der letzte Band der Wewerreihe befasst sich mit der langen Geschichte des auf der Anhöhe vor Paderborn gelegenen Gutes Warthe. Mit seiner Bedeutung als Gasthof am Alten Hellweg, der alten Heeres- und Handelsstraße, und wie es ihm gelang, diese Lage aufrecht zu erhalten, selbst anlässlich des als Wewerscher Skandal bekanntgewordenen kulturzerstörenden Straßenausbaus. Im weiteren Teil geht es um die Gefährdung der natürlichen Umgebung, den Ausverkauf der Landschaft und der Natur durch die Windindustrialisierung, aber auch um historische und aktuelle Naturbeobachtungen, auch der geheimnisvollen Nachtfalter, und um das Naturschutzgebiet Ziegenberg bei Paderborn. Der dritte Teil fasst die bisherigen Forschungen zur katholischen Pfarrkirche St. Johannes-Baptist zusammen, von ihrem mittelalterlichen Beginn über die Rolle der adeligen Patronatsherren, dem Ende als selbstständiger Pfarrei durch Aufgehen im neuen Pfarrverbund bis zur Suche nach neuen Impulsen für das Gemeindeleben, wie schon einmal im 19. Jhdt. Damals hatte es in der politisch schwierigen Zeit von Bismarcks Kirchenkampf unerwartete weibliche Impulse im Zusammenhang mit der Schlosskapelle gegeben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 186
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gut Warthe
Naturschutzgebiet Ziegenberg
Kirche St. Johannes-Baptist
Isa Freifrau von Elverfeldt
Gut Warthe
Naturschutzgebiet Ziegenberg
Kirche St. Johannes Baptist
Wewer Band VIII
Wewer-EDITION
1 Inhaltsverzeichnis
1 Inhaltsverzeichnis
Vorwort
2 Gut Warthe
2.1 Ein kurzer Streifzug durch die Geschichte
2.2 Der Alte Hellweg
2.3 Die Landwehr und der geheimnisvolle Turm
2.4 Die Klus am alten Hellweg, Klause oder Gerichtsstätte?
2.5 Die Familie Jakobs
2.6 Die Hofgebäude
2.7 Die Landwirtschaft früher
2.71 Ankauf durch den Freiherrn von Brenken
2.72 Pächterfamilie Schlüter
2.73 Beginn der Umstrukturierung
2.74 Der Hof blüht auf
2.75 Landwirtschaft heute
3 Gensicke lässt die Bagger rollen
3.1 Der Wewersche Skandal
3.2 Wie kann so etwas in einem Rechtsstaat passieren?
3.3 Eine Sache der Ehre oder Sichfügen ist keine Politik
4 Neue Gefahren für die Kulturlandschaft
4.1 Die kulturelle Wende
4.2 Wie Gut Warthe beinahe einen christlichen Beerdigungswald erhalten hätte
5 Das Naturschutzgebiet Ziegenberg
5.1 Ästerlästersillgenbläher, das Wewersche Kräuterbund
5.2 Ausblick
5.3 Besuche von Landfahrern
5.4 Fischerei - Jagd - Natur
6 Katholische Kirche St. Johannes-Baptist
6.1 Das Kirchenpatronat
6.2 Der Kirchenkampf trifft Wewer
6.3 Die Güldenpfennig-Kirche von 1884
6.4 Der Zweite Weltkrieg und die Fatimakapelle
6.5 Wieder eine neue Kirche, 1984/85
6.6 Gerettet: Das Kreuz im Bestattungswald
6.7 Die Bittprozessionen in Wewer
6.8 Zusammenfassung und Persönliches
7 Archive
8 Literaturverzeichnis
Vorwort
Dieser Wewerband gibt noch einmal entlang meiner Familiengeschichte Einblicke in einzelne Episoden der Geschichte Wewers, er erinnert an Naturereignisse und vergessene Bräuche und er enthält auch eine Reportage des wewerschen Skandals um die B 1 bei Gut Warthe. Wieder finden sich hier viele bisher unveröffentlichte Bilddokumente und historische Karten. Immer wieder geht es um die Gefährdungen der Heimat und der Natur, aktuell in Form der Industrialisierung der Landschaft durch die Windindustrie, was ausgerechnet mithilfe der Kirchen und ihrer unkritischen Unterstützung der missglückten Energiewende geschieht. Über Gut Warthe, das Naturschutzgebiet Ziegenberg und das Thema Natur in allen Facetten führt dieser neue und wahrscheinlich letzte Wewer-Band zur wewerschen Kirche St. Johannes-Baptist, ein Thema, zu dem es - wie zuvor schon bei Schloss und Burg - bisher keine umfassende Veröffentlichung gibt. Durch die große Bedeutung der Kirchenpatronate ergab sich hier für mich die Möglichkeit, Quellen aus den Adelsarchiven und meinen Forschungen zu den Familien von Brenken und von Imbsen zusammenzuführen, allerdings in der Hoffnung auf weitere Forschungen durch Kirchenhistoriker. Wie immer geben die Themen neben den Fakten auch meine persönliche, oft kritische Meinung wieder, was zum Hinterfragen so vieler angeblicher Sachzwänge anregen soll.
Isa Freifrau von Elverfeldt, geb. Freiin von und zu Brenken
Im Herbst 2023
2 Gut Warthe
Gut Warthe in der Mitte des 19. Jhdt.s mit der neuen Trasse des Hellwegs. Rechts das Wäldchen Ikerloh. Zeichnung Brand, Altertumsverein Paderborn Cod178-036 AV.
Früher im mythischen Ruf der Mittelaltergeschichte Paderborns, heute eine Oase vor der Stadt, wenn auch seit ungefähr 2012 vom Hellweg aus – als Sieg der Straßenbau-Bürokratie über die Geschichte und den Willen der Bürger – in der Ansicht einer eher skurrilen Höhenfestung. Das Gut hat bis in die neueste Zeit viel erlebt – und überlebt. Kein Wunder also, dass es schon immer großes Interesse und viele Fragen nach seiner Geschichte geweckt hat und sich bereits viele Heimatforscher, von dem Schlossrentmeister Wilhelm Schütte zu Ende des 19. Jhdt.s bis zu Dr. Heinrich Otten in der aktuellen Denkmaltopografie der Stadt Paderborn, damit beschäftigt haben.
Einen breiteren Raum sollen jetzt aber auch die bisher nur ausschnittsweise aus den damaligen Presseveröffentlichungen bekannten Umstände des Jahrhundertskandals der B-1-Erweiterung einnehmen, die Gut Warthe tatsächlich wieder an den Rand seiner Existenz gebracht hatten. Weil an der Breite der Bundesstraße ein einziger Meter fehlte, waren nicht nur ein Hügel abgetragen und rund 50.000 Quadratmeter fruchtbarsten Ackerbodens verbraucht worden, sondern es war durch den Verzicht auf die nötigen Bodenuntersuchungen auch die Existenz der historischen Anlage selbst aufs Spiel gesetzt worden - ein Unterfangen, das über Jahre die Medien beschäftigte.
Aber der Reihe nach. Als das Freiluftmuseum Detmold im Jahr 2006 eine Tagung „Historische Wirtshäuser“ plante, war dies für mich ein Anlass, mich auch mit diesem Aspekt der Geschichte des Gutes Warthe zu beschäftigen. Schließlich war gerade mal fünf Jahre zuvor, im Jahr 2001, nach einer Pause von vielleicht 80 Jahren die alte Tradition des „Gasthauses zum Wartturm“ am Alten Hellweg hier bei Paderborn mit der italienisch geführten „TrattoriAntica“ zu neuem Leben erweckt worden. Wenn auch die „Wiedereröffnung“ durch die näher gerückte Straße, die jetzige Bundesstraße 1, nur noch in einem Stallgebäude anstelle des alten Guts- und Gasthauses möglich war, so wurde damit doch eine jahrhundertealte Tradition an geschichts- trächtigem Ort fortgeführt.
Gut Warthe, als Teil der mittelalterlichen Landwehr auf der westlichen Anhöhe vor Paderborn gelegen, war zu dieser Zeit allgemein als „Tor“ zur Stadt Paderborn bekannt, von wo aus sich ein geradezu amphitheatriger Blick auf die Domstadt eröffnete.
Wenn auch der namensgebende Wartturm zu Anfang des 19. Jahrhunderts abgebaut worden war, so existierten doch immer noch beachtenswerte Gebäude, hervorstechend das von Dombaumeister Güldenpfennig 1878 errichtete Guts- und Gasthaus und das Barrierehaus (um 1800) als ehemalige Chausseegeld-Einnahmestelle, aber auch der benachbarte Gewölbestall aus dem 19. Jahrhundert, der nun mit dem passenden Namen „TrattoriAntica“ eine hochwertige italienische Gastronomie beherbergte. Beim Barriere- oder Zollhaus, das 1999 von slowakischen Restauratoren nach altem Grundriss wiederhergestellt worden war, handelte es sich um das einzige erhaltene Gebäude dieser Art im Kreis Paderborn. Das Gutshaus dagegen stellte den einzigen erhaltenen Profanbau des Architekten Güldenpfennig dar, der sonst überwiegend durch Kirchenbauten bekannt ist.
Dass diese geschichtsträchtige Anlage als eine der wenigen an Straßen erhaltenen Gasthauskomplexe überlebt hatte, noch dazu an einer so bedeutenden Trasse wie dem West- und Osteuropa verbindenden Alten Hellweg, der späteren Reichsstraße und jetzigen Bundesstraße 1, war nicht selbstverständlich gewesen. Denn es waren nicht nur die unterschiedlichen Kriege gewesen, die seine Existenz gefährdet hatten, sondern die Straße selbst, die bei einem Ausbau in den 1960er Jahren den Gutshof vom Dorf Wewer abgetrennt und ein Bewohnen fortan unmöglich gemacht hatte. Denn in der Zeit der Autobegeisterung war eine Überquerung der B 1 zu Fuß nicht mehr vorgesehen gewesen. Die Gebäude schienen, wie so viele andere zu dieser Zeit, dem Untergang geweiht. Da war es die Denkmalbehörde der Stadt Paderborn, die mich als Eigentümerin um 1980 in meinem Entschluss unterstützte, Gut Warthe dennoch zu erhalten. Gutshaus und Zollhaus wurden unter großem Aufwand baulich gerettet, und es kam zur Eröffnung des neuen Gasthauses im Gewölberaum, nachdem im Gutshaus bereits die Galerie Kafsack eingezogen war.
Der Hellweg mit Gut Warthe in der Mitte des 19. Jhdts. Zeichnung Brand, Altertumsverein Paderborn Cod178-168.
Was wir dabei nicht ahnen konnten, war aber, dass in den folgenden Jahren unser Einsatz beinahe wieder zunichte gemacht werden würde, als - wie ein Naturereignis - das Vorhaben einer gefährlichen, von niemandem verstandenen und gewollten, aber mit höchster Autorität ausgestatteten neuerlichen Ausbauvariante der Bundesstraße über uns hereinbrach. Nun ging es gleich wieder um die Existenz der historischen Anlage, deren Bedeutung gerade erst voll ins Bewusstsein gerückt war. In einem jahrelangen, aufreibenden und durch alle Medien gehenden, auch finanziell aufwendigen, aber trotz der großen Unterstützung entsetzter Bürger und Fachbehörden letztlich erfolglosem Kampf, befindet sich die Hofanlage nun in einem völlig anderen Zustand. Als „Sieg der Bürokratie über den Bürgerwillen“, wie es bezeichnet wurde, erwiesen sich die Einwände des Heimatvereins Paderborn, des Heimatbundes Wewer, einer weweraner Bürgerinitiative, des Steuerzahlerbundes u.v.m. als völlig wirkungslos und verlorene Zeit vieler engagierter Bürger, deren Meinung niemanden interessierte.
Zwar hat die Hofanlage letztlich trotz vielerlei Blessuren und dilettantischer Bauplanungen überlebt und überlebte auch der Betrieb im Innenhof wider Erwarten, doch bleibt die äußere Verschandelung eine bleibende Erinnerung an geschichts-, landschafts- und kulturvergessene Behördenwillkür. Aber immerhin, Gut Warthe lebt und die Gastwirtschaft mit neuem Wirt blüht mehr denn je.
2.1 Ein kurzer Streifzug durch die Geschichte
Nachdem das Gut in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts durch unglückliche familiäre Umstände der jahrhundertelangen Besitzer-familie Jakobs verloren gegangen war, wurde es schließlich im Jahr 1844 von dem Rittergutsbesitzer Friedrich Carl Freiherr von und zu Brenken, meinem Ururgroßvater, für seinen Sohn Hermann aufgekauft, der sich in der Folge in einem großen Bauprogramm mit Elan der Erneuerung der Gutsgebäude widmete.
Der Name des Gutes Warthe führt zurück auf die Warttürme der mittelalterlichen Landwehr rund um Paderborn, von wo aus die Stadt Paderborn vor feindlichen Angriffen geschützt wurde. Die Landwehr bestand auch bei Gut Warthe aus mehreren undurchdringlichen, mit geknickten Dornensträuchern, den sogenannten Knicks, bewachsenen Wällen und beidseitig angelegten Gräben, die nur an bestimmten Durchlässen zu passieren waren. Das konnten Archäologen bei ihrer Grabung im Jahr 2008 im ehemaligen Gutsgarten nachweisen. Die Lage der ehemaligen Landwehr nördlich von Gut Warthe ist noch heute durch die weithin sichtbare Frühjahrsblüte der Weißdornhecke zu erkennen.
Nachdem der Hellweg als wichtige Handels- und Heerstraße vermutlich seit dem 14. Jahrhundert vom Wartturm aus überwacht worden war, wurde der Turm in preußischer Zeit, in den 1820er Jahren, abgerissen und das Bruchsteinmaterial zum Bau der Stallgebäude des Gutes verwendet. Das Geheimnis seines genauen Standortes ist bis heute ungelüftet und alle Suche während der Ausbauphase der B 1 war erfolglos. Es wurden die unterschiedlichsten Standorte vermutet, wobei mir wegen der kreisförmigen Einzeichnung auf der Karte von 1829/30 von Seite 19 aber am wahrscheinlichsten ein Standort auf dem jetzigen Hofgelände ist, ungefähr bei der alten Eiche und der Informationstafel.
Der Hellweg auf der Höhe von Gut Warthe mit der Lindenreihe, die sich noch ein Stück bis auf die Kuppe fortsetzte. Aufnahme um 1900/1920. Stadtarchiv Paderborn, Sign. 03.03.1.
Ursprünglich hatte sich das Gut Warthe zur Hälfte im Eigentum des Paderborner Domkapitels befunden und je zu einem Viertel im Eigentum des Fürstbischofs und des Abdinghofklosters. Aber auch die Herren von und zu Brenken waren daran beteiligt und hatten dafür vom Wartemeier als „Weinkauf“ einen Goldgulden und drei Taler erhalten.
Der Maler dieses Bildes hat der Zeichnung Brand von Seite 11 noch einen beladenen Wagen mit Glaswaren aus Siebenstern bei Bad Driburg beigefügt, der vor dem Reisestall ausgespannt hat, während sich ein Wanderer auf der Straße zum Gast- und Gutshaus und angrenzendem Zollhaus begibt, dessen Schranke geöffnet ist. Ob es sich bei dem Loch in der Leinwand um einen Einschuss aus dem 2. Weltkrieg handelt? (Gemälde wohl 19.Jhdt.).
Im Jahr 1583 wird erstmals ein Johannes Jakobs aus Wewer als Besitzer genannt. Das Gut erlebt nun unter der Familie Jakobs, einer bedeutenden weweraner Bauernfamilie, eine Blütezeit. Die besondere Lage an der alten Handels- und Heeresstraße macht das Gasthaus weithin bekannt. Besonders zu Messezeiten machen unzählige durchreisende Händler auf der Warthe Rast. So sollen die Pferdewagen in einer Schlange von 100 Metern vor dem Gasthaus gestanden haben. 20 Pferde hätten bereitgestanden, um den Gästen Vorspanndienste zu leisten. Auch hätte der tüchtige Wirt Jakobs, der zur Messezeit nachts in der Wirtsstube auf einer Holzbank geschlafen habe, um jederzeit für seine Gäste bereit zu sein, einmal einen französischen Kaufmann bis nach Warschau begleitet. Holländer, Engländer und Franzosen seien im Gasthaus eingekehrt, das in Frankreich unter dem Namen „Aupres de la Tour“ (Am Turm) bekannt gewesen sei. Als ungebetener Gast nahm allerdings 1646, zu Ende des 30-jährigen Kriegs, auch der schwedische General Wrangel hier Quartier und während des 7-jährigen Kriegs sollen am 23. März 1759 auf der Warthe 4.000 Mann des französischen Generals Contades gelegen haben. Im 19. Jahrhundert begrüßte hier die Gemeinde Wewer dann durchreisende Honoratioren und so auch einmal den preußischen König.
Nach dem Verkauf im Jahr 1844 an meinen Vorfahren wird das Gut seit den 1880er Jahren in mehreren Generationen durch die Pächter-familie Schlüter bewirtschaftet, durch die es im Kreis Paderborn zu einem Mustergut wird. Unter meinem Urgroßvater Hermann Freiherr von und zu Brenken entsteht 1878 das heutige Gutshaus. Architekt ist der bekannte paderborner Dombaumeister Güldenpfennig. Das damals neue Gutshaus liegt mit seiner Veranda noch auf derselben Höhe wie die ab 1803 ausgebaute Chaussee und lädt weiterhin in die „Schankwirtschaft zur Warthe“ ein, worauf ein Wirtshausschild hinweist. Serviert wird in der Gaststube und im Saal des 1. Stockwerks und im Sommer im gepflegten Garten auf der anderen Seite der Chaussee. Noch lange steht hier auch ein kleines Fachwerkhaus mit hübschem Balkon. Im Zoll- oder Barrierehaus dagegen wohnt bis 1874 ein Chausseegeldeinnehmer, der den Schlagbaum bedient, wie noch auf dem Gemälde aus dem 19. Jahrhundert zu sehen ist. Das hübsche Fachwerkhaus wird im Jahr 1998 durch eine grundlegende Instandsetzung vor dem Verfall gerettet und ist nun das Wahrzeichen von Gut Warthe. Die Restaurierung erfolgte in alter Handwerkstechnik und zeigt im Inneren mit möglichst viel Originalmaterial die traditionelle Bauweise mit luftgetrockneten Ziegeln, Kalkputz und Eichenfachwerk. Im 20. und 21. Jahrhundert kommt es dann aber durch die unglücklichen Straßenbaumaßnahmen zu massiven Gefährdungen für die Existenz des Gutes, obwohl es seit dem 29.6.1984 offiziell unter Denkmalschutz steht.
2.2 Der Alte Hellweg
Der Alte Hellweg - auch ein fast mythischer Begriff! Er bildet hier das Kernstück einer sehr alten Heer- und Handelsstraße, die als große West-Ost-Verbindung des europäischen Nordens den Güteraustausch zwischen Flandern und dem Baltikum bzw. Russland vermittelt und als „via regia“ im Gegensatz zu nur lokalen Verbindungen unter dem besonderen Schutz der Könige steht. Die Stadt Paderborn widmete der berühmten Straße im Jahr 2008 eine große Ausstellung unter dem Titel „Eine Welt in Bewegung“, um auf die wenig bekannte Dimension des mittelalterlichen Reiseverkehrs aufmerksam zu machen. Dem diente auch ein nachgebauter Reisewagen, der unter Beteiligung des wewerschen Heimatbundes auf Gut Warthe Station machte. Es lag nahe, im Rahmen des Tages des offenen Denkmals Gut Warthe als historisches Gasthaus am Hellweg in das Ausstellungsgeschehen mit einzubeziehen.1 Der historische Alte Hellweg hatte mitten durch den Hof von Gut Warthe geführt, was diesem zusätzlich eine ganz besondere Bedeutung verliehen hatte.
Hellweg: Kartenausschnitt in Süd-Nordausrichtung mit farblich markierter alten Straße (gelb) und neuer Trassierung (grün). Links „die Warthe“, darüber - nach Süden - die doppelreihige Landwehr. LWL 406-Karte 7Pa. Hofbesitzer Jakobs konnte die Gelegenheit der Verlegung des Alten Hellwegs nutzen, den Wartturm als Material für seine Gebäude aufzukaufen.
Die Trasse zwischen Salzkotten und Paderborn, von Kirchturm zu Kirchturm.
Auch wenn das Hofgelände jetzt zur Gemarkung Elsen gehört, war und ist Gut Warthe aber immer ein Teil von Wewer, von wo es über das Gebiet „Auf dem Meere“ eine alte Verbindung gab. So waren es auch der Heimatbund Wewer und die wewersche Bürgerinitiative, die sich beim so existenzbedrohenden letzten Ausbau der Bundesstraße für den Erhalt des Gutes einsetzten.
2.3 Die Landwehr und der geheimnisvolle Turm
Noch immer war der Standort des für die Paderborner Geschichte so bedeutenden Wartturms ungeklärt und so schreckte die Gefahr der für den Ausbau der B 1 heranrollenden Bagger nicht nur die lokalen Heimatschützer auf, sondern ließ auch die Archäologen zum Spaten greifen. Es hatte bereits die unterschiedlichsten Spekulationen und Luftbilddeutungen gegeben und weil eine Vermutung in die Richtung Gutsgarten ging, wurde auch dort gegraben. Jedenfalls war davon auszugehen, dass sich der Turm in der Linie der nördlich von Gut Warthe noch überdauerten Landwehr befand. Als im Jahr 2008 dann im ehemaligen Gutsgarten und im Vorfeld gegraben wurde, konnte dort zwar nicht der Turm, aber doch die Landwehr nachgewiesen werden. Die Landwehr hatte sich schon früher im Winter immer wieder als leichte Bodenerhebung gezeigt. Entlang der Straße „Zur Warthe“ (früher Grüner Weg) hatte es auch noch im 20. Jahrhundert im Anschluss an die Landwehrtrasse eine Zwetschenweide gegeben.
Als Überraschung der Grabung traten aber auch Reste einer bisher unbekannten eisenzeitlichen Siedlung mit Scherben zutage.2
Dies ist die einzige amtliche Karte, auf der etwas Rundes und turmartiges abgebildet ist. Die Darstellung passt zu einer späteren Handzeichnung. Ob die beiden oberen, direkt neben dem vermuteten Turm liegenden Gebäude in der Zwischenzeit aus dem Mauerwerk des Turmes errichtet worden waren? Ausschnitt aus der Übersichtskarte der Gemeinde Neuhaus 1829/30 aus dem Residenzmuseum Schloss Neuhaus.
Verlauf der Landwehr, eingezeichnet auf heutiger Katasterkarte. Als „Ausgleichsmaßnahme“ für den Landschaftsverlust durch den Ausbau der Bundesstraße hätte man sie aufgrund der spektakulären Funde nach Wewer hin wiederherstellen können oder auch weiter nach Norden.
2.4 Die Klus am alten Hellweg, Klause oder Gerichtsstätte?
Noch relativ unerforscht stellt sich die Klus am alten Hellweg, zwischen Wewer und Elsen gelegen, dar, an die noch heute westlich von Gut Warthe und nördlich der B 1 der Name Kluswiese erinnert. Es könnte sich dort bis ins 18. Jahrhundert hinein um eine Klause gehandelt haben. Darauf weist ein Schriftstück von Melchior und Emerentia von Imbsen, den Schlossherren von Wewer, zu einer Klus, „genannt Herrn Leichnam“, hin. Ein Brief ihres Sohnes und Nachfolgers Kurt von Imbsen vom 10. August (15) 82 an den Domprobst lässt wegen der Erwähnung einer Kuhpfändung beim „Clusener“ dann an eine Hofstelle denken.3
Allerdings ist auf der Klus auch eine Gerichtsstätte mit alten Eichen vermutet worden, wovon es allerdings keine Abbildung gibt. Auf den Karten des 19. Jahrhunderts gibt es weder eine Klause noch eine Gerichtsstätte, das Gelände ist allgemein nur als „Hutung“ bezeichnet. Heute gibt es westlich des Wassergrabens ein Gehöft.
Dagegen kommt auf der „Karte der Strecke zwischen der Warthe bis Salzkotten“ eine „Galgendreische“ vor, datiert von 1818, und zwar südlich der damaligen Hellwegtrasse.4
Mehrmals taucht die Klus bei den Imbsen auf. So als der Domkantor Johann Werner von Imbsen im Dezember 1713 für die wewersche Adelsfamilie von Imbsen von den umfangreichen Gütern Besitz ergreift und ihn sein Weg auch zur „Kapelle oder Klus zwischen Gut Warthe und Salzkotten, unweit des Dorfes Wewer gelegen“ führt.5 Bei einer Besitzergreifungszeremonie im Jahr 1756 ist dann von einer „Wiese und dem Kluskamp“ bei Elsen die Rede, wo der Bevollmächtigte zum Zeichen der Inbesitznahme einen Erdklotz auszugraben und Zweige von den darumstehenden Bäumen abzubrechen hat.6 Als Wilhelm Anton von Imbsen im Jahr 1806 schließlich vor seiner Hochzeit das Wewersche Schloss renoviert, kauft er eine dicke Eiche aus dem „Klusbusch“ bei Wewer.7 Soweit also die wenigen historischen Nachrichten zur geheimnisvollen Klus.
Gra
Übersichtskarte der Gemeinde Neuhaus 1829/30. Residenzmuseum Schloss Neuhaus. Jakobs auf d. Warte, im Norden umgeben von Hutung (Stadtbruch). Die Bezeichnung Ringelsbruch taucht westlich der jetzt Kluswiese genannten Fläche auf. Als Doppelstrich ist die nördliche Landwehr zu erkennen. Rechts die Waldfläche Ikerloh.
2.5 Die Familie Jakobs
Gut Warthes spannendste Geschichte ist die des Wewerschen Bauerngeschlechts Jakobs. Durch welche unglücklichen Umstände es zum Verkauf des Gutes an meine Vorfahren von Brenken kam, hat der Nachkomme Dr. Wilhelm Thöne aus Bad Soden recherchiert. Er hatte sich im Jahr 1929 auf die Spuren seiner außergewöhnlichen Urgroßmutter Gertrud, geb. Roggel-Glehn gemacht und mit viel Herzblut ihre Geschichte festgehalten.
Die drei Hofgebäude zur Zeit der Familie Jakobs sind bezeichnet als das alte Wohnhaus, das neue Wohnhaus und die Scheune. Oben im Bild (im Süden) geht die Wegeverbindung nach Wewer ab. Mit Neutrassierung des Hellwegs in rot. 1818.8
Demnach beginnt im Jahr 1821 der Niedergang der Familie, als Johann Friedrich Jakobs, der Sohn des Johann Bernhard Jakobs, genannt Wardemann, mit 29 Jahren stirbt. Er hinterlässt seine junge Frau Gertrud, die von ihrem Schwiegervater zusammen mit ihrer Tochter Franziska, der rechtmäßigen Erbin, vom Hof verdrängt wird.9 Der ebenfalls verwitwete Schwiegervater ehelicht die junge Kellnerin Antonetta Göke, die nach seinem Tod in zweiter Ehe einen Ferdinand Kirchhoff heiratet, der nun das Gut im Jahr 1844 an den Freiherrn Friedrich Carl von und zu Brenken verkauft.10 Damit endet die Geschichte der Jakobs-Familie, die es auf Gut Warthe zu großem Ansehen und Wohlstand gebracht hatte und um 1700 sechs große wewersche Bauernhöfe ihr Eigen nennen konnte: neben dem Warthehof auch den Weiken-, Volmers-, Paggels-, Pulsen- und den Steffenshof.
„Pastor Meiwes nannte sie die größte Frau, die ihm je im Leben begegnet wäre“, schreibt ihr Nachkomme Wilhelm Thöne über seine Urgroßmutter Gertrud, die letzte Jakobs auf Gut Warthe. Es ist die Geschichte einer Frau, die ihr schweres Schicksal mit Fleiß und Klugheit meistert, alle Herausforderungen annimmt und schließlich geschickt die Möglichkeiten nutzt, die die neue Zeit ihr - nicht zuletzt durch die Separation - bietet. Wir kennen nur wenige Lebensgeschichten früherer Weweraner und schon gar nicht solche von Frauen. Deshalb ist es angebracht, Gertrud Roggel, der für ihre Tochter um das Erbe betrogenen Witwe des letzten Jakobs, stellvertretend für die vielen tüchtigen, aber geschichtlich unbeachteten Frauen dieser Zeit ein Denkmal zu setzen. Da wir mit ihr einen konkreten Namen haben, habe ich für sie die Benennung einer Straße in Wewer beantragt. Denn es ist in Paderborn auch seit langem eine Straße einem anderen Bewohner Gut Warthes gewidmet, dessen Name ausgerechnet an denjenigen erinnert, durch den die Erbin Gertrud Roggel vom Hof vertrieben worden war. Es ist der Jurist und Ministerialdirektor Hermann Werner Kirchhoff, der sich um den Eisenbahnbau verdient gemacht hatte.
Vielleicht hatte Dr. Thöne sich bei seinen Nachforschungen mit dem historisch so interessierten brenkenschen Rentmeister Wilhelm Schütte zusammengetan, denn beide haben zur Geschichte von Gut Warthe veröffentlicht.11
Der Name der weitverzweigten Familie Jakobs ist an anderer Stelle in Wewer weiter präsent. Das Foto zeigt den (1960?) beim Ausbau der B 1 unterhalb der Warthe, zwischen der B 1 und dem Sandberg, abgerissenen alten Hof der heutigen Landwirtsfamilie Jakobs. (Foto Lohmann).
2.6 Die Hofgebäude
Als Baumaterial für die neuen Gebäude, zumindest die der Jakobs/Kirchhoff‘schen Zeit, wurden endgültig die Reste des wohl auf dem Hofgelände stehenden, aus Bruchstein errichteten alten Wartturms aufgebraucht. Der nun entstehende Gebäudekomplex zählt - selbst ohne den Wartturm und einige ursprüngliche Hofgebäude - vermutlich zu den ältesten erhaltenen Hofanlagen Wewers, auch wenn er natürlich nicht mit dem wewerschen Schloss- und Burgbereich mit seinen Nebengebäuden mithalten kann. Zu Recht genießt er aber großes Interesse und ist 1984 offiziell unter Denkmalschutz gestellt worden.
Als die Stadt Paderborn im Jahr 2018 dann für ihr gesamtes Gebiet eine wissenschaftliche Denkmaltopografie in Auftrag gab, war das die Gelegenheit, meine eigenen historischen Dokumente mit den Untersuchungen des Bauhistorikers Dr. Heinrich Otten vor Ort abzugleichen. So konnten in dem umfangreichen Paderborner Werk alle bekannten Informationen zu den zu Gut Warthe gehörenden Gebäuden zusammengeführt werden.12
Sind auf den älteren Karten noch die wie hingewürfelten Hofgebäude aus der Jakobszeit zu sehen, so entsteht durch die Nachfolger - und besonders durch die brenkensche Bautätigkeit - mit der Zeit die jetzt noch vorhandene symmetrische Hofanlage. Auch der Hellweg verläuft nun südlich des Gutshauses, mit zwei Zufahrten zum Hof. Die Hauseingänge von Gutshaus und Zollhaus liegen, wie auf vielen Abbildungen zu sehen, straßenseitig und werden erst nach dem Straßenausbau der 1960er Jahre und dem damit verbundenen Verlust der Zufahrten notgedrungen nach innen verlegt.
Das Zollhaus mit Anbau, vor der eigentlichen Restaurierung mit bunten Fensterläden als Blickfang notdürftig gesichert.