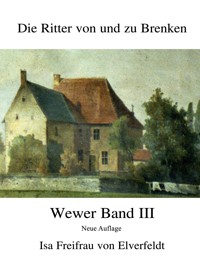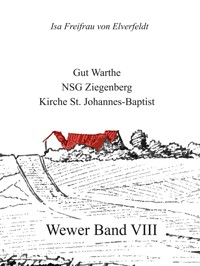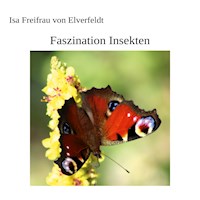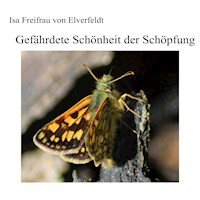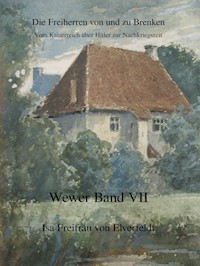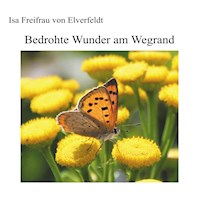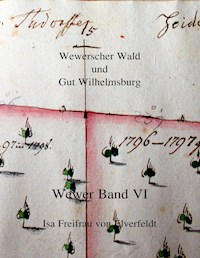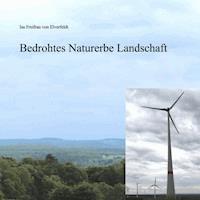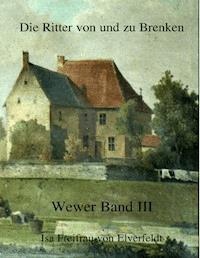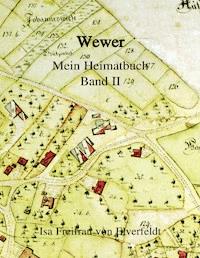Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Der 2015 als zweiter Teil der dreiteiligen, erstmaligen Familienbiografie des im Hochstift Paderborn bedeutenden Adelsgeschlechts von und zu Brenken erschienene Band konnte durch Quellen ergänzt werden. In diesem Teil geht es um Hermann Freiherr von und zu Brenken als bedeutendstem Familienmitglied, der Wewer wieder zum Familienmittelpunkt machte. Beeinflusst von seinem Schwiegervater Werner Graf von Haxthausen setzte er sich zusammen mit seiner Frau Maria für das Gemeinwesen ein. Als Mitglied des Reichstags nutzte er seine politischen Möglichkeiten, um der Kirche von Paderborn und speziell auch seiner Gemeinde Wewer im Kirchenkampf beizustehen. Seine gebildete und weltläufige Frau Maria war zusammen mit den Schlosskaplänen maßgeblich an der Begründung von (weiblicher) Mitarbeit in der Kirche beteiligt, wozu sie während der Einschränkungen durch den Kirchenkampf die 1862 errichtete Schlosskapelle nutzte. Architekt war der ihrem Mann Hermann durch die Zentrumspartei verbundene Dombaumeister Arnold Güldenpfennig. Es werden auch die Schicksale von Hermanns zahlreichen Geschwistern weiterverfolgt, besonders des Landrats Reinhard im Klostergut Holthausen. Nicht zuletzt geht es auch um die Beziehungen zur Ordensgründerin Pauline von Mallinckrodt, der zwei Schwestern Hermanns als Lehrerinnen in den Orden folgten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 233
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ne cede malis
(Weiche nicht dem Bösen)
Inhaltsverzeichnis
Die Freiherren von und zu Brenken
Wewer Band IV
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
Das 19. Jahrhundert – Adel am Scheideweg
1.1 Werner von Haxthausen und Betty von Harff
1.2 Maria von Haxthausens Kindheit und Jugend
1.2.1 Lottchen, Cousine und Gefährtin Marias
1.3 Die Brenken und die Dichterin
1.4 Maria von Brenken als Mutter
1.5 Hermann von Brenken
1.6 Hermanns Werdegang in seinen Briefen
1.7 Hermann als zweifacher Fideikommissherr
1.8 Gut Warthe
1.9 Der Schlosshof in Wewer
1.10 Hermann und Marias Kapellenbau
1.10.1 Hauskaplan Bernhard Lüthen
1.10.2 Hauskaplan Moritz Oppermanns Briefe
1.11 Hermann und Maria im Kulturkampf
1.12 Das Wewersche Kirchenpatronat
1.13 Hermanns Leben und Tod
2 Zusammenfassung
3 Hermann und seine Geschwister
3.1 Reinhard und das Klostergut Holthausen
4 Die Brenken und die Ordensgründerin
5 Hermann und Marias Kinder
5.1 Otto von Brenken
6 Nachwort
7 Literaturverzeichnis
8 Benutzte Archive
1 Einleitung
Das 19. Jahrhundert – Adel am Scheideweg
Mein erster Band der Geschichte der Familie von und zu Brenken endete mit dem bedeutenden Friedrich Carl Freiherrn von und zu Brenken in Erpernburg.1 Der zweite Band beginnt mit einer ebenso interessanten Persönlichkeit, mit Friedrich Carls Sohn Hermann in Wewer.
Hermann und seine Frau Maria Freiin (Gräfin) von Haxthausen stammen aus hochgebildeten und im Fall von Maria auch hochpolitischen Familien. Der Name Haxthausen steht für die geistige Spitze des heimischen Adels, für den Bökendorfer Kreis mit den Gebrüdern Grimm und anderen wichtigen Köpfen der Zeit, natürlich auch für Annette von Droste-Hülshoff, auch wenn Marias Vater Werner Freiherr (später Graf) von Haxthausen, ebenso wie sein begabter Bruder August, nicht immer mit ihrer Nichte Annette harmonieren. Auch Hermann von Brenken ist mit Annette verwandt und sie besucht bei ihren Reisen durch die Verwandtschaft sein Elternhaus Erpernburg. Annette kennt die Brenkensche Geschichte und macht deren wildesten Teil in ihrem Gedicht vom „Fegefeuer des westfälischen Adels“, wo sie „den alten Brenken“ und weitere räuberische Ritter in einem Berg bei Wewelsburg schmoren lässt, für immer bekannt.2
Daneben gibt es die Haxthausen-Beziehung zur „Familia sacra“, der berühmten katholischen Erneuerungsbewegung der Fürstin Gallitzin in Münster.
Die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts stellte schon für Hermanns Eltern und Großeltern die Zeit der neuen Identifikationsfindung dar. Nach der Erfahrung der Säkularisation und dem Zusammenbruch der alten Ordnung hatten schon sie sich entschieden, sich nicht schmollend ins adlig-ländliche Privatleben zurückzuziehen, sondern die untergegangene Zeit auf einen Sinn für die Zukunft zu befragen.
Es mag erstaunen, wenn man die Akribie sieht, mit der im 19. Jahrhundert der Adel wieder seine Stammbäume zusammenstellt, und es hat zunächst den Hauch eines verschrobenen Hobbys oder elitärer Abkapselung – trotz der christlichen Grundeinstellung der Gleichheit aller Menschen.
Doch abgesehen davon, dass genealogische Forschungen immer auch Forschungen zur Lokalgeschichte sind, muss in Erinnerung gerufen werden, in welchem Maße den Adel die Abschaffung des geburtsständischen Herrschaftsprinzips getroffen hatte. Verhaftet in einer Vorstellung gottgegebener Privilegien findet er sich völlig unvorbereitet seiner jahrhundertealten Funktionen beraubt. In dieser Situation ist es nur folgerichtig, sich seiner selbst zu vergewissern, Bilanz zu ziehen, das Alte abzuwägen, um daraus Neues zu suchen und zu erproben. In diesem Zusammenhang steht sicher auch die Neugründung des Malteserund Johanniterordens, der sich nun in den Kriegen 1864 in Dänemark (mit dem Flensburger Malteserkrankenhaus als katholischem Vorposten) und 1870/71 in Frankreich der Krankenpflege an den verwundeten Soldaten widmet. Hermann von Brenken selbst, seine Schwiegermutter und Söhne sind dabei an verschiedenen Orten im Einsatz.
Für den westfälischen Adel kommt hinzu, dass er in den Fürstbistümern Paderborn und Münster nicht nur die Regierungen trug, sondern jeder einzelne auch ganz konkret selbst Landesherr hatte werden können, wenn er den Nachweis seines Standes führen konnte, was regelmäßig in den Aufschwörungen kontrolliert worden war. Es war also keine Anmaßung, wenn die heimischen Adelsfamilien den Glanz dynastischen Familienstolzes auch auf sich ruhen sahen.
Die Säkularisation mit ihren Enteignungen bedeutete nun nicht nur einen Schlag gegen die Kirche, der man so selbstverständlich verbunden war, sondern durch die Brutalität der Zerstörung von wertvollem Kirchengut und der klösterlichen Bibliotheken auch einen Kulturschock und Geschichtsbruch, der von den neuen, so überheblichen Herren nichts Gutes erwarten ließ. Die neue Zentralisation der Verwaltung lässt die kritischen Adeligen die tatsächlich neuen Gefahren des Bürokratismus und Militarismus erkennen, worüber in allen adeligen Kreisen heftig diskutiert wird. Einer der bedeutendsten Köpfe, Werner von Haxthausen, veröffentlicht seine Schrift „Über die Grundlagen unserer Verfassung“, die natürlich im Haus seiner Tochter Maria in Wewer großen Einfluss hat. Ihr Schwiegervater Friedrich Carl von Brenken schließt sich mit eigenen Veröffentlichungen an.
Der Adel hat kaum seine Wunden geleckt und sich in den neuen Verhältnissen eingerichtet, als mit dem preußisch-protestantischen Kulturkampf (ca. 1870 bis in die 1880er Jahre) die nächste Herausforderung zu bestehen ist, wobei man sich wie selbstverständlich an die Spitze des katholischen Volkes stellt. Unterdes hatte man sich in dem neu gegründeten kath. Verein des Adels auf eine neue Bestimmung geeinigt: die Verteidigung des Glaubens durch Mitwirkung in den Parlamenten und Tätigkeiten in der Öffentlichkeit. Nicht nur Rückzug ins behagliche Privatleben, vielleicht auch im Beamtenstatus der neuen Regierung, sondern sittliche und moralische Erneuerung und möglichste Bewahrung der Gewissensfreiheit durch Meidung weisungsgebundener Anstellungen. Die Zentralisation und jetzt auch die Gefahren eines Militarismus, „der die besten Gefühle der Menschen ersticke“, werden vom Mainzer Bischof Wilhelm Emanuel von Ketteler, mit dem auch die Familie von Brenken in persönlichem Kontakt steht, in seinem viel beachteten Buch3 angeprangert.
Hermann von Brenken legt bei Schöningh in Paderborn die Schrift seines Schwiegervaters Werner von Haxthausen über die Grundlagen der Verfassung neu auf, obwohl natürlich schon Werner klar ist, dass es keine Rückkehr in den Ständestaat alter Art mehr gibt. Trotzdem mutet es durchaus modern an, wenn schon damals die Probleme und Gefahren eines Parlamentarismus, der nur die öffentliche Meinung bedient, gesehen werden. Noch der in der Zeit des Nationalsozialismus berühmt gewordene Münsteraner Bischof von Galen, der wohl seinerseits stark von Bischof von Ketteler beeinflusst ist, erklärt, dass man einem Staat nur so lange Gehorsam schulde, wie er nicht Unsittlichkeit verlange.
In diesen neuen Prozess der Selbstvergewisserung sind meine Vorfahren also in besonderer Weise einbezogen und aktiv. Durch mehrere Generationen sind sie als Kreistagsabgeordnete, Landräte und Reichstagsabgeordnete für das Allgemeinwohl tätig, wenn auch nicht alle für ihre eigentliche Gründung, die Zentrumspartei, antreten. So gehört Hermanns Bruder Reinhard, der Landrat von Büren, der Bismarck nahestehenden Freien Konservativen Vereinigung an.
Neben der Verteidigung der Kirche, für die man in regem Kontakt mit den Bischöfen steht und auch den Papst in der Zeit seiner politischen Bedrängnis unterstützt, findet man seine Aufgabe in seinem Grund und Boden und solidarisiert sich mit dem Bauernstand. Da der hiesige Adel nur 5 % des bebaubaren Grund und Bodens besitzt, gibt es hier nicht die Konfrontationen wie gegenüber dem echten Großgrundbesitz. Hier übernimmt man die Vorreiterrolle in der wissenschaftlichen Landwirtschaft und stellt sich in der Politik an die Spitze der Bauern, um sich Freiräume für den gemeinsamen Stand zu sichern. Dr. Burkhard Freiherr von Schorlemer-Alst gelingt es, ein umfassendes System an Organen der landwirtschaftlichen Selbstverwaltung aufzubauen, auch wenn er dann mit ansehen muss, wie die Regierung es durch die Gegenschaffung der Landwirtschaftskammern zum großen Teil wieder zerschlägt. Auch im Bereich der Landwirtschaft fallen die Aktivitäten Friedrich Carl von Brenkens auf.
So zieht sich der westfälische Adel weder in die Rolle des Landedelmanns mit der Ritualisierung seiner speziellen Umgangsformen zurück, noch strebt er eine sichtbare Präsenz bei Hofe an.4
Wie gehen nun Hermann und Maria mit der geistigen Grundlage um, die ihre Eltern geschaffen haben? Der Inhalt dieses Buches wird anhand auch vieler privater Zeugnisse ihren spannungsreichen Weg durch die 1848er Revolution und den Kirchenkampf nachzeichnen.
1.1 Werner von Haxthausen und Betty von Harff
In welchen Zeiten wachsen unsere Stammeltern Hermann und Maria von Brenken, die Erben berühmter Familientraditionen, in den Umwälzungen des 19. Jahrhunderts auf? Was bewegt ihre Elternhäuser? Die geistes- und kulturgeschichtlichen Hintergründe und Zusammenhänge dieser Zeit sind so interessant, vielfältig und spannend, dass sie hier nicht übergangen werden können. Denn beide – Hermann von Brenken ebenso wie seine Frau, Maria von Haxthausen – stammen aus hochpolitischen oder jedenfalls politisch hochinteressierten Familien. Nicht zu letzt weil es sich bei Maria um die einzige Nachkommin des berühmten Werner von Haxthausen handelt und der ebenso berühmte August von Haxthausen sogar unverheiratet blieb, soll hier auch Marias Familienhintergrund, der sich mit dem ihres Mannes berührt, erwähnt werden.
Marias Vater, Werner von Haxthausen (Bökendorf 18.7.1780 – Würzburg 20.4.1842), gehört zusammen mit seinem Bruder August, der das zaristische Russland bei der Abschaffung der Leibeigenschaft unterstützt, zu den interessantesten Gestalten in Westfalen. Werner ist eng verbunden mit Hermanns Vater, Friedrich Carl von Brenken, Dritter im Bunde ist Joseph von Lassberg5.
Werner von Haxthausen ist hochbegabt und gebildet und wie Friedrich Carl von Brenken der Vergangenheit verhaftet. Doch gerade dieser wertschätzende Blick zurück ist es, der ihn wertvolles Kulturgut für künftige Generationen retten lässt. „Im Gedächtnis einer größeren Öffentlichkeit blieb Werner von Haxthausen als einer der größten Sammler mittelalterlicher Kunst in Köln in den Jahrzehnten nach der Säkularisation. Sein Enthusiasmus für die in seiner Zeit immer noch wenig beachtete Kunst des Mittelalters, vor allem der gotischen Tafelmalerei, war bezeichnend für seine Lebenswünsche. Er war geprägt von der altkatholischen Welt des Ancien regime und erhoffte sich nichts sehnlicher als die Rettung und Wiedergewinnung der in Auflösung befindlichen ständischen Welt.“6 Werner von Haxthausen ist von bedeutendem Einfluss auf seinen Schwiegersohn Hermann von Brenken, der sich nicht scheut, dessen längst überholte, ultrakonservative Schrift über die ständische Verfassung wiederaufzulegen.7
Werners Mittelaltersehnsucht zeigt sich auch in dem Gemälde, das er 1840 von Ludwig Emil Grimm aus dem Bökendorfer Kreis anfertigen lässt8. Es zeigt Werner mit Frau und Tochter betend, in eigenartig ‚altdeutsche‘ Tracht gekleidet.
Bei allen Vorwürfen gegen den gerade abgeschafften Ständestaat, gegen die Herrschaft durch einige wenige Familien, machen deren nostalgisch erscheinenden Verfechter jedoch gerade im Vergleich mit der preußischen Regierung einige zutreffende Beobachtungen: Weil die dynastischen Adelsfamilien ihre Vorrechte gegenüber einem nicht heiratsberechtigten Landesherrn gemeinsam verteidigten, hatte sich für das Hochstift Paderborn keine der sonst blühenden, erblichen absolutistischen Regierungsformen herausbilden können. „Allen Tendenzen des Absolutismus und des sich aus ihm entwickelnden modernen Staates mit seinen Ansprüchen auf Unumschränktheit und Allzuständigkeit der fürstlichen Gewalt waren diese Gebilde diametral entgegengesetzt.“9 Auch wurden die Bauern- und Bürgersöhne nicht in den Kriegsdienst geschickt, denn es gab keinen Militärdienst. „Das Hochstift Paderborn war in den letzten 150 Jahren seines Bestehens ein um Frieden bemühter Kleinstaat.“10 Das ist die Zeit, die Werner von Haxthausen und Friedrich Carl von Brenken in Erinnerung hatten.
Werner, einer der vielen Haxthausen-Geschwister und Halbbruder von Annette von Droste-Hülshoffs Mutter Therese, wird in Münster zusammen mit den Söhnen des berühmten Konvertiten Friedrich zu
Stolberg von dem Theologen Georg Kellermann (1776 – 1847) erzogen. Kellermann wird später Domprediger und Electus des Bistums Münster. Werner wächst damit im unmittelbaren Umkreis der „familia sacra“ auf, dem neben Bökendorf zweiten bedeutenden geistigen Treffpunkt Westfalens mit hohem intellektuellem Niveau. Der welterfahrene ehemalige Diplomat Friedrich Leopold (Fritz) Graf zu Stolberg (1750 – 1819) hatte sich dort der berühmten „familia sacra“ um die Fürstin Gallitzin (geb. Gräfin von Schmettau, 1748 – 1806) und Franz Freiherr von Fürstenberg, den Gründer der Universität Münster, angeschlossen.11 Die Fürstin Gallitzin, deren Wirken nach Meinung ihres Biografen Hänsel-Hohenhausen „den Triumpf der katholischen Seite über die Unterstellung der Kulturlosigkeit des Katholizismus“ darstellt, erfreute sich mancher Ehrbezeugungen durch den damals schon das „Maß aller Kultur“ darstellenden Goethe. In ihrem Kreis lebt – so zitiert der Biograf Joseph Galland – „das warme Interesse für Fragen der Wissenschaft und Kunst, der Philosophie und Literatur, der Politik und Pädagogik“. Doch nicht als Selbstzweck, sondern sich der Religion, und dabei nicht nur der katholischen Konfession, was im späteren Kulturkampf vergessen wird, unterordnend, worin die kulturhistorische Bedeutung der „familia sacra“ liege.12 All das beeinflusste naturgemäß auch Werner von Haxthausen.
Werner von Haxthausen, der als „einer der profiliertesten hochkonservativen Theoretiker des Ständestaates in der Moderne“13 später großen Einfluss auf seinen Schwiegersohn Hermann von Brenken erlangen sollte, wird also „Eleve“ des Konvertiten Fritz zu Stolberg im Kreis der „familia sacra“ in Münster. Fritz zu Stolbergs Sohn Joseph Theodor zu Stolberg (1804 bis 1859), der später für das politische katholische Deutschland eine besondere Rolle spielt, lässt sich in Westheim (damals Kreis Büren) nieder. Fritz’ Tochter Pauline hingegen heiratet Wilderich von Ketteler (1809 – 1873) zu Thüle bei Salzkotten, einen der profiliertesten Politiker aus der frühen Zentrumsphase.14 Fritz zu Stolbergs Enkelsohn aus Westheim wird vermutlich Spielgefährte von Hermann von Brenkens Kindern in Wewer und lebt wohl auch zeitweise hier.
Die wenigen erhaltenen Briefe des jungen Werner von Haxthausen, einmal vom 27.3.1809 aus Kassel wegen eines dort behandelten blinden Pferdes, dann ohne Datum auf einer Reise in der heimatlichen Umgebung, geben Einblick in die damalige Reisewirklichkeit. „Theuerste Eltern, (…) kam gestern nach Leberg und übernachtete dort mit einem Juden, und ritt diesen Morgen hierher, morgen geh ich nach Padberg, kommen dann wieder zurück und fahre Samstag mit Calenberg nach Paderborn. Könnten Sie mir den 4ten ein Pferd nach Paderborn schicken, liebste Eltern? Damit ich nach Bökendorf reiten könnte. Sollten Sie mir aber kein Reitpferd schicken können, so komme ich lieber in Ruhe, denn Wagenpferd und Kutsche würde mir zuviel kosten. In der Politik sieht es mißlich aus, die Tante will nicht mehr davon hören. Ich küsse die Hände, umarme meine Geschwister und bin Ihr gehorsamer Sohn Werner.“15
Durch die Brüder Grimm im Bökendorfer Kreis verhaftet, interessiert sich auch Werner von Haxthausen für die Volksdichtung. Er studiert in Halle Naturphilosophie, Jura, orientalische Sprachen und Medizin, schließt sich dem antifranzösischen „Tugendbund“ an und gerät mitten hinein in die Turbulenzen der Fremdherrschaft. Er ist mit von der Partie, als Wilhelm Dörnberg König Jérome entmachten will und ist gezwungen unterzutauchen. Als ein Preis auf seinen Kopf ausgesetzt wird, flieht er über Schweden nach England, wo er sich mit Gneisenau anfreundet. Unter dem Pseudonym „Dr. Albrock“ arbeitet er als Arzt in einem Londoner Krankenhaus. Doch gerade als er als Schiffsarzt für die Ostindische Companie in Kalkutta angeheuert hat, erfährt er, dass er nach Napoleons Rückzug aus Russland nach Deutschland zurückkehren kann. Als Adjutant des Grafen Wallmoden zieht er mit der Deutschen Legion in Paris ein, wo er den Freiherrn vom Stein und den Staatskanzler von Hardenberg kennenlernt, der ihm eine Stelle im preußischen diplomatischen Dienst in Aussicht stellt.
Dazu hat sich ein französischer Pass erhalten, den der dreißigjährige Werner am 4.6.1811 ausgestellt erhält: „General-Polizey Im Namen Seiner Majestät des Kaisers der Franzosen, Königs von Italien und Protectors des Rheinbundes. Vom Präfekten des Lippe-Departements Ersuchen alle Civil- und Militairbehörden, Vorzeigern dieses (…) von Münster nach dem Königreich Westphalen, Sachsen, Böhmen und Gegend frei und ungehindert passiren, repassiren, und ihm nötigen Falls jeden Schutz angedeihen zu lassen. Ausgefertigt, weil der Inhaber hier hinlänglich bekannt ist. Münster, den 4ten Juny 1811 der provisorische Präfekt Mylius.“ Werner wird beschrieben mit einer Größe von fünf Schuh, vier Zoll, mit hellbraunen Haaren, bläulichen Augen, hellbraunem Bart und – typisch für alle Haxthausen-Geschwister – mit ziemlich großer Nase.16
Am 8.5.1814 berichtet er dann aus Paris an seine Eltern in Appenburg:17 „Seit langer Zeit bin ich hier müde, liebe Eltern, allein ich werde von einer Woche zur anderen hingehalten. Erst hieß es, die hohen Herrschaften würden nur bis zur Ankunft Ludwigs des 18ten hier bleiben; jetzt ist der endlich gekommen, und noch immer verschiebt sich ihre Abreise von einem Tag zum Andren; sobald sie fort sind, werde ich, wo möglich, nach Westphalen gehen; die Reise von England; vielleicht noch die von Oestreich, der König von Preußen und viele der Minister und Generäle etc. gehen nach England; dort wird das erste Friedensfest gefeiert; die Erbprinzessin (die englische Prinzessin Charlotte, Tochter Georgs IV.) wird mit dem Erbprinzen von Oranien (Wilhelm II.) vermählt. So freit England zum 2ten Male um die Nassauer. Von London gehen die hohen Herrschaften nach dem Haag von dort nach Wien und Berlin.
Wenn ich mich nicht darauf freute, nach Westphalen zu gehen, und mich auf der Reise einige Wochen sehnte, so ging ich mit. Es ist mir angeboten worden, die tour mitzumachen, ohne dass es mir etwas kosten würde. Aber ich will erst einmal wieder nach Bökendorf, und dann, wenn möglich, einige Wochen ins Bad; denn ich fühle die fatiguen müssen wieder ein bischen ausgestärkt werden; ich bin zwar wohl, aber doch nicht so stark, wie sonst. Ich bin übrigens mit sehr vielen Bekannten hier zusammen; Hans und William Hammerstein - den Minister Münster, und seinen Neffen Carl. Die beiden Busch, den Minister Stein, General G (unleserlich, wahrscheinlich Gneisenau) viele Offiziere, die ich früher gekannt oder in der campagne kennen gelernt habe. Endlich Wallmoden und Dörnberg und ihre Adjudanten.
An Schauspielen allerlei Art fehlt es uns hier nicht, der Einzug des Königs; die Revue, die Feuerwerke, Feste aller Art. Kurz man lebt in einigem Saus und Braus. Ich werde recht froh sein, wenn ich erst wieder heraus bin; ich habe des Zeuges so viel gesehen; dass es mich ordentlich (unleserlich).
Leben Sie wohl, liebe theuren Eltern, ich umarme Fritz, Sophie, Fränzchen (…).
Ihr (…) Sohn Werner.
Paris, den 8ten Mai 1814
Es folgt der Wiener Kongress und auch Werner von Haxthausen sieht sich dort um, vielleicht auf Anregung des preußischen Staatskanzlers von Hardenberg. Es entsteht auch die Zusammenarbeit und lange Freundschaft mit Joseph von Lassberg, dem Retter des Nibelungenliedes und späterem Ehemann von Werners Nichte Jenny von Droste-Hülshoff, der Schwester von Annette von Droste-Hülshoff. Werner von Haxthausen ist maßgeblich an der Gründung und Begründung der von Joseph von Lassberg initiierten Standesvereinigung mit dem programmatischen Namen „Die Kette“ beteiligt, einer konservativen Adelsvereinigung, die in Wien entsteht. Während „der Kongress tanzt“, wie es damals heißt, träumt eine Handvoll idealistischer Adeliger – vor dem Hintergrund der französischen Revolution und ihrem Bruch mit der Vergangenheit in Terror und Blut – von der Wiederherstellung eines „unschuldigen“, edlen Rittertums, nicht in der straff organisierten Form anderer Geheimbünde, sondern in harmloser und ehrenhafter Absicht einer Selbstreform, der Erneuerung moralischer und wissenschaftlicher Bildung. Mit dabei ist Friedrich Carl von Brenken, der spätere Schwiegervater von Werners Tochter Maria. Auch der letzte Imbsen aus Wewer, Wilhelm Anton, gehört zum Kreis der schon aufgenommenen oder vorgeschlagenen Mitglieder.18
Dank seiner Wiener Kontakte wird Werner nun statt Diplomat oder Schiffsarzt in Kalkutta bis zu seiner Entlassung 1825 solider preußischer Regierungsrat in Köln, wo anscheinend von ihm erwartet wird, zwischen Berlin und den Kölnern als „Neupreußen“ zu vermitteln. Doch die von ihm so vehement geteilte Mittelalterbegeisterung der „Kette“ lässt ihn auch im Rheinland wirken. So gehört er zu den ersten Propagandisten des Denkmalschutzes, setzt sich für die Erhaltung des Altenberger Domes ein, für die Rückführung der französischen Beutekunst, für ein Rheinisches Museum und für die Wiedereröffnung der Kölner Universität. Er steht in Kontakt zu berühmten Kunstsammlern, wie Wallraf und Boisserée. Werner benutzt seine Dienstreisen dazu, auf kirchlichen Dachböden vergessene oder missachtete altdeutsche Malerei, Handschriften, Glasgemälde und „Altertümer und Kunstsachen aller Art“ aufzuspüren, wobei die Ergebnisse seiner Suche im Wallrafianum und zeitweise im ehemaligen Rathaus ausgestellt werden.19 Zu seinen vielen Kontakten gehört auch die Beziehung zu Joseph Görres, den er bei dessen Gefährdung 1819 zur Flucht überredet. Am 16.7.1825, dem Jahr seiner unter kränkenden Umständen erfolgenden Entlassung, heiratet Werner von Haxthausen Elisabeth (Betty) Freiin von Harff-Dreiborn (1787 – 1862) aus Köln, die ihrerseits von ihrem Vater ein großes Kunstinteresse mitbringt. Im Jahr 1826 wird seine einzige Tochter Maria geboren, die spätere Ehefrau von Hermann von Brenken.
Durch seinen Stand ist Werner von Haxthausen Mitglied des Westfälischen Provinzial-Landtags, wo er als Vorsitzender eines Ausschusses für das bäuerliche Erbfolgegesetz tätig ist. Dabei entsteht 1833 seine berühmte staatskritische Schrift „Über die Grundlagen unserer Verfassung“20, mit deren Grundgedanken sich sein späterer Schwiegersohn Hermann von Brenken auseinandersetzen wird. Das als „Manuscript“ bezeichnete Büchlein führt zu weitreichenden Konsequenzen, der Konfiskation des Buches und zu Verfolgungen, die möglicherweise erst durch den preußischen König beendet werden. Anhand der negativen Folgen der Erbteilung der Höfe hatte Werner von Haxthausen die Wiederherstellung der alten Rechte der Stände, die der preußische König auch beim Reichsdeputationshauptschluss 1803 garantiert hatte, propagiert und angemahnt. Sicher heute noch aktuell ist seine Kritik an der wachsenden Bürokratie, der Missachtung landschaftlicher Verhältnisse sowie der Kritik an den Kollegien, die ohne Verantwortung des Einzelnen und ohne Sachkenntnis entschieden. Möglicherweise wurde die Schrift jedoch erst durch die von seinem Schwiegersohn Hermann von Brenken veranlasste Neuauflage von 1881 allgemeiner bekannt.
Gemäldeportrait des Werner Freiherrn von Haxthausen. Die Haarmode entspricht der Zeit des Wiener Kongresses, doch Werner ließ sich in der Mode von 1530 – 1560 und der Art eines Holbein-Portraits darstellen.21 Unter dem Wappen ist vermerkt: „aetate 38 1818“. (Privatbesitz).
Zu Werners „Grundlagen“ gibt es in der literarischen Rundschau 1882 eine Kritik und in einem Brief des Mitglieds des Reichstags Dr. Moritz Lieber an den Herzog Wilhelm Belgicus zu Nassau eine Verteidigung, in der Werner bescheinigt wird, dass die Schrift keinen Aufruf zum Aufruhr darstelle.22 B. Gramich aus Würzburg ist der Meinung, dass Werner zu Recht den Finger in die Wunden des modernen preußischen Verwaltungsstaates lege. Werner prangere auch zu Recht an, dass die Selbstverwaltung vielfach nur im Wählen und Wiederwählen zu finden sei. Überzeugend sei die Ausführung, dass das Prinzip des modernen Repräsentativsystems falsch sei; nicht der Mensch als Mensch solle im Staate vertreten werden, sondern der Bürger, der Bauer einer bestimmten Gegend usw. Anziehend sei die zugrunde liegende Gesinnung, welche nur den positiven Glauben und das positive Recht als sichere Richtpunkte politischen Denkens und Handelns anerkenne. Doch der preußische Oberpräsident von Vincke ist wütend und nennt die „Schmähschriften des Werner v. Haxthausen über die Grundlagen unserer Verfassung“ die Ursache für die „unermüdeten Reklamationen“ und Beschwerdeschriften einzelner westfälischer Adeliger. Diese sind mit Werner von Haxthausen der Meinung, dass die preußischen Reformen auf eine „Untertanenschaft“ abzielten, „die dem Staat ohne Unterschied der Herkunft und ohne die Möglichkeit des gemeinschaftlichen Widerstandes gleichmäßig unterworfen und in sich gleichberechtigt (ist); für alle sollten nun dieselben Gesetze gelten, die allenthalben von einer sich omnipotent gebärdenden, oft landfremden Bürokratie eingeführt und angewandt wurden.“ Doch es ist ausgerechnet sein Vorgänger, der preußische Reformer vom Stein, der seine frühere scharfe Kritik an den Zuständen im Hochstift Paderborn ändert, nachdem er nach 1816 durch den Ankauf des ehemaligen Klosters Cappenberg selbst zum westfälischen Adel gehört. „Steins Unzufriedenheit mit der politischen Entwicklung nach den Freiheits-kriegen richtete sich (…) ebenso gegen das Überwuchern der liberalen Bürokratie (…), gegen die er den Adel gestärkt wissen wollte.“ 23
Im Jahr 1837 übersiedelt Werner von Haxthausen, vielleicht auch aus Enttäuschung und angetan vom romantischen bayrischen König Ludwig I. nach Bayern, wo er mit seiner Frau Betty und mit ihrem Geld für 72.000 Gulden das Barockschloss Neuhaus und die Ruine Salzburg bei Neuhaus in Franken kauft – während der ihm so sehr seelenverwandte Joseph von Lassberg das Alte Schloss über Meersburg erwirbt. Beide bieten den entlassenen Brüdern Grimm eine Bleibe an. Werner von Haxthausen wird in den bayrischen Adel aufgenommen und 1839 in den Grafenstand erhoben.24 Nun macht er sich um Bayern verdient, wie vorher schon um Preußen. Er rettet die Salzburg, der man große Bedeutung zumisst, weil man der Meinung ist, der hl. Bonifatius habe dort im Jahr 741 drei bayrische Bistümer gegründet. Als Zentrum für die 1100-Jahr-Feier, bei der im Jahr 1841 König Ludwig I., die Bischöfe von Fulda, Eichstätt und Würzburg und an die 200 Priester anwesend sind, lässt Werner an der Stelle der alten Kapelle einen neuen Altar aufstellen. Zusammen mit dem bayrischen König legt er den Grundstein für eine neue Kapelle in neuromanischem Stil. Nach seinem Tod im Jahr 1842 lässt seine Witwe Betty die Kapelle 1848 vollenden.25 Im selben Jahr, dem Revolutionsjahr, hält Jacob Grimm in der Paulskirche eine Rede zur Abschaffung des Adels und vertreibt Joseph von Lassberg bewaffnete Freischärler aus seiner Burg.
Werner von Haxthausen ist hochgeehrt und selbst der preußische König Friedrich Wilhelm IV., dessen Land er verlassen hatte, der aber dennoch mit ihm einig ist in der Burgenbegeisterung, dem Enthusiasmus für den Kölner Dom und für Wallrafs Gemäldesammlung, besucht ihn.
Werners Leben zeigt einen hochbegabten Mann, der angeblich 13 oder sogar 16 Sprachen beherrscht, der aber so vielseitig interessiert ist, dass er vieles nicht beendet oder nicht verwirklicht. So werden trotz Drängens von Jacob Grimm und Goethe die Übersetzungen seiner gesammelten neugriechischen Volkslieder nie fertig und sein Nachlass scheint in alle Winde zerstreut.26 Werners Übersiedlung nach Bayern stand wohl auch im Zusammenhang mit den dortigen Bemühungen um die Anwerbung „katholischen alten Adels aus Rheinland und Westphalen“, die auf seine Preußen-Enttäuschung traf. Mehrmals berichtet er seinem Bruder Moritz unter dem Siegel der Verschwiegenheit („Es versteht sich, daß mein Name nicht weiter genannt wird, und du auch diesen Brief, oder doch diesen Passus des Briefs sogleich verbrennen wirst“), dass er beim bayrischen Hof als Vermittler für andere Adelige tätig werden könne.27
Werner hatte am 16. Juli 1825, im Jahr seines Ausscheidens aus dem preußischen Beamtendienst, die reiche Kölnerin Elisabeth von Harff zu Dreiborn (1787 – 1862) geheiratet. Sie und ihre Schwester, verheiratete Gräfin von Stauffenberg, wurden „die Goldgänse“ genannt, wie ein Stauffenberg-Nachkomme später berichten wird: „Mein Urgroßvater hatte eine sehr günstige und reiche Heirat gemacht, er hatte sich seine Frau vom Rhein geholt, aus der Familie der Harff, Tochter einer geborenen Kerpen, die nach ihrem hinterlassenen Bilde kaum verständlich von einem französischen Liebeshof zur Liebeskönigin des Niederrheins ernannt wurde. Meine Urgroßmutter und ihre Schwester Elisabeth, spätere Gräfin Haxthausen, hießen am Rhein wegen ihrer großen Mitgift die Goldgänse.“28
Portrait der Elisabeth (Betty) Freifrau von Haxthausen, geb. Freiin von Harff-Dreiborn. (Besitzer: Frhr. von dem Bottlenberg-Landsberg).
Portraits von Betty von Harffs Eltern: „Frantz Ludwig von Harff, Herr zu Dreyborn“, 1747 – 1814 und „Clara Elisabeth freiin von Kerpen“, 1751 – 1825. (Privatbesitz).
Sicher scheint nicht nur, dass Elisabeth (Betty) von Harff mit ihrem Vermögen den hoch verschuldeten Haxthausenschen Besitz rettet, den Werner übernommen hatte, sondern mit ihrem Kunstverstand auch sein Interesse teilt. Doch gleichzeitig erscheint auch Friedrich Carl von Brenken in Erpernburg als Kenner und Retter gefährdeten Kulturgutes.
Wie verschiedene Briefe zeigen, gilt Betty, Werners Frau, als jemand, der das Geld gut zusammenhält. Sie geht durchaus selbstbewusst vor, wenn sie unnötig teure Aktionen ihres Mannes wieder stoppt. Trotz Bildung und Vermögen scheint sie durchaus auch praktisch veranlagt zu sein. So schreibt ihr Mann Werner Ende März 1839 an seinen Bruder Moritz, seine Frau Betty könne ihn noch nicht zu ihrem Besitz in Franken begleiten, da sie in Bökerhof zuvor noch ihre Frühjahrswä-sche halten wolle.
Durch die sich über Jahrzehnte hinziehenden Ablösungen der bäuerlichen Abgaben befindet sich der Haxthausensche Besitz in einem prekären Zustand. 1834 kann Werner von Haxthausen dann aber an seinen Bruder Moritz berichten, dass er sich mit den Bauern von Altenberge, wo seit dem Jahr 1809 alle Verpflichtungen aufgelaufen waren, geeinigt habe. Er habe ihnen Etliches nachgelassen und damit, wie er schreibt, als Einziger im Lande die Ablöse der Bauern erhalten. Doch wie überall, gehen die Auseinandersetzungen noch weiter, sodass er auch im Brief an seinen Bruder Moritz vom 20.5.1838 noch darüber klagt, dass er sich seinem Besitz in Franken noch nicht voll zuwenden könne, auch wegen der unbeendeten Prozesse mit den Bauern und der noch nicht abgeschlossenen Gemeinheitsteilungen und Ablösungen.29