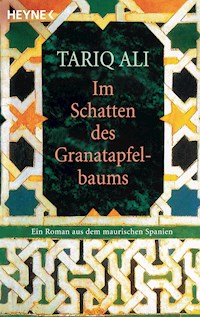5,99 €
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
Die Geheimnisse einer Adelsfamilie – der Glanz und Zerfall eines Reiches: Der Orient-Roman »Die Gärten von Marmara« von Tariq Ali als eBook bei dotbooks. Eine Liebe, die im Verbotenen erblüht, am Meer von Marmara 1899. Nach Jahren des Exils kehrt die schöne Nilofer in die Sommerresidenz ihrer Familie zurück, an ihrer Hand ein kleines Kind – in den Augen ihres Vaters eine ständige Erinnerung an Nilofers bitteren Verrat der Familienehre. Doch Iskander Pasha hütet selbst ein Geheimnis, das er um jeden Preis geheim zu halten versucht. Während sich Hitze wie ein erdrückender Schleier über das Land legt, drängen lang verborgene Leidenschaften und Sehnsüchte immer mehr an die Oberfläche. Wird am Ende dieses Sommers jemals wieder etwas sein wie zuvor? Aus bunt leuchtenden Mosaiksteinen setzt Tariq Ali das berauschende Bild einer orientalischen Adelsfamilie im 19. Jahrhundert zusammen: »Ein Roman über Angst und Sehnsucht, Verlangen und Liebe« New York Times Book Review Jetzt als eBook kaufen und genießen: Die Familiensaga »Die Gärten von Marmara« von Bestseller-Autor Tariq Ali – eine Geschichte wie aus Tausendundeiner Nacht, vorab erschienen unter dem Titel »Die steinerne Frau«. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 467
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Anhang
Personenverzeichnis
Über dieses Buch:
Eine Liebe, die im Verbotenen erblüht, am Meer von Marmara 1899. Nach Jahren des Exils kehrt die schöne Nilofer in die Sommerresidenz ihrer Familie zurück, an ihrer Hand ein kleines Kind – in den Augen ihres Vaters eine ständige Erinnerung an Nilofers bitteren Verrat der Familienehre. Doch Iskander Pasha hütet selbst ein Geheimnis, das er um jeden Preis geheim zu halten versucht. Während sich Hitze wie ein erdrückender Schleier über das Land legt, drängen lang verborgene Leidenschaften und Sehnsüchte immer mehr an die Oberfläche. Wird am Ende dieses Sommers jemals wieder etwas sein wie zuvor?
Aus bunt leuchtenden Mosaiksteinen setzt Tariq Ali das berauschende Bild einer orientalischen Adelsfamilie im 19. Jahrhundert zusammen: »Ein Roman über Angst und Sehnsucht, Verlangen und Liebe« New York Times Book Review
Über den Autor:
Tariq Ali wurde 1943 in Lahore/Pakistan geboren. Als 20-Jähriger emigrierte er nach London, wo er Politik und Philosophie studierte und Ende der 60er-Jahre zum Führer der englischen Studentenbewegung wurde. Heute arbeitet er als Schriftsteller, Filmemacher und Journalist. Er veröffentlichte zahlreiche Bücher zur Weltgeschichte und -politik, Bühnenstücke und Drehbücher, bevor ihm mit seinem ersten historischen Roman »Im Schatten des Granatapfelbaums« direkt der Sprung auf die Bestsellerlisten gelang.
Bei dotbooks veröffentlichte Tariq Ali bereits seine Orient-Romane »Das Flüstern des Orangenbaums«, »Im Schatten der Akazie« und »Die Nacht des goldenen Schmetterlings«.
***
eBook-Neuausgabe Juni 2020, Juli 2023
Dieses Buch erschien erstmals 2000 unter dem Originaltitel »The Stone Women« bei Verso, London. Die deutsche Erstausgabe erschien 2001 unter dem Titel »Die steinerne Frau« im Heinrich Hugendubel Verlag.
Copyright © der englischen Originalausgabe 2000 by Tariq Ali
Copyright © der deutschen Erstausgabe 2001 by Heinrich Hugendubel Verlag, Kreuzlingen/München
Copyright © der Neuausgabe 2020, 2023 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: dotbooks GmbH, München, unter Verwendung eines Bildmotivs von Adobe Stock/top images
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (tw)
ISBN 978-3-96148-900-8
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Die Gärten von Marmara« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Tariq Ali
Die Gärten von Marmara
Roman
Aus dem Englischen von Petra Hrabak, Gerlinde Schermer-Rauwolf und Robert A. Weiß
dotbooks.
Kapitel 1
Sommer 1899. Nach einer unfreiwilligen Abwesenheit kehrt Nilofer nach Hause zurück.Das Exil des Jussuf Pascha.Iskander Pascha erleidet einen Schlaganfall.
Mythen gewinnen in Familiengeschichten stets die Oberhand über die Wahrheit. Und so fragte ich vor zehn Tagen meinen Vater, warum unser großer Vorfahr Jussuf Pascha vor nahezu zweihundert Jahren beim Sultan von Istanbul in Ungnade gefallen und verbannt worden war. Ich stellte diese Frage meinem Sohn Orhan zuliebe, der schüchtern neben mir saß und hin und wieder einen verstohlenen Blick auf seinen Großvater warf, den er bis dahin noch nie gesehen hatte.
Wenn man nach langer Abwesenheit über die kurvigen Straßen durch die grünen Hügel fährt und schließlich hier eintrifft, wird man von den vielen Wohlgerüchen schier überwältigt, und der Gedanke an Jussuf Pascha drängt sich förmlich auf. Denn dies war in all den Jahren der Verbannung sein Palast, und die grazile, doch beständige Schönheit des Anwesens hatte noch nie ihre Wirkung auf mich verfehlt. Als Kinder flohen wir oft in der stickigen, lähmenden Sommerhitze von Istanbul hierher, und noch ehe wir die kühle Brise tatsächlich auf unserer Haut spürten, hatte uns der Anblick des Meeres bereits in gehobene Stimmung versetzt. Nun endlich war unsere beschwerliche Reise zu Ende.
Jussuf Pascha selbst hatte dem Architekten den Auftrag erteilt, einen abgelegenen Platz ausfindig zu machen, der jedoch nicht allzu weit von Istanbul entfernt sein durfte. Zwar sollte sein Haus am Rande der Einöde erbaut werden, aber dennoch in Reichweite seiner Freunde liegen. So sollte allein schon der Standort die Strafe widerspiegeln, die über ihn verhängt worden war – einerseits sehr nah der Stätte seines Triumphs in der alten Stadt, doch zugleich auch unendlich fern. Dies war der einzige Punkt, in dem sich Jussuf Pascha den Auflagen des Sultans beugte.
In seiner Anlage ähnelt das Gebäude einem Palast. Zwar wurden einige Kompromisse gemacht, doch im Großen und Ganzen war es ein Zeichen des Trotzes und somit Jussuf Paschas Botschaft an den Sultan: Ich mag zwar aus der Hauptstadt des Reiches verbannt worden sein, doch mein Lebensstil wird sich niemals ändern. Und wenn seine Freunde hier zu Besuch weilten, klangen ihr Lärmen und ihr Lachen bis hinüber in den Palast von Istanbul.
Eine ganze Heerschar von Aprikosen-, Walnuss- und Mandelbäumen wurde gepflanzt, stille Bewacher des Exils und zugleich Schutz vor den Stürmen, die alljährlich den Wintereinbruch ankündigten. Solange ich zurückdenken kann, hatten wir Sommer für Sommer im Schatten dieser Bäume gespielt, wir scherzten und spotteten, lachten und brachten einander zum Weinen, wie Kinder es eben tun, wenn sie unter sich sind. Der Garten auf der Rückseite des Hauses war wie ein sicherer Hafen, dessen Stille noch eindrucksvoller wirkte, wenn das Meer im Hintergrund von Stürmen aufgepeitscht war. Hierher kamen wir, um innezuhalten und nach unserer ersten Nacht auf unserem Sommersitz die berauschend frische Morgenluft einzuatmen. Die unerträgliche Langeweile der Sommer in Istanbul wurde abgelöst vom Zauber dieses Palasts. Als ich zum ersten Mal hierher kam, zählte ich noch nicht einmal drei Jahre und kann mich dennoch gut an diesen Tag erinnern: Es regnete, und ich war sehr traurig, weil der Regen das Meer nass machte.
Und da waren noch andere Erinnerungen. Erinnerungen voller Leidenschaft und voller Pein. Die süße Qual gestohlener Augenblicke bei einem spätabendlichen Stelldichein. Der Wohlgeruch des Grüns im nächtlichen Orangenhain, der das Herz besänftigte. Hier geschah es auch, dass ich Orhans Vater zum ersten Mal küsste – den »hässlichen, knochigen Dmitri, diesen griechischen Schulinspektor aus Konya«, wie ihn meine Mutter streng und unnachgiebig nannte, wobei sich ihre Miene verhärtete. Schon dass er Grieche war, war schlimm genug. Aber dass er auch noch ein einfacher Schullehrer sein musste! Im Grunde war es die Kombination aus beidem, die meine Mutter so erboste. Wäre Dmitri Spross einer der Phanarioten-Familien des alten Konstantinopel gewesen, sie hätte nichts gegen ihn gehabt. Aber wie konnte ihre einzige Tochter eine solche Schande über Iskander Paschas Haus bringen?
Diese Haltung war ungewöhnlich für sie, die sich nie viel um Stammbäume geschert hatte. Aber meine Mutter hatte schlicht einen anderen Freier für mich im Sinn: Ich hätte den ältesten Sohn meines Onkels Sifrah heiraten sollen, dem ich schon kurz nach meiner Geburt versprochen worden war. Und deshalb fuhr diese sonst so sanfte und nicht aus der Ruhe zu bringende Frau vor Wut und Ärger schier aus der Haut, als sie hörte, dass ich solch einen Niemand heiraten wollte.
Meine verheiratete Halbschwester Zeynep schließlich erzählte ihr, dass besagter Vetter sich überhaupt nicht für Frauen interessierte, nicht einmal als Mittel zur Fortpflanzung. Sie spann ein Lügennetz und schilderte lüsterne Szenen in solch schlüpfriger Sprache, dass meine Mutter ihre detaillierten Beschreibungen als unpassend für die Ohren einer unverheirateten Frau wie mir erachtete. Zeynep rückte meinen armen Vetter in so ein schlechtes Licht und stellte ihn als verworfenen Lüstling dar, dass ich schließlich aus dem Zimmer geschickt wurde.
Später an diesem Tag brach meine Mutter in lautes Wehklagen aus, denn Zeynep hatte sie davon überzeugt, dass unser armer Vetter ein unbarmherziges Monster war. Voller Selbstvorwürfe angesichts der Vorstellung, dass sie ihre einzige Tochter beinahe gezwungen hätte, dieses entartete Geschöpf zu ehelichen und somit deren lebenslanges Unglück zu besiegeln, umarmte und küsste sie mich und weinte dabei bittere Tränen der Reue. Natürlich verzieh ich ihr, und wir sprachen lachend von dem, was hätte passieren können. Ich weiß nicht, ob sie jemals entdeckte, dass Zeynep sich das alles nur aus den Fingern gesogen hatte. Als mein viel geschmähter Vetter kurz darauf bei einer Typhusepidemie starb, hielt Zeynep es jedenfalls für besser, meiner Mutter weiterhin die Wahrheit zu verschweigen. Mit bedauernswerter Folge: Als ihr Neffe in Smyrna beerdigt wurde, fiel es meiner Mutter zur großen Bestürzung meines Onkels Sifrah schwer, auch nur die geringste Trauer zu zeigen, ja, sie bedachte mich gar mit einem entsetzten Blick, als ich meinerseits ein paar Tränen herausquetschte.
Doch all dies war Vergangenheit. Jetzt gab es nur noch eines, das zählte: Nach neun Jahren des Exils war ich hierher zurückgekehrt. Mein Vater hatte mir verziehen, dass ich weggelaufen war. Er wollte meinen Sohn sehen. Ich wiederum hatte Sehnsucht nach der Steinernen Frau.
In unserer Kindheit hatten meine Schwester und ich uns häufig in den Höhlen nahe eines alten Felsens versteckt, der früher einmal die Statue einer heidnischen Göttin gewesen sein musste. Er überragte die Mandelbäume hinter unserem Haus, und von ferne ähnelte er einer Frau. Umgeben von Ruinen und anderen Felsen beherrschte das Monument den kleinen Hügel, auf dem es stand. Doch handelte es sich weder um Aphrodite noch Athene, denn die kannten wir. Dieser Stein hingegen ließ, allerdings nur bei Sonnenuntergang, Spuren eines geheimnisvollen Schleiers erkennen: Ihr Gesicht war verhüllt. Vielleicht sei es eine lokale Göttin, mutmaßte Zeynep, die schon seit langem in Vergessenheit geraten sei. Vielleicht habe der Bildhauer es sehr eilig gehabt. Oder die Christen seien auf dem Vormarsch gewesen, so dass ihn die Umstände zu einem Sinneswandel bewogen hätten. Möglicherweise handelte es sich gar nicht um eine Göttin, sondern um ein erstes Bildnis Mariams, der Mutter Jesu.
Da wir uns nie über ihre Identität einigen konnten, wurde sie für uns Kinder die Steinerne Frau. Ihr vertrauten wir uns an, wir richteten heimlich Fragen an sie und stellten uns vor, was sie antworten würde.
Eines Tages entdeckten wir, dass unsere Mütter, unsere Tanten und unsere Dienerinnen dasselbe taten. Da versteckten wir uns oft hinter den Felsen und lauschten ihren Kümmernissen. Allein auf diese Weise konnten wir in Erfahrung bringen, was sich wirklich in dem großen Haus abspielte. Und ebenso schütteten auch wir der Steinernen Frau unsere Herzen aus und luden bei ihr unsere Sorgen ab. Geheimnisse sind schrecklich. Manchmal sind sie zwar notwendig, doch sie zerfressen einem die Seele. Es ist immer besser, sich nicht zu verschließen, und die Steinerne Frau gab allen Frauen in diesem Haus die Möglichkeit, sich ihrer Geheimnisse zu entledigen und somit ein gesünderes Leben zu führen.
»Mutter«, flüsterte Orhan und umklammerte meinen Arm, »ob Großvater mir wohl je erzählen wird, warum dieser Palast erbaut wurde?«
In unserer Familie kursierten viele Versionen von Jussuf Paschas Geschichte, und nicht wenige hatten einen feindseligen Unterton unserem Ahnherrn gegenüber. Allerdings wurden diese meist von jenen Großonkeln und Großtanten verbreitet, deren Linie von meiner Familie enterbt worden war. Wir alle wussten, dass Jussuf Pascha erotische Gedichte geschrieben hatte, die man samt und sonders verbrannt hatte, nur ein paar wenige Verse wurden noch mündlich von einer Generation an die nächste überliefert. Aber warum hatte man sein dichterisches Werk zerstört? Und wer hatte dies getan?
Bevor ich ins Exil gegangen war, pflegte ich meinem Vater diese Fragen mindestens einmal jährlich zu stellen. Doch er hatte stets nur gelächelt und schien sie gar nicht gehört zu haben. Ich vermutete, dass es meinem Vater vielleicht unangenehm war, so etwas mit einem Kind, und dazu noch mit einer Tochter, zu erörtern. Doch dieses Mal reagierte er anders. Vielleicht wegen Orhans Anwesenheit. Er sah Orhan zum allerersten Mal, und vielleicht wollte mein Vater die Geschichte an ein jüngeres männliches Familienmitglied weitergeben. Vielleicht aber war er einfach nur in der richtigen Stimmung. Erst später wurde mir klar, dass er eine Vorahnung von der Katastrophe gehabt haben musste, die bald über ihn hereinbrechen sollte.
Es war spät am Nachmittag und noch immer warm. Die Sonne nahm ihren Lauf gen Westen, und ihre goldroten Strahlen tauchten jeden Winkel des Gartens in zauberhaftes Licht. Nichts hatte sich in dieser Residenz an dem sommerlichen Alltag geändert. Während die alten Magnolienbäume mit ihren großen Blättern im Glanz der ersterbenden Sonnenstrahlen leuchteten, war mein Vater von einem wohltuenden Nickerchen erwacht, und seine Gesichtszüge wirkten entspannt. Seit er in die Jahre gekommen war, wirkte Schlaf bei ihm wie ein Lebenselixier und schien seine Stirnfalten zu glätten. Als ich ihn betrachtete, wurde mir klar, wie sehr ich ihn in diesen vergangenen neun Jahren vermisst hatte. Ich küsste ihm die Hand und wiederholte meine Frage. Doch er lächelte nur, antwortete nicht gleich darauf.
Er wartete.
Und das tat ich auch, während ich an die vielen gleichförmig verlaufenen Sommernachmittage zurückdachte. Wortlos fasste mein Vater Orhans Hand, zog ihn an sich und strich über den Kopf des Jungen, der seinen Großvater nur von einer verblassten Fotografie her kannte, die ich mitgenommen und neben meinem Bett aufgestellt hatte. Während er heranwuchs, hatte ich ihm außerdem Geschichten aus meiner Kindheit und von dem alten Haus über dem Meer erzählt.
Da betrat der alte Petrossian, unser Haushofmeister, das Zimmer. Er hatte schon zur Familie gehört, als ich geboren wurde. Ihm folgte ein Junge, nicht viel älter als Orhan, mit einem Tablett in Händen. Der alte Petrossian servierte meinem Vater den Kaffee genau so, wie er es seit mehr als dreißig Jahren tat und wie es wahrscheinlich schon sein Vater vor all den Jahren bei meinem Großvater getan hatte. Sein Gebaren hatte sich nicht verändert. Wie stets würdigte er mich in Anwesenheit meines Vaters keines Blickes. Als junges Mädchen hatte mich dies derart erzürnt, dass ich ihm hin und wieder die Zunge herausstreckte oder eine ungehörige Geste machte. Doch was ich auch tat, nichts vermochte sein Verhalten zu ändern. Als ich älter wurde, lernte ich, seine Anwesenheit nicht weiter zu beachten, er wurde für mich unsichtbar. Aber spielte mir meine Fantasie einen Streich, oder hatte er heute gelächelt? In der Tat, doch galt dies Orhan. Ein weiteres männliches Wesen war zu unserem Haushalt gestoßen, was Petrossian erfreute. Nachdem er sich mit respektvoll geneigtem Haupt erkundigt hatte, ob mein Vater noch etwas benötige, und dieser verneint hatte, zog sich Petrossian wieder zurück, zusammen mit seinem Enkel, den er zu seinem Nachfolger in unserem Haushalt ausbildete. Eine Weile sagte keiner von uns ein Wort. Ich hatte schon vergessen, wie still es hier sein konnte, wie schnell dieser Ort meine aufgewühlten Sinne zu beruhigen vermochte.
»Du fragst, warum Jussuf Pascha vor zweihundert Jahren hierher geschickt worden ist?«
Begierig nickte ich, ich konnte meine Aufregung nicht verhehlen. Nun, da ich bereits zweifache Mutter war, wurde ich endlich als reif genug erachtet, die offizielle Version der Geschichte zu hören.
Mein Vater setzte in einem Tonfall zu sprechen an, der zwar vertraulich war, aber auch keinen Zweifel duldete – als hätten die Ereignisse, von denen er erzählte, erst letzte Woche und in seiner Gegenwart stattgefunden und nicht vor zweihundert Jahren in einem Palast am Ufer des Bosporus in Istanbul. Während er sprach, schenkte er mir keinen Blick. Stattdessen galt sein Augenmerk ganz dem kleinen Orhan, er wollte keine Gemütsregung des Knaben verpassen. Vielleicht erinnerte er sich dabei seiner eigenen Kindheit und jenes ersten Mals, da er diese Geschichte gehört hatte. Aber auch Orhan starrte wie gebannt seinen Großvater an. Seine Augen funkelten voll vergnügter Vorfreude, als mein Vater weitschweifig und im übertriebenen Singsang eines Geschichtenerzählers auf dem Dorfplatz zu erzählen begann.
»Wie es seiner Gewohnheit entsprach, schickte der Sultan des Abends nach Jussuf Pascha, und unser großer Vorfahr erschien und entbot ihm mit geneigtem Haupt seinen Gruß. Er war mit dem Sultan zusammen aufgewachsen, die beiden kannten einander gut. Eine Dienerin stellte einen Becher Wein vor Jussuf Pascha, und der Sultan bat seinen Freund, ein neues Gedicht vorzutragen. Doch an diesem Tag war Jussuf Pascha in merkwürdiger Stimmung, niemand wusste den Grund zu benennen. Normalerweise war er ein solch mustergültiger Höfling, dass er jede Bitte seines Herrschers wie einen Befehl des Himmels zu erfüllen bestrebt war. Überdies war er so geistreich, dass er einen Vierzeiler aus dem Stegreif erfinden und vortragen konnte. Doch an diesem Abend verhielt es sich anders, und keiner wusste, warum. Vielleicht hatte man ihn aus dem Bett einer Geliebten geholt, und er war verärgert. Vielleicht hatte er einfach genug von seinem Höflingsdasein. Oder er litt an schweren Verdauungsstörungen. Keiner kannte die Ursache.
Als der Sultan merkte, dass sein Freund sich in Schweigen hüllte, machte er sich zuerst große Sorgen. Er erkundigte sich nach dessen Gesundheit, bot ihm an, seinen Leibarzt zu rufen. Doch Jussuf Pascha lehnte dankend ab. Dann sah er sich um und stellte fest, dass er ausschließlich von Sklavinnen und Eunuchen umgeben war, was zwar nichts Neues war, unseren Vorfahr an diesem Tag jedoch aus unerfindlichem Grund erzürnte. Nach langem Schweigen bat er den Sultan um die Erlaubnis, sprechen zu dürfen, und sie wurde ihm gewährt.
›O großer Herrscher und Quell aller Weisheit, Sultan der zivilisierten Welt und Kalif unseres Glaubens, dein unwürdiger Diener bittet um Vergebung. Die wankelmütige Muse hat mich verlassen, kein Vers findet heute seinen Weg in meinen leeren Kopf. Mit Eurer gütigen Erlaubnis werde ich heute Abend stattdessen eine Geschichte zum Besten geben, doch möchte ich meinen erhabenen Herrscher zuvor eindringlich bitten, jedem meiner Worte aufmerksam zu lauschen, denn was ich zu erzählen habe, ist wahr.‹
Inzwischen war der Sultan recht neugierig geworden, und auch all die anderen am Hof spitzten die Ohren, um nur ja keines von Jussuf Paschas Worten zu verpassen.
›Fünfhundertachtunddreißig Jahre vor der Geburt jenes christlichen Heiligen Jesus gab es in Persien ein mächtiges Reich. Auf dem Herrscherthron saß ein großer König mit Namen Kyros, der in diesem Glück verheißenden Jahr zum König aller Könige ausgerufen wurde, und zwar in Babylon, also einem Gebiet, das heute von unserem großen und weisen Sultan regiert wird. In jenem Jahr schien das Große Persische Reich unbesiegbar. Es beherrschte die Welt. Man bewunderte es für seine Toleranz, denn die Perser gestatteten die Ausübung jeglicher Religion, respektierten alle Sitten und Gebräuche und passten in ihren neuen Gebieten gar ihre Regierungsform den dortigen Gepflogenheiten an. Alles ging gut. Das Reich blühte und gedieh und entledigte sich seiner Feinde mit einem Fingerschnippen wie ein Mensch eines lästigen Flohs.
Zweihundert Jahre später waren Kyros' Erben zu Spielbällen von Eunuchen und Frauen geworden, die Satrapen des Reiches hatten ihnen die Treue aufgekündigt, ihre Beamten waren korrupt, abgestumpft und unfähig. Zwar retteten Mesopotamiens ungeheure Reichtümer das Imperium vor dem rapiden Untergang, doch je länger sich sein Verfall dahinschleppte, umso unvermeidlicher war er. Und da gewannen die Griechen an Einfluss. Ihre Sprache verbreitete sich. Und so geschah es, dass schon lange vor der Geburt Alexanders die Route seiner Eroberungen auf der Karte der Geschichte vorgezeichnet war.
Schließlich geschah es, dass zehntausend griechische Soldaten ihren persischen Schutzherrn ohne Vorwarnung meuchelten, ihre Offiziere zu Gefangenen machten und von der Stadt, die wir heute Bagdad nennen, nach Anatolien marschierten, ohne dass sich ihnen irgendein Hindernis in den Weg stellte. Nur zehntausend Soldaten brachten dies zuwege, und so wurde dem Volk sehr bald klar, dass Herrscher und Heerführer leicht entbehrlich waren, wenn ...‹
Jussuf Pascha hatte seine Geschichte noch nicht zu Ende gebracht, doch ein Blick ins Antlitz des Sultans unterbrach seinen Redefluss. Er verstummte und wagte es nicht, seinem Herrscher in die Augen zu blicken, der wütend aufgesprungen war und aus dem Zimmer stürmte. Jussuf Pascha fürchtete schon das Schlimmste. Dabei hatte er seinen Jugendfreund lediglich vor zu viel Trägheit und Sinnenfreuden und dem erstickenden Einfluss der Eunuchen warnen wollen. Er wollte seinen Herrscher an das unabänderliche Gesetz gemahnen, dass nichts ewig währt. Doch der Sultan hatte die Geschichte als eine düstere Anspielung auf die Zukunft des Osmanischen Reiches, auf seine Herrschaft verstanden. Jeder andere wäre deshalb hingerichtet worden, doch die Erinnerungen an die gemeinsame Kindheit bewogen den Sultan, Gnade walten zu lassen. Jussuf Pascha wurde nur leicht bestraft, er wurde für immer aus Istanbul verbannt. Der Sultan wollte nicht mehr in derselben Stadt weilen wie er. Und so geschah es, dass unser Ahnherr mit seiner Familie in diese abgeschiedene, felsige Einöde kam und beschloss, hier den Palast seines Exils zu erbauen. Nie hörte er auf, sich vor Verlangen nach der alten Stadt zu verzehren, doch er sollte den Bosporus niemals wieder sehen.
Es heißt, dass auch der Sultan seine Gesellschaft vermisste und sich oft nach ihm sehnte, aber seine Höflinge, die stets eifersüchtig auf Jussuf Paschas Einfluss gewesen waren, stellten sicher, dass die beiden Freunde einander nie wieder trafen. Das ist alles. Bist du nun zufrieden, mein Täubchen? Und du, Orhan, wirst du dich meiner Worte entsinnen und die Geschichte deinen Kindern weitererzählen, wenn ich nicht mehr unter euch bin?«
Orhan lächelte und nickte, während meine Miene ausdruckslos blieb. Ich wusste, dass mein Vater uns mit Halbwahrheiten abgespeist hatte, denn über Jussuf Pascha kursierten gänzlich andere Geschichten, die ich von den Onkeln und Tanten eines anderen Familienzweigs gehört hatte. Die wiederum waren Kinder eines Großonkels, den mein Vater verabscheute, und wurden deshalb niemals eingeladen, uns hier oder in Istanbul zu besuchen.
Sie hatten von weit aufregenderen Eskapaden zu erzählen gewusst, die wahrer und unendlich überzeugender klangen. Ihnen zufolge hatte Jussuf Pascha sich in des Sultans weißen Lieblingssklaven verliebt, und die beiden waren erwischt worden, als sie gerade den Liebesakt vollzogen. Den Sklaven richtete man auf der Stelle hin, seine Genitalien wurden vor der königlichen Küche an die Hunde verfüttert. Jussuf Pascha hingegen soll öffentlich ausgepeitscht und dann fortgeschickt worden sein, um den Rest seines Lebens in Schimpf und Schande zu verbringen. Nun, vielleicht stimmte ja auch die Version meines Vaters, vielleicht vermochte eine Begebenheit allein nicht zu erklären, warum unser Ahnherr der Gunst des Sultans verlustig gegangen war. Vielleicht kannte auch gar niemand den wahren Grund, und keine der vielen Geschichten, die in Umlauf waren, entsprach der Wahrheit.
Nun, vielleicht.
Ich verspürte jedenfalls kein Bedürfnis, meinen Vater nach unserer langen Trennung gleich wieder vor den Kopf zu stoßen, deshalb wollte ich auch nicht weiter nachfragen. Denn es hatte ihn tief getroffen, dass ich mich vor vielen Jahren damals in diesen durchreisenden Schulinspektor verliebt hatte und mit ihm weggelaufen war, dass ich ihn geheiratet und ihm Kinder geboren hatte und dazu noch seine Gedichte liebte – heute weiß ich, dass sie schlecht waren, aber damals hatten sie einfach wunderschön geklungen. Nun, Dmitri hatte sich schon seit jeher zum Dichter berufen gefühlt, doch da er sich seinen Lebensunterhalt verdienen musste, hatte er angefangen zu unterrichten. So konnte er etwas Geld verdienen und sich zugleich um seine Mutter kümmern, denn sein Vater war in Bosnien gefallen, als er für unser Reich kämpfte. Ja, was mein Herz vornehmlich betört hatte, war die sanfte Stimme gewesen, mit der Dmitri seine Gedichte vortrug.
All dies war in Konya geschehen, wo ich bei der Familie meiner besten Freundin zu Besuch war. Sie hatte mir die Stätten des Zeitvertreibs in Konya gezeigt, wir hatten die Gräber der alten Seldschuken-Könige besichtigt und in die Häuser der Sufi gespäht. Als ich Dmitri hier zum ersten Mal begegnete, war ich siebzehn Jahre alt. Er war beinahe dreißig.
Ich wollte der beklemmenden Atmosphäre meines Vaterhauses entfliehen, und so waren mir Dmitri und seine Dichtkunst wie ein Glück verheißender Ausweg erschienen. Eine Zeit lang war ich auch glücklich, doch nie war mein Glück so vollkommen, dass es den Schmerz gedämpft hätte, den ich empfand, weil man mir den Zutritt zum Haus meiner Familie verwehrte. Mir fehlte meine Mutter, und schon bald vermisste ich auch die Annehmlichkeiten unseres Zuhauses. Doch mehr als alles andere fehlten mir die Sommer hier in diesem Haus über dem Meer.
Natürlich hatte ich mein Heim verlassen wollen, aber zu meinen eigenen Bedingungen. Das Verdikt meines Vaters hingegen, mit dem er mich zur unerwünschten Person erklärte, traf mich wie eine Ohrfeige. Damals hasste ich ihn, ihn und seine Engstirnigkeit. Ich hasste die Art und Weise, wie er meine Brüder behandelte – vor allem den ungestümen Halil, der sich, einem ungebärdigen Hengst gleich, nicht an die Kandare nehmen lassen wollte. Manchmal gab ihm mein Vater vor der ganzen Familie die Peitsche zu spüren, und in diesen Augenblicken hasste ich ihn am meisten. Doch Halils Widerstandsgeist blieb ungebrochen. Und da er in den Augen meines Vaters ein fauler, respektloser Anarchist war, war er verblüfft, als Halil in die Armee eintrat, aufgrund seiner familiären Verbindungen rasch Karriere machte und mit Aufgaben im Palast betraut wurde. Iskander Pascha misstraute den Motiven seines jüngeren Sohnes, und nicht ohne Grund.
Wie wir von unserem älteren Bruder Salman gehört hatten, machte Vater als langjähriger Botschafter der Hohen Pforte in den Pariser Salons stets einen vornehmen und kultivierten Eindruck. Salman wusste dies, weil er Vater hatte begleiten dürfen und seine höhere Bildung an der Akademie in Paris erhielt, weshalb er jetzt für alles Französische schwärmte, außer für die französischen Männer.
Und wann immer Vater mit neuen Möbeln und Stoffen sowie Aktgemälden für den westlichen Flügel unseres Hauses und Parfüm für seine Frauen nach Istanbul zurückkehrte, waren wir frohen Mutes. »Vielleicht ist er ja jetzt endlich ein moderner Mann geworden«, flüsterte Halil uns dann zu, woraufhin wir aufgeregt kicherten. Vielleicht würde es ja doch einmal einen Silvesterball bei uns zu Hause geben, und wir würden festliche Kleidung tragen und tanzen und Champagner trinken wie unser Vater und Salman in Paris und Berlin. Müßige Träumerei. Unser Leben änderte sich nie. In der gewohnten Umgebung seiner Stadt, zu Hause in seinem Heimatland war Vater sofort wieder der türkische Aristokrat.
Und nun war ich also zum ersten Mal seit meiner Hochzeit eingeladen worden, in unser altes Sommerhaus zurückzukehren, wenngleich nur in Begleitung von Orhan. Dmitri und meine allerliebste kleine Emineh mussten zu Hause bleiben. Vielleicht nächstes Jahr, hatte meine Mutter in Aussicht gestellt. Vielleicht nie, hatte ich wütend zurückgeschrien. Meine Mutter hatte mich heimlich dreimal besucht, um den Kindern Kleider und mir Geld zu bringen. Dabei agierte sie als Vermittlerin, und ganz allmählich begann sich die Beziehung zwischen mir und meinem Vater zu entspannen. Wir fingen an, einander zu schreiben. Und nachdem wir zwei Jahre lang höfliche und unerträglich steife Formalitäten ausgetauscht hatten, bat er mich, Orhan zu ihm auf den Sommersitz zu bringen. Ich bin froh, dass ich seiner Bitte nachgekommen bin. Beinahe hätte ich abgelehnt, ich wollte darauf beharren, dass ich ihn erst besuchen würde, wenn ich auch meine Tochter mitbringen durfte. Aber Dmitri, mein Mann, überzeugte mich davon, dass diese Haltung dickköpfig und dumm war. Jetzt bin ich froh, dass ich dieses Wiedersehen nicht falschem Stolz geopfert habe. Wenn ich mich für meinen Trotz entschuldigt und mich meinem Vater zu Füßen geworfen hätte, wäre mir schon vor Jahren vergeben worden. Denn im Gegensatz zu dem Bild, das ich vielleicht von ihm gezeichnet habe, war Iskander Pascha weder grausam noch nachtragend. Er war einfach ein Mann seiner Zeit, streng gläubig und hart im Umgang mit uns.
Als Orhan in dieser ersten Nacht eingeschlummert war, ging ich noch einmal nach draußen und schlenderte durch die Obstgärten. Der vertraute Geruch der Thymian- und Pfeffersträucher weckte viele alte Erinnerungen.
Auch die Steinere Frau war noch da, und ich flüsterte ihr zu: »Ich bin zurückgekommen, Steinerne Frau. Mit einem kleinen Jungen. Du hast mir gefehlt, Steinerne Frau, denn es gab so viele Dinge, die ich meinem Ehemann nicht erzählen konnte. Neun Jahre sind lang, wenn man nie von seinen Sehnsüchten sprechen darf.«
Drei Tage nachdem mein Vater Orhan die Geschichte von Jussuf Pascha erzählt hatte, erlitt er einen Schlaganfall. Die Tür seines Schlafzimmers stand halb offen, ebenso die Fenster und Türen zum Balkon, und eine sanfte Brise trug den süßen Duft der Zitronenbäume herein. Stets ging meine Mutter am frühen Morgen in sein Zimmer, öffnete Fenster und Türen, damit ihr Mann das Meer riechen konnte. Doch als sie an diesem Morgen ins Zimmer kam, lag er schwer atmend auf der Seite. Sie drehte ihn um und sah in ein stummes, blasses Gesicht. Sein Blick war in die Ferne gerichtet, und sie fühlte, wie seine Augen nach etwas außerhalb dieses Lebens suchten. Er hatte den kalten Hauch des Todes gespürt und wollte nicht länger leben.
Gelähmt, unfähig, die Beine zu bewegen, und stumm, schien er – sofern man dies aus seinem Blick schließen durfte – jede bewusste Minute zu Allah zu beten, dass dieser seinem irdischen Dasein ein Ende bereiten möge. Doch Allah überhörte sein Flehen, und ganz langsam erholte sich Iskander Pascha wieder. In seine Beine kehrte Leben zurück, und mit Petrossians Hilfe unternahm er erste Gehversuche. Doch seine Zunge blieb gelähmt, wir würden niemals wieder seine Stimme hören. Fortan schrieb er seine Instruktionen und Befehle auf Zettel, die uns auf einem kleinen Silbertablett überreicht wurden.
Und so geschah es, dass sich allabendlich nach dem Essen ein Grüppchen von uns in dem alten Zimmer einfand, dessen Balkon aufs Meer hinausging. Sobald es sich jeder bequem gemacht hatte, schlürfte mein Vater mit einem Mundwinkel ein bisschen Tee – sein Gesicht war von dem Schlaganfall schrecklich in Mitleidenschaft gezogen worden –, und während Petrossians Enkel Akim ihm sanft die Füße massierte, lehnte er sich zurück und wartete darauf, dass wir ihn mit Geschichten unterhielten.
Es war niemals leicht gewesen, sich in Anwesenheit meines Vaters zu entspannen. Er war stets ein fordernder Mann gewesen, der schon bei der leisesten Kritik an ihm als Familienoberhaupt immer den anderen die Schuld zuschob – selbst wenn besagte Angelegenheit schon lange Zeit zurücklag.
Zwar glaubten meine Brüder und Schwestern, die aus den verschiedensten Gegenden des Reiches an sein Krankenbett gerufen wurden, dass ihn sein Gebrechen nachsichtiger stimmen würde. Doch ich war überzeugt, dass sie irrten.
Kapitel 2
Die Familie versammelt sich.Der beeindruckende Auftritt des Barons.Salmans Trübsal.
Ich lag in einem verdunkelten Zimmer mit einer kalten Kompresse auf der Stirn im Bett. Ich ruhte mich aus, damit der dumpfe Kopfschmerz wich, der mich so hartnäckig plagte. An diesem Tag sollten Salman und Halil eintreffen. Und so war ich auch nicht zugegen, als die übrige Familie samt der Dienerschaft von der Terrasse aus zusah, wie die beiden aus unserer alten Kutsche stiegen, mit der sie, flankiert von je sechs Reitern, von Istanbul hergeeilt waren. Später erzählte mir meine Mutter, wie der Anblick meines Vaters, der reglos in einem schweren Sessel saß, die beiden zutiefst erschüttert hatte. Sie waren links und rechts von ihm auf die Knie gesunken und hatten seine Hände geküsst. Halil in seiner Generalsuniform erkannte als Erster, dass das Schweigen schnell bedrückend werden konnte.
»Ich freue mich, dich noch lebend anzutreffen, Ata. Allein der Himmel hätte mir beistehen können, wenn Allah beschlossen hätte, uns zu Waisen zu machen. Mein Bruder, dieser Rohling, hätte womöglich Petrossian angewiesen, mich mit einer seidenen Kordel zu erdrosseln.«
Bei dieser absurden Vorstellung spielte ein Lächeln um die Lippen des alten Mannes, woraufhin alle Versammelten in jenes laute Gelächter ausbrachen, das mich so plötzlich aus meinem Schlummer riss. Doch der Kopfschmerz war verschwunden, also sprang ich aus dem Bett, benetzte mein Gesicht mit Wasser und lief hinunter, um meine Brüder zu begrüßen. Gerade als ich auf die Terrasse trat, schloss Halil Orhan in seine Arme. Er kitzelte den Jungen mit seinem Schnurrbart im Nacken, dann warf er ihn hoch, fing ihn wieder auf und drückte ihn liebevoll an sich. Anschließend stellte er Orhan dem Onkel vor, den er noch nie gesehen hatte. Der Junge betrachtete den neuen Onkel mit einem schüchternen Lächeln, und Salman tätschelte seinem Neffen verlegen den Kopf.
Beinahe fünfzehn Jahre lang hatte ich Salman nicht gesehen. Er hatte sein Vaterhaus verlassen, als ich dreizehn war. Ich erinnerte mich an ihn als einen großen, schlanken Mann mit vollem schwarzen Haar und einer tiefen, melodiösen Stimme. Als ich nun seine Silhouette auf der Terrasse erblickte, war ich irritiert. Denn im ersten Moment hielt ich ihn für Vater. Salman war alt geworden. Obwohl noch keine fünfzig, hatte er bereits graues, schütteres Haar, und als ich ihn zuletzt gesehen hatte, war er mir auch größer erschienen. Sein Leib war gedrungener geworden, sein Gesicht aufgedunsen, er ging in leicht gebeugter Haltung, und seine Augen waren traurig. Grausames Ägypten. Warum hatte es ihn so altern lassen? Wir umarmten und küssten uns. Seine Stimme klang kühl. »Jetzt bist du also eine Mutter, Nilofer.«
Das waren die einzigen Worte, die er an jenem Tag an mich richtete. Und in ihnen lag ein Erstaunen, als wäre es etwas gänzlich Neues, dass man Kinder in die Welt setzte. Aus irgendeinem Grund ärgerte ich mich über Salmans Ton und seine Bemerkung. Ich weiß nicht, warum, aber ich entsinne mich, dass ich damals ein bisschen böse auf ihn war. Vielleicht weil er mir das Gefühl vermittelte, mich weder als eine erwachsene Frau zu sehen noch mich als solche zu behandeln. In seinen Augen war ich noch immer ein Kind. Aber ehe mir eine angemessen scharfe Erwiderung eingefallen war, hatte Petrossian ihn bereits zu einer privaten Unterredung mit meinem Vater weggeführt.
Nun war Halil an der Reihe. Er hatte nie die Verbindung zu uns abgebrochen und legte Wert darauf, sich regelmäßig mit Orhans Vater auszutauschen. In Zeiten der Not war er uns eine große Hilfe gewesen. Er hatte dafür gesorgt, dass wir ausreichend zu essen hatten und uns ordentlich kleiden konnten, nachdem man Dmitri, wie den meisten Griechen in Konya, verboten hatte, weiter seiner Arbeit nachzugehen. Ich hatte Halil zum letzten Mal gesehen, als er eines schönen Frühlingsnachmittags ohne Vorankündigung in Konya aufgetaucht war. Damals war Orhan erst drei Jahre alt gewesen, doch er hatte seinen Onkel, genauer dessen Schnurrbart, niemals vergessen, mit dem er den Kleinen immer ärgerte. Ich musterte Halil. Er sah so gut aus wie eh und je, und die Uniform stand ihm gut. Manches Mal fragte ich mich, wie es dazu gekommen war, dass ausgerechnet der Ungebärdigste aus unserer Familie sich für die Disziplin und den Drill der Armee entschieden hatte. Während er mich umarmte, flüsterte er: »Ich bin froh, dass du gekommen bist. Hat er Orhan eine Geschichte erzählt?«
Ich nickte.
»Die von Jussuf Pascha?«
»Von wem sonst?«
»Welche Version?«
Wir mussten beide lachen.
Gerade als wir den anderen ins Haus folgen wollten, bemerkte Halil in der Ferne eine Staubwolke, die über dem Zufahrtsweg zu unserem Haus aufstob. Es musste sich um eine weitere Kutsche handeln, aber wer mochte darin sitzen? Iskander Pascha war in der ganzen Familie bekannt für seine Ungeselligkeit und sein reizbares Gemüt. Daher erschien nur selten jemand uneingeladen in unserem Haus in Istanbul, und ich kann mich nicht erinnern, dass jemals einer hierher gekommen wäre. Was seine weitläufigere Verwandtschaft betraf, war meinem Vater die traditionelle Gastfreundschaft fremd. Besonders feindselig verhielt er sich seinen Vettern ersten Grades und deren Nachkommen gegenüber, aber auch zu seinen Brüdern wahrte er gern Distanz. Aus all diesen Gründen war es für uns als Kinder immer eine angenehme Überraschung gewesen, wenn unerwartet Gäste kamen, insbesondere Onkel Kemal, der stets mit einer ganzen Wagenladung voller Geschenke eintraf.
»Wird heute sonst noch jemand erwartet?«
»Nein.«
Halil und ich verharrten auf der Terrasse und warteten auf die Kutsche. Wir tauschten einen Blick und kicherten. Wer wagte es, ungebeten bei unserem Vater aufzukreuzen? Als wir noch sehr klein waren, hatte das Haus Großvater gehört, und in jener Zeit waren ständig Gäste zugegen gewesen. Für Großvaters engste Freunde, die hier nach Belieben ein und aus gingen, hielt man stets drei Gästezimmer bereit. Das gesamte Hauspersonal wusste, dass man immer und zu jeder Tageszeit mit ihnen und ihrer Dienerschar rechnen musste. Doch das war lange her. Kurz nachdem das Haus in den Besitz meines Vaters übergegangen war, stellte er klar, dass Großvaters Freunde hier nicht länger erwünscht waren. Dies löste einen Familienstreit aus, denn Großmutter erhob heftige Einwände dagegen, und zwar in einer für sie ungewöhnlich deutlichen Sprache. Aber mein Vater blieb unnachgiebig: Er pflege eben eine andere Lebensart und habe diese Lüstlinge, die sich zu Zeiten seines Vaters im Haus herumtrieben und den hübscheren unter den Dienstmädchen das Leben schwer machten, noch nie ausstehen können.
Als die Kutsche näher kam, erkannten wir den Kutscher und den Diener, der neben ihm saß. Halil lachte leise in sich hinein, während wir die Treppe hinunterstiegen, um den älteren Bruder unseres Vaters, Mehmed Pascha, und seinen Freund, Baron Jakob von Hassberg, zu begrüßen. Beide Männer, inzwischen Anfang siebzig, schienen bei guter Gesundheit zu sein. Ihre normalerweise sehr blassen Gesichter waren sonnengebräunt. Sie trugen Strohhüte und leichte helle Leinenanzüge, jedoch von unterschiedlichem Schnitt. Denn jeder war fest davon überzeugt, den besseren Schneider zu haben. Wenn die beiden über ihre Kleidung diskutierten, konnte mein Vater seinen Unmut nie verhehlen.
Halil entbot dem Preußen einen herzlichen Gruß und küsste seinem Onkel ehrerbietig die Hand.
»Willkommen in deinem Haus, Onkel, und seien auch Sie uns willkommen, Baron. Welch unverhofftes Vergnügen! Wir hatten keine Ahnung, dass ihr im Lande weilt.«
»Wir auch nicht, bis wir endlich ankamen«, erwiderte Mehmed Pascha. »Der Zug aus Berlin hatte wie üblich Verspätung.«
»Aber erst, nachdem er die Grenze des Osmanischen Reichs überquert hatte«, warf der Baron ein. »Das sollte man gerechterweise schon erwähnen. Bis zur Grenze war der Zug auf die Minute pünktlich. Wir sind nämlich sehr stolz auf unsere Züge.«
Mehmed Pascha ging über den Einwand hinweg und wandte sich an Halil. »Stimmt es, dass der Pfeil des Todes meinen Bruder durchbohrte, er sich aber weigerte zu fallen? Ist das wahr?«
»Ich fürchte, ich habe deine Frage nicht verstanden, Onkel.« Hilfe suchend blickte Halil zu mir.
»Unser Vater hat sein Sprechvermögen verloren, Onkel«, murmelte ich. »Ansonsten geht es ihm wieder gut, allerdings wird er fortan nicht ohne fremde Hilfe gehen können.«
»Das halte ich für nicht allzu tragisch. Er hat schon immer zu viel geredet. Wisst ihr, was eure Mutter zum Abendessen kochen lässt? Gibt es Champagner im Haus? Nein? Das habe ich mir schon gedacht, deshalb habe ich ein paar Kisten vom Gut des Barons mitgebracht. Ich habe zu viele trübsinnige Abende in diesem elenden Haus zugebracht, als ich in eurem Alter war. Nie wieder! Habt ihr Eis in der Grube?«
Ich nickte.
»Gut. Lass ein paar Flaschen für den Abend kühl stellen, Kind, und sag Petrossian, er soll unsere Zimmer herrichten. Bestimmt sind sie seit dreißig Jahren nicht mehr gelüftet worden. Und du, junger Mann, bring mich nun zu meinem Bruder.«
Vater hatte Mehmed Pascha nicht sonderlich gern, doch er behandelte ihn niemals unhöflich, und zwar aus gutem Grund. Als mein Großvater starb, erbte Mehmed Pascha als ältester Sohn das Herrenhaus der Familie in Istanbul ebenso wie dieses Anwesen, das er jedoch noch nie gemocht hatte. Den Grund dafür hatten wir niemals verstanden. Wie konnte sich irgendjemand in dieser Umgebung nicht wohl fühlen? Allerdings sprachen wir nie allzu ausführlich darüber, zogen wir doch in ganz erheblichem Maße Gewinn aus Onkel Mehmeds Abneigung. Unsere Freude wog stärker als unsere Neugier, denn wir liebten dieses Haus. Und wir liebten unsere Steinerne Frau. Ich erinnere mich an meine Aufregung, als Vater erzählte, Onkel Mehmed habe uns dieses Haus geschenkt. Halil, Zeynep und ich hatten vor Begeisterung in die Hände geklatscht und uns umarmt. Nur Salman war ernst geblieben und hatte eine peinliche und unpassende Frage gestellt: »Wird es nach deinem Tod wieder an seine Kinder zurückfallen?«
Vater hatte ihn wortlos angefunkelt, als wollte er sagen: Du Trottel, gerade haben wir dieses Haus geschenkt bekommen, und schon denkst du an meinen Tod. Meine Mutter hingegen versuchte ein Lächeln zu unterdrücken. Allerdings hätte keiner von uns je den Grund für ihre heimliche Freude erfahren, hätte sich Zeynep, die vertraut war mit den Gepflogenheiten meiner Mutter, nicht an jenem Tag nach Sonnenuntergang hinter einem Felsen versteckt und Mutter dabei belauscht, wie sie mit der Steinernen Frau redete.
»Was darf man Kindern heutzutage sagen, Steinerne Frau? Wie weit darf man gehen?
Armer Salman. Dabei wollte er doch nur wissen, ob er das Haus eines Tages erben würde. Aber mein Gemahl hat ihn angesehen, als hätte er ihn zu ermorden versucht. Wenngleich ich nicht seine Mutter bin, so ist mir der Junge doch sehr ans Herz gewachsen. Ich wünschte, sein Vater würde mit ihm sprechen, ihm sagen, wie lieb er ihn im Grunde hat. Es ist doch nicht Salmans Schuld, dass seine Mutter bei seiner Geburt gestorben ist. Aber er spürt die Zerrissenheit seines Vaters. Beim Anblick des Jungen fühlt sich Iskander Pascha meist an seine erste Frau erinnert, und dann liebt er ihn. Aber in anderen Momenten wieder sieht er Salman so gehässig an, als hätte der Junge seine Mutter vorsätzlich umgebracht. Einmal habe ich Iskander Pascha nach seiner ersten Frau gefragt. Da wurde er sehr zornig auf mich und verbot mir, ihn jemals wieder darauf anzusprechen. Ich hatte ihn nur aus Anteilnahme gefragt, doch er benahm sich höchst eigenartig. Ja, ich fragte mich damals ernstlich, ob er etwas zu verbergen habe. Was ist nur mit den Knaben in dieser Familie los, Steinerne Frau? Sobald sie in die Pubertät kommen, werden sie verschlossen und blicken auf ihre Mütter und Schwestern herab. Hoffentlich wird Halil niemals so. Auch wenn ich nicht seine leibliche Mutter bin, werde ich mein Bestes tun, um ihn daran zu hindern.
Und was Mehmed Pascha betrifft, was soll ich da sagen? Niemand hätte etwas dagegen gehabt, wenn er ebenfalls geheiratet und Kinder gezeugt hätte, doch er weigerte sich und wurde für seinen Ungehorsam von seinem Vater streng bestraft. Er stand andauernd unter Aufsicht und wurde von ausgesuchten Hauslehrern unterrichtet. Wer hätte denn ahnen können, dass dieser junge Baron, der vor mehr als fünfzig Jahren hierher kam, um Mehmed und seine Brüder in der deutschen Sprache zu unterrichten, Mehmed so zugetan sein würde? Nicht einmal die Dienstboten schöpften Verdacht. Als die Angelegenheit ans Licht kam, wurde Petrossians Vater einem eingehenden Verhör unterzogen, doch er schwor im Namen Allahs, er habe von nichts gewusst.
Wenn du doch reden könntest, Steinerne Frau. Dann könntest du Salman sagen, dass sein Onkel Mehmed niemals Kinder haben und er, Salman, eines Tages dieses Haus erben wird.«
All das erfuhr ich von Zeynep, und ich erzählte es Halil. Als Halil wiederum Salman einweihte, brach dieser in Gelächter aus. Er hielt kurz inne und schaute uns ernst an, doch konnte er nur wenige Sekunden lang an sich halten, bevor er erneut losprustete. Sein Lachanfall geriet immer mehr außer Kontrolle. Mittlerweile hatte sich das Zimmer gefüllt, Petrossian und auch die ansonsten stillen Dienstmädchen waren hereingekommen, angesteckt von der ungewohnten Heiterkeit, die wie ein sommerlicher Sturm durchs Haus fegte. Alle wollten sie mitlachen, aber Salman brachte kein Wort heraus.
Halil, Zeynep und ich wurden still und sogar ein bisschen ängstlich, besonders als Iskander Pascha die Treppe herunterkam. Anfangs lächelte er, doch da erblickte Salman seinen Vater und lachte noch schallender heraus. Die Atmosphäre wurde zusehends angespannt. Petrossian, der um die Launen seines Herrn wusste, scheuchte die Dienstmägde aus dem Zimmer. Erst als sie gegangen waren, fragte Iskander Pascha in trügerisch sanftem Ton: »Warum lachst du, Salman?«
Abrupt verstummte Salman. Er wischte sich die Tränen aus dem Gesicht und sah seinen Vater freimütig an.
»Ich lache, Ata, über meine eigene Torheit und Verblendung. Wie hatte ich nur so dumm sein können, dich nach Onkel Mehmeds Erben zu fragen. Ich meine, es ist wohl noch kein Fall bekannt geworden, in dem ein Baron, selbst mit preußischem Blut in den Adern, Kinder gebären konnte.«
Meine Mutter sog scharf die Luft ein. Und Iskander Pascha war außer sich vor Zorn. Alles, woran ich mich noch erinnere, ist sein raubtierhaftes Profil, als er die Faust ballte und Salman hart ins Gesicht schlug. Erschrocken taumelte mein Bruder zurück.
»Solltest du in meiner Gegenwart oder in der deiner Mutter jemals wieder respektlos über deinen Onkel sprechen, werde ich dich enterben. Ist das klar?«
Salman nickte stumm, während Zorn, Schmerz und Bitterkeit ihm Tränen in die Augen trieben. Obwohl ich noch keine neun Jahre alt war, hasste ich meinen Vater in diesem Augenblick aus tiefstem Herzen. Es war das erste Mal, dass ich sah, wie er jemanden schlug.
Ich nahm Salmans Hand, während Zeynep Wasser brachte, um ihm die brennende Wange zu kühlen. Halil war blass geworden. Er war entsetzt, so wie ich, doch ihm ging dieser Vorfall noch viel näher. Von da an, glaube ich, hatte er jede Achtung vor seinem Vater verloren. Ich war noch sehr jung, aber jenen Nachmittag werde ich niemals vergessen.
Was uns so verstörte, war nicht allein Vaters Gewalttätigkeit, sondern vielmehr der Ausbruch einer tiefen Verbitterung, die bislang unter der Oberfläche geblieben war. Er hatte die Maske fallen gelassen und ein verzerrtes Gesicht mit derben, rohen Zügen gezeigt. Immerhin war Salman damals sechsundzwanzig Jahre alt. Wir, die vier Kinder von Iskander Pascha, verließen wie im Delirium das Haus. Zusammen gingen wir zu einem flachen Felsen unweit der Stelle, wo die Steinerne Frau stand, doch ein Pinienwäldchen verdeckte den Blick auf sie.
Jeder von uns hatte seinen Lieblingsplatz auf diesem Felsen, aber es war das erste Mal, dass wir alle gemeinsam hierher kamen. Abgesehen von einigen kleineren Vertiefungen war die Oberseite des Steins vollkommen glatt. Doch war dies angeblich nur zu einem geringen Teil auf Naturkräfte zurückzuführen. Petrossian behauptete, hier habe Jussuf Pascha oft gesessen und im Angesicht des weiten Meeres so manches seiner gelungeneren Gedichte verfasst. Deshalb hätten mehrere Steinmetze in harter Arbeit den Fels abgeflacht und seine Oberfläche geglättet.
Dort saßen wir also schweigend und sahen aufs Meer hinaus, bis dessen Anblick die aufgewühlten Wogen in unserem Inneren besänftigte. Wir blieben lange auf diesem Felsen sitzen und warteten auf den Sonnenuntergang. Schließlich brach Halil als Erster das Schweigen. Er wiederholte ebenjene Bemerkung über Onkel Mehmed, an der sich der Zorn unseres Vaters entzündet hatte. Dann wiederholte Zeynep diese Worte, doch als ich an der Reihe war, legte mir Salman die Hand auf den Mund.
»Kleine Prinzessin, du solltest nicht über Dinge sprechen, von denen du noch nichts verstehst.«
Und wir alle brachen erneut in Gelächter aus, um jede Erinnerung an jenen Vorfall aus unserem Gedächtnis zu tilgen. Von unserer Reaktion gerührt, bekannte Salman, dass er für immer von zu Hause weggehen wolle. Dieses Haus werde er nie wieder betreten und auch nicht mehr nach Istanbul zurückkehren. Er werde nach Aleppo oder Kairo ziehen oder vielleicht sogar noch weiter, in Länder, in denen es keine Osmanen gab. Erst dann würde er sich wirklich frei fühlen.
Wir waren untröstlich. Vorher solle er wenigstens noch heiraten, bat Zeynep ihn. Er könne doch auch zur Armee gehen, schlug Halil vor. Sie unterhielten sich darüber, was sie für sich selbst und für ihre Kinder, die erst noch geboren werden mussten, vom Leben erhofften, vertieften sich in Gespräche über ihre Zukunftsvorstellungen. All das war neu für mich. Ich war noch zu jung, um mitzureden oder auch nur zu begreifen, wovon sie sprachen, doch die Intensität ihrer Gefühle brannte jenen Tag in mein Gedächtnis ein. So hatte ich meine Geschwister noch nie gesehen. Ihre Gesichter strahlten lebhaft, sie wirkten glücklich, und ich entsinne mich, dass mich das ebenfalls glücklich machte. Es schien beinahe, als hätte das tragische Ereignis jenes Nachmittags einen Wendepunkt in ihrem Leben herbeigeführt, der sie hoffnungsvoll in die Zukunft blicken ließ. Sogar meine Schwester Zeynep, über deren Sanftmut in der Familie gern gewitzelt wurde, war an jenem Tag wütend und aufgeregt. Als es Abend wurde, wollte keiner von uns ins Haus zurückkehren. Wir waren voller Empörung über Iskander Pascha und seine Welt. Schließlich kam Petrossian, der stets wusste, wo wir uns aufhielten, und teilte uns mit, dass es Zeit für das Abendessen sei. Doch wir würdigten ihn keines Blickes. Da setzte er sich zu uns und überredete uns mit honigsüßen Worten und versöhnlichen Schmeicheleien heimzukehren. Salman stand auf und ging voran, wir anderen folgten widerstrebend.
Ich weiß nicht mehr ganz genau, wann Salman von zu Hause auszog. Aber es war wohl kurz nachdem Iskander Pascha ihn geschlagen hatte. Ich entsinne mich nur noch, welchen Schreck die ganze Familie bekam, als Salman eines Morgens beim Frühstück verkündete, er wolle seine Stellung aufgeben und sich für ein paar Jahre die Welt ansehen. Da er in Onkel Kemals Reederei arbeite, würde er ja ohne größere Probleme zurückkehren können, wann immer es ihm beliebe.
Weil Salmans leibliche Mutter bei seiner Geburt gestorben war, hatte sich schon bald darauf Zeyneps und Halils Mutter um ihn gekümmert. Sie war eine entfernte Base und hatte auch mich stets mit Zuneigung überschüttet. Ihre Hochzeit mit Iskander Pascha war recht schnell in die Wege geleitet worden. Zwar war er zu jener Zeit noch immer untröstlich, doch er beugte sich dem Druck der Familie und heiratete erneut, damit Salman eine Mutter hatte. Sie sorgte für den Knaben, hegte und pflegte ihn und wurde ihm tatsächlich eine Mutter. Ja, sie liebte ihn wie einen eigenen Sohn und nahm ihn stets in Schutz, auch nachdem sie Halil und Zeynep geboren hatte.
Da sie nur selten im Sommerhaus weilte, hatte sie Salmans Demütigung nicht miterlebt. Allerdings war die Kunde davon bis nach Istanbul gedrungen, und meine Mutter meinte, Iskander Pascha habe deshalb bestimmt so manche Spitzzüngigkeit von ihr ertragen müssen. Vielleicht hatte sie sogar versucht, Salman zum Bleiben zu bewegen. Doch Salman hatte seine Entscheidung getroffen, und nichts und niemand konnte ihn mehr davon abbringen. Uns sagte er, dass er für einige Zeit auf Reisen gehen und uns Bescheid geben würde, wenn er sich in einer bestimmten Stadt niederließ.
Sein zerknirschter Vater bot ihm Geld für seine Reisen an, doch Salman wies es zurück. In den letzten vier Jahren hatte er von seinem Lohn genügend abzweigen können. Er hatte uns noch einmal alle umarmt und war dann aufgebrochen. Viele Monate lang hörten wir nichts von ihm. Dann erhielten wir gelegentlich Briefe, aber nur unregelmäßig. Ein Jahr nach seiner Abreise kam eine Nachricht von Onkel Kemal, der soeben aus Alexandria zurückgekehrt war. Er teilte uns mit, er sei bei Salman gewesen, der nun ein erfolgreicher Diamantenhändler sei und eine Frau aus Alexandria geheiratet habe. Zudem hatte Salman einen Brief an Zeyneps Mutter geschickt. Was darin stand, wurde uns jedoch niemals offenbart. Obgleich Zeynep das ganze Zimmer ihrer Mutter durchsuchte, konnte sie den Brief nicht finden. In unserer Verzweiflung fragten wir sogar einmal Petrossian, ob er den Inhalt des Briefes kenne. Er schüttelte betrübt den Kopf.
»Wenn man zu viele Steine nach jemandem wirft, hat er irgendwann keine Angst mehr davor.«
Bis zum heutigen Tag bin ich mir nicht sicher, was Petrossian damit gemeint hat. Zeynep und ich hatten zwar klug genickt, aber prustend gelacht, als er das Zimmer verließ.
Merkwürdig, dass sie sich alle am selben Tag hier eingefunden hatten. Welche Erinnerungen mochten in Iskander Pascha aufflackern, als er sah, wie Salman, Onkel Mehmed und der Baron gemeinsam sein Zimmer betraten? Später berichtete mir Halil, Vater habe beim Anblick von Salman geweint, ihn innig in die Arme geschlossen und auf die Wangen geküsst. Salman war gerührt, vergoss jedoch keine Träne. Die Geste war zu spät gekommen. Dass erwachsene Männer stets einen solchen Stolz an den Tag legen, ist mir schon vor langer Zeit aufgefallen, aber ich habe es nie richtig verstanden. Dieser Stolz ist auch meinem Gatten Dmitri nicht völlig fremd, wurde aber von ihm bewusst unterdrückt.
Im Lauf der nächsten Tage hatte ich Gelegenheit, Salman genauer zu beobachten. Mein Bruder, in jungen Jahren der Lebhafteste und Ehrgeizigste von uns allen, war nun schwermütig und verbittert. Ich denke, er litt daran, dass er nicht mehr aus seinem Leben gemacht hatte. Ja, es hatte ganz den Anschein, als wäre sein Erfolg als Diamantenhändler die Wurzel seines Unglücks. Nie war er zufrieden. Er hatte in Alexandria eine Ägypterin geheiratet, »eine wunderschöne Koptin«, wie Onkel Kemal es ausdrückte, doch er hatte sie nie seiner Familie vorgestellt. Und nicht einmal jetzt, da sein Vater von einem Schlaganfall gezeichnet war, hatte Salman seine Söhne mitgebracht, damit sie wenigstens einmal ihren Großvater sahen. Einzig Halil hatte schon einmal eine Einladung nach Ägypten erhalten und das Privileg genossen, Salmans Frau und Kinder kennen zu lernen. Aber als ich Halil einmal hartnäckig mit der Frage bedrängte, warum Salman uns gegenüber so gleichgültig sei, erhielt ich eine gleichermaßen scharfe wie überraschende Antwort.
»Salman leidet daran, dass das Reich seit dreihundert Jahren seinem unaufhaltsamen Niedergang zustrebt. Auch mir ist diese Tatsache bewusst, aber Salman geht es zu Herzen.«
Rein gefühlsmäßig lehnte ich diese Begründung ab. Ich wusste durchaus, dass Salman die Istanbuler Lebensweise zuwider war, dass er tief enttäuscht war und eine Veränderung herbeisehnte. Aber das konnte sein Verhalten bestenfalls teilweise erklären. Mir gefiel der Gedanke nicht, dass mein früher so lustiger Bruder aufgrund der historischen Entwicklungen in eine derartige Hoffnungslosigkeit versunken war. Unsere Familie hatte seit jeher Geschichte geschrieben. Wie konnten wir es da zulassen, dass sie uns nun zerstörte? Es musste einen anderen Grund für Salmans Trübsal geben, und ich war fest entschlossen, diesen herauszufinden.
Kapitel 3
Der Baron zitiert aus dem Fürstenspiegel Qabus-nameh eine Passage mit der Überschrift »Romantische Leidenschaft«.Die unvollständige Geschichte von Enver dem Albaner.Sabiha und die tscherkessische Magd, die sich nur dadurch zu retten wusste, indem sie davonflog.
»Dein Osmanisches Reich gleicht einer betrunkenen Prostituierten, die mit gespreizten Beinen daliegt und nicht weiß und auch gar nicht wissen will, wer sie als Nächstes nimmt. Übertreibe ich, Mehmed?«
Der Baron und Mehmed leerten gerade die zweite Flasche Champagner.
»Wie üblich bringst du hehre Gedanken sehr anschaulich zum Ausdruck«, entgegnete Mehmed. »Aber ich frage mich zuweilen, ob der große Gelehrte Hegel nicht vielleicht ein wenig von dir enttäuscht wäre. Den Äußerungen deiner Zeitgenossen zufolge hast du in Berlin als hoffnungsvoller Student gegolten ...«
Der Baron stimmte ein Lachen an, das sich staccatoartig wie eine Maschinengewehr-Salve entlud: Haha-ha-ha, ha-ha-ha-ha, ha-ha-ha und ein abschließendes ha. Der Lachsalve war kein Lächeln vorausgegangen, aus dem allmählich ein Lachen wurde, nein, es war Teil eines verbalen Rüstzeugs, angelegt zur Demütigung, Niederwerfung, Störung oder Ablenkung eines jeglichen Widersachers.
»Wann immer ich dieser Familie einen Besuch abstatte, geht mir die wahre Welt verloren. Die reale Welt ist eine Welt der Ameisen, wie ich dir ja bereits des Öfteren erklärt habe. Ein menschliches Wesen kann dort nur überleben, wenn es selbst zu einer Ameise wird. Und da liegt unsere Zukunft. Diese Welt lockt uns an, aber ihr verweigert euch ihr. Ihr tut so, als wäre euer Reich die reale Welt, und haltet euch auf diese Weise die Ungeheuer vom Leib – indes wie lange noch, Mehmed? Wie lange noch? Euer Reich ist so heruntergewirtschaftet, dass ihr euch noch nicht einmal Zeit kaufen könnt, wie ihr es annähernd dreihundert Jahre lang getan habt.«
Mein Onkel verharrte eine Weile schweigend. Dann antwortete er leise: »Was deine Philosophen Fortschritt nennen, mein lieber Baron, hat die Menschen innerlich verdorren lassen. Sie gehen unbedacht miteinander um. Sieh dir doch Frankreich an, ein Land, das wir beide lieben. Oder gar England. Keine Spur von Solidarität unter den Menschen. Kein gemeinsames Streben, nur der Wunsch zu überleben und reich zu werden – koste es, was es wolle. Vielleicht ist dies der Lauf der Dinge. Vielleicht werden auch wir eines Tages so sein. Du und ich natürlich nicht. Bis dahin sind wir schon lange tot, und wer vermag zu sagen, ob wir nicht doch glücklich gestorben sind? Warum sollten wir nicht Glück und Zufriedenheit in gegenseitiger Gesellschaft finden? Warum sollte ich nicht mein Leben, dieses Haus, meine Familie lieben?«
Der Baron lachte lauthals heraus. Dieses Mal war sein Gelächter echt.
»Weshalb lachst du?«