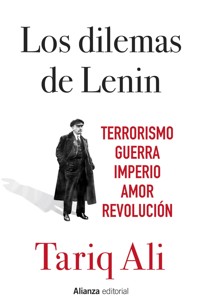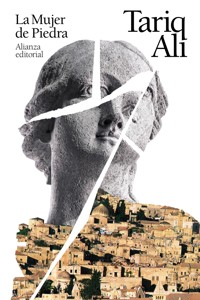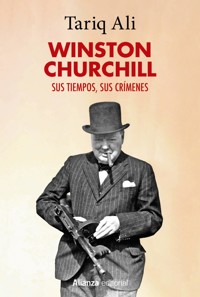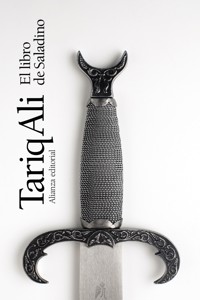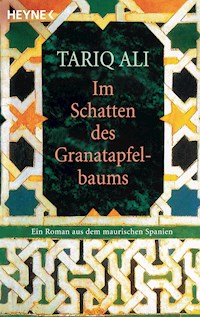
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In seinem fesselnden Roman beschreibt Tariq Ali die Tragödie der andalusischen Mauren.
Das E-Book Im Schatten des Granatapfelbaums wird angeboten von Heyne Verlag und wurde mit folgenden Begriffen kategorisiert:
historische romane,romane,roman,mittelalter romane,spanien,ebooks,historischerroman,mauren,andalusien,familiengeschichte
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 440
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
TARIQ ALI
IM
SCHATTEN
DES
GRANATAPFELBAUMS
Aus dem Englischen von
Margarete Längsfeld
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel Shadows of the Pomegranate Tree bei Chatto & Windus, London.
Die Übersetzerin dankt Falih Al-Khannak für seine Unterstützung.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
1. E-Book Ausgabe
Copyright © 1992 by Tariq Ali
Copyright © 1993 der deutschsprachigen Ausgabe by Eugen Diederichs Verlag, München
Copyright © dieser Ausgabe by Wilhelm Heyne Verlag,
München in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Printed in Germany
Umschlaggestaltung: Nele Schütz Design, München unter Verwendung des Umschlags der deutschen Ausgabe von © Sander & Krause Werbeagentur, München
eISBN 978-3-641-23484-3V003
www.www.heyne.de
Für Aisha, Chengiz und Natasha
VORBEMERKUNG DES VERFASSERS
Im maurischen Spanien erhielten Kinder, wie heute in der arabischen Welt üblich, einen Vornamen, ansonsten wurden sie mit dem Namen ihres Vaters oder ihrer Mutter bezeichnet. Suhayr bin Umar ist in dieser Erzählung Suhayr, Sohn des Umar; Asma bint Dorothea ist Asma, Tochter der Dorothea. Der offizielle Name eines Mannes kann ihn schlicht als den Sohn seines Vaters bezeichnen – Ibn Farid, Ibn Chaldun, Sohn des Farid, Sohn des Chaldun. Die Mauren in dieser Geschichte verwenden ihre eigenen Namen für Städte, die heute spanische Namen tragen, darunter etliche, die von den Mauren gegründet wurden. Diese Namen sowie einige allgemeine maurische Ausdrücke sind im Glossar erläutert.
PROLOG
Die fünf christlichen Ritter, die zum Wohnsitz von Jimenez de Cisneros befohlen wurden, waren über diese nächtliche Vorladung nicht erbaut. Dies hatte wenig mit dem Umstand zu tun, daß es der kälteste Winter seit Menschengedenken war. Sie waren Veteranen der Reconquista. Unter ihrem Kommando waren die Truppen vor sieben Jahren im Triumph in Gharnata einmarschiert und hatten die Stadt im Namen Ferdinands und Isabellas besetzt.
Keiner der fünf Männer stammte aus dieser Region. Der älteste unter ihnen war der leibliche Sohn eines Mönches aus Toledo. Die übrigen waren Kastilen und sehnten sich nach ihren Dörfern zurück. Sie waren alle gute Katholiken, doch duldeten sie es nicht, daß ihre Loyalität für selbstverständlich gehalten wurde, auch nicht vom Beichtvater der Königin. Sie wußten, wie er seine Versetzung von Toledo, wo er Erzbischof gewesen war, in die eroberte Stadt bewerkstelligt hatte. Es war kaum ein Geheimnis, daß Cisneros ein Werkzeug der Königin Isabella war. Die Macht, die er ausübte, war nicht ausschließlich geistlicher Natur. Die Ritter wußten nur zu gut, wie ein Aufbegehren gegen seine Autorität bei Hofe verstanden würde.
Die fünf Männer, die, obwohl in Umhänge gehüllt, vor Kälte zitterten, wurden in Cisneros’ Schlafkammer geführt. Die Kargheit der Lebensumstände überraschte sie. Blicke wurden gewechselt. Daß ein Kirchenfürst Räumlichkeiten bewohnte, die einem fanatischen Mönch besser angestanden hätten, war ohne Beispiel. Noch waren sie es nicht gewohnt, daß ein Prälat so lebte, wie er predigte. Jimenez blickte zu ihnen auf und lächelte. Die Stimme, die ihnen Anweisungen erteilte, hatte keinen befehlenden Klang. Die Ritter waren verblüfft. Der Mann aus Toledo flüsterte laut zu seinen Gefährten: »Isabella hat die Schlüssel des Taubenhauses einer Katze anvertraut.«
Cisneros zog es vor, diese anmaßende Bemerkung zu überhören. Er hob nur leicht die Stimme.
»Ich möchte ausdrücklich betonen, daß es uns nicht um persönliche Vergeltungen zu tun ist. Ich spreche zu euch kraft der Gewalt von Kirche und Krone.«
Das entsprach nicht ganz der Wahrheit, doch Soldaten sind es nicht gewohnt, an denen zu zweifeln, welche die Gewalt ausüben. Sobald er sich überzeugt hatte, daß seine Anweisung verstanden worden war, entließ der Erzbischof die Männer. Er hatte deutlich machen wollen, daß die Mönchskutte über das Schwert gebot. Eine Woche später, am ersten Tag im Dezember des Jahres 1499, drangen christliche Soldaten unter dem Befehl von fünf Ritter-Komturen in die einhundertfünfundneunzig Bibliotheken der Stadt ein sowie in ein Dutzend Wohnhäuser, die einige der bekannteren Privatsammlungen beherbergten. Alles in Arabisch Geschriebene wurde konfisziert.
Tags zuvor hatten im Dienste der Kirche stehende Gelehrte Cisneros zugeredet, dreihundert Manuskripte von seinem Verdikt auszunehmen. Er war einverstanden gewesen, vorausgesetzt, sie würden der neuen Bibliothek einverleibt, die er in Alcala zu gründen gedachte. Es waren größtenteils arabische Handbücher der Heilkunst und Astronomie. Sie enthielten die fortgeschrittensten Erkenntnisse in diesen und verwandten Wissenschaften seit den Tagen des Altertums. Hierunter befand sich ein Großteil des Schrifttums, das sich von der Halbinsel al-Andalus sowie von Sizilien aus im übrigen Europa ausgebreitet und den Weg für die Renaissance geebnet hatte.
Mehrere tausend Abschriften des Korans mitsamt gelehrten Kommentaren sowie theologischen und philosophischen Betrachtungen über seine Vorzüge und Nachteile, alle in der erlesensten Kalligraphie ausgeführt, wurden wahllos von den Männern in Uniform fortgeschleppt. Seltene Manuskripte, die für alle Bereiche des Geisteslebens in al-Andalus von größter Bedeutung waren, wurden in behelfsmäßige Bündel gestopft, die sich die Soldaten auf den Rücken luden.
Den ganzen Tag über errichteten die Soldaten einen Wall aus Hunderttausenden von Manuskripten. Das gesammelte Wissen der Halbinsel lag auf dem alten Seidenmarkt unterhalb des Bab al-Ramla.
Dies war die alte Stätte, wo maurische Ritter einst Reiterturniere austrugen, um die Blicke ihrer Damen auf sich zu ziehen, die Stätte, wo die Bevölkerung sich in großer Zahl versammelte und die Kinder rittlings auf den Schultern ihrer Väter, Oheime und älteren Brüder saßen, während sie ihre Favoriten anfeuerten. Dies war die Stätte, wo diejenigen, die in Ritterrüstung paradierten, mit Schmähungen begrüßt wurden, nur weil sie Geschöpfe des Sultans waren. Wenn ersichtlich wurde, daß ein tapferer Mann einen Höfling aus Ehrerbietung für den König gewinnen ließ oder, was ebenso wahrscheinlich war, weil man ihm einen Beutel voll Golddinare versprochen hatte, stimmten die Bürger von Gharnata ein lautes Hohngeschrei an. Diese Bürgerschaft war bekannt für ihre unabhängige Denkweise, ihren sarkastischen Witz und ihre Abneigung gegen die Obrigkeiten. Dies war die Stadt und dies die Stätte, die Cisneros für sein Feuerwerk in jener Nacht auserwählt hatte.
Die kostbar gebundenen und verzierten Bücher gaben Zeugnis von den Künsten der Araber auf der Halbinsel und stellten alles in den Schatten, was die Klöster der Christenheit in dieser Hinsicht zu bieten hatten. Die Schriften, die sie enthielten, hatten den Neid von Gelehrten in ganz Europa geweckt. Welche Pracht wurde da vor den Bewohnern der Stadt aufgehäuft.
Die Soldaten, die seit den frühen Morgenstunden den Bücherwall errichteten, hatten die Blicke der Gharnater gemieden. Einige Zuschauer waren bekümmert, andere zornig, mit blitzenden Augen, Ärger und Trotz in den Gesichtern. Wieder andere, die sich sachte hin und her wiegten, zeigten abwesende Mienen. Einer von ihnen, ein alter Mann, wiederholte unentwegt den einzigen Satz, den er im Angesicht des Unheils hervorbringen konnte:
»Wir werden in einem Meer aus Hilflosigkeit ertränkt.«
Einige Soldaten, vielleicht, weil man sie nie lesen oder schreiben gelehrt hatte, begriffen die Ungeheuerlichkeit des Verbrechens, das sie verüben halfen. Sie fühlten sich unbehaglich in der Rolle. Als Bauernsöhne erinnerten sie sich der Geschichten, die sie von ihren Großeltern gehört hatten, deren Schilderungen maurischer Grausamkeit zu den Darstellungen ihrer Kultur und Gelehrsamkeit im Widerspruch standen.
Dieser Soldaten waren nicht viele, aber genug, um etwas zu bewirken. Während sie durch die schmalen Straßen gingen, ließen sie absichtlich ein paar Manuskripte vor den fest verschlossenen Türen fallen. Da sie es nicht besser wußten, meinten sie, die schwersten Folianten müßten auch die gewichtigsten sein. Die Annahme war falsch, doch die Absicht war redlich, und die Geste wurde gewürdigt. Kaum waren die Soldaten außer Sicht, als eine Türe aufging, eine verhüllte Gestalt heraussprang, die Bücher aufhob und wieder hinter dem Schutz der Schlösser und Riegel verschwand. Auf diese Weise überlebten dank des natürlichen Anstands einer Handvoll Soldaten mehrere hundert wichtiger Manuskripte. Sie wurden später auf dem Wasserweg nach Fes gebracht, wo sie in Privatbibliotheken unterkamen, und so blieben sie erhalten.
Auf dem Platz dunkelte es allmählich. Eine große Menge widerstrebender, zumeist männlicher Bürger war von den Soldaten zusammengeholt worden. Muselmanische Granden und beturbante Priester mischten sich unter Ladenbesitzer, Händler und Bauern, Handwerker und Budeninhaber, Kuppler, Prostituierte und Schwachsinnige. Die ganze Menschheit war hier vertreten.
Am Fenster einer Herberge beobachtete der bevorzugte Wächter der Kirche von Rom mit zufriedener Miene die wachsende Bücherpyramide. Jimenez de Cisneros hatte immer geglaubt, daß die Heiden als Gesamtheit nur ausgerottet werden konnten, wenn ihre Kultur vollkommen ausgelöscht wurde. Das bedeutete die systematische Vernichtung ihrer sämtlichen Bücher. Mündliche Überlieferungen würden noch eine Weile überdauern, bis die Inquisition den Unbotmäßigen die Zungen ausriß. Hätte er es nicht getan, dann hätte jemand anders dieses unumgängliche Feuer anordnen müssen – jemand, der begriff, daß die Zukunft durch Härte und Disziplin gesichert werden mußte und nicht durch Liebe und Bildung, wie diese schwachsinnigen Dominikaner unaufhörlich verkündeten. Was hatten sie denn schon erreicht?
Jimenez frohlockte. Er war zum Werkzeug des Allmächtigen auserwählt. Wohl hätten andere diese Aufgabe durchführen können, niemand aber so methodisch wie er. Seine Lippen kräuselten sich zu einem höhnischen Lächeln. Was konnte man von einem Klerus erwarten, dessen Äbte noch vor wenigen hundert Jahren Mohammed, Umar, Uthman und so weiter hießen? Jimenez war stolz auf seine Reinheit. Die Verhöhnungen, die er in der Kindheit erduldet hatte, waren falsch. Er hatte keine jüdischen Vorfahren. Kein Mischlingsblut besudelte seine Adern.
Ein Soldat war unmittelbar vor dem Fenster des Prälaten postiert. Jimenez blickte ihn an und nickte, das Zeichen wurde an die Fackelträger weitergegeben und das Feuer entfacht. Eine halbe Stunde herrschte vollkommene Stille. Dann zerriß lautes Wehklagen die Dezembernacht, gefolgt von Rufen: »Es gibt keinen Gott außer Allah, und Mohammed ist sein Prophet.«
In einiger Entfernung von Cisneros sang eine Gruppe, aber er konnte ihre Worte nicht hören. Er hätte sie auch gar nicht verstanden, denn die Sprache der Verse war Arabisch. Das Feuer stieg höher und höher. Der Himmel selbst schien eine flammende Unendlichkeit geworden, ein Spektrum von stiebenden Funken, als die prachtvoll kolorierten Handschriften verbrannten. Es war, als ließen die Sterne ihren Kummer herabregnen.
Langsam, benommen, begannen die Leute sich zu entfernen. Ein Bettler aber zog sich nackt aus und kletterte auf den brennenden Scheiterhaufen. »Was für einen Sinn hat das Leben ohne unsere Lehrbücher?« rief er aus sengenden Lungen. »Sie müssen es büßen. Sie werden büßen für das, was sie uns heute angetan haben.«
Er verlor das Bewußtsein. Die Flammen hüllten ihn ein. Tränen wurden in Schweigen und Haß vergossen, doch Tränen konnten das an diesem Tag entfachte Feuer nicht löschen. Die Leute gingen fort.
Auf dem Platz ist es stumm. Hier und da glimmt noch ein Feuerrest. Jimenez wandert durch die Asche, ein schiefes Lächeln im Gesicht, derweilen er seinen nächsten Schritt plant. Er denkt laut.
»Auf welche Rache auch immer sie in ihrem tiefen Gram sinnen mögen, es ist zwecklos. Wir haben gewonnen. Diese Nacht war unser wahrer Sieg.«
Inhaltsverzeichnis
1. KAPITEL
»Wenn das so weitergeht«, nuschelte Ama durch ihre Zahnlücken, »wird von uns nichts bleiben als eine flüchtige Erinnerung.«
Yasid, aus seiner Konzentration gerissen, blickte mit finsterem Gesicht vom Schachtuch auf. Er saß am anderen Ende des Innenhofs, wo er sich eifrig mühte, die Listen und Kniffe des Schachspiels zu meistern. Seine Schwestern Hind und Kulthum waren beide perfekte Strateginnen. Sie weilten mit den übrigen Familienangehörigen in Gharnata. Yasid wollte sie bei ihrer Rückkehr mit einem unüblichen Eröffnungszug überraschen.
Er hatte versucht, Ama für das Spiel zu begeistern, die alte Frau aber hatte über dieses Ansinnen nur gackernd gelacht und abgelehnt. Yasid konnte ihre Weigerung nicht verstehen. War Schach den Perlen, die sie unablässig befingerte, nicht bei weitem überlegen? Warum nur wollte ihr das nicht in den Kopf?
Zögernd räumte er die Schachfiguren fort. Wie außergewöhnlich sie sind, dachte er, indes er sie sorgsam in ihre Schatulle zurücklegte. Sein Vater hatte sie eigens für ihn in Auftrag gegeben. Juan der Tischler war angewiesen worden, sie rechtzeitig zu Yasids zehntem Geburtstag zu schnitzen. Er hatte ihn im vergangenen Monat des Jahres 905 A. H. begangen, welches die Christen nach ihrer Zeitrechnung als das Jahr 1500 bezeichneten.
Juans Familie hatte seit Jahrhunderten in Diensten der Banu gestanden. Im Jahre des Herrn 932 war das Oberhaupt der Hudayl-Sippe, Hamsa bin Hudayl, mit seiner Familie und seinen Gefolgsleuten an die westliche Grenze des Islams geflohen. Er hatte sich an den Hängen der Gebirgsausläufer gut zwanzig Meilen von Gharnata entfernt niedergelassen. Hier errichtete er das Dorf, das als al-Hudayl bekannt wurde. Es erhob sich auf einer Anhöhe und war schon von weitem zu sehen. Es war von Gebirgsbächen umgeben, die sich im Frühjahr, zur Zeit der Schneeschmelze, in reißende Fluten verwandelten. Hamsas Kinder bestellten das umliegende Land und pflanzten Orchideen. Nachdem Hamsa fast fünfzig Jahre tot war, errichteten sich seine Nachfahren einen Palast. Ringsum gab es Ackerland, Weinberge und Obstgärten mit Orangen-, Granatapfel- und Maulbeerbäumen, welche wie Kinder anmuteten, die sich um ihre Mutter scharen.
Nahezu sämtliche Möbel, ausgenommen natürlich die von Ibn Farid in den Kriegen erbeuteten Stücke, waren von Juans Vorfahren sorgfältig gefertigt worden. Wie jedermann im Dorf wußte auch der Tischler um die besondere Rolle, die Yasid zu Hause spielte: Der Knabe war der Liebling der ganzen Familie. Und so beschloß Juan, Schachfiguren zu schaffen, die alles überdauern würden. Am Ende hatte er sich selbst übertroffen.
Die Mauren bekamen die Farbe Weiß. Ihre Königin war eine edle Schönheit mit einer Mantilla, ihr Gemahl ein rotbärtiger Monarch mit blauen Augen, dessen Gestalt ein fließendes, mit seltenen Edelsteinen geschmücktes arabisches Gewand umhüllte. Die Türme waren Nachbildungen der Befestigungsanlagen, welche den Eingang zu der palastartigen Residenz der Banu Hudail beherrschten. Die Springer verkörperten Yasids Urgroßvater, den Krieger Ibn Farid, dessen legendäre Liebes- und Kriegsabenteuer dieser eigenwilligen Familie ihr kulturelles Gepräge verliehen hatten. Die weißen Läufer waren nach dem beturbanten Imam der Dorfmoschee modelliert. Die Bauern wiesen eine frappierende Ähnlichkeit mit Yasid auf.
Die Christen waren nicht bloß schwarz: Sie glichen Ungeheuern. Die Augen der schwarzen Königin glitzerten böse, ein krasser Gegensatz zu der winzigen Madonna, die sie um den Hals trug. Ihre Lippen waren blutrot gefärbt. An einem Finger trug sie einen Ring mit einem aufgemalten Totenschädel. Der König hatte eine bewegliche Krone auf dem Kopf, die sich leicht anheben ließ, und als sei es mit dieser Symbolik nicht genug, hatte der kunstsinnige Tischler den Monarchen mit einem winzigen Paar Hörner versehen. Um diese einzigartigen Verkörperungen von Ferdinand und Isabella gruppierten sich ebenso groteske Figuren. Die Springer erhoben blutbefleckte Hände. Die beiden Läufer waren in Satansgestalt modelliert; sie umklammerten Dolche und hatten peitschengleiche, abstehende Schwänze. Juan hatte Jimenez de Cisneros nie zu Gesicht bekommen, ansonsten dürfte kaum ein Zweifel bestehen, daß des Erzbischofs glühende Augen und Hakennase sich vorzüglich für eine Karikatur geeignet hätten. Die Bauern waren samt und sonders als Mönche gestaltet mit Kapuzen, hungrigen Blicken und Bierbäuchen: beutelüsterne Geschöpfe der Inquisition.
Alle, die die fertige Arbeit sahen, waren sich einig, daß Juan ein Meisterwerk geschaffen hatte. Yasids Vater Umar war beunruhigt. Er wußte, sollte je ein Spion der Inquisition die Schachfiguren zu Gesicht bekommen, würde der Tischler zu Tode gefoltert. Doch Juan war unnachgiebig: Das Kind mußte das Geschenk erhalten. Des Tischlers Vater war vor sechs Jahren während eines Verwandtenbesuches in Tulaytula von der Inquisition der Abtrünnigkeit bezichtigt worden. Er war später im Gefängnis den schweren Verletzungen erlegen, die er infolge seines Stolzes während der Folterung durch die Mönche erlitten hatte. Zum Schluß hatte man ihm an beiden Händen Finger abgehackt. Der Lebenswille des alten Tischlers war gebrochen. Der junge Juan sann auf Rache. Seine Schachfiguren waren erst der Anfang.
Am Fuße jeder Figur war Yasids Name eingeritzt, und Yasid hing an seinen Schachfiguren, als seien es lebendige Wesen. Seine Lieblingsfigur aber war Isabella, die schwarze Königin. Sie erschreckte und faszinierte ihn zugleich. Mit der Zeit wurde sie ihm eine Art Beichtvater, jemand, dem er alle seine Sorgen anvertraute, jedoch nur, wenn er sicher sein konnte, daß sie allein waren.
Nachdem er die Schachfiguren weggeräumt hatte, blickte er wieder zu der alten Frau hinüber und seufzte.
Warum sprach Ama in letzter Zeit immer soviel mit sich selbst? Wurde sie wirklich verrückt? Hind behauptete es, doch er war sich nicht sicher. Yasids Schwester sprach oft etwas im Zorn, aber wenn Ama wirklich verrückt wäre, hätte sein Vater ihr im maristan in Gharnata einen Platz gleich bei Großtante Sahra besorgt. Hind war nur verstimmt, weil Ama dauernd davon anfing, es sei endlich Zeit, daß ihre Eltern einen Ehemann für sie fänden.
Yasid durchquerte den Innenhof und setzte sich auf Amas Schoß. Das ohnehin schon von Falten durchzogene Gesicht der alten Frau wurde noch runzliger, als sie ihren Schutzbefohlenen anlächelte. Ohne jedes Zeremoniell ließ sie von ihren Perlen ab, streichelte das Antlitz des Knaben und küßte ihn sacht auf den Kopf.
»Möge Allah dich segnen. Bist du hungrig?«
»Nein. Ama, mit wem hast du vorhin gesprochen?«
»Wer hört heutzutage schon auf eine alte Frau, Ibn Umar? Ich könnte ebensogut tot sein.«
Ama hatte Yasid nie bei seinem richtigen Namen genannt. Niemals. War Yasid etwa nicht der Name des Kalifen, welcher bei Kerbala die Enkelsöhne des Propheten besiegt und getötet hatte? Jener Yasid hatte seine Soldaten angewiesen, ihre Pferde in der Moschee von Medina einzustallen, wo der Prophet selbst Gebete dargebracht hatte. Jener Yasid hatte die Gefährten des Propheten mit Verachtung behandelt. Seinen Namen auszusprechen hieß das Andenken der Familie des Propheten beschmutzen. All dies konnte Ama dem Knaben nicht erzählen, doch war es Grund genug für sie, ihn stets als Ibn Umar zu bezeichnen, den Sohn seines Vaters. Einmal hatte Yasid sie vor der ganzen Familie hiernach gefragt, und Ama hatte einen zornigen Blick auf Subayda, die Mutter, geworfen, als wollte sie sagen: Es ist alles ihre Schuld, warum fragst du nicht sie? Doch alle hatten gelacht, und Ama war wütend hinausgegangen.
»Ich habe dir zugehört. Ich hörte dich sprechen. Ich kann dir sagen, was du gesprochen hast. Soll ich deine Worte wiederholen?«
»O mein Sohn«, seufzte Ama. »Ich sprach zu den Schatten der Granatapfelbäume. Sie wenigstens werden noch da sein, wenn wir alle gegangen sind.«
»Wohin gegangen, Ama?«
»Nun, in den Himmel, mein Kind.«
»Gehen wir alle in den Himmel?«
»Möge Allah dich segnen. Du wirst in den siebenten Himmel eingehen, mein armes Mondscheibchen. Bei den anderen bin ich mir nicht so sicher. Und was deine Schwester betrifft, Hind bint Umar, wenn man sie nicht bald vermählt, so wird sie nicht einmal in den ersten Himmel eingehen. Nein, sie nicht. Ich fürchte, ein Unheil wird über das Kind hereinbrechen. Ich fürchte, sie wird wilden Leidenschaften erliegen, und Schande wird über das Haupt eures Vaters kommen, möge Gott ihn beschützen.«
Bei dem Gedanken, daß Hind nicht einmal in den ersten Himmel kommen würde, war Yasid in Kichern ausgebrochen, und sein Gelächter wirkte so ansteckend, daß auch Ama zu gackern begann, wobei sie alle ihre acht verbliebenen Zähne entblößte.
Von all seinen Geschwistern hatte Yasid Hind am liebsten. Die anderen behandelten ihn immer noch wie einen Säugling, sie schienen sich andauernd zu wundern, daß er selbständig denken und sprechen konnte, sie hoben ihn hoch und küßten ihn wie ein Schoßhündchen. Er wußte, daß er ihr Liebling war, aber er haßte es, wenn sie ihm nie auf seine Fragen antworteten. Deshalb sah er sie alle mit Verachtung an.
Das heißt: alle bis auf Hind. Obwohl sechs Jahre älter als Yasid, behandelte sie ihn doch wie ihresgleichen. Sie stritten und rauften sich häufig, doch liebten sie sich innig. Diese Liebe zu seiner Schwester war so tief verwurzelt, daß Amas rätselhafte Vorahnungen ihn nicht im mindesten bekümmerten, noch seine Gefühle für Hind beeinträchtigten.
Hind hatte ihm auch den wahren Grund für Großonkel Miguels Besuch genannt, welcher seine Eltern letzte Woche so aufgeregt hatte. Auch er war aufgeregt gewesen, als er hörte, Miguel wünsche, sie würden alle nach Qurtuba kommen, wo er Bischof war, auf daß er sie persönlich zum Katholizismus bekehren könne. Und vor drei Tagen hatte Miguel sie alle miteinander, einschließlich Hind, nach Gharnata geholt. Yasid wandte sich wieder an die alte Frau.
»Warum spricht Großonkel Miguel nicht arabisch mit uns?«
Ama war über die Frage bestürzt. Alte Gewohnheiten sterben nicht, und so spuckte sie bei der Erwähnung des Namens Miguel unwillkürlich aus und begann leicht erschrocken ihre Perlen zu befingern, indes sie die ganze Zeit murmelte: »Es gibt keinen Gott außer Allah, und Mohammed ist sein Prophet …«
»Antworte mir, Ama. Antworte mir.«
Ama betrachtete das leuchtende Antlitz des Knaben. Seine mandelfarbenen Augen blitzten vor Zorn. Er erinnerte sie an seinen Urgroßvater. Durch diese Erinnerung besänftigt, antwortete sie auf seine Frage.
»Dein Großonkel Miguel spricht, liest und schreibt arabisch, aber … aber …« Amas Stimme erstickte im Zorn. »Er hat sich von uns abgewendet. Von allem. Hast du bemerkt, daß er diesmal stank, genau wie sie?«
Yasid fing wieder an zu lachen. Er wußte, daß Großonkel Miguel nicht beliebt war in der Familie, nur hatte sich niemand jemals so respektlos über ihn geäußert. Ama hatte ganz recht. Sogar sein Vater hatte in das Gelächter eingestimmt, als Umma Subayda erklärte, die unangenehmen Gerüche, die von dem Bischof ausgingen, erinnerten an ein Kamel, das zu viele Datteln gefressen hat.
»Hat er immer gestunken?«
»Beileibe nicht!« Ama erregte sich über die Frage. »Früher, ehe er seine Seele verkaufte und Bilder von blutenden Männern an Holzkreuzen anzubeten begann, war er der reinlichste Mensch auf Erden. Fünf Bäder täglich im Sommer. Fünfmal frische Kleider. Ich erinnere mich gut an jene Zeiten. Jetzt riecht er wie ein Pferdestall. Weißt du warum?«
Yasid verneinte.
»Damit niemand ihn beschuldigen kann, unter seiner Soutane ein Muselman zu sein. Stinkende Katholiken! Die Christen im Heiligen Land waren reinlich, diese katholischen Priester aber fürchten das Wasser. Sie denken, ein Bad nehmen ist ein Verrat an dem Heiligen, den sie den Sohn Gottes nennen.
Jetzt steh auf und komm. Es ist Zeit zum Essen. Die Sonne sinkt schon, und wir können nicht warten, bis sie aus Gharnata zurückgekehrt sind. Da fällt mir ein: Hast du heute schon deinen Honig genommen?«
Yasid nickte unwillig. Von Geburt an waren er und seine Geschwister von Ama angehalten worden, jeden Morgen einen Löffel voll wilden, reinigenden Honigs zu schlucken.
»Wie können wir essen, bevor du das Abendgebet gesprochen hast?«
Sie sah ihn stirnrunzelnd an, um ihre Mißbilligung zu bekunden. Unvorstellbar, daß sie jemals ihr heiliges Ritual vergessen könnte! Gotteslästerung! Yasid grinste, und sie mußte ihn unwillkürlich anlächeln, als sie sich langsam erhob und zur Badestube begab, um ihre Waschungen vorzunehmen.
Yasid blieb unter dem Granatapfelbaum sitzen. Er liebte diese Tageszeit, wenn die Vögel sich geräuschvoll für die Nacht zurückzuziehen begannen. Die Kuckucke verkündigten emsig ihre letzten Botschaften. In einer Nische an der Außenmauer der Befestigungsanlage, die einen Ausblick auf den Vorhof und die Welt dahinter bot, gurrten die Tauben.
Plötzlich wechselte das Licht, und es wurde ganz still. Der tiefblaue Himmel hatte sich purpur-orange gefärbt und verzauberte die noch schneebedeckten Berggipfel. Yasid strengte seine Augen an, bemüht, den ersten Stern zu erblicken, aber noch war keiner zu sehen. Sollte er zum Turm eilen und durch das Vergrößerungsglas schauen? Und wenn der erste Stern erschien, während er noch die Treppe hinaufstieg? Yasid zog es vor, die Augen zu schließen. Es sah aus, als hätte der berauschende Duft von Jasmin seine Sinne überflutet wie Haschisch und ihn betäubt, doch in Wirklichkeit zählte er bis fünfhundert. Auf diese Weise pflegte er sich die Zeit zu vertreiben, bis der Polarstern erschien.
Des Muezzins Ruf zum Gebet unterbrach den Knaben. Ama kam mit ihrem Gebetsteppich herausgehumpelt, legte ihn in Richtung des Sonnenaufgangs aus und begann, ihre Gebete zu sprechen. Just als sie sich in Richtung der Ka’aba in Mekka niedergeworfen hatte, sah Yasid, daß Hutai’a, der Koch, auf dem gepflasterten Weg, der vom Innenhof zur Küche führte, heftig zu ihm hinüber gestikulierte.
»Was gibt es, Zwerg?«
Der Koch legte den Finger an die Lippen und gebot Schweigen. Der Knabe gehorchte. Einen Augenblick lang verharrten der zwergenhafte Koch und der Knabe wie erstarrt. Dann sagte der Koch: »Horch. Horch nur. Da. Kannst du es hören?«
Yasids Augen leuchteten auf. In der Ferne war das unmißverständliche Getrappel von Pferdehufen zu vernehmen, gefolgt vom Quietschen eines Wagens. Der Knabe lief aus dem Haus, den lauter werdenden Geräuschen entgegen. Der Himmel war unterdessen mit Sternen bedeckt, und Yasid sah, wie die Gefolgsleute und das Gesinde ihre Fackeln anzündeten, um die Familie zu empfangen. Von ferne hallte eine Stimme.
»Umar bin Abdallah ist zurück …«
Weitere Fackeln wurden entzündet, und Yasids Aufregung steigerte sich noch. Dann erblickte er drei Mann zu Pferde und rief:
»Abu! Abu! Suhayr! Beeilt euch. Ich bin hungrig.«
Da waren sie. Yasid mußte sich einen Irrtum eingestehen: Einer der drei Reiter war seine Schwester Hind. Suhayr saß, in eine Decke eingehüllt, bei seiner Mutter und der ältesten Schwester, Kulthum, im Wagen.
Umar bin Abdallah hob den Knaben hoch und umarmte ihn. »Ist mein Prinz brav gewesen?«
Yasid nickte, indes seine Mutter ihm das Gesicht mit Küssen bedeckte. Ehe die anderen sich an diesem Spiel beteiligen konnten, packte Hind ihn am Arm, und die zwei liefen ins Haus.
»Warum hast du Suhayrs Pferd geritten?«
Hinds Miene wurde starr, und sie zauderte einen Moment. Sie überlegte, ob sie ihm die Wahrheit sagen sollte, entschied sich aber dagegen, um Yasid nicht zu ängstigen. Besser als alle anderen in der Familie kannte sie die Phantasiewelt, in welche sich ihr jüngerer Bruder oft einspann.
»Hind! Was fehlt Suhayr?«
»Er hat Fieber bekommen.«
»Hoffentlich ist es nicht die Pest.«
Hind lachte laut auf. »Du hast wieder einmal zu sehr auf Amas Geschichten gehört, nicht wahr? Du Narr! Wenn sie von der Pest spricht, meint sie das Christentum. Und das ist nicht die Ursache von Suhayrs Fieber. Es ist nichts Ernstes. Er ist anfällig für den Wechsel der Jahreszeiten. Es ist ein Frühjahrsfieber. Komm, bade mit uns. Heute sind wir als erste an der Reihe.«
Yasid setzte eine empörte Miene auf.
»Ich habe schon gebadet. Außerdem sagt Ama, ich bin langsam zu alt, um mit den Frauen zu baden. Sie sagt …«
»Ich denke, Ama wird zu alt. Was für dummes Zeug sie doch schwätzt.«
»Sie sagt auch viele kluge Sachen, und sie weiß viel mehr als du, Hind.« Yasid hielt inne, um zu sehen, ob dieser Tadel einen Eindruck auf seine Schwester gemacht habe, doch sie schien ungerührt. Dann bemerkte er das Lächeln in ihren Augen, während sie ihm ihre linke Hand bot und rasch durch das Haus schritt. Yasid übersah ihre ausgestreckte Hand, ging aber an ihrer Seite, als sie den Hof durchquerte. Er trat mit ihr in das Badehaus.
»Ich nehme kein Bad, aber ich komme mit und unterhalte mich mit euch.«
Die Stube war voll von Dienerinnen, welche Yasids Mutter und Kulthum entkleideten. Yasid fragte sich, warum seine Mutter etwas beunruhigt schien. Vielleicht hatte die Reise sie ermüdet. Vielleicht war es Suhayrs Fieber. Er hörte zu denken auf, als Hind sich entkleidete. Ihre Leibdienerin eilte herbei, um die abgeworfenen Kleidungsstücke vom Fußboden aufzulesen. Die drei Frauen wurden mit den weichsten Schwämmen eingeseift und abgerieben, dann wurden Behälter mit sauberem Wasser über ihnen ausgegossen. Danach traten sie in das große Bad, das die Größe eines kleinen Teiches hatte. Der Bach, der durch das Haus floß, wurde durch Rohre geleitet, um die Bäder gleichmäßig mit frischem Wasser zu versorgen.
»Hast du es Yasid gesagt?« fragte die Mutter.
Hind schüttelte den Kopf.
»Was gesagt?«
Kulthum kicherte.
»Großonkel Miguel wünscht, daß Hind Juan heiratet!«
Yasid lachte. »Aber der ist so dick und häßlich.«
Hind kreischte vor Vergnügen. »Siehst du, Mutter! Das findet sogar Yasid. Juan hat einen Kürbis anstelle eines Hirns. Mutter, wie kann er bloß so dumm sein? Großonkel Miguel ist vielleicht widerlich, aber gewiß kein Narr. Wie konnte er nur diese Kreuzung zwischen einem Schwein und einem Schaf hervorbringen?«
»In diesen Dingen gibt es keine Gesetze, Kind.«
»Da bin ich nicht so sicher«, wandte Kulthum ein. »Es könnte eine Strafe Gottes sein, weil er Christ geworden ist!«
Hind prustete und drückte ihrer älteren Schwester den Kopf unter Wasser. Kulthum tauchte gutgelaunt auf. Sie hatte sich erst vor zwei Monaten verlobt, und man war übereingekommen, die Hochzeitsfeier und den Fortgang vom Elternhaus im ersten Monat des nächsten Jahres zu begehen. Sie konnte warten. Sie kannte Ibn Harith, ihren Verlobten, seit sie Kinder gewesen waren. Er war der Sohn des Vetters ihrer Mutter. Er liebte sie, seit sie sechzehn Jahre alt war. Sie wünschte, sie wären in Gharnata statt in Ischbiliya, doch das ließ sich nicht ändern. Sobald sie vermählt waren, wollte sie versuchen, ihn zu bewegen, näher zu ihrer Familie zu ziehen.
»Stinkt Juan auch so arg wie Großonkel Miguel?«
Yasids Frage blieb unbeantwortet. Seine Mutter klatschte in die Hände, und die Dienerinnen, die draußen gewartet hatten, traten mit Handtüchern und wohlriechenden Ölen ein. Nachdenklich sah Yasid zu, wie die drei Frauen abgetrocknet und gesalbt wurden. Draußen war Umars ungeduldig murmelnde Stimme zu vernehmen, und die Frauen verließen die Stube und gingen nach nebenan, wo ihre Kleider für sie bereit lagen. Yasid wollte ihnen folgen, seine Mutter aber schickte ihn mit Anweisungen für den Zwerg, das Essen anzurichten und in genau einer halben Stunde aufzutragen, in die Küche. Als er sich auf den Weg machte, flüsterte ihm Hind ins Ohr: »Juan stinkt sogar noch schlimmer als Miguel, dieser Stockfisch!«
»Da siehst du, Ama hat nicht immer unrecht!« rief der Knabe triumphierend und hüpfte aus der Stube.
In der Küche hatte der Zwerg einen Festschmaus zubereitet: Schließlich galt es, die unversehrte Heimkehr der Familie aus Gharnarta gebührend zu feiern. Der ganze Raum war erfüllt von den widersprüchlichsten Gerüchen, so daß nicht einmal Yasid, der ein großer Freund des Kochs war, auszumachen wußte, was das verwachsene Genie sich diesmal alles hatte einfallen lassen. In der Küche drängten sich Gesinde und Gefolgsleute, von denen einige mit Umar aus der großen Stadt zurückgekehrt waren. Sie redeten so aufgeregt, daß keiner von ihnen Yasid eintreten sah, ausgenommen der Zwerg, der ungefähr gleich groß war. Er eilte dem Knaben entgegen.
»Kannst du erraten, was ich gekocht habe?«
»Nein, aber warum sind alle so aufgeregt?«
»Soll das heißen, du weißt es nicht?«
»Was? Sag es mir augenblicklich, Zwerg. Ich bestehe darauf.«
Yasid hatte unversehens die Stimme gehoben und war auch von den übrigen bemerkt worden, woraufhin das Stimmengewirr verstummte, so daß nur das Brutzeln der Fleischbällchen in der großen Pfanne zu hören war. Der Zwerg sah den Knaben mit einem traurigen Lächeln an.
»Dein Bruder, Suhayr bin Umar …«
»Er hat doch nur leichtes Fieber. Oder ist es etwas anderes? Warum hat Hind es mir nicht gesagt? Was ist es, Zwerg? Du mußt es mir sagen.«
»Junger Herr. Ich kenne nicht alle Umstände, aber dein Bruder hat kein leichtes Fieber. Er wurde in der Stadt nach einer Auseinandersetzung mit einem Christen niedergestochen. Er ist außer Gefahr, es ist nur eine Fleischwunde, doch wird es einige Wochen dauern, bis er wieder gesund ist.«
Yasid vergaß seinen Auftrag und rannte aus der Küche über den Hof. Er wollte gerade in das Zimmer seines Bruders eintreten, als er von seinem Vater hochgehoben wurde.
»Suhayr schläft fest. Morgen kannst du mit ihm sprechen, soviel du magst.«
»Wer hat ihn niedergestochen, Abu? Wer? Wer hat es getan?« Yasid war bestürzt. Er stand Suhayr sehr nahe und hatte nun Gewissensbisse, weil er seinen Bruder vernachlässigt und die ganze Zeit mit Hind und den Frauen zugebracht hatte. Sein Vater suchte ihn zu beschwichtigen. »Es war ein nichtiger Vorfall. Beinahe ein Unfall. Ein Narr hat mich beleidigt, als ich gerade in das Haus deines Oheims eintreten wollte …«
»Womit?«
»Nichts von Bedeutung. Eine Lästerung, daß man uns bald zwingen werde, Schweinefleisch zu essen. Ich habe den Kerl nicht beachtet, aber Suhayr, impulsiv wie immer, schlug ihm ins Gesicht, worauf jener den Dolch zog, den er unter seinem Umhang verborgen hatte, und deinen Bruder unmittelbar unter die Schulter stach …«
»Und? Hast du den Schurken bestraft?«
»Nein, mein Sohn. Wir trugen deinen Bruder ins Haus und pflegten ihn.«
»Wo waren unsere Diener?«
»Bei uns, doch hatten sie strikte Anweisung von mir, keine Vergeltung zu üben.«
»Aber warum, Vater? Warum? Vielleicht hat Ama ja doch recht. Nichts wird von uns übrigbleiben als flüchtige Erinnerungen.«
»Wa Allah! Hat sie das wirklich gesagt?«
Yasid nickte unter Tränen. Umar fühlte, wie das Antlitz seines Sohnes sich benetzte, und er drückte ihn an sich. »Yasid bin Umar. Eine leichte Entscheidung gibt es nicht mehr für uns. Solche Schwierigkeiten hat es nicht gegeben, seit Tariq und Musa einst diese Länder besetzten. Und wie lange ist das her, weißt du das?«
Yasid nickte. »Es war in unserem ersten und ihrem achten Jahrhundert.«
»Genau, mein Kind, ganz genau. Es wird spät. Laß uns die Hände waschen und essen. Deine Mutter wartet.«
Ama, die am Rande des Hofes vor der Küche das ganze Gespräch schweigend mitangehört hatte, segnete Vater und Sohn im stillen, als sie ins Haus gingen. Dann wiegte sie sich hin und her, wobei sie ein seltsames Rasseln aus der Kehle ließ und eine Verwünschung ausspie.
»Ya Allah! Bewahre uns vor diesen verrückt gewordenen Hunden und Schweineessern. Beschütze uns vor diesen Feinden der Wahrheit, die so vom abtrünnigen Glauben geblendet sind, daß sie ihren Gott an ein Stück Holz nageln, ihn Vater, Mutter und Sohn nennen und ihre Anhänger in einem Meer aus Falschheit ertränken. Sie haben uns mit Gewalt unterdrückt, erniedrigt und vernichtet. Sei zehntausendmal gepriesen, o Allah, denn ich weiß, du wirst uns von der Herrschaft dieser Hunde befreien, welche in vielen Städten täglich ausrücken, um uns aus unseren Häusern zu zerren …«
Sie hätte diese Litanei wohl endlos fortgesetzt, wäre sie nicht von einer jungen Dienerin unterbrochen worden.
»Dein Essen wird kalt, Ama.«
Die alte Frau erhob sich langsam und folgte mit leicht gebeugtem Rücken der Magd in die Küche. Amas Stellung unter der Dienerschaft war eindeutig. Als Amme des Herrn, die von seiner Geburt an bei der Familie gewesen, war ihr Ansehen beim Gesinde unbestritten, nur löste das nicht alle Probleme des Protokolls. Abgesehen von dem ehrwürdigen Zwerg, der sich rühmte, der tüchtigste Küchenchef in al-Andalus zu sein, und der genau wußte, wie weit er gehen konnte, wenn er sich in Amas Gegenwart über die Familie ausließ, mieden die übrigen in ihrer Anwesenheit heikle Themen. Nicht, daß Ama eine Familienspionin gewesen wäre. Manchmal löste sie die Zunge, und die Dienerschaft staunte über ihre Verwegenheit, doch trotz solcher Vorkommnisse bereitete ihre Vertrautheit mit dem Herrn und den Söhnen dem übrigen Haushalt Unbehagen.
Tatsächlich stand Ama Yasids Mutter und ihren Erziehungsmethoden äußerst skeptisch gegenüber. Wann immer sie ihren Gedanken zu diesem Thema freien Lauf ließ, endete Ama in dem Gebet, der Herr möge sich eine neue Gemahlin nehmen. In ihren Augen war die Herrin des Hauses allzu nachsichtig mit ihrer Tochter, allzu großzügig zu den Bauern, die auf dem Gut arbeiteten, allzu duldsam mit den Bediensteten und ihren Lastern und gleichgültig in der Ausübung ihres Glaubens.
Gelegentlich ging Ama soweit, Umar bin Abdallah eine gemäßigte Version dieser Gedanken vorzutragen. Dabei unterstrich sie, daß es eben die Schwäche dieser Ordnung sei, welche den Islam in den traurigen Zustand gebracht habe, in welchem er sich gegenwärtig in al-Andalus befand. Umar lachte nur und wiederholte später seiner Gemahlin jedes Wort. Auch Subayda fand die Vorstellung belustigend, daß die Schwächen des al-Andalusischen Islams in ihrer Person verkörpert sein sollten.
Das Gelächter, das heute abend aus dem Speisezimmer drang, hatte nichts mit Ama oder ihrer Verschrobenheit zu tun. Die Scherze waren ein untrügliches Zeichen dafür, daß des Zwerges abendliche Speisenfolge den Beifall seiner Herrschaft gefunden hatte. An gewöhnlichen Tagen speiste die Familie bescheiden. Es gab meistens nicht mehr als vier verschiedene Gerichte und einen Teller mit Naschwerk, gefolgt von frischem Obst. Heute abend aber hatte man einen scharf gewürzten und duftenden Lammbraten aufgetragen, Kaninchen, mit roten Pfefferschoten und ganzen Knoblauchzehen in gegorenem Traubensaft gegart, Fleischbällchen, gefüllt mit braunen Trüffeln, die buchstäblich im Munde zergingen, eine festere Sorte Fleischbällchen, in Korianderöl gebraten und mit dreieckigen Stücken Chilipaste serviert, die in demselben Öl gebraten war, ein großes Gefäß voll Knochen, die in einer mit Safran gefärbten Soße schwammen, eine große Schüssel gerösteten Reis, winzige gefüllte Blätterteigpastetchen und drei verschiedene Salate, Spargel, eine Mischung aus fein geschnittenen Zwiebeln, Tomaten, Gurken, mit Kräutern und dem Saft frischer Zitronen besprenkelt, Kichererbsen, in Joghurt getränkt und mit Pfeffer bestreut.
Das Gelächter hatte Yasid ausgelöst, als er versuchte, das Mark aus einem Knochen zu saugen, und es versehentlich seinem Vater in den Bart blies. Hind klatschte in die Hände, und zwei Dienerinnen traten ein. Die Mutter bat sie, den Tisch abzuräumen und die reichliche Menge übriggebliebener Speisen unter sich zu verteilen.
»Und sagt dem Zwerg, wir werden heute abend nicht von seinem Naschwerk oder den Käseplätzchen kosten. Tragt nur das Zuckerrohr auf. Ist es auch in Rosenwasser getunkt? Sputet euch. Sonst wird es zu spät.«
Es war bereits zu spät, jedenfalls für den kleinen Yasid, der, an das Bodenpolster gelehnt, eingeschlafen war. Ama, die dies geahnt hatte, kam herein, legte den Finger an die Lippen, um darauf hinzuweisen, daß Schweigen geboten sei, und bedeutete den übrigen durch Zeichen, daß Yasid fest schlief. Leider war sie inzwischen zu alt, um ihn noch hochzuheben. Der Gedanke stimmte sie traurig. Umar spürte instinktiv, was seine alte Amme bewegte. Er dachte an seine eigene Kindheit zurück: Ama hatte kaum zugelassen, daß seine Füße den Boden berührten, und seine Mutter war besorgt gewesen, er würde womöglich nie laufen lernen. Umar erhob sich, nahm seinen Sohn sacht hoch und trug ihn in seine Schlafkammer, gefolgt von Ama, die ein triumphierendes Lächeln aufgesetzt hatte. Sie kleidete den Knaben aus, brachte ihn zu Bett und vergewisserte sich, daß er fest zugedeckt war.
Umar war in nachdenklicher Stimmung, als er sich zu Frau und Töchtern gesellte, um ein paar Scheiben Zuckerrohr zu sich zu nehmen. Die Erinnerung, wie Ama ihn vor so vielen Jahren aufgehoben und zu Bett gebracht hatte, bewog ihn auf seltsame Weise, wieder einmal nachzusinnen über das endzeitliche Gepräge des Jahres, das eben erst begonnen hatte. Endzeitlich nämlich für die Banu Hudayl und ihre Lebensweise. Endzeitlich wahrhaftig für den Islam in al-Andalus.
Subayda, die seine Stimmung spürte, bemühte sich, seine Gedanken zu erraten.
»Mein Gebieter, beantworte mir eine Frage.«
Von der Stimme abgelenkt, sah er sie an und lächelte abwesend.
»Was ist in Zeiten wie diesen die wichtigste Überlegung? Hier zu überleben, so gut wir es vermögen, oder die letzten fünfhundert Jahre unseres Daseins zu überdenken und danach unsere Zukunft zu planen?«
»Die genaue Antwort weiß ich noch nicht.«
»Aber ich«, warf Hind ein.
»Dessen bin ich sicher«, erwiderte ihr Vater, »aber die Stunde ist fortgeschritten. Wir können unsere Diskussion ein andermal fortsetzen.«
»Die Zeit ist gegen uns, Vater.«
»Auch dessen bin ich sicher, mein Kind.«
»Friede sei mit dir, Vater.«
»Seid gesegnet, meine Töchter. Schlaft wohl.«
»Bleibst du noch lange auf?« fragte Subayda.
»Nur ein paar Minuten. Ich muß ein wenig frische Luft schöpfen.«
Nachdem sie gegangen waren, blieb Umar noch wenige Minuten sitzen und starrte, in seine Betrachtungen vertieft, auf die leere Tafel. Dann erhob er sich, legte sich eine Decke um die Schultern und trat in den Innenhof hinaus. Die frische Luft ließ ihn leicht frösteln, obgleich es nicht kühl war, und er raffte die Decke enger um sich, indes er auf und ab wanderte.
Drinnen wurden die Fackeln gelöscht, und er mußte seine Schritte bei Sternenlicht bemessen. Das einzige Geräusch kam von dem Bach, der in einer Ecke in den Hof hineinfloß, den Brunnen in der Mitte speiste, um dann am anderen Ende des Hofes wieder hinauszufließen. In glücklicheren Tagen hätte Umar die schwerduftenden Blüten von den Jasminsträuchern gepflückt, sie vorsichtig in ein Musselintüchlein gebettet, sie mit Wasser besprengt, um sie frisch zu halten, und neben Subaydas Kissen gelegt. Am nächsten Morgen wären sie noch frisch und duftend gewesen. Heute abend waren ihm solche Gedanken fern.
Umar bin Abdallah dachte nach, und die immer wiederkehrenden Bilder waren so mächtig, daß sie ihn vorübergehend am ganzen Leibe erzittern ließen. Er sah im Geiste die Flammenwand vor sich. Erinnerungen an jene kalte Nacht kamen zurückgeströmt. Unwillkürlich traten ihm Tränen in die Augen, sie näßten sein Gesicht und fingen sich in seinem Bart. Der Fall Gharnatas vor acht Jahren hatte die Reconquista abgeschlossen. Damit hatte man immer rechnen müssen, und weder Umar noch seine Freunde waren besonders überrascht gewesen. Aber in den Kapitulationsbedingungen war den Gläubigen, welche eine Mehrheit der Bürgerschaft ausmachten, kulturelle und religiöse Freiheit versprochen worden, sofern sie die Oberhoheit der kastilischen Herrscher anerkannten. Es war schriftlich und im Beisein von Zeugen festgelegt worden, daß die Muselmanen von Gharnata nicht verfolgt oder an der Ausübung ihrer Religion, am Sprechen und Lehren des Arabischen sowie am Feiern ihrer Feste gehindert würden. Ja, dachte Umar, das haben Isabellas Prälaten gelobt, um einen Bürgerkrieg zu vermeiden. Und wir haben ihnen geglaubt. Wie blind wir waren! Unser Hirn muß von Alkohol vergiftet gewesen sein. Wie haben wir ihren schönen Worten und Versprechungen glauben können?
Als einflußreicher Edelmann des Königreiches war Umar bei der Unterzeichnung des Kontraktes zugegen gewesen. Nie würde er das letzte Lebewohl des letzten Sultans Abu Abdullah vergessen, welchen die Kastilen Boabdil nannten, als dieser sich in die al-Pudjarras ins marokkanische Exil begab, wo ihn ein Palast erwartete. Der Sultan hatte sich umgedreht und ein letztes Mal auf die Stadt geblickt, er hatte zur al-Hamra hingelächelt und geseufzt. Das war alles gewesen. Nichts wurde gesprochen. Was gab es zu sagen? Sie waren am Endpunkt ihrer Geschichte in al-Andalus angelangt. Sie hatten sich mit den Augen verständigt. Umar und seine Gefährten unter den Edelleuten waren bereit, diese Niederlage hinzunehmen. War die islamische Geschichte denn nicht, wie Subayda ihn unaufhörlich erinnerte, ein ständiger Aufstieg und Niedergang von Königreichen? War nicht sogar Bagdad an ein Heer von ungebildeten Tataren gefallen? Der Fluch der Wüste. Nomadenverhängnis. Die Grausamkeit des Schicksals. Die Worte des Propheten. Der Islam ist entweder universal, oder er ist nichts.
Plötzlich sah Umar die hageren Gesichtszüge seines Oheims vor sich. Sein Oheim! Meekal al-Malek. Sein Oheim! Der Bischof von Qurtuba. Miguel el Malek. Das hagere Gesicht, dessen stets präsenten Schmerz weder der Bart noch das falsche Lächeln zu verbergen mochten. Immer wenn Ama Geschichten von Meekal als Knabe erzählte, kam unweigerlich die Formulierung »er hatte den Teufel im Leib« oder »er benahm sich wie ein Spundhahn, der von Satan auf- und zugedreht wird«. Dies wurde stets in liebevollem Ton geäußert, um darauf hinzuweisen, was für ein ungezogenes Kind Meekal gewesen war. Der jüngste und bevorzugte Sohn, Yasid nicht unähnlich. Wie hatte das geschehen können? Was war Meekal widerfahren, das ihn zwang, sich eilends nach Qurtuba zu begeben und Miguel zu werden?
Die spöttische Stimme des alten Oheims hallte noch in Umars Kopf nach. »Weißt du, was das Mißliche mit unserer Religion ist, Umar? Sie hat es uns zu leicht gemacht. Die Christen mußten sich in die Poren des römischen Reiches einnisten. Das zwang sie, im Untergrund zu wirken. Die Katakomben von Rom waren ihr Übungsgelände. Als sie schließlich siegten, hatten sie schon einen starken gesellschaftlichen Zusammenhalt unter ihren Leuten erreicht. Wir? Der Prophet, Friede sei mit ihm, sandte Chalid bin Walid mit seinem Schwert, und er eroberte. O ja, und wie er eroberte! Wir haben zwei Imperien vernichtet. Alles fiel uns in den Schoß. Wir haben die arabischen Länder, Persien und Teile des byzantinischen Reiches eingenommen. Anderswo war es schwierig, nicht wahr? Sieh uns an. Wir sind seit siebenhundert Jahren in al-Andalus, und dennoch konnten wir nichts erreichen, das von Dauer gewesen wäre. Es sind nicht nur die Christen, nicht wahr, Umar? Der Fehler steckt in uns selbst. In unserem Blut.«
Ja, ja, Onkel Meekal, ich meine, Miguel. Der Fehler steckt auch in uns selbst, aber wie kann ich jetzt nur daran denken? Ich sehe nichts als jene Flammenwand und dahinter das hämische Gesicht dieses Geiers, der seinen Triumph feiert. Der Fluch von Jimenez! Dieser vermaledeite Mönch, der auf ausdrückliche Anweisungen Isabellas nach Gharnata geschickt wurde. Der Beichtvater der Teufelin, hierhergesandt, um für sie die Dämonen auszutreiben. Sie muß ihn gut gekannt haben. Er wußte zweifellos, was sie wollte. Hörst du nicht ihre Stimme? Pater, flüstert sie mit ihrem Tonfall falscher Frömmigkeit, Pater, die Ungläubigen in Gharnata beunruhigen mich. Manchmal drängt es mich, sie durch Kreuzigen zu unterwerfen, auf daß sie auf den Pfad der Rechtschaffenheit gelangen können. Warum hat sie ihren Jimenez nach Gharnata geschickt? Wenn sie sich der Überlegenheit ihres Glaubens so gewiß sind, warum vertrauen sie dann nicht auf das endgültige Urteil der Gläubigen?
Hast du vergessen, warum sie Jimenez de Cisneros nach Gharnata geschickt haben? Weil sie vermuteten, Erzbischof Talavera würde die Dinge nicht richtig handhaben. Talavera wollte uns mit Argumenten gewinnen. Er hat Arabisch gelernt, um unsere Lehrbücher zu lesen. Er riet seiner Geistlichkeit, es ihm gleichzutun. Er übersetzte ihre Bibel und ihren Katechismus ins Arabische. Einige unserer Brüder ließen sich auf diese Weise gewinnen, aber nicht viele. Deswegen haben sie Jimenez geschickt. Ich habe es dir erst letztes Jahr erläutert, mein bischöflicher Oheim, nur hast du es schon vergessen. Was hättest du gemacht, wenn sie wirklich schlau gewesen wären und dich zum Erzbischof von Gharnata ernannt hätten? Wie weit wärest du gegangen, Meekal? Wie weit, Miguel?
Ich war bei der Versammlung zugegen, als Jimenez unsere wadis und Gelehrten im theologischen Disput zu gewinnen trachtete. Du hättest dabeisein sollen. Ein Teil von dir wäre stolz auf unsere Leute gewesen. Jimenez ist klug, doch an jenem Tag war ihm kein Erfolg beschieden.
Als Segri bin Musa Punkt für Punkt erwiderte und ihm sogar einige von Jimenez’ Geistlichen Beifall zollten, verlor der Prälat die Beherrschung. Er behauptete, Segri habe die Jungfrau Maria beleidigt, dabei hatte unser Freund lediglich gefragt, wie sie nach der Geburt Isas habe Jungfrau bleiben können. Du wirst doch einsehen, daß die Frage einer gewissen Logik folgte, oder hindert deine Theologie dich, alle bekannten Fakten anzuerkennen?
Unser Segri wurde in die Folterkammer gebracht und so lange gemartert, bis er sich schließlich bereit erklärte zu konvertieren. Zu diesem Zeitpunkt brachen wir auf, aber zuvor sah ich noch das Glitzern in Jimenez’ Augen, als habe er in diesem Moment erkannt, daß dies das einzige Mittel sei, die Einwohner zu bekehren.
Am nächsten Tag wurde die gesamte Einwohnerschaft hinaus auf die Straßen befohlen. Jimenez de Cisneros, möge Allah ihn strafen, erklärte unserer Kultur und Lebensweise den Krieg. Allein an jenem Tag räumten sie unsere sämtlichen Bibliotheken leer und errichteten am Bab al-Ramla einen massiven Wall aus Büchern. Sie ließen unsere Kultur in Flammen aufgehen. Sie verbrannten zwei Millionen Handschriften. Die Aufzeichnungen von acht Jahrhunderten wurden an einem einzigen Tag vernichtet. Nicht alles haben sie verbrannt. Sie waren schließlich keine Barbaren, sondern die Träger einer anderen Kultur, die sie in al-Andalus ansiedeln wollten. Ihre eigenen Ärzte verwendeten sich dafür, dreihundert Handschriften zu verschonen, die sich hauptsächlich mit der Heilkunst befaßten. Jimenez war einverstanden, weil sogar er wußte, daß unsere Kenntnisse der Heilkunst weit fortgeschrittener waren als alles, was man im Christentum darüber weiß.
Diese Flammenwand sehe ich jetzt immer vor mir, Oheim. Sie erfüllt mein Herz mit Angst um unsere Zukunft. Das Feuer, das unsere Bücher verschlang, wird eines Tages alles vernichten, was wir in al-Andalus geschaffen haben, einschließlich dieses Dorfes, das unsere Vorfahren erbauten, wo du und ich als kleine Knaben gespielt haben. Was hat dies alles mit den mühelosen Siegen unseres Propheten zu tun und mit der unaufhaltsamen Verbreitung unserer Religion? Das war vor achthundert Jahren, Bischof. Der Bücherwall wurde erst letztes Jahr in Brand gesetzt.
Zufrieden, daß er den Disput gewonnen hatte, kehrte Umar bin Abdallah ins Haus zurück und trat in das Schlafgemach seiner Gemahlin. Subayda war noch nicht zu Bett gegangen.
»Die Flammenwand, Umar?«
Er setzte sich auf die Bettstatt und nickte. Seine Gemahlin befühlte seine Schultern und schreckte zurück. »Die Spannung in deinem Leib schmerzt mich. Komm, lege dich nieder, und ich werde sie aus dir herauskneten.«
Umar tat, wie ihm geheißen, und ihre Hände, die in dieser Kunst geübt waren, ertasteten die Stellen an seinem Körper. Sie waren hart wie kleine Kieselsteine, und ihre Finger massierten sie rundherum, bis sie sich aufzulösen begannen und sie fühlte, daß die verspannten Partien wieder locker wurden.
»Wann wirst du Miguel wegen Hind antworten?«
»Was sagt das Mädchen?«
»Sie würde sich eher mit einem Pferd vermählen.«
Umars Stimmung schlug unvermittelt um. Er brüllte vor Lachen. »Sie hatte schon immer einen guten Geschmack. Da hast du deine Antwort.«
»Aber was wirst du seiner bischöflichen Exzellenz sagen?«
»Ich werde Onkel Miguel sagen, der einzig sichere Weg für Juan, eine Bettgefährtin zu finden, ist, Priester zu werden und sich des Beichtstuhls zu bedienen!«
Subayda kicherte erleichtert. Umars gute Laune war wiederhergestellt. Bald würde er wieder der alte sein. Sie irrte sich. Der Bücherwall brannte noch immer.
»Ich bin nicht sicher, daß sie uns in al-Andalus leben lassen werden, ohne daß wir zum Christentum übertreten. Daß Hind Juan heiratet, ist ein Witz, aber was mir große Sorgen bereitet, das ist die Zukunft der Banu Hudayl, all derjenigen, die seit Jahrhunderten bei uns gelebt, für uns gearbeitet haben.«
»Niemand weiß besser als du, daß ich keine fromme Frau bin. Deine abergläubische alte Amme weiß das nur zu gut. Sie erzählt unserem Yasid, seine Mutter sei eine Gotteslästerin, obgleich ich den Schein wahre. Ich faste im Ramadan. Ich …«
»Wir wissen doch alle, daß du nur fastest und betest, um deine Figur zu bewahren. Das ist wahrlich kein Geheimnis.«
»Mach dich nur lustig über mich. Vor allem aber geht es um das Wohlergehen unserer Kinder. Und doch …«
Umar war wieder ernst geworden. »Ja?«
»Und doch lehnt sich etwas in mir auf gegen die Konvertierung. Ich werde aufgewühlt, ja hitzig, wenn ich nur daran denke. Lieber würde ich sterben, als mich zu bekreuzigen und so zu tun, als würde ich Menschenfleisch essen und Menschenblut trinken. Der Kannibalismus in ihren Riten stößt mich ab. Der sitzt sehr tief. Erinnere dich an das Entsetzen der Sarazenen, als die Kreuzritter anfingen, Gefangene bei lebendigem Leibe zu braten und ihr Fleisch zu essen. Es macht mich krank, wenn ich nur daran denke, aber es ist in ihrem Glauben verankert.«