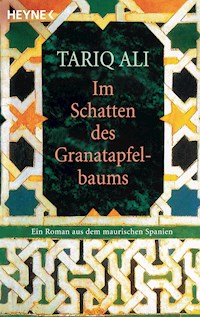5,99 €
1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
Eine mitreißende und farbenprächtige Reise durch den Orient: Der historische Roman »Im Schatten der Akazie« von Tariq Ali jetzt als eBook bei dotbooks. Über dem 12. Jahrhundert liegt ein dunkler Schatten: Abendland und Morgenland sind erbitterte Feinde, die Hoffnung auf Frieden scheint unmöglich. Doch Saladin, Sohn eines muslimischen Diplomaten, träumt von einer Welt, in der Weisheit und Verständnis regieren. Um seine kühnen Pläne zu verwirklichen, kämpft er sich Stufe für Stufe empor, verstrickt sich dabei aber in einem Netz aus Intrigen und tödlichen Leidenschaften, das ihn fast das Leben kostet. Saladins Stunde scheint gekommen zu sein, als er nach Jerusalem gelangt – eisern entschlossen, die Heilige Stadt vom Joch der Kreuzritter zu befreien. Doch welchen Preis ist er bereit, für eine bessere Welt zu bezahlen? Was, wenn er dafür alles verraten muss, woran er glaubt … und alle, die er liebt? Mit märchenhafter Sprachkunst haucht Tariq Ali der schillerndsten Figur des Orients neues Leben ein: »So einfallsreich und fantastisch wie die Geschichten aus Tausendundeiner Nacht« The Times »Sprachgewaltig werden politische Intrigen, Liebe, Verrat, Mord und Verbrechen der Leidenschaft verwebt.« Publishers Weekly Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der Orient-Roman »Im Schatten der Akazie« von Bestseller-Autor Tariq Ali, vorab erschienen unter dem Titel »Das Buch Saladin«. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 612
Ähnliche
Über dieses Buch:
Über dem 12. Jahrhundert liegt ein dunkler Schatten: Abendland und Morgenland sind erbitterte Feinde, die Hoffnung auf Frieden scheint unmöglich. Doch Saladin, Sohn eines muslimischen Diplomaten, träumt von einer Welt, in der Weisheit und Verständnis regieren. Um seine kühnen Pläne zu verwirklichen, kämpft er sich Stufe für Stufe empor, verstrickt sich dabei aber in einem Netz aus Intrigen und tödlichen Leidenschaften, das ihn fast das Leben kostet. Saladins Stunde scheint gekommen zu sein, als er nach Jerusalem gelangt – eisern entschlossen, die Heilige Stadt vom Joch der Kreuzritter zu befreien. Doch welchen Preis ist er bereit, für eine bessere Welt zu bezahlen? Was, wenn er dafür alles verraten muss, woran er glaubt … und alle, die er liebt?
Mit märchenhafter Sprachkunst haucht Tariq Ali der schillerndsten Figur des Orients neues Leben ein: »So einfallsreich und fantastisch wie die Geschichten aus Tausendundeiner Nacht« The Times
»Sprachgewaltig werden politische Intrigen, Liebe, Verrat, Mord und Verbrechen der Leidenschaft verwebt.« Publishers Weekly
Über den Autor:
Tariq Ali wurde 1943 in Lahore/Pakistan geboren. Als 20-Jähriger emigrierte er nach London, wo er Politik und Philosophie studierte und Ende der 60er-Jahre zum Führer der englischen Studentenbewegung wurde. Heute arbeitet er als Schriftsteller, Filmemacher und Journalist. Er veröffentlichte zahlreiche Bücher zur Weltgeschichte und -politik, Bühnenstücke und Drehbücher, bevor ihm mit seinem ersten historischen Roman »Im Schatten des Granatapfelbaums« direkt der Sprung auf die Bestsellerlisten gelang.
Bei dotbooks veröffentlichte Tariq Ali auch seine Orient-Romane »Das Flüstern des Orangenbaums«, »Die Gärten von Marmara« und »Die Nacht des goldenen Schmetterlings«.
***
eBook-Neuausgabe Juni 2020
Dieses Buch erschien erstmals 1998 unter dem Originaltitel »The Book of Saladin« bei Verso, London. Die deutsche Erstausgabe erschien 1998 unter dem Titel »Das Buch Saladin« im Eugen Diederichs Verlag.
Copyright © der englischen Originalausgabe 1998 by Tariq Ali
Copyright © der deutschen Erstausgabe 1998 by Eugen Diederichs Verlag, München
Copyright © der Neuausgabe 2020 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von Bildmotiven von shutterstock/Anna Poguliaeva, PIGAMA, Repina Valeriya
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (tw)
ISBN 978-3-96148-899-5
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Im Schatten der Akazie« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Tariq Ali
Im Schatten der Akazie
Roman
Aus dem Englischen von Petra Hrabak, Gerlinde Schermer-Rauwolf und Robert A. Weiß
dotbooks.
Für Robin Blackburn
Teil 1Kairo
Kapitel 1
Auf Ibn Maymuns Empfehlung hin werde ich Salah al-Dins ergebener Schreiber.
Viele Jahre lang habe ich nun nicht mehr an unser ehemaliges Zuhause gedacht. Seit dem Feuer ist viel Zeit vergangen. Mein Haus, meine Frau, meine Tochter, mein zweijähriger Enkelsohn: sie alle waren darin gefangen wie Tiere im Käfig. Hätte das Schicksal nicht etwas anderes mit mir im Sinn gehabt, wäre auch von mir nur Asche übriggeblieben. Wie oft habe ich mir gewünscht, ich hätte in jener schweren Stunde an der Seite meiner Lieben sein und dieses Martyrium mit ihnen teilen können.
Es sind schmerzliche Erinnerungen, die ich tief in mir begraben habe. Doch heute, da ich diese Geschichte zu schreiben beginne, steht mir jener kuppelüberwölbte Raum, in dem einst alles seinen Anfang nahm, wieder deutlich vor Augen. Die Tiefen unseres Gedächtnisses sind unergründlich, längst vergessene Dinge bleiben in dunklen Nischen verborgen und treten dann plötzlich zutage. Nun sehe ich alles so klar vor mir, als wäre die Zeit stehengeblieben.
Es war eine kalte Winternacht in el-Cairo, im Jahr 1181 nach der christlichen Zeitrechnung. Von den Straßen draußen drang nur das Miauen der Katzen herein. Ibn Maymun, ein alter Freund unserer Familie und deren selbsternannter Arzt, war nach einem Besuch beim Kadi al-Fadil, der seit einigen Tagen unpäßlich war, zu mir nach Hause gekommen.
Wir hatten unser Mahl beendet und tranken schweigend unseren Minztee, umgeben von dicken farbenprächtigen Wollteppichen und Kissen aus Seide und Satin. Die Glut der wohlgefüllten, kreisrunden Kohlenpfanne inmitten des Raumes verbreitete ihre Wärme in sanften Wellen. Auf dem Boden liegend, sahen wir den Widerschein des Feuers in der Kuppel über uns, die wie ein heller Sternenhimmel leuchtete.
Ich sann über unser soeben beendetes Gespräch nach. Mein Freund hatte einen ärgerlichen und bitteren Wesenszug offenbart, was mich überraschte wie auch beruhigte. Unser Heiliger war auch nur ein Mensch wie jeder andere. Und die Maske setzte er für die Außenstehenden auf.
Wir hatten über die Umstände gesprochen, die Ibn Maymun zur Flucht aus al-Andalus gezwungen hatten, mit der seine fünfzehn Jahre währende Reise von Kurtuba nach el-Cairo begonnen hatte. Zehn Jahre davon hatte er in der maghrebinischen Stadt Fes verbracht. Dort hatten sich alle Angehörigen seiner Familie genötigt gesehen, sich als Anhänger des islamischen Propheten auszugeben. Ibn Maymun dachte voller Groll daran zurück. Was ihn erzürnte, war der Betrug als solcher, denn Heuchelei widersprach seiner Natur.
Noch nie zuvor hatte ich ihn derart reden gehört. Mir fiel auf, welche Veränderung damit einherging: Seine Augen funkelten bei jedem Wort, seine Hand war zur Faust geballt. Ich fragte mich, ob diese Erfahrung der Grund für seine Vorbehalte gegen die Religion war, vornehmlich gegen eine Religion, die Macht besaß, und gegen einen Glauben, der mit dem blanken Schwert aufgezwungen wurde. Schließlich brach ich das Schweigen.
»Ist denn eine Welt ohne Religion denkbar, Ibn Maymun? Die Ahnen kannten viele Götter. Einst kämpften die Anhänger des einen Gottes gegen diejenigen eines anderen Gottes. Jetzt haben wir einen einzigen Gott und müssen uns zwangsläufig um ihn streiten. So ist alles ein Krieg um die Auslegungen geworden. Wie erklärst du dir mit deiner Anschauung dieses Phänomen?«
Er lächelte, doch ehe er antworten konnte, hörten wir ein lautes Klopfen an der Tür. Ibn Maymun runzelte die Stirn.
»Erwartest du jemand?«
Ich schüttelte den Kopf, indes er sich vorbeugte, um sich die Hände an der Kohlenpfanne zu wärmen. Obwohl wir uns beide in Wolldecken gewickelt hatten, spürten wir dennoch die Kälte. Mein Gefühl sagte mir, daß dieses spätabendliche Klopfen an der Tür meinem Freund galt.
»Nur der Gefolgsmann eines mächtigen Mannes klopft in dieser Weise«, seufzte Ibn Maymun. »Vielleicht geht es dem Kadi schlechter, und ich muß zu ihm.«
Ein zitternder Diener betrat mit einer Fackel in der Hand den Raum. Ihm folgte ein Mann von mittlerer Größe mit unauffälligen Gesichtszügen und rötlichem Haar. Er war in eine Decke gehüllt und zog das rechte Bein ein wenig nach. Einen Moment lang flackerte Angst in Ibn Maymuns Augen auf, als er sich erhob und vor dem Gast verbeugte. Ich hatte den Mann noch nie gesehen. Der Kadi war es gewiß nicht, denn diesen kannte ich.
Auch ich stand auf und verneigte mich vor dem Fremden. Als er bemerkte, daß er mir völlig unbekannt war, lächelte er.
»Entschuldigt die Störung zu dieser Stunde. Der Kadi hat mir berichtet, daß Ibn Maymun sich in unserer Stadt aufhält und in Eurem erlauchten Haus nächtigt. Ich befinde mich doch im Haus von Isaac Ibn Yakub, nicht wahr?«
Ich nickte.
»Ich hoffe«, sagte der Fremde mit einer leichten Verbeugung, »Ihr verzeiht mir meinen unangemeldeten Besuch. Doch mir ist nicht oft die Gelegenheit vergönnt, zwei große Gelehrte an einem Tag zu treffen. Eine Weile war ich unentschlossen, ob ich es vorziehen sollte, früh schlafen zu gehen oder ein Gespräch mit Ibn Maymun zu führen. Schließlich entschied ich, daß seine Worte einen günstigeren Einfluß auf mich haben könnten als Schlaf. Und deshalb bin ich hier.«
»Jeder Freund von Ibn Maymun ist in diesem Haus willkommen. Bitte nehmt Platz. Dürfen wir Euch eine Schale Suppe anbieten?«
»Ich denke, sie würde Eurer Gesundheit guttun, Herrscher der Tapferen«, meinte Ibn Maymun leise.
Da erkannte ich, daß ich mich in Gegenwart des Sultans befand. Dies war Yussef Salah al-Din höchstpersönlich. In meinem Haus. Ich fiel auf die Knie und berührte seine Füße.
»Verzeiht, daß ich Eure Hoheit nicht erkannt habe. Euer Sklave bittet um Vergebung.«
Er lachte und half mir wieder auf die Beine.
»Ich mache mir nicht viel aus Sklaven. Sie neigen zu sehr zur Aufsässigkeit. Doch für etwas Suppe wäre ich Euch dankbar.«
Nachdem er seine Suppe gegessen hatte, fragte er mich nach der Herkunft der irdenen Schalen, in denen sie gereicht wurde.
»Sind sie nicht aus dem roten Ton Armeniens gemacht?«
Überrascht nickte ich.
»Meine Großmutter besaß ganz ähnliche, aber sie hat sie nur bei Hochzeiten und Begräbnissen auf die Tafel gebracht. Sie erzählte mir immer, sie stammten aus ihrem Dorf in den armenischen Bergen.«
Nachdem das Gespräch noch eine Zeitlang in diesem allgemeinen Stil weitergelaufen war, erklärte der Sultan Ibn Maymun, daß er einen vertrauenswürdigen Schreiber in seine Dienste nehmen wolle. Er brauche jemanden, dem er seine Lebenserinnerungen diktieren könne. Sein eigener Sekretär sei zu sehr in Intrigen verschiedenster Art verwickelt, weshalb er ihm nicht rückhaltlos vertrauen könne. Dieser Mann sei durchaus imstande, den Sinn der Worte zu verdrehen, um später einen persönlichen Vorteil daraus zu ziehen.
»Ihr wißt wohl, mein Freund«, sagte der Sultan, während er Ibn Maymun direkt in die Augen sah, »daß es Zeiten gibt, in denen uns in jeder Minute Gefahr für Leib und Leben droht. Wir sind von Feinden umzingelt und haben keine Zeit, an irgend etwas anderes als ans Überleben zu denken. Nur wenn Frieden herrscht, kann man sich den Luxus leisten, in Ruhe seinen Gedanken nachzuhängen.«
»So wie jetzt?«
»So wie jetzt«, murmelte der Sultan. »Ich brauche jemand, dem ich vertrauen kann. Und der nicht davor zurückschreckt, die Wahrheit offenzulegen, wenn ich zu Staub geworden bin.«
»Ich kenne jemanden von dem Schlag, den Eure Hoheit sucht«, erwiderte Ibn Maymun. »Aber Euer Wunsch birgt eine Schwierigkeit. Ihr seid nie allzu lange in einer Stadt. Entweder müßte der Schreiber mit Euch reisen, oder es gälte, einen zweiten in Damaskus zu finden.«
Der Sultan lächelte.
»Warum nicht? Mich lockt noch eine dritte Stadt. Ich hoffe, daß ich in Kürze Jerusalem einen Besuch abstatten werde. Also brauchen wir vielleicht drei Schreiber, einen in jeder Stadt. Da ich für meine Worte verantwortlich bin, werde ich dafür Sorge tragen, mich nicht zu wiederholen.«
Meinem Freund und mir verschlug es den Atem. Wir konnten unsere Erregung kaum verbergen, sehr zur Freude unseres hohen Gastes. Denn Jerusalem war von den Franken besetzt, die selbstzufrieden und überheblich geworden waren. Und gerade eben, in meinem Haus, hatte der Sultan verkündet, daß er den Feind zu vertreiben gedachte.
Seit vielen Jahren lagen wir, die wir schon immer hier gelebt hatten, mit den Franken, die übers Meer gekommen waren, im Zwist. 1099 war Jerusalem an sie gefallen. Sie hatten die alte Stadt geplündert und zerstört und ein Blutbad unter den Juden und Muslimen angerichtet. Dort waren die Barbaren gewalttätiger über unsere Welt hereingebrochen als in den Küstenstädten. Kein Jude und kein Muslim hatte das Massaker überlebt. Überall in den Moscheen und Synagogen waren die Gläubigen entsetzt aufgesprungen, als die Kunde von diesen Greueltaten durchs Land ging. Sie verfluchten die Barbaren aus dem Westen und schworen, ihre Schandtaten zu rächen. Vielleicht war jetzt die Zeit gekommen. Vielleicht war die stille Zuversicht dieses Mannes gerechtfertigt. Mein Herz schlug schneller.
»Mein Freund Ibn Yakub, dessen Haus Eure Hoheit heute mit ihrer Anwesenheit beehrt, ist einer der verläßlichsten Gelehrten unserer Gemeinschaft. Ich kenne keinen, der sich besser zu Eurem Schreiber eignen würde. Und seine Lippen werden wie versiegelt sein.«
Der Sultan musterte mich eingehend.
»Seid Ihr einverstanden?«
»Ich stehe zu Euren Diensten, Herrscher der Getreuen. Unter einer Bedingung.«
»Sprecht.«
»Ich habe so manches Buch über die Könige aus den alten Zeiten gelesen. Für gewöhnlich wird der Herrscher als Gott oder als Teufel dargestellt, je nachdem, ob die Schilderung aus der Feder eines Höflings oder eines Feindes stammt. Bücher dieser Art sind wertlos. Wenn Wahrheit und Unwahrheit eng umschlungen beieinander liegen, ist es schwer, sie auseinanderzuhalten. Deshalb bitte ich Eure Hoheit um die Erlaubnis, Fragen stellen zu dürfen, die mir die Bedeutung eines bestimmten Abschnittes Eures Lebens klarer vor Augen führen. Es mag vielleicht nicht als nötig erscheinen, aber wir alle wissen, wie viele Pflichten auf Euren Schultern ruhen, und ...«
Lachend unterbrach er mich.
»Ihr dürft fragen, was immer Ihr wollt. Dieses Vorrecht sei Euch gewährt. Aber es ist mein Vorrecht, nicht immer antworten zu müssen.«
Ich verneigte mich.
»Da Ihr regelmäßig in den Palast kommen werdet, können wir Eure Ernennung nicht geheimhalten, doch schätze ich Verschwiegenheit und Sorgfalt. Es gibt einige Personen in meiner Nähe, einschließlich unseres geliebten Kadis al-Fadil, die neidisch auf Euch sein werden. Schließlich ist unser al-Fadil ein begnadeter und bewunderter Schriftsteller. Gewiß könnte er niederschreiben, was ich ihm diktiere, aber seine Sprache ist für meinen Geschmack zu verschnörkelt, zu geschraubt. Er umschreibt das Thema mit so vielen wohlklingenden Worten, daß man manchmal kaum noch den Sinn zu erfassen vermag. Er ist ein Wortkünstler, ein Magier, ein Meister der Verschleierung.
Ich hingegen möchte, daß Ihr alles, was ich sage, möglichst genau und ohne jegliche Beschönigung festhaltet. Kommt morgen früh in den Palast, dann fangen wir unverzüglich an. Wenn Ihr mich nun bitte ein Weilchen entschuldigen wollt, ich möchte Ibn Maymun in einer persönlichen Angelegenheit um Rat fragen.«
Gehorsam verließ ich den Raum.
Als ich eine Stunde später erneut erschien, um zu fragen, ob ich ihnen noch eine Schale Hühnerbrühe anbieten dürfe, hörte ich die laute, klare Stimme meines Freundes.
»Ich habe Eurem Kadi schon oft gesagt, daß die Empfindungen unserer Seele, jenes, was wir in unserem Inneren spüren, einen wesentlichen Einfluß auf unsere Gesundheit hat. All jene Gefühle, die Eurer Hoheit Unwohlsein bereiten, sollten geklärt, ihre Ursachen offengelegt und ausgeräumt werden. Habt Ihr mir wirklich alles erzählt?«
Darauf kam keine Antwort. Wenige Minuten später verließ der Sultan mein Haus. Er sollte es niemals wieder aufsuchen. Allerdings brachten seine Gefolgsleute in regelmäßigen Abständen Geschenke für meine Familie sowie Schafe oder Ziegen, damit wir das muslimische Fest al-Fitr zum Gedenken an Abrahams Opfer feiern konnten.
Von jenem Abend an bis zu dem Zeitpunkt, da er nach Jerusalem aufbrach, sah ich den Sultan täglich. Manchmal ließ er mich nicht nach Hause zurückkehren, und mir wurde eine Unterkunft in seinem Palast zugewiesen. In den nächsten acht Monaten bestimmte der Sultan Yussef Salah al-Din Ibn Ayyub mein Leben.
Kapitel 2
Ich lerne Shadhi kennen, und der Sultan beginnt, mir seine Lebenserinnerungen zu diktieren.
Ibn Maymun hatte mich vorgewarnt, daß der Sultan ein Frühaufsteher sei. Noch vor Sonnenaufgang pflege er zu erwachen, seine Waschungen zu verrichten und eine Tasse heißen Wassers zu trinken, bevor er zu den Mukattam-Höhen vor den Toren der Stadt reite, wo seinerzeit die Zitadelle errichtet wurde. Der Sultan, der sich mit großem Eifer der Kunst der Architektur widmete, verwarf des öfteren Pläne des obersten Baumeisters. Niemand außer ihm wußte, daß die neue Feste nicht dazu diente, Kairo gegen die Franken zu verteidigen, sondern den Sultan vor aufständischen Untertanen zu schützen.
Die Stadt war als Unruheherd bekannt. Sie hatte sich rasch ausgedehnt und lockte Strolche und unzufriedene Seelen an. Aus diesem Grund war Kairo bei seinen Herrschern gefürchtet.
Auch hier stellte der Sultan sein Geschick und das seines Streitrosses auf die Probe. Zuweilen nahm er Afdal, seinen ältesten Sohn, mit. Afdal zählte erst zehn Jahre. Der Sultan nutzte jede Gelegenheit, den Knaben in der Kunst und Taktik der Kriegsführung zu unterweisen. Schließlich wurde auf dem Schlachtfeld über Wohl und Wehe von Dynastien entschieden. Das hatte Salah al-Din von seinem Vater Ayyub und seinem Onkel Chirkuh gelernt.
Als der Sultan an jenem Morgen zurückkehrte, erwartete ich ihn bereits. Ich berührte meine Stirn zum Gruß.
»Ihr seid genau zum richtigen Zeitpunkt erschienen, Ibn Yakub«, meinte er und stieg schwungvoll ab. Er war erhitzt und schwitzte, doch seine Augen leuchteten wie die eines Kindes. Frohmut und Zufriedenheit waren aus seiner Miene zu lesen.
»Das verheißt Gutes für unsere Arbeit, mein Freund. Ich werde zunächst baden und danach in der Bibliothek das Morgenmahl mit Euch einnehmen. Bis zur Ankunft des Kadis bleibt uns noch eine Stunde. Shadhi wird Euch den Weg weisen.«
Ein uralter kurdischer Krieger mit einem Bart so weiß wie Gebirgsschnee faßte mich am Ellbogen und führte mich sanft zur Bibliothek, indes er von sich selbst erzählte. Demnach hatte Shadhi, lange bevor Yussef das Licht der Welt erblickt hatte und Ayyub und sein Bruder Chirkuh in die Ebene Mesopotamiens gezogen waren, bereits dem Vater des Sultans als Gefolgsmann gedient.
»Ich, Shadhi, war es, der Euren Sultan noch vor seinem achten Geburtstag lehrte zu reiten und das Schwert zu führen. Ich, Shadhi, war es, der ...«
Unter normalen Gegebenheiten hätte ich dem alten Mann aufmerksam gelauscht und ihn eingehend befragt, doch an jenem Tag war mein Geist mit anderem beschäftigt. Ich hielt mich zum erstenmal im Palast auf, und es wäre töricht zu leugnen, daß ich mich in einem Zustand höchster Erregung befand. Plötzlich war ich ein Mann von Geltung. Ich sollte ein Vertrauter des mächtigsten Herrschers der Erde werden.
Shadhi geleitete mich zur bedeutendsten Privatbibliothek unserer Stadt. Allein die Zahl der Bücher über Philosophie belief sich auf über tausend. Hier stand alles, von Aristoteles bis zu Ibn Ruschd, von der Astronomie bis zur Geometrie. Hier fand Ibn Maymun sich ein, wenn er die Arzneirezepturen von al-Kindi, Sahlan Ibn Kaysan und Abul Fadl Daud studieren wollte, sowie, selbstredend, den Meister selbst, al-Razi, den namhaftesten der Ärzte. An diesem Ort wollte Ibn Maymun die Bücher und Manuskripte, die er von eigener Hand verfaßt hatte, nach seinem Hinscheiden aufbewahrt wissen.
Kaum hatte ich den Fuß in die Bibliothek gesetzt, sah ich mich überwältigt angesichts ihrer Größe und verlor mich alsbald in hochfliegenden Gedanken. Diese kunstvoll gebundenen Bücher waren ein Born jahrhundertelangen Lernens und Denkens. In einer eigenen Abteilung standen Werke, die man nirgendwo erwerben konnte und die als ketzerisch galten, oder anders ausgedrückt, Schriften, die philisterhafte Gemüter zum Umdenken veranlassen mochten. Sie öffneten sich dem Interessierten in den Leseräumen des Dar al-Hikma nur, sofern er willens war, den Bibliothekar mit einer außerordentlich großzügigen Gabe zu bedenken. Doch selbst das bot keine Gewähr dafür, jeden Wunsch erfüllt zu bekommen.
So war beispielsweise Abul Hassan al-Bakris Werk »Sirat al-Bakri« aus den Läden und öffentlichen Bibliotheken verschwunden. Ein Prediger der al-Azhar-Moschee hatte diese Biographie des Propheten als reine Erfindung angeprangert und den Gläubigen beim Freitagsgebet verkündet, al-Bakri schmore wegen seines blasphemischen Tuns in der Hölle.
Und nun stand das anrüchige Werk vor mir. Mit zitternden Händen nahm ich es aus dem Regal und begann die ersten Zeilen zu lesen. Es war im besten Sinne orthodox. Ich war in die Lektüre derart vertieft, daß ich nicht wahrnahm, wie Shadhi sich Mekka zuwandte und in gebeugter Haltung auf den Gebetsteppich niederwarf. Ebensowenig bemerkte ich das unerwartete Erscheinen des Sultans. Er holte mich in die Wirklichkeit zurück.
»Es ist besser, als Wissender zu träumen, denn zu beten und mit Dummheit geschlagen zu sein. Pflichtet Ihr mir bei, Ibn Yakub?«
»Ich bitte um Vergebung, Eure Hoheit, ich war ...«
Er bedeutete mir, Platz zu nehmen. Das Morgenmahl wurde aufgetragen. Der Sultan wirkte gedankenverloren. Unvermittelt erfaßte mich Unruhe, während wir schweigend aßen.
»Wie geht Ihr bei Eurer Arbeit vor?«
Seine Frage verwunderte mich.
»Mir scheint, ich habe Euch nicht verstanden, Herrscher der Tapferen.«
Er brach in Gelächter aus.
»Ich bitte Euch, mein Freund. Ibn Maymun hat mir erzählt, daß Ihr Geschichtsgelehrter seid. Euer Bemühen, das Schicksal Eures Volkes niederzuschreiben, findet seine große Wertschätzung. Ist meine Frage so schwierig zu beantworten?«
»Ich arbeite in der Tradition des angesehenen Tabari und gehe streng chronologisch vor. Zudem vergewissere ich mich bei jenen, die unmittelbar Kenntnis besitzen, des Wahrheitsgehalts jeder wesentlichen Begebenheit. Unterschiedliche Darstellungen gebe ich an den Leser weiter.«
Wieder lachte der Sultan.
»Ihr widersprecht Euch selbst. Wie kann es denn unterschiedliche Schilderungen einer Tatsache geben? Es existiert doch nur eine Tatsache. Folglich gibt es eine wahre und etliche falsche Darstellungen.«
»Eure Hoheit reden von Tatsachen. Ich rede von Geschichte.«
Er lächelte.
»Sollen wir anfangen?«
Ich nickte und legte mir meine Schreibutensilien zurecht.
»Wollen wir beim Anfang beginnen?«
»Was sonst«, murmelte er, »wo Ihr Euch derart der Chronologie verschrieben habt. Obzwar ich es für besser hielte, damit zu beginnen, wie ich erstmals Kairo erblickte.«
»Der Anfang, mein Sultan, der Anfang. Euer Anfang. Eure frühesten Erinnerungen.«
»Ich konnte mich glücklich schätzen. Ich war nicht der Erstgeborene. Somit wurde nicht viel von mir erwartet. Ich war häufig mir selbst überlassen und genoß reichlich Freiheit. Meine Erscheinung und mein Benehmen stellten für niemanden eine Bedrohung dar. Ich war ein ganz gewöhnlicher Knabe. Ihr seht mich jetzt als Sultan, umgeben von sämtlichen Insignien der Macht. Ihr seid beeindruckt, und Euch ist vielleicht sogar ein wenig beklommen zumute. Ihr befürchtet, Euer Kopf könnte womöglich im Staub rollen, falls Ihr der Schicklichkeit nicht Genüge tut. Diese Ängste sind normal und rühren von der Wirkung der Macht auf die Untertanen des Sultans. Doch ebendiese Macht kann die unscheinbarste Person in eine bedeutende verwandeln. Seht mich an. Hättet Ihr mich als Knaben gekannt, hättet Ihr Euch nicht im Traum vorstellen können, daß ich einmal der Sultan von Misr werde. Und nicht zu Unrecht! Schicksal und Historie haben sich verbrüdert und aus mir gemacht, was ich heute bin.
Der einzige Mensch, der mir etwas zutraute, war meine Großmutter väterlicherseits. Ich war neun oder zehn Jahre alt, als sie mich und ein paar meiner Freunde beim Versuch beobachtete, eine Schlange zu töten. Als Knaben traten wir des öfteren in Wettstreit um derlei alberne Dinge ... Wir versuchten eine Schlange am Schwanz zu packen und sie herumzuwirbeln, um schließlich ihren Kopf auf einem Stein zu zerschmettern oder, wie die Kühneren unter uns es zu tun pflegten, ihren Kopf zu zertreten.
Daraufhin rief mich meine Großmutter zu sich.
›Yussef! Yussef! Ibn Ayyub! Komm her, auf der Stelle!‹
Während die anderen Jungen davonrannten, ging ich in Erwartung einer Ohrfeige zögernd auf sie zu. Meine Großmutter war von aufbrausendem Temperament und hatte, so war es mir zumindest von Shadhi erzählt worden, meinen Vater einmal ins Gesicht geschlagen, obschon er damals bereits ein erwachsener Mann gewesen war. Keiner hatte nach dem Grund für diese öffentliche Züchtigung zu fragen gewagt. Mein Vater hatte daraufhin den Raum verlassen, und es geht die Rede, daß Mutter und Sohn ein Jahr lang kein Wort miteinander gewechselt hätten. Letzten Endes sei es mein Vater gewesen, der um Verzeihung gebeten hatte.
Zu meiner Verwunderung schlang die Großmutter die Arme um mich und küßte mich abwechselnd auf beide Augen.
›Du bist beherzt, Junge, doch sieh dich vor. So manche Schlange weiß sich selbst dann noch zu wehren, wenn man sie am Schwanz festhält.‹
Ich erinnere mich noch, wie erleichtert ich gelacht habe. Dann erzählte sie mir von einem Traum, den sie vor meiner Geburt geträumt hatte.
›Du warst noch im Bauche deiner Mutter. Ich glaube, du hast gehörig gestrampelt, denn deine Mutter klagte zuweilen, sie würde wohl ein Füllen zur Welt bringen. Eines Nachts träumte mir, eine gewaltige menschenfressende Schlange würde sich deiner Mutter nähern, die unbedeckt in der Sonne lag. Als deine Mutter die Augen öffnete, trat ihr der Schweiß aus allen Poren hervor. Sie wollte sich bewegen, konnte ihren Körper aber nicht aufrichten. Die Schlange glitt langsam auf sie zu. Da öffnete sich mit einmal der Bauch deiner Mutter – ähnlich einer verwunschenen Tür. Ein Kind trat heraus, in der Hand ein Schwert, und enthauptete die Schlange mit einem gewaltigen Hieb. Dann warf es einen Blick auf seine Mutter und verschwand wieder in ihrem Bauch. Aus dir wird einmal ein großer Krieger, mein Sohn. Das steht in den Sternen geschrieben, und Allah selbst wird dein Führer sein.‹
Mein Vater und mein Onkel lachten über die einfältigen Träume meiner Großmutter, doch bereits zu jener Zeit verlieh mir ihre Auslegung des Traumes Stärke. Sie war der erste Mensch, der mich ernst nahm.
Doch ihre Worte zeitigten offenbar nicht allein bei mir ihre Wirkung, denn nach dieser Begebenheit beobachtete mich mein Onkel Asad-al-Din Chirkuh aufmerksam. Er kümmerte sich höchstselbst um meine Ausbildung zum Reiter und Schwertkämpfer. Von ihm erwarb ich all mein Wissen über Pferde. Ihr wißt sicher, Ibn Yakub, daß ich die Herkunft eines jeden Streitrosses unserer Armee kenne. Es scheint Euch zu überraschen. Doch über Pferde werden wir ein andermal sprechen.
Wenn ich die Augen schließe und mir meine frühesten Erinnerungen ins Gedächtnis zurückrufe, sehe ich zunächst die griechischen Tempelruinen von Baalbek vor mir. Ihre Größe ließ einen vor Staunen und Ehrfurcht erzittern. Die Tore zum Tempelhof waren unversehrt. Man hatte sie wahrlich für Gottheiten gebaut. Mein Vater war als Abgesandter des großen Sultans Zinki von Mosul für die Festung und deren Verteidigung verantwortlich. Dort bin ich aufgewachsen. Griechen und Römer hatten ihr den Namen Heliopolis gegeben und dort Zeus, Hermes und Aphrodite gehuldigt.
Als Kinder versammelten wir uns in Gruppen zu Füßen der Statuen und spielten Verstecken. Nichts regt die Vorstellungskraft eines Kindes stärker an als eine Ruine. Die alten Steine bargen einen Zauber, und ich durchlebte in meiner Phantasie die vergangenen Epochen. Bis zu jener Zeit war uns die Welt der Griechen und Römer ein vollkommenes Rätsel. Die Anbetung von Gottheiten stellte für uns die höchste Form der Ketzerei dar. Allah und Sein Prophet hatten dem ein Ende gesetzt. Und doch waren die Tempel und insbesondere die Statuen von Aphrodite und Hermes von verlockender Schönheit.
Wir malten uns aus, wie aufregend das Leben damals gewesen sein mußte, und gerieten nicht selten über die Gottheiten in Streit. Ich hatte mich Aphrodite verschrieben, während mein älterer Bruder Turanschah Hermes verehrte. Von Zeus' Statue waren allein die Beine übriggeblieben, die nicht sonderlich reizvoll waren. Ich glaube, mit dem Rest seines Körpers hatte man die Feste errichtet, die uns damals als Wohnstätte diente.
Shadhi war besorgt über den verderblichen Einfluß dieser Zeugnisse vergangener Zeiten und mühte sich nach Kräften, uns von den Ruinen fernzuhalten. Er machte uns weis, die Götter könnten Menschenwesen in Statuen oder andere Gebilde verwandeln, ohne sie jedoch ihres Verstands zu berauben. Er dachte sich Märchen von Dschinnen, Dämonen und anderen ruchlosen Geschöpfen aus, die sich bei Vollmond an den Ruinen zusammenfanden und beratschlagten, wie sie Knaben und Mädchen in ihre Gewalt bringen konnten, um sie zu verspeisen. Myriaden von Kindern seien im Laufe von Jahrhunderten den Dschinnen zum Opfer gefallen, erzählte er uns mit tiefer Stimme. Als er die Angst in unseren Gesichtern wahrnahm, beruhigte er uns wieder. Nichts würde uns zustoßen, da Allah und Sein Prophet uns beschützten.
Shadhis Erzählungen erhöhten den Reiz des Verbotenen um ein beträchtliches. Wir fragten ihn über die drei Götter aus, und etliche der Bibliotheksgelehrten erzählten uns freimütig von den Griechen und Römern und ihren Religionen. Deren Götter und Göttinnen waren wie Menschen. Sie bekämpften und liebten einander und hegten auch noch andere menschliche Gefühle. Von uns unterschieden sie sich allein durch ihre Unsterblichkeit. Ihr Wohnsitz bis in alle Ewigkeit war der Olymp, ein Ort, der nichts mit unserem Paradies gemein hatte.
›Wohnen sie immer noch auf dem Olymp?‹ fragte ich meine Großmutter eines Abends.
Sie geriet außer sich vor Zorn.
›Welcher Narr hat dir denn diesen Unfug in den Kopf gesetzt? Dein Vater wird ihm die Zunge herausschneiden. Sie sind nie etwas anderes als Statuen gewesen, törichter Knabe. Die Menschen jener Zeit waren sehr dumm. Sie verehrten Götzenbilder. In unserem Land hat schließlich unser Prophet, möge er in Frieden ruhen, die Statuen und ihre Macht zerschlagen.‹
Was immer man uns über die Gottheiten erzählte, schlug uns um so stärker in ihren Bann. Nichts konnte uns von den Statuen fernhalten. Eines Nachts, der Mond war voll, beschlossen die älteren Kinder, angeführt von meinem Bruder, die heilige Stätte der Aphrodite aufzusuchen. Sie wollten mich eigentlich zurücklassen, doch ich hörte sie tuscheln und drohte ihnen, sie bei unserer Großmutter zu verraten. Mein Bruder versetzte mir zwar einen heftigen Tritt, aber er hatte bereits eingesehen, wie gefährlich es sein könnte, mich auszuschließen.
Es war kalt in jener Nacht, so kalt, daß wir uns in Decken wickelten. Ich glaube, wir waren zu sechst oder siebt. Klammheimlich schlichen wir aus der Festung. Uns allen war unbehaglich zumute, und ich erinnere mich an das Genörgel der anderen, als ich zweimal stehenbleiben mußte, um mich zu erleichtern. Unsere Angst ließ etwas nach, als wir uns Aphrodite näherten. Außer dem Schreien der Eulen und dem Bellen der Hunde drang kein Laut an unsere Ohren. Auch die Dschinnen hatten sich uns nicht gezeigt.
Doch als wir den mondbeschienenen Hof des Tempels betraten, vernahmen wir wunderliche Geräusche. Ich verging fast vor Angst und klammerte mich an Turanschah. Auch er war erschrocken. Langsam begaben wir uns in die Richtung des Ortes, von dem die Laute ausgingen. Da streckte sich uns Shadhis bloßes Hinterteil entgegen, das sich vor- und zurückbewegte, und seine schwarze Haarpracht flatterte im Wind. Shadhi kopulierte wie ein Esel mit jemandem, den wir nicht erkennen konnten, und nachdem wir begriffen hatten, daß er es war, brachen wir in schallendes Gelächter aus. Unser Lachen hallte durch den leeren Hof und traf Shadhi wie eine Dolchspitze. Er wandte sich zu uns um und rief laute Verwünschungen, woraufhin wir das Weite suchten.
Am folgenden Tag stellte mein Bruder ihn zur Rede.
›Der Dschinn vergangene Nacht hatte einen uns wohlbekannten Hintern, nicht wahr, Shadhi?‹«
Salah al-Din hielt kurz inne und lachte bei dieser Erinnerung. Wie der Zufall es wollte, betrat Shadhi gerade in diesem Augenblick den Raum, um eine Nachricht zu überbringen. Bevor er zu sprechen anhob, wurde der Sultan von einer neuen Lachsalve geschüttelt. Als der verwunderte alte Mann von einem zum andern blickte, kostete es mich große Mühe, nicht loszuprusten.
Nachdem Shadhi über den Grund unserer Heiterkeit aufgeklärt worden war, stieg ihm die Zornesröte ins Gesicht. Verärgert wandte er sich an Salah al-Din, verlieh auf kurdisch seiner Empörung Ausdruck und hastete aus dem Zimmer.
Erneut fing der Sultan an zu lachen.
»Er hat mit Vergeltung gedroht und will Euch Geschichten aus meiner Jugendzeit in Damaskus erzählen, die ich, wie er meint, gewiß vergessen habe.«
Unsere erste Zusammenkunft war beendet.
Als wir aus der Bibliothek traten, bedeutete mir der Sultan, ihm zu folgen. Die Flure und Räume, die wir durchschritten, waren mit einer prächtigen Vielfalt von Seiden- und Brokatstoffen ausgeschlagen sowie mit golden und silbern gerahmten Spiegeln geschmückt. Vor jedem Gemach wachte ein Eunuch. Derartigen Luxus hatte mein Auge noch nicht erblickt.
Der Sultan gewährte mir wenig Zeit zum Staunen. Er ging so rasch, daß sich sein Gewand im Luftstrom blähte. Schließlich erreichten wir den Audienzsaal. Ein nubischer Wächter mit Krummsäbel wachte vor der Tür und verneigte sich, als wir die Schwelle überschritten. Der Sultan ließ sich auf einem mit purpurroter Seide verkleideten und mit Kissen aus Satin und Goldbrokat umgebenen Podest nieder.
Der Kadi hatte sich bereits zur täglichen Berichterstattung und Beratung eingefunden und wurde nun in den Audienzsaal gebeten. Als er eintrat und sich verneigte, machte ich Anstalten, den Raum zu verlassen. Doch zu meiner Verwunderung hieß mich der Sultan zu bleiben. Ich sollte aufmerksam zuhören und Einzelheiten von Bedeutung niederschreiben.
Schon oft hatte ich den Kadi al-Fadil in Begleitung seiner Wächter und seines übrigen Gefolges, Vertretern von Macht und Ansehen, in den Straßen der Stadt erblickt. Er war das Antlitz des Staates, er war der Mann, der der Diwan alinsha, der Staatskanzlei, vorsaß, der Mann, der für Ordnung und Ruhe in Misr sorgte. Mit demselben Eifer, den er einst für die fatimidischen Kalifen und deren Minister aufgebracht hatte, diente er nunmehr dem Mann, der sie bezwungen hatte. Der Kadi verkörperte den Fortbestand der Institutionen von Misr. Da er als Berater und Freund das Vertrauen des Sultans genoß, schreckte er nicht davor zurück, unliebsame Ratschläge zu erteilen. Nach Entwürfen des Sultans verfaßte er offizielle und private Botschaften aus dem Palast.
Der Sultan stellte mich als seinen persönlichen Schreiber mit besonderer Aufgabe vor. Ich erhob mich und verneigte mich tief. Der Kadi lächelte.
»Ibn Maymun hat viel von Euch gesprochen, Ibn Yakub. Er achtet Eure Gelehrtheit und Eure Fähigkeiten. Das ist mir ausreichende Gewähr.«
Zum Dank senkte ich den Kopf. Ibn Maymun hatte mich gewarnt. Sollte der Kadi mir meine Stellung neiden, würde er mich mühelos aus dem Weg räumen können.
»Und wie steht es mit meiner Billigung, al-Fadil?« wollte der Sultan wissen. »Kommt ihr keinerlei Bedeutung zu? Ich lasse gelten, daß ich Euch als großem Denker oder Poeten nicht das Wasser reichen kann, ebensowenig wie unserem guten Freund, dem Philosophen und Arzt Ibn Maymun. Doch werdet Ihr mir zugestehen müssen, Menschenkenntnis zu besitzen. Schließlich war ich es, der Ibn Yakub ausgewählt hat.«
»Erhabener Herr, Ihr macht Euch über Euren Diener lustig«, entgegnete der Kadi mit leicht gelangweiltem Unterton, als wolle er zu verstehen geben, daß er für derlei Scherze heute nicht in der Stimmung sei.
Nach etlichen ironischen Wortgefechten, während derer sich der Kadi weiteren Herausforderungen seines Herrn entzog, gab er einen Abriß der wesentlichen Begebenheiten der vergangenen Woche. Es handelte sich dabei um einen der üblichen Berichte über völlig bedeutungslose Fragen der Regierung, allerdings vorgetragen mit einer Kunstfertigkeit, die jeden Zuhörer fesselte. Jedes Wort war mit Bedacht gewählt, jeder Satz ein Wohlklang, am Ende gekrönt von einem Reim. Ein wahrlich außergewöhnlicher Mann. Während der Berichterstattung, die eine Stunde dauerte, hatte der Kadi nicht ein einziges Mal Grund, ein Stück Papier zu Rate zu ziehen. Welch Gedächtniskraft!
Dem Sultan war die Vortragsweise des Kadis wohlvertraut, und er hielt während der vortrefflichen Ausführungen seines Beamten die Augen über längere Passagen hinweg geschlossen.
»Jetzt komme ich zu einer wichtigen Angelegenheit, Herr, welche Eurer Entscheidung bedarf. Es handelt sich um den Mord, den einer Eurer Offiziere an einem anderen Offizier begangen hat.«
Der Sultan war schlagartig hellwach.
»Weshalb erfahre ich erst jetzt davon?«
»Der Vorfall, von dem ich spreche, hat sich erst vor zwei Tagen zugetragen. Ich habe den ganzen gestrigen Tag damit verbracht, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Jetzt bin ich in der Lage, Euch umfassend zu berichten.«
»Ich höre, al-Fadil.«
Kapitel 3
Ein Fall von unbezwingbarer Gemütserregung: die Geschichte von Halima und die Entscheidung des Sultans.
Der Kadi begann zu erzählen.
»Messud al-Din war, wie Euch erinnerlich sein wird, einer der tapfersten Offiziere Eurer Hoheit. Er hatte bei so manchem Kampf an Eurer Seite gefochten. Vor zwei Tagen wurde er getötet, von einem wesentlich jüngeren Mann namens Kamil Ibn Zafar, der, wie man mir berichtete, zu den besten Schwertkämpfern unserer Stadt zählt. Die Kunde davon überbrachte mir Halima, jene Frau, um die der Streit zwischen den beiden Männern entbrannt war. Sie befindet sich jetzt solange unter meinem Schutz, bis die Angelegenheit geklärt ist. Wenn der Sultan sie sehen würde, wäre ihm begreiflich, warum Messud niedergestreckt wurde und warum Kamil bereit ist, ein ähnliches Schicksal zu erleiden. Sie ist eine Schönheit.
Halima war ein Waisenmädchen. Ihr war keine glückliche Kindheit beschieden. Fast scheint es, als habe sie geahnt, welche Missetaten einst ihretwegen verübt werden würden. Als sie ins Erwachsenenleben eintrat, verblüffte sie jedermann mit ihrer Anmut, ihrem Verstand und ihrer Kühnheit. Sie wurde Bedienstete im Haushalt von Kamil Ibn Zafar, wo sie für seine Frau arbeitete und seine Kinder hütete.
Kamil hätte mit ihr tun können, was er wollte. Er hätte sich ihres Körpers bemächtigen können, wann immer er Lust danach verspürte, oder hätte sie ganz formell als seine Konkubine im Haus einführen können. Doch er liebte sie. Nicht sie war es, die ihn zur Heirat drängte, sondern er war darauf erpicht, und so wurde rechtmäßig die Ehe zwischen ihnen geschlossen.
Halima bestand darauf, so weiterzuleben wie bisher. Sie weigerte sich, den ganzen Tag im Haus zu verbringen. Sie bediente Kamil zu Hause und hielt sich auch dann im Raum auf, wenn seine Freunde zugegen waren. Zwar sei Kamil ein gütiger und rücksichtsvoller Mann, sagte sie mir, aber sie sei ihm dennoch nicht so leidenschaftlich zugetan gewesen wie er ihr. Auf meine Frage nach dem Grund für die Heirat, meinte sie, durch diese Verbindung habe Kamil sicherstellen wollen, daß sie ihr Leben lang sein Eigentum bliebe. Ja, Herr, diese Worte hat sie gebraucht: sein Eigentum.
Messud hatte Halima im Haus seines Freundes Kamil kennengelernt. Dieser hatte ihm sein Herz ausgeschüttet, wie sehr er Halima liebte und daß er nicht ohne sie sein könne. Zwischen den beiden Männern war sehr viel von Halima die Rede gewesen, und so hatte Messud von ihren beträchtlichen Reizen erfahren.
Wenn Messud gelegentlich vorbeikam, um mit seinem Freund ein Glas zu trinken, und dieser nicht anwesend war, reichte ihm Halima ein kleines Glas Tee. Sie sprach mit ihm wie mit einem Ebenbürtigen und ergötzte ihn mit dem jüngsten Klatsch und den Scherzen vom Basar, die oft auf Kosten Eures Kadis gingen, o gnädiger Sultan. Manchmal richtete sich der Spott auch gegen den Kalifen in Bagdad oder sogar gegen Eure ehrwürdige Person.
Kamils Mutter und seine älteste Frau waren entsetzt über Halimas Betragen. Sie beschwerten sich bitterlich bei Kamil, der jedoch ungerührt blieb.
›Messud ist für mich wie ein Bruder‹, entgegnete er ihnen. ›Ich diene unter ihm, in der ruhmreichen Armee von Yussef Salah al-Din. Seine Familie ist in Damaskus beheimatet. Deshalb ist mein Haus auch sein Haus. Behandelt ihn wie einen Angehörigen unserer Familie. Halima versteht mich darin besser als ihr. Wenn euch Messud mißfällt, geht ihm aus dem Weg. Ich will ihn euch nicht aufdrängen.‹
Das Thema kam nie wieder zur Sprache. Und Messud wurde ein regelmäßiger Gast.
Es war Halima, die den ersten Schritt tat. Nichts ist verlockender als eine verbotene Frucht. Eines Nachmittags, als Kamil und die übrige Familie zur Beerdigung des Vaters seiner ersten Frau gingen, blieb Halima allein zu Hause. Auch die Diener und die bewaffneten Gefolgsleute begleiteten ihren Herrn zur Bestattung. Da erschien der arglose Messud, der nichts von dem Todesfall in der Familie wußte, um mit seinem Freund zu speisen, und wurde in dem verlassenen Hof nur von der schönen Halima willkommen geheißen. Als die Strahlen der untergehenden Sonne auf ihr rötliches Haar fielen, mag er sich gewiß an eine Märchenprinzessin aus dem Kaukasus erinnert gefühlt haben.
Sie erstattete mir nicht genau Bericht davon, wie unser ehrenwerter Krieger den Nachmittag verbrachte, den er befriedigt auf ihrem Leib ruhend und den Kopf an ihre pfirsichgleichen Brüste schmiegend beendete. Ich weiß, daß Euer Gnaden Einzelheiten zu schätzen wissen, doch meine bescheidene Vorstellungskraft reicht nicht aus, Euch heute zufriedenzustellen. Aber ihre Leidenschaft zueinander wurde zu einem schleichenden Gift.
Im Laufe der Monate suchte Messud immer häufiger nach Gelegenheiten, Kamil zu Sondereinsätzen wegzuschicken. Er wurde nach Fustat abkommandiert oder zur Überwachung des Baus der neuen Zitadelle. Dann sollte er wiederum junge Soldaten in der Kunst des Schwertkampfes unterweisen, oder er sah sich mit sonst einem Auftrag fortgesandt, den Messuds krankhafter, besessener Geist ersonnen hatte.
Halima hat mir erzählt, sie hätten einen bestimmten Treffpunkt gehabt, nicht weit vom Mahmudiya-Viertel entfernt, wo sie wohnte. Doch ohne ihr Wissen hatte Kamils Mutter begonnen, sie von einem Diener beschatten zu lassen, bis die Machenschaften der Liebenden zweifelsfrei erwiesen waren.
Eines Tages sandte Kamils Mutter einen Boten zu ihrem Sohn. Sie behauptete, sie sähe dem Tode entgegen. Krank vor Sorge eilte Kamil nach Hause und sah mit Erleichterung, daß seine Mutter wohlauf war. Doch ihre Miene sagte ihm alles. Sie sprach kein Wort, sondern machte nur eine Kopfbewegung zu dem zwölfjährigen Diener hin, ihrem Späher, und bedeutete ihrem Sohn, ihm zu folgen. Kamil wollte sein Schwert zurücklassen, aber sie meinte, es würde ihm vielleicht bald von Nutzen sein.
Schnellen Schrittes eilte der Knabe voraus. Kamil folgte ihm benommen. Er wußte, daß seine Mutter Halima nicht mochte. Und er wußte auch, daß er sie dort, wo sie hingingen, antreffen würde. Doch auf den Anblick, der sich ihm bot, als er den Raum betrat, war er nicht gefaßt gewesen. Messud und Halima lagen nackt auf dem Boden und gaben sich schamlos ihrer Lust hin.
Kamil schrie auf. Es war ein entsetzlicher Schrei. Zorn, Verrat und Eifersucht entluden sich in ihm gleichermaßen. Messud bedeckte seine Blöße und sprang auf, die Gesichtszüge verzerrt von Schuldgefühlen. Er leistete keinen Widerstand. Er wußte, was ihm gebührte, und wartete geduldig auf seine Strafe. Und da stieß Kamil seinem Freund das Schwert ins Herz.
Halima gab keinen Laut von sich. Sie packte ihren Umhang und rannte hinaus. So sah sie nicht, wie ihr Ehemann angesichts des spritzenden Blutes ihres Liebhabers in Raserei geriet. Doch der Knabe beobachtete alles. Er sah, wie sein Herr den Leichnam des Freundes mißhandelte, wie er ihm das Körperteil abtrennte, das ihn so gekränkt hatte. Als sein Zorn verraucht war, setzte sich Kamil auf den Boden und brach in Tränen aus. Er sprach zu seinem toten Freund, flehte Messud an, ihm zu sagen, warum ihm Halimas Leib mehr bedeutet hatte als ihre Freundschaft.
›Wenn du mich darum gebeten hättest‹, rief er den Leichnam an, ›hätte ich sie dir geschenkt.‹«
An dieser Stelle unterbrach der Sultan den Kadi.
»Genug, al-Fadil. Wir haben alles gehört, was wir wissen müssen. Es ist ein Elend. Einer meiner besten Krieger ist tot. Niedergestreckt nicht von den Franken, sondern von seinem besten Freund. Dabei hatte der Tag mit Ibn Yakub so gut begonnen, doch jetzt habt Ihr ihn mir mit dieser schmerzlichen Geschichte verdorben. Es gibt keine Lösung für diese Angelegenheit. Die Lösung selbst ist das Problem. Habe ich nicht recht?«
Der Kadi lächelte traurig.
»In gewisser Hinsicht trifft dies natürlich zu. Doch vorn Standpunkt des Staates aus betrachtet, liegt ein schweres Vergehen vor. Ein Verstoß gegen die bestehende Ordnung. Kamil hat einen ranghöheren Offizier getötet. Sollte er unbestraft bleiben, würde sich das herumsprechen. Es würde die Moral der Truppe untergraben, vornehmlich die der syrischen Soldaten, denn sie haben Messud geliebt. Ich halte eine Strafe für unabdingbar. Er hätte sich nicht selbst zum Richter machen dürfen. Im Reich Eurer Hoheit ist die Rechtsprechung einzig und allein meine Angelegenheit. Nur Ihr könnt mir Weisung erteilen. Was schlagt Ihr also im vorliegenden Fall vor?«
»Wie lautet Euer Urteil, al-Fadil?«
»Ich fordere Kamils Kopf.«
»Nein!« schrie der Sultan. »Laßt ihn auspeitschen, wenn es denn sein muß, aber nicht mehr. Die Tat wurde in einer unbezwingbaren Gemütserregung begangen. Selbst Euch, mein Freund, wäre es unter solchen Umständen schwergefallen, Euch zu zügeln.«
»Wie es Eurer Hoheit beliebt.«
Der Kadi blieb sitzen. Nach den vielen Jahren im Dienst des Sultans wußte er aus einem Gefühl heraus, daß die Sache für Salah al-Din damit noch nicht abgeschlossen war. Einige Minuten lang sprach niemand von uns ein Wort.
»Sagt mir, al-Fadil«, vernahm ich dann die mir wohlbekannte Stimme, »was ist aus der Frau geworden?«
»Ich dachte, Ihr wünscht sie vielleicht selbst zu befragen, und habe mir deshalb erlaubt, sie in den Palast zu bringen. Man sollte sie wegen Ehebruchs steinigen. Doch das Urteil muß der Sultan fällen. Indessen, das Volk wäre mit einer solchen Entscheidung zufrieden. Auf dem Basar erzählt man sich, sie sei vom Teufel besessen.«
»Ihr macht mich neugierig. Was für eine Bestie mag sie wohl sein? Laßt sie hereinbringen, wenn Ihr geht.«
Der Kadi verbeugte sich und verließ den Raum, ohne mich auch nur eines Blickes zu würdigen.
»Was ich bislang noch nicht verstehe, Ibn Yakub«, wandte sich der Sultan an mich, »ist, warum mir der Kadi diesen Fall vorgetragen hat. Vielleicht weil er nicht wagte, ohne meine Zustimmung einen Offizier aus Misr hinrichten zu lassen? Nun, vielleicht. Das wird wohl der Grund sein. Aber man darf al-Fadil niemals unterschätzen. Er ist ein schlaues Kamel. Ich bin mir sicher, daß es noch einen weiteren Beweggrund gibt.«
In diesem Augenblick kam ein Gefolgsmann herein und verkündete, daß Halima vor der Tür stehe. Auf das Nicken des Sultans hin wurde sie ihm vorgeführt. Sie fiel auf die Knie, verbeugte sich und berührte mit der Stirn seine Füße.
»Genug davon«, sprach der Sultan im barschen Ton eines Herrschers, der über jemanden zu Gericht sitzt. »Setz' dich vor uns.«
Als sie den Oberkörper aufrichtete, sah ich zum ersten Mal ihr Gesicht. Es war, als würde eine Lampe den Raum erleuchten. Dies war keine gewöhnliche Schönheit. Trotz ihrer Traurigkeit ging von ihren tränennassen Augen ein Strahlen aus, und ihr Blick kündete von einem wachen Geist. Diese Frau würde sich nicht bereitwillig dem Henker überantworten lassen. Sie würde kämpfen. Es stand ihr ins Gesicht geschrieben, daß sie mit jeder Faser Widerstand leisten würde.
Als ich mich dem Sultan zuwandte, die Feder zückte und darauf wartete, daß er sprach, bemerkte ich, daß ihn der Anblick dieser jungen Frau ebenfalls verzaubert hatte. Sie mochte höchstens zwanzig Jahre alt sein, wahrscheinlich aber jünger.
Salah al-Dins Augen offenbarten eine Sanftheit, die mir bislang nicht an ihm aufgefallen war, doch hatte ich ihn auch noch nie in Gegenwart einer Frau erlebt. Er sah sie so durchdringend an, daß jede andere Person Angst bekommen hätte, sie hingegen blickte ihm geradewegs in die Augen. Am Ende war es der Sultan, der den Blick senkte. Halima hatte das erste Kräftemessen für sich entschieden.
»Ich warte«, brach der Sultan das Schweigen. »Sag mir, warum ich dich nicht dem Kadi überantworten soll, der dich für dein Verbrechen steinigen lassen will.«
»Wenn Liebe ein Verbrechen ist«, begann sie mit Selbstmitleid in der Stimme, »dann, o barmherziger Herrscher, habe ich den Tod verdient.«
»Nicht die Liebe ist das Vergehen, du schamloses Weib, sondern Ehebruch. Du hast deinen dir vor Allah angetrauten Ehemann mit einem anderen betrogen.«
Da funkelten ihre Augen. Die Traurigkeit hatte sich verflüchtigt. Und als sie weiterredete, änderte sich auch ihr Ton. Sie klang selbstsicher und nicht im mindesten demütig. Nun hatte sie sich wieder ganz in der Gewalt und sprach ohne jede Scheu zum Sultan, als hätte sie ihresgleichen vor sich.
»Ich vermochte nicht zu begreifen, wie klein die Welt für zwei Menschen sein kann. Wenn Messud nicht bei mir war, wurde jede Erinnerung an ihn zur Qual. Ob ich lebe oder sterbe, ist mir einerlei, und ich werde mich dem Urteil des Kadis beugen. Er kann mich steinigen lassen, ich werde nicht um Gnade betteln oder den Aasgeiern meine Reue entgegenschreien. Ich bin traurig, aber ich bedauere nichts. Die kurze Spanne des Glücks war mehr, als ich in diesem Leben je für möglich gehalten hätte.«
Der Sultan fragte, ob sie Verwandte habe, doch sie schüttelte den Kopf. Dann bat er Halima, ihre Geschichte zu erzählen.
»Ich war zwei Jahre alt, als ich an die Familie von Kamil Ibn Zafar verkauft wurde. Sie sagten mir, ich sei ein Waisenkind, das viele Meilen entfernt ausgesetzt und von kurdischen Kaufleuten gefunden worden sei. Aus Mitleid hatte mich die Familie aufgenommen, doch dieses Mitleid währte nur wenige Jahre. Kamil Ibn Zafars Mutter konnte keine Kinder mehr bekommen. Ihr Ehemann, so sagte man mir damals, sei tot. Sie wohnte im Haus ihres Vaters, und dieser gütige alte Mann hatte ihr daher ein Kind von der Straße gekauft. Ich war also eine Ware, die feilgeboten worden war. Mehr weiß ich nicht von meiner Vergangenheit.
Kamil zählte zu jener Zeit zehn oder elf Jahre. Schon damals war er freundlich und liebevoll und stets um mein Wohlergehen besorgt. Er behandelte mich wie eine leibliche Schwester. Die Einstellung seiner Mutter hingegen schwankte. Sie konnte sich nie entscheiden, ob sie mich als Tochter oder als Sklavin aufziehen sollte. Als ich älter wurde, gab sie mir dann deutlicher zu verstehen, welche Rolle im Haus mir zukam. Zwar aß ich gemeinsam mit der Familie, was die anderen Diener ärgerte, wurde jedoch als persönliche Dienerin der Mutter angelernt. Es war kein allzu schlechtes Leben, obwohl ich mich oft einsam fühlte. Denn die anderen Bediensteten trauten mir nie so ganz.
Täglich kam ein alter Mann ins Haus, um uns die Weisheit des Koran nahezubringen und von den Taten des Propheten und seiner Gefährten zu berichten. Doch schon bald erschien Kamil nicht mehr zu diesen Stunden. Statt dessen ging er mit seinen Freunden reiten oder übte sich im Bogenschießen. Eines Tages griff der Lehrer der heiligen Texte nach meiner Hand und schob sie sich zwischen die Beine. Ich schrie. Daraufhin stürmte Kamils Mutter ins Zimmer.
Der Lehrer murmelte den Namen Allahs und bezichtigte mich der Unanständigkeit und Liederlichkeit. In seiner Gegenwart schlug mir Kamils Mutter zweimal ins Gesicht und entschuldigte sich bei ihm. Als Kamil später nach Hause kam, erzählte ich ihm, was tatsächlich vorgefallen war. Er war zornig auf seine Mutter, und der Lehrer durfte sich nie wieder auch nur in der Nähe des Hauses blicken lassen. Ich glaube, daß Kamils Zuneigung zu mir die Mutter mit Sorge erfüllte, weshalb sie ihm bald eine Frau suchte. Ihre Wahl fiel auf Zenobia, die Tochter ihrer Schwester, die zwei Jahre älter war als ich.
Nach Kamils Hochzeit wurde mir aufgetragen, seiner jungen Frau zu dienen. Ich mochte sie. Wir kannten uns bereits, seit ich zum ersten Mal dieses Haus betreten hatte, und vertrauten einander oft unsere Geheimnisse an. Als Zenobia Kamil einen Sohn gebar, war ich darüber ebenso entzückt wie alle anderen. Ich hatte das Kind oft in meiner Obhut und gewann es allmählich so lieb, als wäre es mein eigenes. Ich beneidete Zenobia, der Allah schier unerschöpfliche Mengen an Milch zuteil werden ließ.
Alles war gut, sogar Kamils Mutter war wieder freundlich, bis zu jenem verhängnisvollen Tag, da Kamil mich beiseite nahm und mir gestand, daß er mich liebe, und zwar nicht nur als Bruder. Allah ist mein Zeuge, ich war vollkommen überrascht. Anfangs hatte ich Angst. Doch Kamil begehrte mich, und er bedrängte mich. Lange Zeit widerstand ich ihm. Obzwar ich große Zuneigung zu ihm empfand, liebte ich ihn nicht. Ganz und gar nicht.
Ich weiß nicht, was geschehen und wie alles ausgegangen wäre, hätte Kamils Mutter nicht versucht, mich mit dem Sohn des Wasserträgers zu verheiraten. Er war ein grober Kerl, den ich nicht leiden konnte. Doch wie Euer Gnaden bekannt ist, haben die Frauen nicht die Wahl, mit wem sie die Ehe eingehen. Da meine Herrin mein Schicksal demgemäß beschlossen hatte, hätte ich eigentlich den Sohn des Wasserträgers heiraten müssen.
Doch Kamil war außer sich, als er davon erfuhr. Er verkündete, daß er dies niemals zulassen würde, und bat mich ohne Umschweife, seine Frau zu werden. Seine Mutter war entsetzt. Und Zenobia erklärte, es sei zutiefst demütigend für sie, daß er ihre eigene Dienerin zur zweiten Frau nehmen wolle. Von da an sprachen die beiden Frauen monatelang nicht mehr mit mir.
Ich befand mich in einer schwierigen Lage. Und es gab niemanden, mit dem ich über meine Nöte hätte reden können. Nachts weinte ich oft im Bett und sehnte mich nach der Mutter, die ich nie gekannt hatte. Nüchtern wägte ich ab, welche Möglichkeiten mir offenstanden. Der Gedanke an den Sohn des Wasserträgers bereitete mir Übelkeit. Lieber wäre ich gestorben oder fortgelaufen, als mich von ihm berühren zu lassen. Kamil, der immer gut und liebevoll zu mir gewesen war, erschien mir als der einzig mögliche Ausweg. Also willigte ich ein, seine Frau zu werden.
Kamil brach in einen wahren Freudentaumel aus. Und ich war zufrieden, das heißt zumindest nicht unglücklich, wenngleich Zenobia mich haßte und Kamils Mutter mich wie Dreck von der Straße behandelte. Ihre eigene Vergangenheit hing wie eine dunkle Wolke über ihr. Niemals konnte sie vergessen, daß Kamils Vater sie wegen einer anderen verlassen hatte, als sie mit seinem Kind schwanger gewesen war. Er war eines Nachts aus Kairo weggegangen und nie mehr zurückgekehrt. Angeblich lebt er mit seiner Familie in Bagdad, wo er mit Edelsteinen handelt. Sein Name wurde niemals erwähnt, obschon Kamil oft an ihn dachte. Was ich hier berichtet habe, ist allerdings die Darstellung seiner Mutter. In der Küche war jedoch eine andere Fassung dieser Geschichte in Umlauf, und jedermann kannte sie. Die Diener erzählten sie mir erst, nachdem sie zu der Überzeugung gelangt waren, daß ich der Herrin nichts davon hinterbringen würde. Dieser Quelle zufolge verließ Kamils Vater unsere Stadt, als er von einer langen Auslandsreise zurückkehrte und herausfand, daß seine Frau sich mit einem hiesigen Kaufmann eingelassen hatte. Das Kind in ihrem Bauch stammte nicht von ihm. Dies hat Kamil mir bestätigt, nachdem wir geheiratet hatten. Seine Mutter wußte, daß ich davon erfahren hatte, und der bloße Gedanke daran erfüllte sie mit Haß. Was aus uns allen unter diesen Umständen geworden wäre, weiß allein Allah.
Da trat Messud in mein Leben, mit mandelförmigen Augen und Lippen süß wie Honig. Er erzählte mir von Damaskus und wie er an der Seite des Sultans Yussef Salah al-Din Ibn Ayyub gekämpft hatte. Ich konnte ihm einfach nicht widerstehen. Und ich wollte es auch nicht. Nie zuvor hatte ich geahnt, daß man soviel für einen Menschen empfinden kann.
Das, o großer Sultan, ist meine Geschichte. Ich weiß, Ihr werdet glücklich weiterleben. Ihr werdet große Siege erringen, über uns herrschen, Eure Urteile fällen und dafür sorgen, daß Eure Söhne erzogen werden, wie Ihr es wünscht. Euer Erfolg hat Euch dorthin gebracht, wo Ihr nun seid. Dieses unbedarfte, blinde und heimatlose Geschöpf, das ich bin, begibt sich vertrauensvoll in Eure Hand. Allahs Wille geschehe.«
Während Halimas Schilderung hatte Salah al-Din jedes Wort in sich aufgesogen, jede ihrer Gesten beobachtet, jedes Aufblitzen in ihren Augen bemerkt. Ihr Blick war der einer wilden, in die Enge getriebenen Katze. Nun betrachtete der Sultan sie mit dem starren, ungerührten Blick eines Kadis, mit einer Miene wie aus Stein. Das Mädchen geriet in Unruhe ob der lastenden Eindringlichkeit seines Blicks. Dieses Mal war sie es, die die Augen niederschlug.
Da lächelte er und klatschte in die Hände. Als der allzeit getreue Shadhi das Audienzzimmer betrat, sprach ihn der Sultan in kurdischem Dialekt an, den ich nicht verstehen konnte. Die Töne beschworen in Halima eine dunkle Erinnerung herauf. Es verblüffte sie, die beiden in ihrer Sprache reden zu hören, und sie lauschte ihnen aufmerksam.
»Folge ihm«, befahl ihr der Sultan dann. »Er wird dafür sorgen, daß du in Sicherheit bist, weit entfernt von den Steinen des Kadis.«
Sie küßte ihm die Füße. Daraufhin faßte Shadhi sie behutsam am Ellbogen und führte sie hinaus.
»Sprecht offen, Ibn Yakub. Eure Religion teilt viele unserer Vorschriften. Wenn Ihr an meiner Stelle gewesen wärt, hättet Ihr zugelassen, daß so ein wunderschönes Geschöpf vor dem Bab-el-Barkiya gesteinigt wird?«
Ich schüttelte den Kopf.
»Nein, Euer Hoheit, aber nicht wenige der Orthodoxen in meiner Glaubensgemeinschaft würden die Ansicht des ehrenwerten Kadis teilen.«
»Gewiß ist Euch klar, mein guter Schreiber, daß al-Fadil sie gar nicht töten lassen wollte. Darum geht es ja bei dieser ganzen Angelegenheit. Er wollte die Entscheidung mir überlassen. Weiter nichts. Hätte er ihren Tod gewünscht, so hätte er die Sache durchaus selbst regeln und mich erst dann davon unterrichten können, wenn es zu spät gewesen wäre. Indem er mich bat, sie anzuhören, stand bereits sein Entschluß fest, daß er sie nicht den grausamen Unwägbarkeiten eines rätselhaften Schicksals ausliefern wollte. Er kennt mich gut. Er war sich ziemlich sicher, daß ich sie am Leben lassen würde, und so konnte er mir die weichherzige Entscheidung überlassen, um sich seine harte, reine Position zu bewahren. Um der Wahrheit die Ehre zu geben, ich glaube, daß auch unser Kadi ihrem Zauber verfallen ist. Nun, ich denke, im Harem wird sie sicher sein.
Es war ein anstrengender Tag. Ihr werdet doch bestimmt das Brot mit mir brechen?«
Kapitel 4
Ein Eunuch tötet den großen Sultan Zinki, und das Schicksal wendet sich gegen Salah al-Dins Familie Shadhis Bericht.
Am folgenden Morgen begab ich mich zur vereinbarten Stunde zum Palast und wurde von Shadhi in die Bibliothek geführt. Da sich der Sultan nicht einfand, vertiefte ich mich in mir bis dahin unbekannte Bücher. Zu Mittag überbrachte mir ein Bote, dem Shadhi sich an die Fersen geheftet hatte, die Nachricht, der Sultan müsse sich um wichtige Staatsangelegenheiten kümmern und hätte an jenem Tag keine Zeit.
Als ich mich eben zum Gehen wandte, blinzelte mir Shadhi zu. Ich war auf der Hut vor diesem alten Mann mit dem gekrümmten Rücken, der so eitel war, seinen weißen Bart mit Henna zu färben, und dessen üppig eingeölte Glatze in der Sonne glänzte. Sicherlich stand mir die Verwirrung ins Gesicht geschrieben.
»Staatsangelegenheiten?«
Der Greis lachte auf. Es war ein krächzendes, lautes, derbes Lachen voller Argwohn, als beantwortete sich diese Frage von selbst.
»Ich bezweifle, daß der Beschützer der Schwachen die Zitadelle in Augenschein nimmt, wie es sich zu dieser Tageszeit geziemen würde. Eher erkundet er die Spalten und Ritzen des Mädchens mit den roten Haaren.«
Ich war wie vor den Kopf geschlagen, ohne recht zu wissen, ob das Shadhis Wortwahl bewirkt hatte oder die Botschaft als solche. Konnte das denn wahr sein? Der Sultan wurde wegen seiner Behendigkeit zu Pferde gerühmt, und so stieg in mir die Frage auf, ob er im Schlafgemach eine ebensolche Unbezähmbarkeit an den Tag legte. Und wie stünde es in diesem Fall mit Halima? Hatte sie seinem Drängen willig, kampflos nachgegeben, oder hatte sie ihn zumindest mit Worten um Geduld gebeten? Handelte es sich um Verführung oder Schändung?
Shadhis Aussage entsprach vermutlich den Tatsachen. Ich wollte unbedingt mehr erfahren, enthielt mich aber zugleich einer Erwiderung, um den alten Mann nicht zu weiteren Ausführungen zu ermuntern. Mein Verhalten verunsicherte ihn. Ihm war daran gelegen, eine gewisse Vertraulichkeit zwischen uns zu schaffen, so daß er sich durch mein Schweigen gekränkt fühlte. Rasch verabschiedete ich mich von ihm und ging nach Hause.
Zu meiner Verwunderung erwartete mich der Sultan am nächsten Morgen in der Bibliothek. Als ich eintrat, lächelte er, wollte aber unverzüglich beginnen und keine Zeit mit Höflichkeitsbekundungen verlieren. Vor meinem geistigen Auge tauchte kurz das Bild von Halima auf, doch schon zwang mich die vertraute Stimme des Sultans, meine Gedanken auf seine Worte zu richten. Meine Hand glitt über das Papier, getrieben von einer Kraft, die meine eigene bei weitem überstieg.
»Das Frühjahr in Baalbek war stets etwas Besonderes. Des Nachts glich der Himmel einer Decke mit eingewebten Sternen. Am Tag, im Lichte der herablächelnden Sonne, war er von einem durchdringendem Blau. Wir lagen im Gras und sogen den Duft der Mandelblüten ein. Als sich die Luft zunehmend erwärmte und der Sommer nahte, wetteiferten wir darum, wer sich als erster in den kleinen See wagen würde, welcher unaufhörlich von mehreren Bächen gespeist wurde. Er lag verborgen hinter einer Baumgruppe, und wir hüteten ihn wie ein Geheimnis, obwohl jeder in Baalbek um ihn wußte.
Eines Tages, wir tummelten uns gerade im Wasser, kam Shadhi auf uns zugelaufen. Damals vermochte er noch zu rennen, wenngleich nicht mehr so behende wie in seiner Jugend. Meine Großmutter pflegte uns zu erzählen, wie Shadhi in früheren Zeiten von einem Bergdorf zum anderen gerannt war, wobei er mehr als zwanzig Meilen zurücklegte. Er machte sich nach dem Morgengebet auf den Weg und kehrte rechtzeitig zurück, um meinem Großvater das Morgenmahl zu reichen. Das trug sich vor langer Zeit zu, damals, als wir noch in Dvin lebten, ehe unsere Familie nach Takrit übersiedelte.
Shadhi befahl uns, aus dem Wasser herauszukommen und möglichst schnell zur Zitadelle zu laufen. Unser Vater hatte nach uns geschickt. Shadhi beschwor uns und drohte mit schrecklichen Strafen, falls wir seinen Worten nicht unverzüglich Folge leisteten. Da sein Gesicht von Sorge gezeichnet war, schenkten wir seinen Worten Glauben.
Als Turanschah, mein älterer Bruder, nach dem Grund für die Eile fragte, funkelte Shadhi uns zornig an und erklärte ihm, es sei Aufgabe meines Vaters, uns über das Unheil in Kenntnis zu setzen, das über unsere Gläubigen hereingebrochen sei. Ernstlich besorgt, machten wir uns eilends auf den Weg. Ich erinnere mich, daß Turanschah etwas von den Franken murmelte. Falls sie vor den Toren standen, würde er sich in den Kampf wagen, selbst wenn er dafür ein Schwert stehlen müßte.
Während wir uns der Zitadelle näherten, drang das vertraute Geräusch wehklagender Weiber an unsere Ohren. Ich faßte nach Turanschahs Hand und blickte ihn ängstlich an. Shadhi hatte es bemerkt und deutete meine Unruhe richtig. Er setzte mich auf seine Schultern und beruhigte mich mit leisen Worten.
›Dein Vater lebt und ist wohlauf. Du wirst ihn sogleich sehen.‹