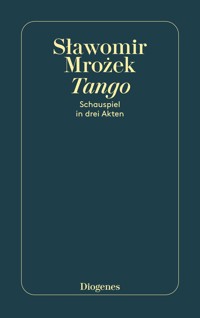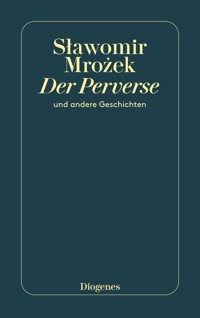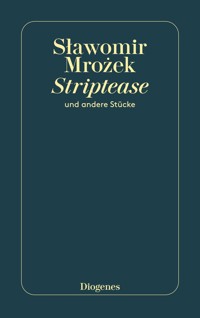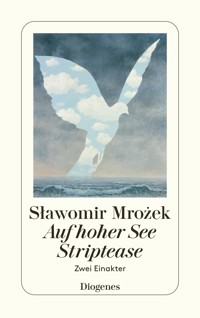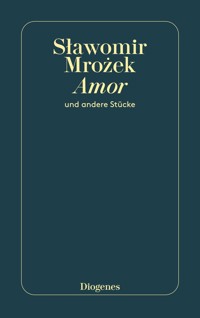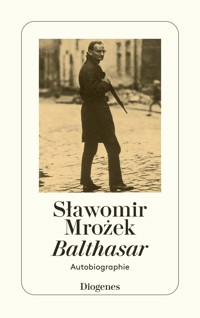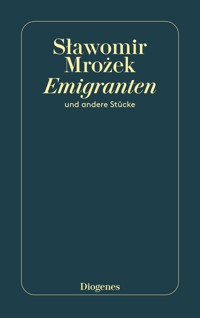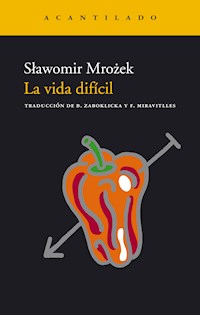7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
»Mrozek verzerrt, verfremdet, steigert Szenerie, Handlung, Figuren ins Absurde. Doch ist solche Absurdität keinesfalls nur auf das Politische beschränkt, reicht vielmehr ins Existentielle hinein. Dabei gewinnt sie, wie seine Erzählanthologie aus den Jahren 19861990 ( Die Geheimnisse des Jenseits) beweist, geradezu beckettsche Qualität.«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 204
Ähnliche
Sławomir Mrożek
Die Geheimnisse des Jenseits
und andere Geschichten
Aus dem Polnischen von Christa Vogel
Diogenes
Tee oder Kaffee
»Tee oder Kaffee?« fragte die Dame des Hauses.
Ich mag das eine wie das andere, und hier befahlen sie mir auszuwählen. Das hieß, sie geizten entweder mit Kaffee oder mit Tee.
Ich bin gut erzogen, also ließ ich mir nicht anmerken, daß ich einen derartigen Geiz verabscheue. Ich war gerade mitten im Gespräch mit dem Professor, meinem Tischnachbarn, den ich von der Überlegenheit des Idealismus dem Materialismus gegenüber überzeugte, und tat so, als hätte ich die Frage nicht gehört.
»Tee«, sagte der Professor, ohne zu zögern. Natürlich, dieses Mistvieh war ein Materialist und drängelte sich gleich an den Freßtrog.
»Und Sie?« wandte sie sich an mich.
»Entschuldigung, ich muß mal raus.«
Ich legte die Serviette hin und ging zur Toilette. Ich mußte überhaupt nicht, aber ich wollte überlegen und Zeit gewinnen.
Wenn ich mich für Kaffee entscheide, dann verliere ich den Tee und umgekehrt. Wenn die Menschen frei und gleich geboren werden, dann sind es Kaffee und Tee auch. Wenn ich Tee nehme, dann fühlt sich der Kaffee zurückgesetzt und umgekehrt. Eine solche Verletzung des Naturgesetzes des Kaffees, oder auch des Tees, widersprach meinem Gerechtigkeitsgefühl als der übergeordneten Kategorie.
Ich konnte aber nicht endlos in der Toilette sitzen, sei es auch nur deshalb, weil das nicht die reine Idee einer Toilette war, sondern eine allgemeine Toilette, beziehungsweise eine gewöhnliche Toilette mit Kacheln. Als ich ins Eßzimmer zurückkam, tranken bereits alle entweder Tee oder Kaffee. Mich hatte man ganz offensichtlich vergessen.
Das traf mich tief. Keinerlei Aufmerksamkeit, keinerlei Toleranz für das Individuum. Nichts kann ich so wenig leiden wie eine seelenlose Gesellschaft; ich lief also in die Küche, um die Menschenrechte einzufordern. Als ich auf dem Tisch einen Samowar mit Tee sowie eine Kaffeemaschine sah, erinnerte ich mich, daß ich das ursprüngliche Dilemma noch nicht gelöst hatte: Tee oder Kaffee, oder auch Kaffee oder Tee. Natürlich sollte man das eine oder das andere fordern, statt dem Kompromiß einer Wahl zuzustimmen. Ich bin aber nicht nur gut erzogen, sondern auch sehr zartfühlender Natur. Also sagte ich höflich zur Dame des Hauses, die in der Küche herumwirtschaftete: »Bitte halb und halb.«
Dann schrie ich: »Und ein Bier!«
Entwicklung
Das Leben ist eben so. Um mich zu zerstreuen, liebe ich es, Kakerlaken zu beobachten. Eine einzelne ist uninteressant, aber gemeinsam besitzen sie ein großes Potential.
Gestern zum Beispiel. Ich sitze in der Küche, rauche, und sie laufen herum. Sie laufen und laufen, bis sie sich in einem bestimmten Moment zu dem Meisterwerk Leonardo da Vincis Das letzte Abendmahl gruppieren. Ein Zufall? Nein, nur das unumgängliche unvermeidbare Gesetz der Entwicklung, die schöpferische Dynamik der Gruppe, die Evolution. Es genügt, daß die Gesellschaft läuft, und die Ergebnisse sind da.
Die Schwierigkeit lag darin, daß sie sofort auseinanderrannten. Leonardo dauerte nicht länger als eine Sekunde. Ich dachte, ich nehme ein Giftspray, warte, und wenn sie sich wieder zu irgendeinem Meisterwerk gruppieren, spritze ich und fixiere sie. Das Spray in der Hand, lag ich auf der Lauer.
Sie wieder hierhin und dorthin. Es huschte sowas wie Déjeuner sur l’herbe von Manet vorbei. Das ließ ich vorbei. Offensichtlich haben sie sich in der Entwicklung vorwärts bewegt und sind sozusagen schon im Impressionismus.
Ich hätte sie fixieren können, aber habe ich das Recht, ihre Entwicklung aufzuhalten? Der Impressionismus ist eine große Errungenschaft, aber wer weiß, wohin sie nicht gelangen, aber gelangen könnten.
Die Kubisten – habe ich vorbeigelassen.
Die Surrealisten – habe ich vorbeigelassen.
Ich hatte den Finger auf dem Spray, aber drückte noch nicht. Es ist bekannt, daß nach etwas Neuem etwas noch Neueres kommen muß, das heißt nach etwas Gutem etwas Besseres. Das ist also kein großes Unglück, daß Leonardo und die späteren auseinandergelaufen sind, im Gegenteil, es ist ein Fortschritt.
Wir waren schon in der Gegenwart. Nur das Allerbeste. Warhol zum Beispiel. Aber auch er ist nicht das letzte, schon fast ein Klassiker. Lauft weiter, meine Tierchen, und erlauft etwas, was noch nicht da war. Ich wartete auf die allergegenwärtigste Modernität, das heißt auf das, was das Allerbeste ist.
Aber was war das, ich sehe nichts mehr, nur Kakerlaken, die herumlaufen. Hatten sie sich erschöpft? Irgendeine Dekadenz? Der Niedergang der Kunst? Ich rieb mir die Augen, aber nichts außer Kakerlaken.
Oh, bin ich dumm. Wie kann ich etwas sehen, wenn ich mich noch nicht entwickelt habe. Sie sind sicher schon im 25. Jahrhundert (denn es war schon nach Mitternacht, und sie liefen schnell), und ich bin immer noch am Ende des 20. Jahrhunderts. Meine Wahrnehmungsfähigkeit ist nicht nachgekommen, das ist es.
Ich legte das Spray weg und ging schlafen. In die Küche komme ich erst wieder, wenn fünfhundert Jahre vergangen sind.
Schichtkuchen
Vorsichtig entfernten wir die dünne Schicht vulkanischer Asche, unter der sich etwas befand. Es erschien die Gestalt eines menschlichen Kopfes mit Brille. Dank der Eigenschaften des vulkanischen Bodens war er hervorragend erhalten, wie ein Gipsabdruck.
»Das ist wohl ein Japaner«, schätzte der Professor, der der bedeutendste Archäologe des 46. Jahrhunderts war.
Wir entblößten den Ex-Japaner bis zum Gürtel. In den versteinerten Händen hielt er einen versteinerten Fotoapparat. »Stimmt«, sagte der Professor, »Dynastie Nikon, Modell mit Laserautomatik, spätes 31. Jahrhundert.«
Anderthalb Meter unter dem Japaner fanden wir einen versteinerten dicken Mann in kurzen Hosen, ebenfalls mit einer Kamera.
»Asai, erste Hälfte 27. Jahrhundert.«
»Das heißt, auch ein Japaner.«
»Nein, der Apparat ist japanisch, der Mensch nicht. Das ist ein Europäer, vermutlich aus Bayern.«
Drei Meter tiefer eine Überraschung. Ein ganzer Autobus, zweistöckig, mit einer chemischen Toilette. An die sechzig Mann saßen da und fotografierten aus dem Fenster mit japanischen Apparaten. Der Autobus, die Passagiere, die Apparate, alles war versteinert. Der Professor rieb sich die Hände.
»Der größte Fund aus der Ära des späten Demokratos, den ich kenne. Ein unschlagbarer Beweis, daß im Norden unter der Schicht des Industriemülls osteuropäischer Herkunft einst eine Zivilisation bestand, die skandinavisch genannt wird.«
»Woher wissen Sie das?«
»Das ist ganz einfach. Der Autobus hat ein Stockholmer Kennzeichen.«
Unter den Ausflüglern fanden wir jemanden, den der Professor als Ankömmling aus Detroit, Michigan, USA identifizierte, Ende des 20. Jahrhunderts. Das fand er mittels deduktiver Methode heraus. Die Ausgrabungsstelle ließ sich als nichts anderes identifzieren, also konnte es nur das sein, wenn nicht etwas ganz anderes. Außerdem gab es Spuren internationaler Verschuldung in der vorderen Furche.
Der Amerikaner hielt mit beiden Händen einen japanischen Fotoapparat fest.
»Hier ist noch eine zusätzliche Hand«, bemerkte ich.
»Wo?«
»In seiner hinteren Tasche.«
Wir entfernten die Asche. Die Hand gehörte zu einem jungen Mann südländischen Typs, ebenfalls versteinert.
»Typisch für die mediterrane Kultur«, behauptete der Professor. »Die ausgebeulte Tasche weist darauf hin, daß ein Portemonnaie in der Tasche war. Das Ganze ist ein Beweis, daß sich die Katastrophe blitzschnell ereignete. Was halten Sie von all dem?«
»Ich denke, daß sie verschüttet wurden.«
»So ist es, in Zeitabständen, die dem nächsten Ausbruch des Vesuv entsprachen. Erst der Amerikaner am Ende des 20. Jahrhunderts. Dann nacheinander der Rest, die letzte Katastrophe fand vor tausendfünfhundert Jahren statt.«
»Aber was ist unter dem Amerikaner?«
»Pompeji. Eine antike römische Stadt aus dem 5. Jahrhundert der vorchristlichen Ära, die von einem Ausbruch des Vulkans in dem ersten Jahrhundert dieser Ära vernichtet wurde. Im 17. Jahrhundert entdeckt, wurde sie schon im 19. Jahrhundert zu einer Touristenattraktion. Der Tourist aus Amerika hat Pompeji am Ende des 20. Jahrhunderts fotografiert, als der Vesuv wieder ausbrach und den Amerikaner verschüttete. Es vergingen Jahrhunderte, und man grub den Amerikaner aus, der wiederum zu einer Touristenattraktion wurde. Bis diejenigen, die ihn später fotografierten, wieder verschüttet wurden. Man fand sie nach einiger Zeit, und neue Touristen haben sie wieder fotografiert. Die wurden wieder verschüttet. Einer der Touristen, die beim letzten Mal verschüttet wurden, war dieser Japaner. Der Vesuv ist seit fünfzehnhundert Jahren nicht mehr ausgebrochen. Aber was machen Sie denn da?«
»Ich fotografiere. Schließlich hat diese letzte Attraktion noch niemand fotografiert. Ich werde der erste sein.«
Aber bevor mir der Professor den Apparat aus der Hand reißen konnte, spie der Vesuv seine erste Rauchwolke.
Der Baum
Ich wohne in einem Haus nah an einer Straße. An dieser Straße wächst in der Kurve ein Baum.
Als ich ein Kind war, war die Straße noch ein Feldweg, das heißt staubig im Sommer, schlammig im Frühling und im Herbst, im Winter genauso mit Schnee bedeckt wie die Felder. Jetzt ist der Weg asphaltiert – für jede Jahreszeit.
Als ich jung war, befuhren Bauernkarren mit Ochsengespannen die Straße, und das nur zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang. Ich kannte sie alle, denn es waren Hiesige. Pferdegespanne fuhren seltener. Jetzt befahren Autos die Straße – Tag und Nacht. Ich kenne niemanden, sie erscheinen von irgendwoher und verschwinden irgendwohin.
Nur der Baum blieb derselbe, grün von Frühling bis Herbst. Er steht auf meinem Grund und Boden.
Ich bekam einen Brief von der Obrigkeit. »Es besteht die Gefahr«, stand in diesem Brief, »daß ein Auto an den Baum prallt, denn der Baum steht in einer Kurve. Deshalb muß er gefällt werden.«
Das bedrückte mich. Wo sie recht haben, haben sie recht. Der Baum steht wirklich in der Kurve, es fahren immer mehr Autos, und sie fahren immer schneller und immer unvorsichtiger. Eine Frage der Zeit, bis eins an den Baum prallt.
Ich nahm also eine Flinte, setzte mich unter den Baum, und sowie das erste ankam, schoß ich. Aber ich traf nicht. Dafür haben sie mich verhaftet und vor Gericht gestellt.
Ich habe dem Hohen Gericht erklärt, daß ich nur deshalb nicht getroffen habe, weil ich bereits schwache Augen habe, aber wenn sie mir eine Brille gäben, würde ich sicher treffen. Das half gar nichts.
Es gibt keine Gerechtigkeit. Es ist wahr, daß irgendein Auto an den Baum prallen und ihn beschädigen kann. Aber wenn sie mir eine Brille gäben und von Amts wegen Munition, dann würde ich da sitzen und ihn immer bewachen. Wieso denn gleich den Baum fällen, wo es doch andere Methoden gibt, ihn vor Unfällen zu bewahren?
Das würde sie nichts kosten, außer ein bißchen Munition. Ist das denn zuviel verlangt?
Hamlet
Der Intendant rief mich zu sich und sagte: »Ich gratuliere, wir haben beschlossen, Ihnen die Rolle des Hamlet anzuvertrauen.«
Wie jeder Schauspieler hatte ich immer davon geträumt, diese Rolle zu spielen. Also konnte ich mich vor Glück gar nicht fassen. Überschwenglich dankte ich dem Intendanten und versprach, alle Anstrengungen zu unternehmen, um mich der mir anvertrauten großen Aufgabe würdig zu erweisen.
Ich sollte schon mit den Proben beginnen, als mich der Intendant wieder zu sich rief. Er schien mir etwas bekümmert zu sein.
»Es ist ein gewisser Umstand eingetreten. Das Ensemble meint, daß es Begünstigung eines Individuums wäre, wenn man Ihnen die Rolle des Hamlet anvertraute.«
»Das heißt, daß jetzt jemand anderes den Hamlet spielt?«
»Nein, das wäre auch Begünstigung eines Individuums. Aber wir haben einen Ausweg gefunden. Hamlet spielen Sie und noch acht weitere Schauspieler. Mehr als neun Personen, die mehr oder weniger wie Hamlet aussehen können, haben wir zum Glück nicht im Ensemble.«
»Ich verstehe, das heißt, ich und noch acht andere spielen abwechselnd.«
»Nein, alle gleichzeitig.«
»Was? Gleichzeitig? Aber doch nicht in derselben Vorstellung?«
»Doch, in derselben, jeden Abend.«
»Aber das ist doch unmöglich! Neun Hamlets in einem Stück!«
»Ja.«
»Aha. Das heißt, der erste tritt ab, der zweite tritt auf, tritt ab, der dritte tritt auf und so weiter.«
»Nein, denn dann entstünde das Problem der Reihenfolge, und es ergäbe sich eine Verletzung der Gleichberechtigung. Niemand sollte der erste sein, niemand der zweite und auch nicht der neunte. Sie vergessen, daß alle gleiche Chancen haben müssen.«
»Wie dann also?«
»Im Chor.«
Ich fiel auf den Stuhl. Der Intendant stand auf, kam hinter dem Schreibtisch hervor und legte mir die Hand auf die Schulter.
»Kopf hoch! Gesellschaftlich ist das bestens, aber auch künstlerisch kann das eine große Errungenschaft werden. Wir haben schon einen Regisseur, der sich dessen annimmt, ein sehr interessantes avantgardistisches Experiment. Die Verteilung Hamlets auf neun Persönlichkeiten, Sie verstehen.«
»Ich verstehe. Die Psychologie von unten.«
»Wunderbar haben Sie das erfaßt.«
Dann beugte er sich zu mir nieder und fügte mit leiser Stimme hinzu: »Aber unter uns gesagt. Niemand verbietet Ihnen, lauter zu sprechen als die anderen.«
Die Proben fingen an. Es war ein bißchen eng in der Garderobe, und auf der Bühne stolperten wir übereinander, aber dafür entwickelte sich ein starker Kollektivgeist.
So kam es zur Premiere. Der erste Akt ging irgendwie über die Bühne, aber bei der Szene auf dem Friedhof fehlte für mich der Schädel des Yorick, weil der Requisiteur sich geirrt hatte und nur acht davon vorbereitet hatte. Also wollte ich einem Kollegen auf der linken Seite den Schädel wegnehmen, aber der wollte ihn mir nicht geben. So fielen wir gemeinsam ins Grab. Währenddessen begannen die oben sich auch zu schlagen, denn unser Schädel war oben geblieben, also waren da weitere acht Schädel, aber sie waren zu siebt, und jeder wollte zwei haben.
Es gab neun Fälle von allgemeinen Prellungen, fünf Gesichtsverletzungen und drei Fälle von Stichwunden. Wer wollte da behaupten, daß Hamlet die Tragödie eines Individuums sei?
Streit über das Altertum
Eines Tages unterhielten wir uns am Büfett über unseren Präsidenten. Der Buchhalter behauptete, daß der Präsident schon im Altertum bekannt war, nur daß er sich damals nicht Präsident, sondern Präsus nannte.
»Überhaupt nicht Präsus, sondern Krösus«, widersprach der Referent.
»Nein, eben Präsus, wir können wetten.«
Sie wetteten. Der Verlierer sollte die Rechnung bezahlen. Es vergingen einige Stunden, und die Diskussion war noch in vollem Gange.
»K-krösus war nie und nimmer der P-präsus«, bewies der Referent. »Sie irren sich. Der beste Beweis dafür ist, daß die Papuas Opas sein können, aber nie Opas Papuas.«
»Was für ein O.A.S.?«
»Ein Nackter ist kein Beknackter und ein P-pruses ist kein K-kruses.«
Die Situation wurde lästig. Es näherte sich der Zeitpunkt, wo das Lokal geschlossen wurde, und es war immer noch nicht klar, wer die Wette verloren hatte, und wer bezahlen sollte. Wir beschlossen, mit der Akademie der Wissenschaften zu telefonieren, damit die den Streit lösten. Es gab keinen anderen Ausweg.
Der Kellner meldete ein Ferngespräch an. Die Verbindung dauerte eine Weile, und als das Telefon klingelte, war es bereits tiefe Nacht. Das Gepräch führte der Buchhalter.
»Hallo«, rief er in den Hörer. »H-hier spricht ein L-liebhaber der A-antike. K-könnten Sie vielleicht gütigst informieren, w-wie sich im Altertum der P-präsus nannte?«
Die Antwort war kurz. Der Buchhalter legte den Hörer auf, sah uns an und sagte: »Meine Herren, weder Krösus noch Präsus.«
Weiter wollte er nichts sagen. Wir ahnten, daß den Anruf irgendein Nachtwächter entgegengenommen hatte. Denn kein ernsthafter Professor hätte so ein Wort je benutzt.
Demiurg
Ein früher Morgen, eine Kastanienallee. In dieser Nacht sind wieder die Blätter gefallen. Später kommen die Stadtreinigungsmänner, und es herrscht wieder Ordnung. Erst mal herrscht keine.
Ich gehe, und mir entgegen kommt ein kleines Mädchen. Lila Strümpfe, ein Schulranzen; schlurft es absichtlich im Laub, um zu hören, wie die Blätter rascheln? Um mit dem Rascheln zu laufen? Ich gehe normal, ich raschle nicht.
Sie geht in die eine Richtung, ich in die andere. Sie geht an mir vorbei, ich gehe an ihr vorbei, wir beide gehen an einem Garten vorbei, in dem Garten ist ein Café. Am Tisch sitzt irgendein Herr, ein eher älterer Herr, und winkt uns zu.
Normalerweise hätte ich dem keine Aufmerksamkeit geschenkt und wäre weitergelaufen. Aber das kleine Mädchen blieb stehen, also blieb ich auch stehen. Wir blieben gemeinsam stehen, wenn auch unabhängig voneinander.
»Setzen Sie sich doch einen Augenblick zu mir«, ruft der da. »Ich lade Sie beide ein!«
Normalerweise hätte ich mich nicht gesetzt. Ich mag keine Aufdringlichkeit, meistens wollen die irgendwas, wenn sie sich anbiedern, und warum sollte ich für andere was erledigen. Aber sie ging in den Garten und setzte sich zu dem Herrn. Also ging ich auch hinein und setzte mich. Ich konnte sie ja schließlich nicht mit dem ersten besten Unbekannten allein lassen.
Sie baumelte lässig mit den Beinen, sie reichten nicht bis zum Boden, und sah sich um. Ich baumelte mit dem einen über das andere geschlagene Bein, nervös, aber ich sah mich nicht um. Ich sehe mich schon seit langem nicht mehr um, weil ich von vornherein weiß, was ich sehen werde. Oder es scheint mir, daß ich es weiß.
Er bestellte für mich ein Eis, für das kleine Mädchen ein Bier.
»Das ist wohl ein Irrtum«, erhob ich Einspruch. »Es sollte umgekehrt sein.«
»Normalerweise wäre es ein Irrtum, aber ich mache ein Experiment. Erlauben Sie, daß ich mich vorstelle. Ich bin Regisseur.«
»Vom Theater?«
»Nein, von Menschen. Eine Art Demiurg, ich inszeniere Situationen.«
»Eine Art Verrückter«, dachte ich und sagte: »Sehr angenehm.«
Normalerweise wäre ich aufgestanden und gegangen, aber nun war ich schon sein Gast, und mir lag viel an dem kleinen Mädchen.
»Wissen Sie, was ein Demiurg ist?«
»Irgendwas Griechisches.«
»Der schöpferische Geist. Laut den Anhängern der platonischen Schule macht er alles, damit es so gut wie möglich wird. Laut den Gnostikern umgekehrt, er macht alles, damit es so schlecht wie möglich wird.«
»Sind Sie der eine oder der andere?« fragte ich, um das Gespräch aufrechtzuerhalten. Das kleine Mädchen hielt nichts aufrecht, sondern zog einen kleinen Plüschtiger aus der Tasche und legte ihn auf den Tisch neben den Salzstreuer.
»Weder der eine noch der andere. Mich interessieren nur Experimente.«
Der kleine Tiger hatte einige kahle Stellen.
»Wissen Sie, was ein Experiment ist?«
»Das ist so was, was nicht normal ist.«
»Normen interessieren mich nicht. Ich nehme zwei Elemente, die sich gewöhnlicherweise nicht treffen, stelle sie zusammen und sehe zu, was sich daraus ergibt.«
Soll er doch. Ich würde lieber mit ihr als mit ihm reden, selbst neben ihr zu sitzen wäre gut. Mechanisch frage ich: »Und wozu?«
»Sie verstehen das nicht. Sie sind kein Demiurg.«
»Nein«, erkläre ich mich einverstanden. »Das ist nicht meine Spezialität.«
»Das ist nicht jedem gegeben. Eine höhere Rasse.«
»Zweifellos«, bejahte ich. Das kleine Mädchen legte ein Stück Brötchen vor den Tiger, aber der kleine Tiger fraß nichts. Ich mußte mich um jeden Preis mit diesem Typen unterhalten.
»Sind Sie das schon seit langem?« fragte ich überfreundlich.
»Schon immer.«
»Und wie sind Sie darauf gekommen?«
»Ich bin nicht darauf gekommen«, entgegnete er beleidigt. »Ich bin so geboren.«
Ich wußte nichts zu sagen. Wenn die Kellnerin mit der Bestellung zurückgekommen wäre, hätte sie mich aus der Verlegenheit gerettet, wenn auch nur vorübergehend. Aber je länger sie nicht zurückkehrte, desto länger konnte ich mit dem kleinen Mädchen zusammen sein.
»Sie haben sich selbst geboren?« fragte ich blöde, nur um was zu sagen.
»So ist es. Ich mich selbst.«
»Ja, ja, eigenhändig.«
Das kleine Mädchen hörte auf, sich mit dem Tiger zu beschäftigen. Sie hatte was in der Baumkrone erspäht und sah aufmerksam dorthin. Ich wollte ungemein gerne sehen, was es war, aber ich konnte es nicht, weil die Höflichkeit es erforderte, den Blick nicht vom Gesprächspartner zu wenden.
»Gewöhnlich verhalten sich die Leute mechanisch, das heißt entsprechend der geltenden Sitten und Konventionen. Und auf diese Weise verbergen sie die Wahrheit über sich.«
»Wie wahr«, seufzte ich. Was konnte das bloß sein? Ein Eichhörnchen?
»Und ich erlaube ihnen, indem ich sie aus der Konvention herausstoße, diese Wahrheit zu entdecken.«
»Sicher ein Eichhörnchen«, sagte ich mechanisch.
»Bitte?«
»Nichts, nichts, Entschuldigung, das ist mir so rausgerutscht.«
»Sie hören mir nicht aufmerksam zu.«
»Wieso denn, woher …«
Zeigen sich um diese Jahreszeit noch Eichhörnchen, bevor sie sich in den Winterschlaf begeben? Schlafen Sie im Winter? Wie schade, daß ich kein fleißiger Schüler war, als sie mir das beigebracht haben.
»Ah, endlich!« rief er laut und rieb sich die Hände. »Gleich werden wir uns überzeugen können.«
Ich drehte mich um und erblickte die Kellnerin. Sie brachte Kaffee und eine Flasche Mineralwasser. Das Wasser stellte sie vor mich, den Kaffee vor das kleine Mädchen.
»Was machen Sie denn da?« schrie er.
Sie stellte um, den Kaffee vor mich, das Wasser vor das kleine Mädchen und ging weg.
»Aber nein, darum geht es doch nicht! Ich habe was völlig anderes bestellt, ich habe ganz deutlich bestellt, es sollte ein Bier und ein Eis sein! Hallo, hallo!«
Die Kellnerin verschwand.
»Was für eine Bedienung, ein Skandal! Entschuldigen Sie, ich komme gleich zurück, ich muß das mit der Direktion des Lokals klären.«
Er stand auf, lief los und verschwand ebenfalls. Es herrschte peinliche Stille.
»Magst du Eichhörnchen?« fragte ich.
Das kleine Mädchen sah mich an. Darauf nahm sie den Tiger vom Tisch und steckte ihn in die Schürzentasche. Sie stand auf und ging zum Ausgang des Gartens.
Ich rührte mich nicht vom Fleck. Wie hätte ich den Passanten erklären können, daß ich nicht pervers bin. Und vor ihr schämte ich mich auch.
Ich wartete, bis sie auf der Straße war, sie ging am Zaun entlang, und erst als sie verschwunden war, stürzte ich los. Ich hatte große Angst, daß er zurück wäre, bevor ich fliehen konnte, aber glücklicherweise kam er nicht zurück. Er kam ganz sicher zurück, aber da war ich schon nicht mehr da.
Als ich mich wieder auf der Allee befand, sah ich sie nirgends mehr. Ich setzte meinen Weg fort, mit den Beinen in den trockenen Blättern schlurfend.
Majers Dilemma
»Alles Unglück«, sagte Nowosqdecki, »kommt daher, daß die Erde rund ist. Wo du auch immer losgehst, du entfernst dich genauso weit von dem Ort, von dem du ausgegangen bist, wie du dich ihm näherst. Genauso viel.«
»Woher soll ich eine quadratische Erde für dich hernehmen«, erwiderte Majer.
»Im besten Fall könntest du mir nur eine sechseckige besorgen, keine quadratische. Wir leben ja schließlich in drei Dimensionen, nicht in zwei.«
»Nowosqdecki hat recht«, unterstützte ihn Puszcz Białowieski und sah in die Ferne.
»Außer der Länge und der Breite hat alles auch noch eine Höhe, selbst wenn es niedrig ist, zum Beispiel Majers Stirn. Und selbst wenn du mir eine sechseckige Erde gäbest«, nahm Nowosqdecki den Faden wieder auf, »ein Sechseck hilft auch nichts. Du würdest einmal herum laufen und auch wieder bei dir ankommen, genauso wie auf einer Kugel. Ein geometrischer Körper bleibt ein geometrischer Körper, egal ob er rund oder sechseckig ist.«
»Dann ziehe ich es schon auf einer Kugel vor.«
»Warum?«
»Bei einem Rechteck ist es auf den Kanten unbequem.«
»Idiot«, wandte sich Nowosądecki an Puszcz. »Er sieht das Problem nicht.«
»Sieht er nicht«, stimmte Puszcz zu.
»Habt Ihr keine größeren Sorgen?«
»Nein, weil, die größte Sorge ist die runde Erde. Wenn die Entfernung von irgendeinem Punkt gleichzeitig die Annäherung an diesen Punkt bedeutet, was ergibt sich daraus?«
»Weiß ich nicht«, gestand Majer ein.
»Daß es sich nicht lohnt, aus dem Hause zu gehen. Und zu Hause ist es langweilig.«
»Na, und was für einen Ausweg gibt es?«
»Es gibt keinen Ausweg. Nur eine radikale Rückkehr zur Erde als einer auf dem Ozean schwimmenden Schildkrötenschale, beziehungsweise als einer Ebene, die auf vier Elefanten gestützt ist, würde diese Situation retten. Zwar würdest du, wenn du aus dem Haus gingest, riskieren, daß du in den Ozean fällst oder vor die Füße des Elefanten, aber in jedem Fall wäre das etwas Neues, das heißt eine Abwechslung.«
»Na, warum dann nicht?« begeisterte sich Majer.
Puszcz wandte den Blick gen Himmel und seufzte.
»Ich habe keine Kraft mehr«, sagte Nowosądecki zu Puszcz. »Vielleicht sagst du es ihm?«
»Hoffnungslos«, weigerte sich Puszcz.
»Ich will es versuchen«, nahm Nowosądecki alle Kräfte zusammen. »Das ist zwar ein Kollege, aber auch ein Mensch. Also hör zu, Trottel: Weder zur Schildkröte noch zu den Elefanten gibt es eine Rückkehr, weil die moderne Wissenschaft über jeden Zweifel hinaus bewiesen hat, daß die Erde rund ist. Verstehst du es jetzt?«
»Und wenn ich sie nun … diesen …«
»Wen?«
»Diese moderne Wissenschaft … den da … na ihr wißt, was der da …«
Nowosądecki wandte sich an Puszcz.
»Hast du das gehört?«
»Ja. Nicht zu glauben.«
»Ich verliere wohl endgültig die Geduld.«
»Du kannst ihn nicht so stehenlassen.«
»Ich kann nicht«, gestand Nowosądecki ein. »Diese Sache ist eine nationale. Weißt du, wer bewiesen hat, daß die Erde eine Kugel ist?«
»Woher soll ich das wissen?« verteidigte sich Majer. »Ich war nicht dabei.«
»Kopernikus. Jedes Kind sagt dir das. Und weißt du, wer Kopernikus war?«
»Frag nicht, sag es ihm gleich, schade um die Zeit.«
»Ein Pole! Dadurch wurde er auf der ganzen Erdkugel berühmt. Und als seine Landsleute sind wir es bei dieser Gelegenheit auch. Und du willst ihn … willst ihn was? Wen würdest du wollen, Kopernikus? Einen Polen? Ein Pole einen Polen?!«
»Na, dann bitte ich um Entschuldigung«, entschuldigte sich Majer.
»Na, das denke ich auch! Wenn er ein Deutscher oder ein Russe wäre, dann natürlich, dann könntest du. Aber so?«
»Mir scheint, sie machen auf«, sagte Puszcz, der seit gewisser Zeit wieder in die Ferne geblickt hatte.