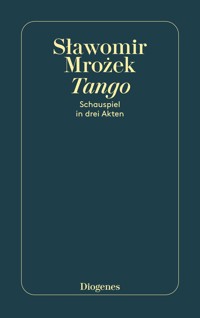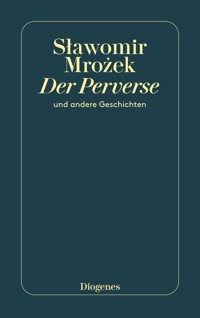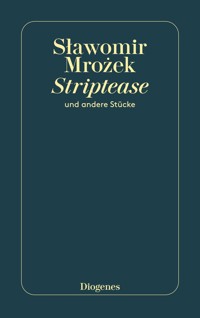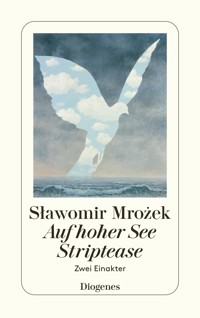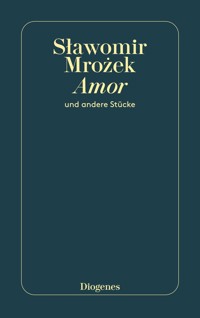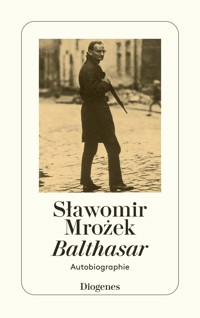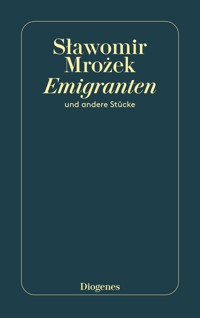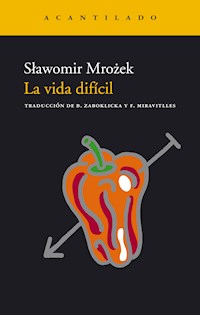7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Von der düsteren Parabel über die ›condition humaine‹, über verspielte, scheinbar naive Geschichten bis hin zu slapstickartigen Fabeln reicht Mrozeks Erfindungsgabe. Bei aller Unterschiedlichkeit der Themen ist den Texten eins gemeinsam: der hintersinnige Humor und das Vergnügen am Skurrilen, das Mrozeks ganzes Werk auszeichnet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 324
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Sławomir Mrożek
Die Giraffe
und andere Geschichten
Aus dem Polnischen von Christa Vogel und Ludwig Zimmerer
Diogenes
Brustpanzer – praktisch
Ich bin ein altes Subjekt und habe viele schwer verkäufliche Waren in meinem Leben gesehen, aber so etwas … Als wir die Pakete des letzten Transports aufmachten, ließ der metallene Glanz vermuten, daß es sich um Aluminiumtöpfe handelte. Indessen – weiß der Teufel, was in der Zuteilung oder Planung passiert war.
Unser Warenhaus bekam vierhundert neue Brustpanzer, Modell 16. Jahrhundert, seinerzeit von den Landsknechten benutzt. Anscheinend waren sie für den Fundus irgendeines Theaters bestimmt, aber selbst wenn dies der Fall gewesen sein sollte, wozu braucht ein Theater so viele Brustpanzer?
Es gab aber keinen Ausweg. Ware ist Ware und muß verkauft werden. Unser Kollege Eugeniusz, den wir als Reklamespezialisten schätzten, packte einige Brustpanzer ins Schaufenster und versah sie mit folgenden Slogans:
»Ein Brustpanzer gehört in jedes Haus.«
»Ob Pfadfinder oder Schornsteinfeger – alle sind sie Brustpanzerträger.«
»Weder Pferdchen noch Läufer hilft – hast du keinen Brustpanzer als Schild« (Parole für die Schachspieler).
Zunächst einmal aber verlangte niemand Brustpanzer. Im Gegenteil – die Kunden reagierten auf Brustpanzer geringschätzig und sogar mit Heiterkeit. Die weiteren Maßnahmen des Kollegen Eugeniusz halfen auch nichts. Er machte bekannt, daß jeder zehnte in unserem Warenhaus erworbene Brustpanzer sozusagen als Prämie ein Krakauer Hütchen mit einer Pfauenfeder und jeder zwölfte einen Federkasten mit der Aufschrift »Andenken aus Zakopane« gewinnen würde. Indessen näherte sich die Zeit der Inventur, und die Situation wurde ernst.
Damals gerade wurde ein alter Mann bei uns vorstellig, der uns im Falle, daß wir ihm den käuflichen Erwerb eines Teekessels zugänglich machten, den Verkauf des gesamten Brustpanzervorrats abnehmen wollte. Der Vorschlag wurde angenommen.
Der Alte begann mit einer geheimen Konferenz bei Herrn Eugeniusz, und am Tage darauf, zur Zeit des größten Betriebs, erschien er im Warenhaus, ging zum Ladentisch und sprach den Kollegen Eugeniusz an:
»Zwanzig Brustpanzer bitte.«
»Wir verkaufen leider nur zwei Stück auf einmal.«
»Aber ich brauche zwanzig.«
»Bedaure, das ist ausgeschlossen.«
Als erster wurde ein düster aussehender blonder Mann mit eingedrückter Nase auf sie aufmerksam. Er blieb daneben stehen und hörte neugierig zu.
»Bitte wenigstens fünfzehn Stück, ich habe Kinder«, flehte der Alte.
»Ich kann nicht, lieber Herr, ich kann nicht«, schlug sich der Verkäufer an die Brust.
Schon nach kurzer Zeit umringte sie eine kleine Menschenmenge. In der Mitte lag der Alte auf den Knien und bettelte mit Tränen in den Augen um fünf Brustpanzer. Eugeniusz verbarg das Gesicht in seinen Händen, aber er gab nicht nach.
»Wohin drängeln Sie denn so?!« rief plötzlich der düstere Blonde.
Als ich am nächsten Tag am Trödelmarkt vorbeikam, bemerkte ich den düsteren Blonden, der monoton rief:
»Plastische, elastische Brustpanzer, praktische Brustpanzer!!!«
In der Mittagspause kam der Kollege Eugeniusz außer Atem mit verrutschter Krawatte zu mir und bat um eine Hilfskraft. Die ersten Posten Brustpanzer waren verkauft. Einige Kunden verließen uns mit dem Ausdruck deutlicher Zufriedenheit auf den Gesichtern, glänzend in den stählernen Rümpfen, andere dagegen schlichen sich in bloßen Jacketts gedemütigt hinweg, trösteten sich aber mit der Aussicht, am nächsten Tag zu kommen.
Der Vorrat ging bald zu Ende. Im Park und auf den Straßen tauchten junge Leute in eleganten Brustpanzern auf. Wenn sie einen Bekannten trafen, zwinkerten sie mit einem Auge und sagten lässig:
»Wo ich ihn gekauft habe? Privat. Wieviel er gekostet hat? Naa, natürlich …«
Der Alte wurde mein Freund, und wir verplauderten gern die Zeit. Und eines Tages, als wir in der Weichsel Fische angelten, hörten wir so ein Gespräch:
»Wohin gehen Sie denn, Frau Modrzejewska?«
»Ins Warenhaus.«
»Wozu? Da gibt es nix! Ich war gestern da, ich habe nach diesen Brustpanzern gefragt. Es gibt nix, hören Sie? Nix, nix!«
Der Fall Leutnant C.: Erzählung des Arkady N.
Wahrscheinlich sind viele unter uns – begann Arkady N., langjähriges Mitglied des hundertköpfigen Männerchors »Polnischer Äol« – auf Fälle gestoßen, die man für Erscheinungsformen von Vetternwirtschaft zu halten hat. Um zu beweisen, wie wenig nützlich eine solche Vetternwirtschaft für das vernünftige Funktionieren einer gegebenen Institution ist, sondern wie verhängnisvoll sie im Gegenteil für den Protegierten selbst sein kann, erzähle ich die folgende Geschichte:
Es war vor fünfzig Jahren. Der Vorsitzende des Gesangvereins »Polnischer Äol« war damals Herr B., ein bekannter Mann, in Wien gern gesehen. Der Vorsitzende B. hatte einen Neffen, den Leutnant C. Leutnant C. verlor bei der Explosion eines Pulvertönnchens sein Gehör, beschloß aber, sich der Gesangskarriere zu widmen. Dank der Stellung seines Onkels, des Vorsitzenden B., trat Leutnant C., seiner Uniform entsagend, in die Sängergemeinschaft »Polnischer Äol« ein. Leutnant C. hatte überhaupt kein Gehör. Die einzige Melodie, die er noch aus Kriegszeiten kannte, war »Töchterchen, was hast du mit dem Husaren«. Dieses Lied sang er, wann immer unser Chor auftrat, ohne Rücksicht auf das Programm. So ist es verständlich, daß bei einem solchen Sachverhalt seine Hoffnungen auf eine rasche Karriere trügerisch gewesen wären, wenn ihm nicht ein gewisses Ereignis zu Hilfe gekommen wäre.
Aufgrund eines Feuers nämlich begann Leutnant C. zu stottern. Er sang jetzt also nicht mehr »Töchterchen, was hast du mit dem Husaren«, sondern »Tttöchch-tt-errrchhen, wwww-as-hahaha-hasttt dddu mmmit ddem Huhuhusssaren«. Dank dieses glücklichen Verlaufs von Umständen waren die Worte seines Liedes nicht mehr so deutlich zu verstehen, sondern zogen sich über einzelne Konsonanten hin. Deswegen gelang es uns oft, ihn zu übertönen, wenn unser Chor zum Beispiel das feierliche »Veni Creator« oder »Bei Morgen- oder Abenddämmerung« sang. Natürlich mußten wir immer forte singen.
Auf diese Weise verbesserte sich die Position des Leutnants C. in unserem Chor erheblich. Bei einigen Auftritten klappte es sogar so vorzüglich, daß das Publikum ihn gar nicht hörte. Aber es bleibt zu bezweifeln, ob Leutnant C. sich ohne eine gewisse Schicksalsfügung so durchgesetzt hätte. Unter dem Einfluß eines Schocks nämlich, verursacht durch eine elementare Niederlage, verlor Leutnant C. seine Stimme.
Von nun an stand es bereits außer jedem Zweifel, daß er Karriere machen würde. Er präsentierte sich hervorragend – ein stattlicher Mann mit breiten Schultern, er stand immer in der Mitte, in der ersten Reihe. Seine rabenschwarzen, zur Seite gekämmten, glänzenden Haare und das weiße Vorhemd des tadellosen Fracks zogen die Aufmerksamkeit auf sich. Ohne einen Laut von sich zu geben, bewegte er den Mund nach dem Takt. Selbstverständlich machte das in unserem hundertköpfigen Chor keinen Unterschied, und niemand warf uns vor, daß nur neunundneunzig sangen. Außerdem war ein für alle Mal Schluß mit »Töchterchen, was hast du mit dem Husaren«, und wir vergaßen das Lied sogar allmählich.
Leutnant C. begab sich auf den Weg von Erfolg zu Erfolg. Der Vorsitzende B. verlieh ihm durch Vermittlung des Fürsten V. eine hohe Auszeichnung. Dieser Orden in goldener Ausführung sah auf der Brust des Leutnants C., auf dem Hintergrund der breiten, dunkelblauen Schärpe, besonders effektvoll aus. In Verbindung mit dem Glanz seiner hervorragenden weißen Zähne brachte er ihm allgemeine Beachtung und Anerkennung ein. Man darf dabei auch nicht vergessen, daß unser Chor, nachdem er jenes »Töchterchen, was hast du mit dem Husaren« losgeworden war, in kürzester Zeit beachtliche Fortschritte machte. Deshalb drang der Name des Leutnants C. um so leichter in die Rezension. Bald danach begann man nur noch über ihn Rezensionen zu schreiben, man lobte seine Stimme und Gesangstechnik. Natürlich war das ein Mißbrauch, weil keiner der Rezensenten seine Stimme hören konnte.
Jahre vergingen. Man huldigte nicht nur seiner Kunst, sondern auch seiner Bescheidenheit, da Leutnant C. aus bekannten Gründen nie ein Interview gab. Seine Schweigsamkeit bei privaten Gesprächen hielt man seiner Sorge um seine Stimme zugute. Schließlich gelangte Leutnant C. selber zu der Überzeugung, er sei ein echter, berühmter Sänger. Dank seines Onkels, des Vorsitzenden B., konnten wir ihm nichts abschlagen. Als er eines Tages versprach, auf einer Namenstags-Gartenparty beim Baron D. zu singen, mußten wir neunundneunzig Mann dort alle zusammen hingehen, um mit ihm auf dem Rasen, im Schein der Lampions, die an den alten Ahornbäumen hingen, »O wunderschöne stille Mainacht« und »Auf deinem Schwanenschoß, dem zitternden« zu singen. Danach gratulierten ihm, ihm allein, alle Versammelten, Baron und Baronin eingeschlossen, zu dem Erfolg. Ein anderes Mal, als er nicht zur Probe kam, weil er sich erkältet hatte und heiser war, mußten wir warten, bis er wieder gesund war, obwohl seine Anwesenheit natürlich gar nicht so notwendig war.
Jahre vergingen. Der Vorsitzende B. starb und wurde auf dem Friedhof in N. beigesetzt, und an seinem Grab sang sein Neffe, Leutnant C., vor der Trauergemeinde angeblich herrlich das »Requiescat in pace«. Natürlich stand er in der ersten Reihe unseres Chors »Polnischer Äol«. Über dieses »Requiescat« wurde nachher noch lange gesprochen. Es war dies wirklich der beste Auftritt des Leutnants C. Alles, was nach dem Tod seines Onkels, des Vorsitzenden B., geschehen sollte, kündigte den unvermeidlichen Abstieg unseres Sängers an.
In seiner Verblendung nahm er eine Einladung zu einem Gastspiel in der Stadt P. an. Auf dem Bahnhof erschienen nur noch Sechsundsechzig von uns. Schließlich lebte ja der Vorsitzende B. nicht mehr.
Als nächstes wollte er auf dem Empfang des Grafen Y. singen. Das alte Faktotum des Grafen, ein ungewöhnlich gewissenhafter Mensch, der vor jedem Empfang selbst die Löffelchen, die gedeckt wurden, zählte, zählte auch die Chormitglieder, die mit Leutnant C. gekommen waren. Es stellte sich heraus, daß wir unser siebenundzwanzig waren.
Leutnant C. erkannte schließlich seine Situation. Aber er konnte seinen Ruhm, den er nur durch Protektion gewonnen hatte, nicht mehr verhindern. Er bekam weiter Einladungen zu Empfängen, und ich habe sogar den Verdacht, einige, wenn auch nicht alle, aus purer Boshaftigkeit. Aber er galt bei verschiedenen einflußreichen Persönlichkeiten weiterhin als ausgezeichneter Künstler.
Bis schließlich der Tag seines ersten Jubiläums herankam. Das Jubiläum seiner Arbeit auf dem Gebiet der Kunst. Der Saal der Philharmonie war voll. Man hatte den Jubilar mit Blumen geschmückt und Reden auf ihn gehalten, schließlich bat man ihn, er möge etwas singen. Und es geschah, was geschehen mußte. Von dem ganzen singenden »Polnischen Äol« stand ihm nur ein einziges Chormitglied zur Seite und obendrein ein fatal heiseres. Leutnant C. zuckte ratlos mit den Schultern, als er dem riesigen Publikum von Angesicht zu Angesicht gegenüberstand. So endete seine Karriere.
Der Bürger Arkady N. hatte seine Erzählung beendet. Wir saßen schweigend da. Schließlich stand Arkady auf und sagte:
Heute ist gerade der Tag des zweiten Jubiläums von Leutnant C., dem Opfer der Protektion auf dem Gebiet der Kunst. Laßt uns aufstehen und ein Lied singen. Vielleicht kommt Leutnant C. gerade die Straße entlang und sieht durchs Fenster, wie wir singen? Soll sich der Alte noch einmal ausleben.
Wir standen auf und sangen: »Wie schnell die Augenblicke vergehen.«
Stabskapitän Hippolyt
Oh, nein! Er wurde nicht sofort Stabskapitän. Als man ihn zum Dienst in die Kaiserliche Armee einzog, im Jahre 1844, war er noch nicht einmal Stabsleutnant. Was rede ich! Noch nicht einmal Stabskorporal, noch nicht einmal Stabsgefreiter. Er beabsichtigte, Philosophie zu studieren.
Erst zu Beginn des Jahres 1854 erhielt er die erste Auszeichnung. Eine Kanone fuhr ihm übers Bein, und er wurde in der Liste der Verwundeten erwähnt.
Anfangs erhielt er Briefe von Freunden. Das Kasernentreiben füllte sein Leben aus. Hinlegen, Aufstehen, »Es lebe das Allergnädigste Herrscherhaus«-Schreien.
Er stumpfte ab.
Im Jahre 1859, vor der Parade, erlaubte man ihm nicht, eine Brille zu tragen. »Wozu?« wurde er gefragt.
Sein Leben war rauh und streng. Im Jahre 1867 stieß ihn ein Pferd von der Lafette. Er begann, sein Gedächtnis zu verlieren.
Von den menschlichen Gefühlen blieb ihm nur noch eine heiße Liebe zu Tieren.
Im Jahre 1872 zog er aus Versehen Socken an. Man schickte ihm zwei Regimenter berittener Gendarmerie auf den Hals. Sie überfuhren ihn. Er genas im Militärspital.
Im Jahre 1880 starb er, erhielt aber eine erneute Einberufung. Er mußte sich stellen.
Er war schon ganz hart geworden. Als er im Jahre 1893 in seinen ersten Urlaub fuhr, forderte er zum Mittagessen nur Wasser aus dem Sumpf.
Noch im Jahre 1914 benutzte man ihn als Achse im Fahrzeugpark.
Danach hat nie wieder jemand etwas vom Stabskapitän Hippolyt gehört.
So eine Geschichte ist das.
Der Bericht
Weil es halt in unserem gottverlassenen Dorf an Aufklärung fehlt, steckt alles voller Aberglaube. So müßte ich jetzt eines dringenden Bedürfnisses wegen auf den Hof hinaus, aber dort flattern, wie Blätter im Oktober, ganze Scharen von langohrigen Fledermäusen herum; an die Fensterscheiben schlagen sie mit ihren Flügeln, und ich hätte Angst, daß mir eine davon, Gott bewahre!, in die Haare geriete. Also sitze ich da, kann nicht hinaus, obwohl es mir sehr pressiert, und schreibe an Euch, Genossen, meinen Bericht.
Was die Getreideablieferung betrifft: Seitdem der Teufel in der Mühle erschienen ist und mit seiner Mütze gegrüßt hat, sind die Ablieferungen zurückgegangen. Eine farbige Mütze war es: rot, weiß, blau, mit der Aufschrift »Tour de la Paix« auf französisch. Seither machen die Bauern einen Bogen um die Mühle; der Mühlenleiter und seine Frau aber tranken sich aus Kummer einen Rausch an, und schon schien es, als bliebe alles beim alten, da übergoß der Müller die Müllerin mit Wodka und zündete sie an. Er selbst trieb sich dann herum und landete schließlich an der Volkshochschule, wo er jetzt Marxismus studiert, denn er hat, wie er sagt, genug vom Irrationalen und möchte dem etwas entgegenzusetzen haben. Die Müllerin aber ist verbrannt, und wir haben jetzt einen Nachtmahr mehr.
Ihr müßt nämlich wissen, daß es bei uns nachts ganz merkwürdig weht und weht – das Herz krampft sich einem zusammen davon. Die einen meinen, es sei der Geist des armen Karas, der sich auf diese Weise über die Kulaken beklagt, andere sagen, es sei der Kulak Krzywdoń, der nach seinem Tode noch über die Pflichtablieferungen jammert. Normaler Klassenkampf also! Ausgerechnet meine Hütte steht ganz einsam am Walde. Die Nacht ist schwarz, der Wald ist schwarz, und meine Gedanken gleichen Raben. Neulich saß mein Nachbar Jusienga auf einem Baumstrunk am Waldrand und las die »Horizonte der Technik«; da fuhr ihm etwas ins Kreuz, daß er drei Tage lang nicht stehen und gehen konnte.
Ratet uns, Genossen! Wir sind da ganz allein mitten auf dem Land und rings um uns her nur Meilensteine und Grabhügel.
Ein Förster hat mir erzählt, daß bei Vollmond auf den Waldwegen und Schneisen Köpfe ohne Rümpfe herumtollen, einander nachjagen, sich an die kalte Stirn klopfen und heulen, als ob sie irgendwohin wollten. Sobald es dämmert, ist alles verschwunden. Dann rauschen nur die Tannen, aber ganz leise, weil auch sie Angst haben. Du guter Gott! Für nichts in der Welt würde ich jetzt hinausgehen, und wenn ich noch sosehr müßte.
Und so ist es mit allem. Ihr sagt zu uns: Europa. Aber wenn wir hier die Milch zum Sauerwerden hinstellen, kriechen auf einmal bucklige Zwerge herbei und pissen uns in die Töpfe.
Die alte Glusiowa wacht einmal ganz naß von Schweiß auf. Sie schaut, und da sitzt auf dem Federbett der kleine Kredit, der vor den Wahlen für den Bau einer Brücke bestimmt wurde und gleich darauf ohne letzte Ölung verschieden ist. Er sitzt da, ist ganz grün, lacht und würgt sie. Die Alte schreit. Aber niemand verläßt sein Haus. Denn woher soll man immer wissen, wer gerade schreit und aus welcher Haltung er es tut?
Und an der Stelle, wo die Brücke hätte sein sollen, ertrank, eben weil sie fehlte, ein Künstler. Er war erst zwei Jahre alt, aber ein Genie, und wenn er groß geworden wäre, hätte er alles begriffen und beschrieben. Aber so fliegt er jetzt bloß in der Nacht herum und leuchtet wie ein Johanniswürmchen.
Es ist ganz klar, daß all diese Vorfälle in unserer Mentalität ihre Spuren hinterlassen. Die Leute glauben an Gespenster und Hexerei. Gestern erst wurde hinter dem Stadel von Moczasz ein Skelett gefunden. Der Pfarrer behauptet, es sei ein politisches Skelett. An die Geister Ertrunkener, an Mahre, ja sogar an Hexen glauben die Leute. Tatsächlich wohnt hier so eine Alte, die den Kühen die Milch nimmt und Weichselzöpfe bezieht. Aber wir versuchen, sie für die Partei zu gewinnen, um den Feinden des Fortschritts ein Argument aus der Hand zu winden.
O Gott, wie die mit ihren Flügeln flattern, wie die fliegen und »pi, pi« und immer wieder »pi, pi« pfeifen. Ja, hier ist das nicht wie in den großen Häusern, wo sich alles sicher unter dem Dach befindet und man nicht an den Waldrand zu gehen braucht, um seine Notdurft zu verrichten.
Aber das alles ist noch gar nicht das Schlimmste. Am schrecklichsten ist, daß sich jetzt, während ich dies schreibe, die Tür geöffnet hat, ein Schweinerüssel unter ihr erschienen ist und mich ganz seltsam anschaut und anschaut …
Habe ich es nicht gleich gesagt, daß bei uns manches anders ist?
Poesie
Die Lehrerin befahl, die Hefte rauszunehmen. Die Schülerin in der ersten Bank, in jeder Hinsicht mustergültig, kam dieser Empfehlung sofort nach. Sie zog ein nagelneues, ziegelfarbenes Heft aus ihrer Schulmappe und legte es vor sich hin. Sie war ein Kind, das weder zu dick noch zu dünn war, sie sah eben so aus, wie ein gehorsames Töchterchen aussieht, das nahrhafte Mittagessen ißt und keine Grimassen dazu schneidet. Sie hatte tadellos geflochtene Zöpfchen, keine Rede davon, daß etwa eine Haarsträhne liederlich heraussah. Die Strümpfe ordentlich hochgezogen, ohne häßliche Ringe, und so saubere Schuhchen, daß jeder sofort wußte: Oh, dieses Mädchen tritt nicht absichtlich in eine Pfütze, wenn es aus der Schule kommt, ganz sicher nicht!
Nachdem die Lehrerin einen Punkt hinter das letzte Wort an der Tafel gemacht hatte, erklärte sie den Kindern, was Poesie ist. Es hat nämlich was mit den Wortendungen zu tun. Wenn die Kinder also Ausdrücke lesen, die hinten gleich enden, dann ist das Poesie. Als Beispiel führte die Lehrerin an: Schule – Spule, Sand – Wand, Haus – Maus. Darauf rieten die Kinder mehrere Minuten lang, wie die Poesie zu verschiedenen von der Frau Lehrerin angegebenen Worten wäre. Unsere musterhafte Schülerin brillierte vor allen anderen. Die Frau Lehrerin rief zum Beispiel: »Kügelchen«. Dieses bemerkenswerte Geschöpf antwortete sofort: »Tiegelchen«, und ihre kornblumenblauen Augen blitzten vor Freude, daß noch nicht einmal die Hälfte der Stunde vergangen war und sie schon etwas Neues gelernt hatte. Eine gewisse Verwirrung entstand nur bei dem kleinen Józef, der in der letzten Bank saß. Aufgerufen bei dem Wort »Stöckchen«, antwortete er »Trompete«, statt der Regel entsprechend »Böckchen« zu sagen. Alle wunderten sich, und die Lehrerin schimpfte mit ihm. Aber er widersprach finster: »Trompete«, wobei er sehr komisch aussah, weil ihm die Haare zu Berge standen.
Später sagte die Lehrerin:
»Kinder, ihr wißt jetzt, was Poesie ist. Der größte Dichter war Adam Mickiewicz. Ich habe euch einen Vers des Dichters Adam Mickiewicz an die Tafel geschrieben. Schreibt ihn sauber ab in eure Hefte, und zu Hause lernt ihr ihn auswendig.«
Die Musterschülerin machte sich sofort an die Aufgabe. Mit der neuen Stahlfeder kratzend, schrieb sie einfach und deutlich in das saubere Heft ohne ein einziges Eselsohr:
»Litauen! Du mein Heimatland!
Wenn du verloren, unbekannt,
lernt dich dein Sohn erst schätzen.«
Die Stunde war zu Ende, und die Kinder gingen nach Hause. Auch unsere Kleine begab sich heimwärts, sorgfältig den Pfützen ausweichend. Sie küßte die Mammi und den Pappi, aß die Suppe und das Gulasch, um sich nach einer Stunde Mittagsruhe an ihre Aufgaben zu setzen. Sie machte das Heft auf und begann nachzudenken. Jetzt erst bemerkte sie, daß sich zwei Verse im Heft befanden. Einer, der an der Tafel gestanden hatte:
»Litauen! Du mein Heimatland!
Wenn du verloren, unbekannt,
lernt dich dein Sohn erst schätzen …«
und ein zweiter, der mit großen Buchstaben von der Herstellungsfirma der Hefte auf den Umschlag gedruckt worden war:
»Einmal in der Woche baden,
kann dem Faulsten nicht mal schaden.«
Welchen von den beiden Versen hatte die Lehrerin aufgegeben zu lernen? Das arme Kind konnte sich beim besten Willen nicht mehr daran erinnern. Beide waren gut. Einer: Heimatland – unbekannt, und der andere: baden – schaden.
Schließlich lernte sie, weil sie Disziplin und Ordnung gewöhnt war, der Reihe nach, von links nach rechts, dieses baden – schaden und ging mit der Mama spazieren.
Am nächsten Tag wurde sie von der Lehrerin aufgerufen. Sie sagte auf, was sie gelernt hatte, und erhielt zu ihrer Überraschung und Verzweiflung zum ersten Mal im Leben die Note ungenügend. Der Rest der Stunde verlief ohne Zwischenfälle, abgesehen von ein wenig Geschimpfe um Józef, der überhaupt nichts auswendig gelernt hatte.
Niemand wußte, daß genau an diesem Tag eine radikale Veränderung in der Persönlichkeit der Kleinen stattfand. Auf dem Weg nach Hause bemerkte sie in einem Schaufenster die Aufschrift: »Mehr Freizeit für die Ehefrau – eßt stets nur Fertig-Kabeljau.« »Ehefrau – Kabeljau« wiederholte sie und stapfte voller Genugtuung durch die Pfützen. Zu Hause sah sie sorgfältig auf allen Umschlägen der Hefte nach; auf jedem war etwas gedruckt, aber nicht alles reimte sich. Auf einem zum Beispiel stand nur: »Halte mich rein.« Da das Kind die Anweisungen der Lehrerin noch im Gedächtnis hatte, schrieb sie in ihrer ungeübten Handschrift darunter: »Mach dich fein«, und abends hatte sie Fieber.
Mein Gott, wie sich das Kind verändert hatte! Es war Schluß mit dem anständigen Essen ohne Grimassen und Nörgelei. Jetzt bestellte sie sich ganz nach Laune mal Paprika, mal Hering auf japanisch, dann Sauce tartare, und nie war sie mit dem Essen zufrieden.
Es war jeden Tag das gleiche – sie knallte die Tür hinter sich zu und ging ins Restaurant. Statt früh schlafen zu gehen, las sie bis um ein Uhr in der Nacht Andersens Märchen oder die »Polnischen Märchen des Onkel Cześ«. Und wenn Gäste kamen, begrüßte sie sie, anstatt »Guten Tag« zu sagen, mit Versen:
Hier ist der Kredit gestorben
von den Gläubigern ermordet,
davon berichten die traurigen Horden,
den Hinterbliebenen am nächsten Morgen.
Sie beschloß, Poetin zu werden. In ein besonderes Heftchen schrieb sie ihre Verse:
Der polnische Motorverein
ist fürs ganze Allgemein –
wohl sowohl nützlich wie auch fein.
Sollst ein kühner Fahrer sein,
immer vorwärts, nie zurück,
sei kein Feigling, drück
dich nicht, sammle Schrott,
sonst fahren wir dich tot.
Und viele andere.
In der Schule gewöhnte man sich an sie. Nur Józef machte immer noch Schwierigkeiten. Der lernte weiterhin nichts.
Ich möchte ein Pferd sein
Mein Gott, wie gern wäre ich ein Pferd …
Sowie ich im Spiegel statt meiner Hände und Füße Hufe erblickte, hinten einen Schwanz und einen authentischen Pferdekopf, ginge ich sofort zum Wohnungsamt. »Ich möchte eine moderne, große Wohnung«, würde ich sagen.
»Reichen Sie ein Gesuch ein und warten Sie ab, bis Sie dran sind.«
»Haha«, würde ich lachen. »Sehen Sie denn nicht, meine Herren, daß ich kein gewöhnlicher Durchschnittsmensch bin? Ich bin wer anderes, jemand Besonderes!«
Und ich bekäme sofort eine moderne, große Wohnung mit Bad. Ich würde im Kabarett auftreten, und niemand könnte sagen, ich sei unbegabt. Selbst dann, wenn meine Texte nicht gut wären. Ganz im Gegenteil. »Für ein Pferd ist das ausgezeichnet«, würde man mich loben.
»Der hat Köpfchen«, würden andere sagen.
Ganz zu schweigen von den Vorteilen, die ich aus den Sprichwörtern und Redensarten ziehen könnte: Roßkur, Pferdegesundheit, einem geschenkten Gaul, ein Königreich für ein Pferd … Natürlich hätte der Umstand, ein Pferd zu sein, auch einige negative Seiten. Meinen Feinden gäbe ich eine neue Waffe in die Hand. Wenn sie mir anonyme Briefe schrieben, könnten sie zum Beispiel beginnen:
»Sie sind ein Pferd? Ein Pony sind Sie!«
Die Frauen würden sich für mich interessieren. »Sie sind so anders …«, würden sie sagen.
Wenn ich in den Himmel käme, wüchsen mir selbstverständlich Flügel. Ich würde ein Pegasus. Ein geflügeltes Pferd! Kann es etwas Schöneres für einen Menschen geben?
Der Rebus
Die Straße, an der ich früher wohnte, ist schon vor fünfzig Jahren eine Hauptader der Stadt gewesen. Ich hatte dort ein hohes Zimmer; hoch waren auch die schießschartenschmalen beiden Parterrefenster, und selbst die Tür, deren Klinke merkwürdige Verzierungen schmückten, schien übermäßig in die Länge gezogen zu sein. Der Tag reichte nicht aus, um die graue Dämmerung aus diesem Zimmer zu vertreiben, nur gegen Mittag zog sie sich ein wenig in die Ecken und unter die hohe Decke zurück, aber schon am frühen Nachmittag kroch sie frech wieder hervor. Aus den Fenstern sah man lediglich die Reihen ebensolcher Fenster auf der anderen Straßenseite. Sie schienen blind zu sein, denn in den Zimmern dahinter herrschte das gleiche Zwielicht wie bei mir. Über dem Fensterbrett schwammen die Kopfbedeckungen der Passanten vorbei, als sei die ganze Stadt überschwemmt und die Strömung führe nun die einzigen an der Oberfläche gebliebenen Überbleibsel der Ertrunkenen, Damen- und Herrenhüte, mit sich. Auch das Geräusch der Schritte, das unablässig durch die Scheiben tropfte, ließ mich an Wasser denken.
Eines Tages schwamm ein Hut vorüber, der den anderen nicht glich. Es war eine schwarze Melone. Als es kurz darauf an meiner Tür klingelte und ich öffnete, befand er sich auf dem Kopf eines älteren Herrn; dieser trat sich die Füße ab, obwohl es seit einer Woche trocken war und vor der Tür kein Schuhabstreifer lag, nahm diesen Hut ab und fragte, ob er eintreten könne.
In meinem Zimmer schaute er sich um, zog eine der Länge nach gefaltete Zeitung aus der Tasche und sagte: »Ich habe die Auflösung.«
»Wie bitte?«
Er reichte mir die Zeitung. Sie hatte die Farbe alter, aus Knochen gefertigter Dominosteine. Die Drucktypen wiesen einen heute nicht mehr üblichen Schnitt auf, Buchstaben auf mageren, langen Beinchen, deren unterer und oberer Rand mit dünnen, waagerechten Strichen versehen ist. Das Datum eines Berichts fiel mir in die Augen: »6. Juni 1906. Die Woche in Baden-Baden …«
»Der Rebus«, half der Mann nach, als er merkte, daß ich nicht wußte, worum es ihm ging. Auf Seite zwei war ein Rebus. Daneben stand, sorgfältig mit Tintenstift geschrieben, die Auflösung.
»Ich sehe es.«
»Ich habe alles herausbekommen.«
»Ja.«
»Ich wollte es selbst in die Redaktion bringen. Dies ist die Adresse. Aber anscheinend ist hier keine Redaktion mehr«, sagte er, während er einen Blick auf die Möbel warf.
»Ja, hier ist jetzt eine Privatwohnung.«
»Schade, und ich habe alles herausbekommen. Wo ist die Redaktion jetzt?«
Ich zuckte die Schultern: »Ehe ich hier einzog, war es auch eine Privatwohnung.«
»Und vorher?«
»Woher soll ich das wissen? Vermutlich ebenfalls.«
»Schade, ich habe es ganz allein herausbekommen.«
»Vielleicht war hier einmal eine Redaktion, aber das ist jedenfalls lange her«, sagte ich boshaft.
Er nickte. »Ja«, sagte er, »fünfzig Jahre.«
Dieser Halbgebildete fing an, mich aus dem Gleichgewicht zu bringen. »Was wollen Sie denn mit Ihrem Rebus? Schließlich wissen Sie doch, daß sich seither allerhand geändert hat.«
»Wissen Sie, ich bin ja schließlich kein Professor. Und trotzdem bin ich ganz von alleine auf alles gekommen«, sagte er beleidigt.
Einen Augenblick schwiegen wir. Dann las ich den Namen der Zeitung und war empört. »Wissen Sie denn nicht, daß Ihre Zeitung die perfide Politik der Monarchie gegen die nationalen Minderheiten unterstützte?«
»Es war an einem Sonntag. Der Onkel kam zu uns, und in der Tasche hatte er diese Zeitung. Es war heiß, und wir saßen im Garten. Vater und der Onkel sagten, sie wollten Karten spielen. Ich wollte mitspielen, aber Vater erlaubte es nicht; ich sei noch zu jung, später dürfe ich auch. Dann zogen sie ihre Jacken aus. Als sie das Spiel begannen, nahm ich diese Zeitung heraus, denn die Jacke des Onkels hing an einem Ast des Kirschbaums. Ich machte mich gleich an den Rebus.«
»Und Sie haben fünfzig Jahre dazu gebraucht«, fügte ich sarkastisch hinzu.
»Bitte, das war sehr schwierig. Wissen Sie etwa, was ›adäquat‹ bedeutet, und es gab noch schwierigere Sachen.«
»Und der Erste Weltkrieg, mein Herr?«
»Ich war unabkömmlich.«
»Sie sind lächerlich. Die ganze Umwälzung, der ungeheure Schritt, die Weimarer Republik, die Volksabstimmungen?«
»Bilden Sie sich nur nicht ein, das wäre alles so leicht. Im Jahre 1909 wußten wir noch nicht so recht, was ein Zeppelin ist. Erst als ich ›Veloziped‹ und ›Kraut‹ – für ›Pflanze‹, wissen Sie – hatte, kam ich darauf.«
»Sie gehen mir auf die Nerven. 1929 die Weltwirtschaftskrise – und Sie noch immer mit diesem Rebus!«
»Ich bin vielleicht nicht besonders begabt. Aber glauben Sie nur nicht, ich hätte zu viel Zeit gehabt. Bitte sehr, ich mußte arbeiten, und mit der Auflösung beschäftigte ich mich vor allem in den Abendstunden.«
»Und Hitler? Das ging Sie wohl nichts an? Spanien? Was haben Sie denn damals gemacht?«
»Ich sage Ihnen doch die ganze Zeit, daß ich alles allein herausbekommen habe. Es kamen eine Menge Fremdwörter drin vor. Aber wozu hat man schließlich Köpfchen?«
»Ein Salomon sind Sie«, spottete ich. »Sicher haben Sie auch während des Zweiten Weltkriegs vor Ihrem Rebus gesessen? Ein Einstein sind Sie, aber die Atombombe haben Sie wohl nicht erfunden.«
»Die Bombe? Damit habe ich nichts zu tun. Glauben Sie vielleicht, daß es einem alten Mann leichtfällt? Was man in der Schule gelernt hat, ist längst vergessen, und schließlich hat man noch andere Sorgen. Aber jedenfalls habe ich es nicht aufgegeben.«
Ich lachte laut und boshaft. Das schüchterte ihn ein; dann stand er auf und sagte:
»Lachen Sie nicht. Ich habe die Bombe nicht erfunden, was kann ich daran machen? 1914 war ich unabkömmlich, aber meinen Teil habe ich schon vorher in Montenegro abbekommen, einen Rikoschettschuß in den Kopf. Sie lachen, aber man muß das menschliche Denken achten, mein Herr. Hier ist der Rebus. Der Gedanke lebt.«
Das Abenteuer des Trommlers
Ich liebte meine Trommel. An einem breiten, im Nacken geknüpften Band trug ich sie. Es war eine große Trommel. Auf ihr blaßgelbes Fell schlug ich mit Schlegeln aus Eichenholz. Diesen hatten meine Finger allmählich einen gewissen Glanz verliehen, der von meinem Fleiß und meiner Arbeitslust zeugte. Die Wege, auf denen ich mit meiner Trommel schritt, waren bald weiß von Staub, bald schwarz von Kot, und zu beiden Seiten lag die Welt, grün, gelb, braun oder weiß, je nach der Jahreszeit. Über allem aber polterte rasend die Stimme meiner Trommel, denn meine Hände gehörten nicht mir, sondern ihr, und wenn die Trommel schwieg, war mir nicht wohl. Munter trommelte ich eines Abends, als der General an mich herantrat. Seine Uniform war unvollständig, die Jacke stand am Hals offen, und er war in Unterhosen. Er grüßte mich, räusperte sich, lobte Staat und Regierung und sagte schließlich gleichsam nebenbei:
»Und Ihr trommelt unentwegt?«
»Jawohl!« rief ich und schlug mit verdoppelter Kraft auf das Fell. »Zur Ehre des Vaterlandes!«
»Richtig, richtig!« pflichtete er irgendwie traurig bei. »Und wie lange werdet Ihr weitermachen?«
»Solange die Kräfte reichen, Herr Genosse«, gab ich munter zurück.
»Teufelskerl!« lobte mich der General und kratzte sich den Kopf. »Und werden sie noch lange reichen?«
»Bis zum Ende«, rief ich stolz.
»Na, na«, wunderte sich der General, schwieg einen Augenblick nachdenklich und fing dann von etwas anderem an: »Es ist schon spät«, sagte er.
»Spät ist es nur für den Feind, niemals für uns«, schrie ich, »denn unser ist die Zukunft.«
»Sehr richtig«, stimmte der General leicht irritiert zu. »Ich meinte auch nur die späte Stunde.«
»Die Stunde des Kampfes ist angebrochen. Auf, ertönet Kanonen, läutet Sturm, ihr Glocken«, brüllte ich in der edlen Verzückung des echten Trommlers.
»Nur keine Glocken«, rief der General hastig. »Das heißt, nichts gegen Glocken, von Zeit zu Zeit.«
»Richtig, Bürger General!« Mit Feuereifer griff ich seinen Gedanken auf. »Was sollen uns Glocken, da wir doch Trommeln haben. Die Glocken mögen schweigen, wenn mein Wirbel ertönt.« Und zur Bekräftigung hieb ich auf die Trommel ein, als ob der Sturm beginne.
»Und niemals umgekehrt, nicht wahr?« fragte der General unsicher und hielt sich verstohlen die Hand vor den Mund.
»Niemals!« schrie ich schallend. »General, unaufhörlich wird unser Wirbel dröhnen. Ihr könnt Euch auf Euren Trommler verlassen.« Eine Feuerwelle der Begeisterung riß mich hin.
»Unsere Armee kann stolz auf Euch sein«, sagte der General sauer. Ihn fröstelte, denn über das Biwak war der Nachtnebel gefallen. Aus dem grauen Dunst ragte nur der Kegel des Generalszeltes hervor. »So ist es, stolz kann sie sein. Wir werden nicht weichen, und wenn wir marschieren müßten, ja, mein Lieber, marschieren, Tag und Nacht. Und jeder unserer Schritte … ja, jeder Schritt …«
»… Jeder unserer Schritte ist ein unablässiger Trommelwirbel des Sieges«, brach es aus mir hervor, und ich rührte die Trommel.
»Hm, ja, ganz richtig«, brummte der General und ging auf sein Zelt zu.
Aber das Alleinsein verstärkte meine Opferbereitschaft und mein Verantwortungsbewußtsein als Trommler nur noch mehr. Du bist weggegangen, General, dachte ich, aber du weißt, daß dein treuer Trommler wacht. Gesammelt brütest du mit faltendurchfurchter Stirn über den strategischen Plänen, steckst auf der Karte mit Fahnen den Weg unseres gemeinsamen Sieges ab. Du und ich, beide werden wir die Zukunft, das hellere Morgen erobern, das ich in deinem Namen durch das Gedröhn des Wirbels verkünde.
Eine solche Zärtlichkeit umfaßte mich für den General, ein solcher Wille, mich der Sache ganz zu weihen, daß ich, soweit dies möglich war, noch rascher und heftiger auf das Trommelfell einschlug. Schon war die Nacht weit vorangeschritten, und immer noch gab ich mich, durchglüht von der Idee, mit dem Eifer der Jugend meiner ehrenvollen Aufgabe hin.
Manchmal, zwischen den einzelnen Aufschlägen meiner Schlegel, hörte ich vom Generalszelt her das Knarren einer Sprungfedermatratze, als wälze sich dort jemand, der keinen Schlaf fand, von einer Seite auf die andere. Gegen Mitternacht endlich hob sich undeutlich eine weiße Gestalt vor dem Zelt ab. Der General war im Nachthemd. Er hatte eine belegte Stimme.
»Na, nun sagt mal, wollt Ihr noch lange trommeln?« wändte er sich an mich. Ich war ganz gerührt, daß er zu mir in die Nacht hinausgetreten war. Ein echter Soldatenvater!
»Jawohl, General! Weder Kälte noch Schlaf vermögen mich zu bezwingen. Ich bin bereit, zu trommeln, solange ich lebe, wie es meine Pflicht und die gemeinsame Sache mich heißen, wie es Gesetz und Ehre des Trommlers gebieten. So wahr mir Gott helfe!«
Als ich so sprach, ging es mir nicht darum, dem General zu gefallen, meinen Diensteifer zu zeigen. Nichts hatte dies mit hohler Prahlerei oder Spekulation auf Orden und Auszeichnungen zu tun. Es kam mir nicht einmal in den Sinn, man könne meine Worte so verstehen. Immer war ich aufrichtig, geradlinig und, zum Teufel! ein guter Trommler.
Der General knirschte mit den Zähnen. Ich dachte, der Kälte wegen. Dann sagte er dumpf: »Gut, sehr gut!« und ging.
Kurz darauf verhafteten sie mich.
Die Runde, welche den Befehl ausführte, umringte mich schweigend, nahm mir die Trommel vom Hals, riß mir die Schlegel aus den fühllos erstarrten Händen. Plötzlich verbreitete sich Stille im Tal. Mit den Genossen, die mich zwischen Bajonetten aus dem Lager führten, konnte ich mich nicht verständigen. Das Gesetz stand dem entgegen. Aber einer gab mir zu verstehen, sie hätten mich auf Befehl des Generals verhaftet, mir werde Verrat vorgeworfen. Verrat!
Gerade begann es zu tagen. Schon erschienen die ersten Rosenwölkchen. Sie wurden nur von einem gesunden Schnarchen begrüßt, das ich deutlich hörte, als wir am Zelt des Generals vorbeikamen.
Pferdchen
In einer Familienangelegenheit mußte ich nach N. Ich hatte von dort einen Brief voll orthographischer Fehler erhalten, der offenbar von einer der Feder ungewohnten Hand stammte. Irgendeine gute Haut teilte mir mit, daß die Überreste meines Großvaters, eines Aufständischen des Jahres 1863, auf Veranlassung des Direktors eines staatlichen Gestüts aus der repräsentativen Grabstätte entfernt worden seien. An ihrer Stelle habe der Direktor seine Sekretärin beerdigen lassen, die, wie jedermann wisse, zu Lebzeiten seine Geliebte gewesen sei. Der Briefschreiber teilte mir seinen Namen nicht mit, gab mir aber zu verstehen, daß er sich ohnedies großen Gefahren aussetze. Ich nahm zwei Tage Urlaub und fuhr nach N. Ich hatte dieses Städtchen nie zuvor gesehen. Von der Station aus begab ich mich sofort zum Haus des dortigen Totengräbers. Ich traf ihn jedoch nicht an, da er, wie mir seine Frau erklärte, gerade zur Schmiede gegangen war, um ein Pferd beschlagen zu lassen. Ich beschloß zu warten und setzte mich auf eine Bank an der Friedhofsmauer. Endlich erschien der Totengräber auf dem Pfad – ein ungeschlachter, finster blickender Kerl, der ein Pferd am Zaum führte oder, besser gesagt, ein schönes kleines Pony mit leuchtendem Fell, dessen neue Hufeisen hell aufklangen, wenn sie dann und wann an einen Stein stießen. Als er den Grund meines Besuches begriff, wurde der Totengräber noch abweisender, warf mir einen bösen Blick zu und erklärte, er wisse von nichts. Dann ließ er mich stehen und verschwand im Friedhof.
So begab ich mich also zum städtischen Nationalrat. Vor dem Gebäude stand, an einen Pfosten gebunden, ein kleines Pferd. Ich wurde vom Vorsitzenden empfangen und sagte, worum es ging.
Zur Antwort erklärte er mir alles mögliche, was nichts mit der Sache zu tun hatte, schlug aber, als ich nicht locker ließ, einen anderen Ton an: »Es ist Euch vielleicht nicht bekannt, daß es einen Beschluß des Stadtrats gibt, an Stelle Eures Großvaters einen eigens überführten koreanischen Partisanen zu bestatten. Ich nehme an, daß die politische Richtigkeit dieses Schrittes Euch einleuchtet.« Dabei sah er mir forschend in die Augen. Empört verließ ich den Stadtrat und eilte geradewegs zum Kreisrat. Der Vorsitzende dort war ein energischer junger Mann mit hellem Blick.
Als ich ihm den Verlauf meiner vorausgehenden Besuche mitteilte, empörte auch er sich: »Ja, es gibt noch viele Unvollkommenheiten bei den unteren Instanzen. Ihr Großvater? Wir haben schon etwas in dieser Sache gehört. Ja, wir werden uns bemühen, das alles aufzuklären. Aber …«
»Aber?«
»Aber das wird eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen.«
In diesem Augenblick ertönte hinter der Tür, die vom Arbeitszimmer in den nächsten Raum führte, ein schmetterndes, munteres Wiehern, ein Wiehern, wie es nur sehr kleinen Pferden, Ponys oder Kucys, wie man bei uns sagt, eigen ist.
Die Augen des Vorsitzenden irrten unruhig umher. Mein Herz krampfte sich unter der eisigen Kälte eines bösen Vorgefühls zusammen. Ich drehte mich um und lief davon. Der Totengräber mit Pony, ein Pony vor dem Stadtrat, das Wiehern im Kreisrat! Hatten nicht diese Ponys etwas mit dem Widerstand zu tun, auf den ich überall stieß, sobald ich die Sache mit den Überresten meines Großvaters, eines Rittmeisters, aufklären wollte? Es mußte ein Zusammenhang bestehen zwischen dem der Gerechtigkeit hohnsprechenden Verhalten und diesen kleinen Pferden. Mit hängendem Kopf begab ich mich zum Sitz der Nationalen Front. Als ich angelangt war, blieb ich wie angewurzelt stehen. Vor dem Tor erblickte ich einen Zweispänner mit zwei schönen, rassigen Ponys.
Ich drehte mich um und ging langsam zurück.
Ich mußte feststellen, daß die Kinder des Staatsanwaltes auf Ponys in die Schule ritten. Nachdem ich über eine Mauer gestiegen war, entdeckte ich in den Beeten des Präsidenten der Bauernselbsthilfe deutliche Spuren von kleinen Hufen. Auch der Präsident des Verbandes der Widerstandskämpfer und der Leiter des Delikatessengeschäftes besaßen seit einiger Zeit Ponys. Aber was nützten mir diese Entdeckungen? Besiegt verließ ich N. Vor dem Bahnhof kontrollierte ein Miliziant meine Ausweise; er saß auf einem Pony.
Erst einige Zeit später fiel mir eine Zeitung mit folgender Notiz in die Hände: »Der Direktor des staatlichen Gestüts von N. wurde wegen Vergeudung von Staatsgut nach D. strafversetzt. Die nach N. entsandten Inspektoren hatte er zu bestechen versucht, indem er ihnen Ponys anbot.«
Später erhielt ich die Mitteilung, daß meine in D. im Altersheim lebende Großmutter, eine verdiente Frauenrechtlerin, durch den Direktor des Gestüts brutal ausgewiesen worden sei. An ihrer Stelle habe dieser dort seine eigene Großmutter, eine ehemalige Dirne aus Klondike, untergebracht. Ich fuhr nach D. Das Tor des Altersheims öffnete mir der Hausmeister, ein Zwerg. Am Zügel hielt er einen riesigen Percheron.
Ohne ein Wort zu sagen, drehte ich mich um und fuhr ab.