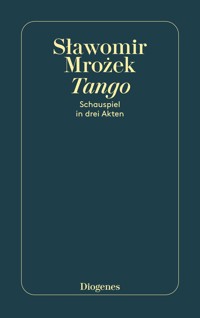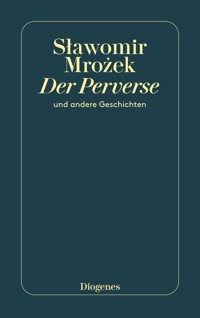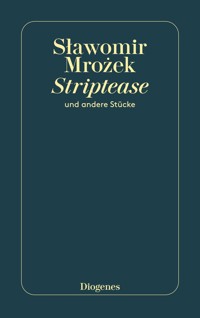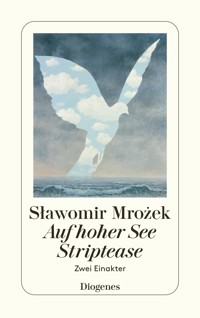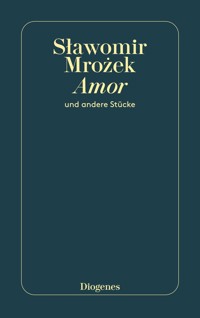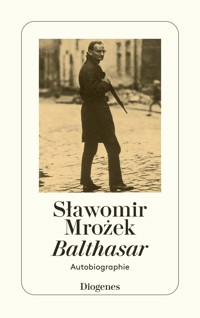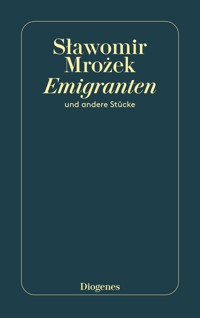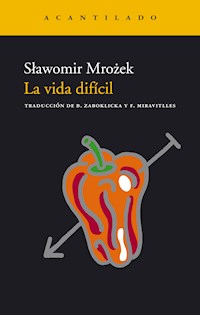7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Nicht jedes in bester Absicht überreichte Geschenk löst ungetrübte Freude beim Empfänger aus. Ein leibhaftiger Affe zum Beispiel kann ungeheure Probleme aufwerfen, vor allem dann, wenn er ein diplomatisches Geschenk ist und nicht einfach in den Zoo abgeschoben werden kann ... Plauderei über die neueste Geschichte ist eine von siebenunddreißig witzigen, das Absurde im Alltag aufspürenden Kurzgeschichten. Da agieren Fuchs und Hahn als Fabelwesen, Pfarrer und Teufel paktieren miteinander, Märchenfiguren werden in die rauhe Wirklichkeit geschubst. Und immer garantieren Einfallsreichtum und hintersinniger Humor ein amüsantes, aber auch nachdenklich stimmendes Lesevergnügen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 182
Ähnliche
Sławomir Mrożek
Mein unbekannter Freund
und andere Geschichten
Aus dem Polnischen von Klaus Staemmler
Diogenes
Die Revolution
In meinem Zimmer stand das Bett hier, der Schrank dort und der Tisch dazwischen.
Bis mir das langweilig wurde. Ich rückte das Bett dorthin und den Schrank hierher.
Eine Weile spürte ich die belebende Strömung des Neuen. Doch nach geraumer Zeit – wieder Langeweile.
Ich gelangte zu dem Schluß, die Quelle der Langeweile sei der Tisch oder vielmehr seine unveränderte mittlere Stellung.
Darum schob ich den Tisch dorthin und das Bett in die Mitte. Nonkonformistisch.
Das erneute Neue belebte mich von neuem, und solange das andauerte, war ich zufrieden mit der nonkonformistischen Unbequemlichkeit, die es zur Folge hatte. Ich konnte jetzt nämlich nicht mehr mit dem Gesicht zur Wand schlafen, was stets meine bevorzugte Lage gewesen war.
Doch nach einer Weile hörte das Neue auf, neu zu sein, nur die Unbequemlichkeit blieb übrig. Deshalb verschob ich das Bett hierhin und den Schrank in die Mitte.
Endlich eine radikale Änderung. Denn der Schrank mitten im Zimmer, das war mehr als nonkonformistisch. Geradezu avantgardistisch.
Aber nach einiger Zeit … Ach, gäb’s nur nicht dieses ›nach einiger Zeit‹! Kurz und gut, auch der Schrank mitten im Zimmer hörte für mich auf, etwas Neues und Ungewöhnliches zu sein.
Man mußte einen Durchbruch erzielen, einen Grundsatzentschluß fassen. Wenn im gegebenen Rahmen keine echte Veränderung möglich ist, muß man ganz aus dem Rahmen treten. Wenn das Nonkonformistische nicht genügt, wenn das Avantgardistische erfolglos ist, muß man zur Revolution schreiten.
Ich beschloß, im Schrank zu schlafen. Jeder, der einmal versucht hat, stehend im Schrank zu schlafen, weiß, daß man in dieser unbequemen Lage überhaupt nicht einschlafen kann, gar nicht zu reden vom Kribbeln in den Füßen und von den Schmerzen im Rücken.
Ja, das war der richtige Entschluß. Der Erfolg, der volle Sieg. Denn diesmal trat der bekannte Effekt auch ›nach einiger Zeit‹ nicht ein. Ich gewöhnte mich nach einiger Zeit nicht nur nicht an die Veränderung, die Veränderung blieb Veränderung, ich empfand die Veränderung im Gegenteil immer stärker, weil die Schmerzen mit dem Ablauf der Zeit stärker wurden.
Alles wäre somit vorzüglich gewesen, hätte sich meine psychische Durchhaltekraft nicht als begrenzt erwiesen. Eines Nachts hielt ich es nicht mehr aus. Ich verließ den Schrank und legte mich ins Bett.
Ich schlief dreimal rund um die Uhr. Darauf schob ich den Schrank an die Wand und den Tisch in die Mitte, denn der Schrank mitten im Zimmer störte mich.
Jetzt steht das Bett wieder hier, der Schrank wieder dort und der Tisch dazwischen. Wenn mir Langeweile zusetzt, erinnere ich mich der Zeiten, als ich ein Revolutionär war.
Das Gesicht
In dem großen Saal – so groß, daß sogar der riesige Schreibtisch wie ein Spielzeug wirkte – saßen an eben diesem Schreibtisch zwei Männer. Das Gesicht des Mannes hinter dem Schreibtisch war reglos, hieratisch, standbildhaft, das Gesicht des Mannes auf dieser Seite des Schreibtisches dagegen so beweglich, daß es aussah, als wollte es ihn verlassen, in alle Ecken laufen, sich an die Decke hängen oder durch das Fenster hinausfliegen, wenn das Fenster offen gewesen wäre. Das Gesicht zog allerlei Mienen und Grimassen und verhielt sich überhaupt wie erfüllt mit eigenständigem Leben, unabhängig nicht nur vom Willen seines nominellen Besitzers, sondern auch von dessen Körper.
Dieser hatte gerade aufgehört zu sprechen, der Standbildhafte hinter dem Schreibtisch räusperte sich und erteilte dann seine Antwort:
»Ja, wir freuen uns, freuen uns, aber …«
»Aber?«
»Aber so einfach ist es nicht, wie Sie glauben.«
Das Gesicht sprang von der Palme herunter, von einer der Palmen, die den Audienzsaal schmückten, glitt über den Marmorfußboden und setzte sich auf die Schulter seines nominellen Besitzers.
»Warum? Ist meine Erklärung nicht klar?«
»Ihre Erklärung ist völlig klar, und wie bereits gesagt, wir freuen uns sehr. Sie sind berühmt, und wir sind mächtig. Die Macht freut sich immer, wenn sie vom Ruhm unterstützt wird, und zeigt sich auf gleiche Weise dankbar.«
»Worum geht es also?«
»Um gewisse Widersprüchlichkeiten. Einerseits sind Sie eine unendlich populäre Persönlichkeit, und Ihr Beitritt zu unserer Bewegung, unserer Idee, unserer Organisation hätte für uns eine positive, eine propagandistische Bedeutung, andererseits jedoch …«
»Aber ich möchte ja gerade in eure Reihen treten.«
»… andererseits liegt gerade in Ihrer Popularität das Hindernis. Denn wir müssen in Betracht ziehen, worauf diese Popularität beruht. Sie sind der größte Komiker unserer Zeit, es genügt, daß Sie sich auf der Bühne sehen lassen, schon wälzen sich alle vor Lachen, noch bevor Sie irgend etwas sagen. Allein der Anblick Ihres Gesichts wirkt auf das Publikum erheiternd. Sie sind …«
»Ein Clown.«
»Ich möchte dieses Wort nicht benutzen, weil eine so gewöhnliche Bezeichnung Ihrer Kunst absolut nicht gerecht wird …«
»Aber warum denn? Ich bin ein Clown und schäme mich dessen überhaupt nicht. Es ist mein Beruf, meine Berufung und auch mein Ruhm. Ich schäme mich nicht einmal des Wortes Hanswurst. Ich bin ein Hanswurst und trete im Zirkus auf. Doch meine Kunst, der Zirkus – ihr unterstützt das.«
»Selbstverständlich unterstützen wir das wie alles Gesunde und Volkstümliche. Aber überlegen Sie bitte: Darf sich jemand mit einem Gesicht, bei dessen Anblick allein sich die Leute totlachen, in den Reihen unserer Bewegung befinden, deren Grundsatz und Ziele ernst sind, todernst?«
Das Gesicht sprang auf den Teppich und drückte sich flach an ihn. Da es jedoch infolge seiner Natur nicht lange völlig reglos bleiben konnte, zappelte es lautlos.
»Aber ich habe ernste Absichten.«
»Die haben Sie vielleicht, aber nicht Ihr Gesicht. Es verbindet sich den Leuten immer mit Witzen und Anekdoten, kurz gesagt mit dem Zweideutigen. Unsere Idee aber ist eindeutig. Absolut eindeutig. Es – Ihr Gesicht – ist Ihr Genie, und Ihr Genie beruht gerade auf unernsten Absichten. Alle erwarten von Ihnen ausschließlich unernste Absichten, und keine Macht wird sie davon überzeugen, Sie hätten andere.«
»Aber ich denke ernsthaft.«
»Es kommt nicht darauf an, was Sie denken, sondern darauf, wie Sie aussehen. Und Sie sehen so aus, daß Ihr Anblick in unseren Reihen diese Reihen nur lächerlich machen, kompromittieren könnte. Und das entgegen Ihren allerernstesten Absichten. Wenn die Leute Sie unter uns sähen, unter unseren Fahnen, unsere Losungen verkündend, würden sie aufhören, an den Ernst unserer Losungen, unserer Fahnen, unserer Grundsätze und Ziele, ja unserer ganzen Bewegung zu glauben. Sie würden anfangen, über uns zu lachen.«
»Das wäre ja entsetzlich.«
»Haben Sie das im Ernst gesagt?«
»Selbstverständlich.«
»Sehen Sie, ich ertappe mich dabei, daß ich Sie der Ironie verdächtige. Ich weiß, ich weiß, Sie reden im Ernst, und trotzdem … Bitte, beunruhigen Sie sich nicht, es ist ja nicht Ihre Schuld, nur die Ihres Gesichts. Aber wo ist es denn? Eben noch war es hier auf dem Teppich …«
»Es sitzt jetzt, glaube ich, auf dem Kronleuchter …«
Beide schauten hinauf, um das festzustellen, dann blickten sie einander an.
»Richtig. Sie sehen es ja selbst. Sie sitzen hier vor mir und Ihr Gesicht ganz woanders. Kann man einem solchen Gesicht vertrauen? Können Sie die Verantwortung für Ihr Gesicht übernehmen?«
»Nein«, antwortete der Clown bedrückt und fiel in sich zusammen. »Das kann ich nicht.«
»Na also«, sprach der Standbildhafte und erhob sich. »Gehen Sie nach Hause. Wir schätzen Ihre Bereitschaft und Ihre Begeisterung für unsere Sache, aber damit müssen wir uns begnügen. Sie bleiben bereit und voller Begeisterung, wir wissen das zu schätzen, aber Sie in unsere Reihen aufzunehmen ist unmöglich. Einfach unmöglich.«
Bedrückt verneigte sich der Clown und wandte sich der Tür zu.
»Und noch etwas.«
Der Clown blieb an der Tür stehen.
»Erzählen Sie niemandem von Ihrer Begeisterung für unsere Ideale. Sagen Sie auch niemandem, daß Sie uns einen Besuch gemacht und um Aufnahme in unsere Organisation gebeten haben. Wenn ich Ihnen nicht vertraute, könnte sogar ich denken, das sei, von Ihnen aus gesehen, eine … Provokation gewesen.«
Der Clown zog seinen Kopf ein.
»Nun, ich denke nicht so, aber die anderen. Sie wissen schon, was sie denken könnten. Darum Diskretion und noch einmal Diskretion. In unserem und Ihrem Interesse. Wenn Ihre Begeisterung ehrlich ist, dann schweigen Sie darüber. Nur auf diese Weise können Sie der Sache dienen, für die Sie sich begeistern.«
Der Clown sagte seine Diskretion zu, und die schwere Tür schloß sich hinter ihm. Der Standbildhafte setzte sich und vertiefte sich in wichtige Dokumente. Doch nach kurzer Zeit lenkte ihn irgend etwas ab. Er hob den Kopf vom Schreibtisch und bemerkte, daß sich auf dem Fußboden vor der mächtigen, polierten Eichentür etwas regte. Das Gesicht versuchte, sich durch die Ritze zwischen Tür und Fußboden zu zwängen, um nach draußen zu gelangen. Vergeblich.
Der Standbildhafte legte die Feder weg und rieb sich die Hände; anschließend nahm er vom Schreibtisch den schweren Messing-Briefbeschwerer und stahl sich heran, so leise, wie es ihm seine ebenfalls schweren langschäftigen, auf Hochglanz gebrachten Stiefel erlaubten.
Plauderei über die neueste Geschichte
Unseren General kennt man in der ganzen Welt, auch unter den gelben und schwarzen Völkern, die, obgleich sie so seltsame Hautfarben haben, richtig und fortschrittlich denken und deshalb Brudernationen sind. Wir lieben sie, senden ihnen allerlei Geschenke, und sie erweisen sich uns gegenüber dankbar. So haben sie uns, als wir ihnen kürzlich eine Zuckerfabrik und eine komplette Einrichtung der chemischen Industrie zugesandt hatten, einen Affen geschickt.
Diesen Affen überreichte ihr Botschafter unserem General während eines feierlichen Empfangs mit Fernsehen. Weder liebt der General Affen, noch liebt er sie nicht, er sagte aber in seiner Ansprache, er liebe sie und sei gerührt, weil es sich anders nicht gehörte, und er danke im Namen der Nation, denn der Affe sei sehr nützlich. Im übrigen muß man zugeben, daß der Affe stattlich und groß und für einen Affen wirklich gelungen war. Man wußte nur nicht so recht, was man mit ihm anfangen sollte.
Das einfachste wäre gewesen, ihn in den Zoo zu geben, damit unsere Jugend sich beim Betrachten des Affen bilde, etwas von fernen Ländern erfahre und ihren Horizont erweitere. Der General war sogar dafür, weil seine Sorge um die Jugend bekannt ist. Doch da der Affe ein offizielles Geschenk auf höchster Ebene war, konnte er nicht degradiert, das heißt von der außenpolitischen in die pädagogische Abteilung versetzt werden. Und außerdem braucht ein Affe, besonders ein ausländischer, Nahrung, und in unseren zoologischen Gärten steht es damit recht unterschiedlich. Die Aufseher sind naschhaft, sie essen nicht nur die Kartoffeln, die für die Löwen bestimmt sind, es kommt auch vor, daß sie den Löwen selbst essen, obwohl der Löwe, vor allem ein abgemagerter, nicht nahrhaft ist und nach Katze stinkt. Erst recht hätte ein so neuer und noch fetter Affe bei ihnen nicht lange überdauert.
Zwar hätte man den Zoo mit einer Division Infanterie umstellen können oder auch mit zwei, ja sogar um der größeren Sicherheit willen noch mit einer Panzerdivision, damit sie für Ordnung sorgten und aufpaßten, daß dem Affen kein Unrecht geschehe. Doch unsere Armee hat, obgleich sie stark an Zahl ist, so viele Aufgaben und so viel zu umstellen, daß dieses Projekt, auch wenn man die Hilfe der verbündeten Länder in Betracht gezogen hätte, auf seine Verwirklichung bis zum weiteren Anwachsen unserer Streitkräfte und zur weiteren Verstärkung unserer Verteidigungsbereitschaft hätte warten müssen. Und dazu wäre es bestimmt gekommen, weil unsere Streitkräfte anwachsen. Doch mit dem Affen mußte gleich etwas geschehen. Obwohl dem General das persönlich nicht paßte – denn er mag keine Neuerungen, weil jede Neuerung ein gewisses Durcheinander mit sich bringt, und Durcheinander kann er ganz einfach nicht ertragen –, entschied er, der Affe solle bis auf weiteres bei ihm in seinem zentral gelegenen Hause bleiben, wo Schutz und Nahrung gewährleistet seien.
Der Affe bekam ein Zimmer im linken Flügel des Bunkers, sehr reinlich – denn beim General ist es sehr reinlich –, mit einem zwar harten und schmalen Bettchen – denn der General ist ein echter Soldat, und bei ihm gibt es keine Daunenbequemlichkeit –, mit den gesammelten Werken des Xismus und Ninismus im Regal, damit er keine Zeit vergeudete und sich bildete und weiterentwickelte. Er bekam auch Hosen, denn der General ist schamhaft, und nichts berührt ihn so unangenehm wie der Imperialismus und der Anblick bestimmter Körperteile, sogar eines Affen. Es kostete einige Mühe, bis der Affe gelernt hatte, die Hosen an- und auszuziehen – denn ausziehen mußte er sie leider, weil es selbst dem General nicht gelang zu veranlassen, daß der Affe seine natürlichen Bedürfnisse überhaupt nicht mehr befriedigte. Er war dumm und machte erst von dem Augenblick an rasche Fortschritte, als man zwei Pädagogen aus der Spezialabteilung mit ihren wissenschaftlichen Geräten holte. Sogar die Knöpfe lernte er zuzuknöpfen, wenn ihm dabei auch die Hände ein bißchen zitterten.
Andererseits blieb er weiterhin Affe. Das heißt, er tollte herum und schnitt Grimassen, mit oder ohne Hosen. Er konnte keinen Augenblick still sitzen, was den General am meisten ärgerte, denn er mochte es sehr, wenn die Leute an einer Stelle saßen. Doch scheute er sich, den Affen einzusperren, und zwar aus Angst vor internationalen Schwierigkeiten, die sich daraus ergeben könnten. Die Völker, die uns den Affen gesandt hatten, konnten nach ihm fragen, und da es sich um Brudervölker handelte, war es besser, derartige Komplikationen zu vermeiden. Er wandte sich deshalb an seinen Ratgeber, das heißt an den Vertreter eines sehr großen, gleichfalls brüderlichen Landes, das zwar von uns unabhängig, jedoch so nahe gelegen ist, daß man bei uns gar nicht wegzugehen braucht, um dort zu sein, noch von dort wegzugehen, um bei uns zu sein. Dieses Land liebte seinen, das heißt unseren General wie sich selbst und achtete darauf, daß es ihm gut ging. So vertraute der General dem Ratgeber seine Sorgen an, und der Ratgeber antwortete darauf: »Zunächst warten wir ab und unternehmen gar nichts. Und wenn wir lange genug gewartet haben, geben wir dem Affen einen Orden. Dann einen zweiten, größeren. Dann einen dritten, noch größer als der zweite, und so weiter. Hat der Affe erst dreißig, vierzig Orden zu tragen, wird er in Schweiß geraten, denn die Orden sind bei uns aus echtem Gold und schwer. Und wenn er in Schweiß gerät, wird er sich erkälten und anfangen zu niesen. Wenn er anfängt zu niesen, laden wir ihn zu uns zur Behandlung ein. Denn unsere Sanatorien sind auf der ganzen Welt bekannt, und die ärztliche Betreuung ist bei uns wie sich’s gehört. Es gibt nirgends dergleichen, nicht einmal bei euch. Ja, und der Affe wird behandelt, zu Tode behandelt, und dann richten wir ihm ein erstklassiges Begräbnis aus. Behandlung und Begräbnis auf unsere Kosten und auf höchster Ebene, niemand wird auch nur ein böses Wort sagen können. Also nur Geduld, die Methode ist erprobt, ich sehe da kein Problem, es ist nur eine Frage der Zeit, und Zeit haben wir mehr als genug.«
Der General dankte, weil er höflich war, besonders dem Ratgeber gegenüber, und ertrug von nun an die Affenpossen leichter, weil er die Gewißheit hatte, daß der Affe nur so lange Possen reißen würde, bis man Sanktionen gegen ihn anwandte.
Übrigens hatte der Affe auch seine guten Seiten, wenngleich nicht im Sinne des Generals. Bei den Appellen im Generalsbunker war es so langweilig, daß manche Obersten mit stiller Befriedigung die Abwechslung genossen, die ihnen der Affe immerhin brachte. Sobald der General seine Gedanken vom Blatt ablas, richteten sie den Blick nach oben, um sie zu fassen, denn diese Gedanken waren erhaben, man suchte sie vergeblich am Boden, ja, das gehörte sich nicht. Dann sahen sie, wie der Affe auf der Lampe unter der Zimmerdecke schaukelte und lustige Grimassen schnitt. Nur ein Oberst namens Kasztanek begriff nie, daß der Affe ein Affe war, er dachte, es handle sich um einen weiteren Obersten. Und da er ihm unbekannt war – er konnte sich nicht erinnern, ihn im Kameradenkreise je gesehen zu haben –, glaubte er, der da oben auf der Lampe sei der Adjutant zur besonderen Verwendung, in Zivil, also geheim, deshalb nahm er auf ihn, also auf den Affen, um so mehr Rücksicht. »Was für ein Kopf«, vertraute er seiner Frau voller Bewunderung an. »Sagt nie ein Wort, sondern hört nur, was die anderen sagen. Er nimmt sich in acht, anscheinend ein echter Stratege. Bestimmt weiß er was, weil er nichts sagt. Du wirst sehen, der bringt es weit. Noch weiß man nicht, wie die Dinge sich fügen, wer es mit wem hält, worum es geht. Aber ich habe eine Nase und werde immer zu ihm halten, zu dem auf der Lampe. Das wird sich bestimmt für mich lohnen.« So sprach Kasztanek zu seiner Frau, und bei den Zusammenkünften im Generalstab lächelte er dem Affen beflissen zu, einmal wagte er sogar, ihm verständnisinnig zuzublinzeln. Der Affe jedoch beachtete ihn zu seinem Kummer nicht, weil er sich in einen Hauptmann Dolinski von der Propagandaabteilung verliebt hatte. Er warf ihm Handküsse zu und setzte sich auf seinen Schoß, so daß die Kameraden über ihn lachten. Weiß der Teufel, was er in Dolinski sah, der eine Brille trug und Schlappohren hatte. Vielleicht waren es gerade diese Ohren, die aussahen wie die einer Fledermaus, sie erinnerten ihn vermutlich an seinen heimischen Dschungel, wo es bekanntlich voll ist von allerlei Ekelzeug, darunter auch Fledermäuse. Aber vielleicht lag es auch daran, daß Kasztanek ein Kretin war und Dolinski intelligent.
Wie gesagt, der General liebte die Reinlichkeit, die physische wie die moralische. Er erließ einen Befehl, jeder Soldat müsse sich zweimal im Jahr die Zähne putzen und in der Strafkompanie dreimal. Auch er selbst bemühte sich um peinliche Sauberkeit. Ständig wusch er sich die Hände und rieb sie mit Spiritus ab, bis unter seiner Umgebung das Bedauern wuchs, daß er so viel Spiritus vergeudete. Was die Hände anging, so ließ sich die Sauberkeit ja noch einfach erzielen, doch den restlichen Körper rein zu halten fiel ihm nicht so leicht. Denn der General trennte sich ganz und gar nicht gern von seiner Uniform, wie aber sollte er in Uniform duschen? Ja, unser General und die Uniform, das ist ein und dasselbe, als wäre er bereits uniformiert zur Welt gekommen. Er schlief in einem Uniformschlafanzug mit Rangabzeichen und nahm die Generalsmütze, obgleich sie steif war, nie ab. Zum Baden aber mußte er es tun. Sowohl praktische Gründe als auch die Achtung vor der Uniform zwangen ihn dazu. Im Leben jedes Militaristen muß, wenn er der Hygiene huldigt, der unangenehme Moment eintreten, da sich die Uniform vom Leibe trennt und auf einem Stuhl ruht, während der Leib sich in die Wanne begibt. Und weil die Uniform für den Leib des Militaristen das ist, was die Seele für den Leib jedes anderen Menschen, deshalb ist dieser Moment für den Militaristen der Moment der Trennung von Leib und Seele. Ein normaler Mensch stirbt nur einmal, der Militarist so viele Male, wie er ins Bad steigt.
Nun geschah es, daß, als der General ins Bad stieg und seine Uniform akkurat zusammengelegt auf einem Stuhl ruhen ließ, der Affe herbeischlich und die Uniform still und leise fortnahm. Der General klettert aus der Badewanne, ohne Seele, er möchte auferstehen, das heißt sich wieder in die Uniform kleiden, tritt zu dem Stuhl, schaut, die Uniform ist weg. Der General ist schlachtengewohnt und hat dem Tod ins Auge gesehen, aber gefürchtet hat er sich nie. Erst jetzt überfällt ihn der Schrecken. Der General läuft hinaus, aber ist es der General? Dieser nackte Mensch – ist das noch der General? Woran erkennt man, daß es der General ist, es gibt ja nicht das geringste Zeichen am Generalsleib – dieser General oder Nicht-General läuft aus dem Badezimmer, schaut sich um und sieht den Affen, der sich seine Uniform angezogen hat. Er schreit, läuft hinter dem Affen her, um ihm die Uniform wegzunehmen. Der Affe gibt Fersengeld. Sie stürzen auf den Korridor, der Affe flieht den Korridor entlang, der General (Nicht-General) hinter ihm her. Der General jagt den Affen durch den Generalstab. Da taucht die Wache auf.
»Faßt ihn, haltet ihn!« ruft der General der Wache im Befehlston zu und vergißt dabei, daß er nackt ist. Die Wache traut ihren eigenen Augen nicht und weiß nicht, was sie tun soll. Denn die Generalschaft ruht nicht auf dem General (Nicht-General), sondern auf dem Affen (aber ist der Affe noch ein Affe, wenn er die Generalsuniform trägt?). Die Wache, in solchen Fragen ungeübt, zögert. Ist ein nackter General noch General? Ist ein Affe als General noch Affe? Eine zu schwierige Frage für diese schlichten Menschen. Ja selbst wenn statt dieser kräftigen, aber in der Schule nicht hervorragenden Knappen die Philosophen auf Wache zögen, wäre es durchaus nicht sicher, ob sie eine Lösung fänden. Zumal der nasse General (?) auf und ab lief und schrie und aller Welt seine Genitalien zeigte, die, obwohl klein, den Blicken der scharfäugigen Schützen nicht entgehen konnten, der trockene Affe (?) in Uniform auf und ab lief und entsetzlich kreischte, immer neue Türen sich öffneten, vom Tumult angelockte Stabsoffiziere herausschauten und aus der Wachstube Verstärkung die Treppe emporstampfte. Mit einem Wort, ein Durcheinander, also genau das, was der General ganz und gar nicht mochte.
Doch die Lösung fand sich. Befehlshaber der Wache war an diesem Tage Kasztanek, jener Oberst, der sich vor seiner Frau gerühmt hatte, er höre das Gras wachsen. Als er den Affen in der Generalsuniform erblickte – und wir wissen noch, Kasztanek war der einzige unter den Obersten, der infolge seiner Dummheit nie begriffen hatte, daß der Affe ein Affe war –, glaubte er sogleich, seine Ahnungen seien Wirklichkeit geworden und auf dem Posten des Generals habe ein Personalwechsel stattgefunden. Er beschloß sofort, sich anzupassen und dem neuen Anführer zu dienen. Denn wie sollte es anders sein? Der Anführer ist der Anführer, nur war jetzt jemand anders – so glaubte Kasztanek – der Anführer. Er salutierte eilfertig vor dem Affen, machte dann kehrt und schrie die Wache an, indem er auf den nackten General wies: »Packt ihn!«
Die Schützen atmeten erleichtert auf, denn endlich war ihr Zwiespalt beendet, sprangen bereitwillig auf den Nackedei zu, packten ihn im Genick und schleppten ihn dorthin, wohin man in solchen Fällen die gestürzten Anführer schleppt und was in den Schulbüchern vorsichtigerweise Müllhaufen der Geschichte heißt.