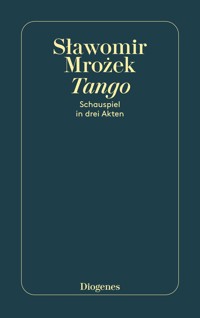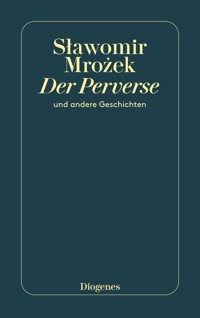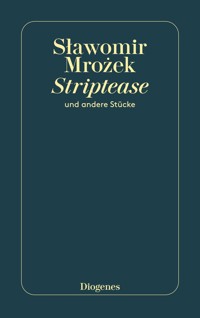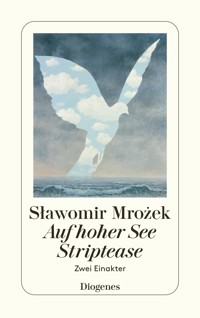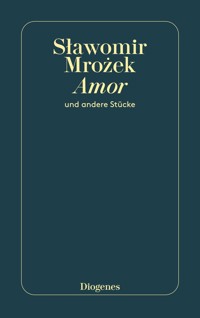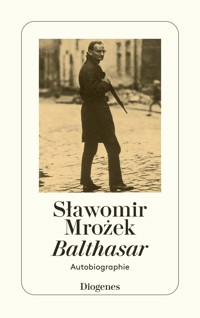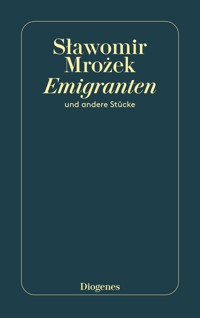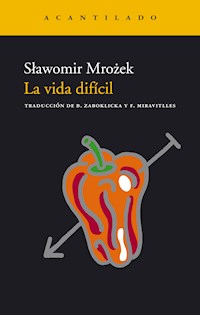7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Die Sechziger waren für den polnischen Dramatiker Slawomir Mrozek entscheidende Jahre, in denen er seine Heimat hinter sich ließ und in Westeuropa mit Stücken wie ›Tango‹ Erfolge feierte. Das Tagebuch eines Autors auf dem Weg in die Weltliteratur – ein großes Werk der Introspektion und Seelenvermessung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 611
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Sławomir Mrożek
Tagebuch 1962–1969
Aus dem Polnischen von Doreen Daume
Diogenes
1962
Im September vor vierzehn Jahren habe ich damit begonnen, Tagebuch zu schreiben. Und im Oktober vor drei Jahren habe ich die etwa zwanzig Bände verbrannt, von denen jeder an die zweihundert Seiten umfasste. Ich habe es nicht bereut. Dieses Tagebuch hatte mir bereits in den drei Jahren vor der Verbrennung immer weniger bedeutet, ich hatte es immer unregelmäßiger geführt, bis ich, einige Zeit vor dem Autodafé, endgültig damit aufhörte.
Es war ein Monstrum, und es hatte drei Motive: das Bedürfnis, mit weißem Papier unter vier Augen zu sein (das war lange vor meinem literarischen Debüt), das Bedürfnis, mich bei jemandem, meinetwegen bei mir selbst, auszuweinen, sowie der Wunsch, Erfahrungen, Lesefrüchte, Ansichten etc. festzuhalten. Drei Bedürfnisse, das ist natürlich eine Vereinfachung. Weder sind sie deutlich voneinander abgegrenzt, noch ist ihre Anzahl definitiv. Ähnlich verhält es sich mit den Motiven für meinen Schlussstrich. Das simpelste und vordergründigste Motiv ist die Tatsache, dass das Schreiben zu meinem Beruf geworden war. Je mehr meiner Texte gedruckt wurden, desto weniger gab ich mich meinen jugendlichen Kritzeleien hin. Obwohl ich auch, als ich längst ein »Schriftsteller« war, noch Tagebuch führte. Diese paar Kilo meiner Herzensabenteuer verbrannte ich natürlich auch aus Angst vor möglichen unbefugten Lesern. Als einmal in meine Krakauer Wohnung eingebrochen wurde, während ich in Amerika war, da begriff ich, dass ich diese Abenteuer vor niemandem geheim halten konnte. In Polen gibt es, soviel ich weiß, keine Safes, und sollte es doch welche geben, so traue ich ihnen nicht.
Aber das ist noch nicht alles. Damals hatte mich plötzlich die Angst gepackt, besonders die vor dem Friedhof. Ich hatte Angst vor dem, der ich nie mehr sein würde, Angst, zum alten Eisen zu gehören. Die Frage, ob ich tatsächlich schon ein anderer war, inwiefern ich schon ein anderer war und inwiefern noch derselbe, bleibt natürlich bis auf Weiteres offen. Vielleicht schämte ich mich vor mir, wollte den kleinen, buckligen Vorfahren meiner selbst verdrängen, als den ich mich sah. Genug der Erklärungen.
Etwa drei Jahre nach dem Feuer, das so hübsch den Ausklang meiner Jugend markieren sollte, und etwa sechs Jahre nachdem meine Lust an Selbstmitleid und Selbstgespräch erloschen war, verspüre ich nun doch wieder, ähnlich wie damals, den Impuls zu schreiben.
Von den drei oder eigentlich vier oben erwähnten Motiven ist nur die eine Frage geblieben: Wie leben?
Es geht um eine Brücke zwischen dem Trubel, dem Leben, wenn man so will, und der Arbeit. Es geht darum, so etwas wie eine Zwischenplattform zu schaffen, eine Art Raumstation, von der aus man den Mond ansteuern kann. Ich gehöre zu einer Generation, für die ein Flugzeug am Himmel noch eine Sensation war. Und doch schreibe ich mit der Schreibmaschine und nicht mit meiner geliebten Füllfeder auf gutem Papier, was mir eigentlich lieber wäre. Rohmaterial habe ich nie ordentlich notiert. Aber wozu diese Erklärungen, für wen?
Natürlich darf ich mich nicht selbst belügen. Ich muss mir gut überlegen, was in Worte gefasst werden soll und was nicht. Ich weiß zwar, was ich denke, aber nur eine Sekunde lang, und die ist schnell vergangen – da haben Sie’s. Die Abmachung gilt: Was ich ab jetzt schreibe, darf jeder lesen.
Ein geselliges Gespräch kommt für mich weder als Werkzeug noch als Methode in Frage. Nur auf dem Papier kann ich ungezwungen plaudern, auch Versuche mit dem Tonband sind erbärmlich gescheitert.
Schade, dass ich keine leserliche Handschrift habe, denn die Schreibmaschine gehorcht mir noch immer nicht ganz.
Ich hoffe, dass ich mich an diese Form gewöhne. Im Moment fühle ich mich unbehaglich. Ende der Vorrede.
Einakter mit dem Titel Kto tam (Wer da?)1
Seit einiger Zeit ist mein Schlaf irgendwie sonderbar. Nur wenn ich betrunken zu Bett gehe, schlafe ich sofort ein und träume nichts. Da ich mich in letzter Zeit kaum noch betrinke, ist mein Schlaf sozusagen eine Art Maschine geworden, in die ich abends das bewusst Erlebte hineinwerfe. Dieses wird die ganze Nacht lang gemahlen und dann wieder neu zusammengesetzt, auf eine geheimnisvolle und doch geordnete Art und Weise, nach einem mir unbekannten System. Die ganze Nacht hindurch, während ich träume, weiß ich, dass ich Stücke und Erzählungen schreiben sollte. Diese Vorgabe ist ständig präsent und komponiert meine Träume. Noch klarer ist das im Halbschlaf, hier zeigt sich noch deutlicher die Berufsbezogenheit meiner Träume. Früher, wenn ich Volleyball gespielt hatte oder gerudert war, tat ich die ganze folgende Nacht nichts anderes, als mich in die Ruder zu legen oder einen Ball übers Netz zu schlagen. So ungefähr ist es jetzt auch.
Weniger im Schlaf als im Halbschlaf kommen mir diese Ideen (das ist nicht das richtige Wort, aber ich finde gerade kein anderes), die gar nicht selten durchaus etwas taugen. Vor einigen Tagen, als ich gegen Morgen in eben so einem Halbschlaf lag, klopfte eine Milchfrau an die Tür und rügte mich mit scharfen Worten dafür, dass ich im fünften Stock wohne (das war um ein Stockwerk übertrieben, aber ich war zu verschlafen, um es richtigzustellen). Schon auf dem Weg zurück ins Bett fiel ich wieder in Halbschlaf und träumte Folgendes:
Wer da?
Personen:
Jaś, beinahe
Vater, unter anderem
Milchfrau, sozusagen
Mutter, in gewissem Grad
Auf der Bühne ein Wohnzimmer (Salon), fünf Uhr morgens, unaufgeräumt, als seien Gäste da gewesen. Es klingelt an der Tür. Durch das Zimmer geht Beinahe-Jaś, verschlafen, im Bademantel. Er öffnet. Die Milchfrau. Nach der Milchfrau klingelt der Hausmeister:
»Es ist nichts, ich wollte Ihnen nur sagen, dass die Milch vor der Tür steht.«
Dann der Briefträger. Beinahe-Jaś, der gar nicht mehr fragt, weil er nach den Begegnungen mit Milchfrau und Hausmeister schon weiß, was kommt, führt ihn ins Zimmer und bittet ihn, sich zu setzen.
»Ich bin nur der Briefträger, und da soll ich mich setzen?«
»Aha, ha, mich können Sie nicht täuschen. Sie sind bestimmt, Moment, wer sind Sie gleich …«
Versuch eines Dialogs mit der Milchfrau:
»Warum klingeln Sie?«
»Sie wohnen im fünften Stock.«
»Im vierten. Ist das ein Grund zu klingeln?«
»Glauben Sie, ich sei die Milchfrau?«
»Wer denn sonst?«
»Da kennen Sie mich schlecht.«
»Sie lassen mich ja nicht …«
»Nein, zuerst muss man nachdenken. Theoretisch, abstrakt.«
Auf dem Weg zurück zum Bett, nach dem Gespräch mit der Milchfrau, begegnet Beinahe-Jaś seinem Vater. Aber der Vater ist nur teilweise wie der Vater gekleidet, teilweise auch wie ein Bischof: Mitra, Bischofsstab und dergleichen.
»Was ist los?«, fragt Jaś.
»Erwartest du etwa, dass meine Persönlichkeit um fünf Uhr morgens bereits genau festgelegt ist?«
Es geht darum, dass in der Kunst, ganz selbstverständlich, jede Person nur sie selbst ist. Erst dann kann auf der Bühne überhaupt etwas passieren. Jede Figur ist durch ein Element bestimmt. Wenn wir mit diesen Elementen operieren, sie kombinieren, auf andere Elemente prallen lassen, dann entsteht Handlung, ein Konflikt und dessen Lösung. In Wer da? soll mit diesem Prinzip gebrochen werden. Jaś greift es jedoch noch einmal auf, er ist der Fürsprecher des Publikums, das an dieses Prinzip gewöhnt ist. Seine Verwunderung und seine Probleme sind die Verwunderung und die Probleme des Publikums. Darum ist er der Beinahe-Jaś (und nicht der Ganze-Jaś). Wie zerfällt aber seine Ganzheit, und warum? Wie soll das vor sich gehen? Vielleicht, indem Jaś auseinanderfällt und ein Teil von ihm weiterhin verwundert ist und Probleme hat, vielleicht sogar einen kleinen Monolog zum Thema hält.
Woher kommt dieses Auseinanderfallen von Persönlichkeiten auf der Bühne, oder anders gefragt, warum sind die Persönlichkeiten so synthetisch? Das könnte man ganz apodiktisch abhandeln, mit einem Monolog des Vaters gleich zu Beginn des Stücks. Oder mit einem Monolog von Jaś, doch der darf nichts erklären, sondern sich nur wundern.
Die zweite Lösung scheint mir besser. Das Geheimnis hat Priorität, also muss man sich damit auseinandersetzen. Schließlich gibt es viele bekannte, wenngleich unerklärliche Fakten.
Sollte ich nun zum ersten Mal gezwungen sein, so zu tun, als ginge es nicht um Theater? Nichts verabscheue ich so sehr wie diesen blödsinnigen Trick, wenn sich in den ersten Reihen ein Schauspieler erhebt, auf die Bühne steigt, mitspielt und immer noch so tut, als sei er nur ein Zuschauer, der sich in das Geschehen einmischt. Natürlich hat Jaś daran etwas auszusetzen:
»Schlimm genug, was in normalen Stücken gespielt wird, aber das hier ist nicht mehr normal. Wo gibt es denn so was, dass der Vater auf der Bühne der Vater und gleichzeitig nicht der Vater ist?«
Vielleicht ist dieser Monolog des armen Jaś also der Aufschrei einer Seele, die vom zeitgenössischen Relativismus gequält wird, von der Zerschlagung der Form, der doppelten Atomisierung, der Natur des Lichts und Ähnlichem? Womöglich handelt dieses Stück von den Grenzen der Kunst, von der Grenze zwischen der Solidität einer traditionellen Kennerhaltung und der Dreistigkeit einer kosmischen Relativität?
Vielleicht fällt Jaś sogar eine Entscheidung, etwa: »Ich bestimme, wer der Vater ist, ich erlaube nicht …« o.Ä. Ein naives, komisches, in seiner Einfachheit bildhaftes Problem. Der Vater erklärt kurz, was geschehen ist:
»Lieber Sohn, du bist jünger als ich, man könnte meinen, dass dich die Errungenschaften unserer Epoche nicht erschüttern. Schon aus der modernen Physik wissen wir, was Beschleunigung, was Geschwindigkeit heißt. Ich habe ganz einfach meine Geschwindigkeit erhöht, ich habe eine große Beschleunigung, das ist alles.«
Jaś beginnt, schnell um den Tisch zu rennen, aber er scheitert. Er bleibt Jaś.
Das Doppelte, Dreifache, kurz, das Vielfache einer Figur erklären, die vom Halbschlaf um fünf Uhr morgens hervorgebracht wurde …
Irgendwie unerträglich.
Jaś:
»Leise, du weckst die Mutter. Was soll sie sagen, wenn sie dich in diesem Aufzug sieht?«
»Nichts, Mutter ist wach.«
»Willst du sagen, dass sie auch …« (Mutter, im Jockey-Kostüm, tritt auf.)
Wenn ich mich an meine Ideen auf dem Weg zurück zum Bett richtig erinnere, dann war der Ablauf so: Ein Stück mit einer bestimmten Handlung operiert mit bestimmten Elementen. Der Vater ist Vater, oder noch dazu Bischof, aber nur Bischof. Das hat Konsequenzen. Plötzlich hört der Vater damit auf, Vater (oder Bischof) zu sein. Das wirft alles durcheinander. Und da kommt mir folgender Gedanke: Soll ich das Ganze nach diesem Prinzip konstruieren? Das Stück wird nicht mehr nur ein Stück, sondern mehrere Stücke sein. Dieselben Schauspieler verwandeln sich in andere Figuren, und dadurch ändert die Handlung nicht nur ihren Verlauf, sondern sie wird schlichtweg zu etwas anderem, ist nicht mehr Handlung, hat mit etwas ganz anderem zu tun. Doch das ist sehr schwer zu realisieren.
Ich kenne Pirandello nicht. Aber gibt es bei ihm nicht etwas Ähnliches? Jedenfalls ist der Gedanke nicht neu. Der Gebrauch von Masken weist darauf hin, ein schüchterner Versuch in die Richtung.
Jaś:
»Vater.«
Vater: »Lass mich in Ruhe, siehst du nicht, dass ich ein Bischof bin?« (Wenn die Mutter im Kostüm eines Jockeys, oder etwas anderem, auftritt, entspinnt sich zwischen dem Vater-Bischof und ihr ein Sketch, wie er sich zwischen einem Bischof und einem Jockey entwickeln könnte, oder auch zwischen Vater und Mutter.)
Diese Sketches, also die Fragmente einzelner Handlungen sind weniger wichtig als die Reaktionen auf diese Handlungsstränge, etwa von Jaś, der sich in diesem Durcheinander überhaupt nicht mehr zurechtfindet.
Milchfrau:
»Ich habe mein eigenes Leben.«
Jaś:
»Kein Zweifel.«
Milchfrau:
»Möchten Sie mein Leben kennenlernen?«
Jaś:
»Gerne, aber um diese Tageszeit …«
(Der Reihe nach treten folgende Figuren auf: Milchfrau, Hausmeister, dann der Vater, als Kulmination.)
Der Vater tritt gänzlich als Bischof auf. Eine Sequenz, in der Jaś mit dieser Tatsache konfrontiert wird. Erst dann spricht der Bischof – »Na ja, ich habe halt beschleunigt verlangsamt« – mit Jaś wie ein Vater-Bischof.
Vater und Mutter machen sich Sorgen, dass Jaś so normal ist. Jaś, vor lauter Verzweiflung, wird auf einmal zum Schauspieler!
»Ich spiele nicht mehr. Ich gehe nach Hause.« Er zieht Mantel und Hut an, wischt sich auf der Bühne die Schminke ab. »Bitte, da habt ihr’s, ich bin ein anderer, ich bin ein Schauspieler, und gleich werde ich ein normaler Mensch sein.«
»Bravo, Jaś.«
»Was denn, freut ihr euch etwa, ich sage, dass ich ein normaler Mensch sein werde …«
»Hervorragend, solange du ein Schauspieler warst, auf der Bühne, da warst du der Gipfel der Eindeutigkeit, du hast nur das getan und gesagt, was dir der Autor befohlen hat. Wenn du jetzt von der Bühne gehst, wie vielen Autoren wirst du dich dann noch beugen?«
Ich arbeite. Das heißt: Ich schreibe ein Werk. Ein bisschen zu lästern kann nicht schaden.
Ich habe die Physiker von Dürrenmatt gelesen. Eine Wohltat, diese Boshaftigkeit. Am besten erledige ich die Lästerei gleich am Anfang: Ein solches Stück könnte ich schreiben, wenn mir einfiele, dass es mein einziges bliebe. Wenn vom Sketches-Schreiben die Rede ist. (Das soll eine Anspielung sein. Es wurde schon oft behauptet, ich schriebe nur Sketches.) Stimmt aber nicht.
Was ist dieses Stück nicht? Es ist kein bisschen wie Čechovs Platonov. Abgesehen von der technischen Perfektion ist es von der gleichen Sorte wie mein Stück Policja (Polizei).2
Aber es kommt noch schlimmer. Zunächst habe ich nur festgestellt, dass auf beiden Erdhalbkugeln ein Stück zum Meisterwerk erkoren wurde, das fast im Rachen brennt, so trocken ist es, so sehr erinnert es an eine altbackene Semmel, die, ohne etwas zu trinken, heruntergewürgt werden muss. Na bitte. Es ärgert mich, dass ich nichts grundlegend Besseres geschrieben habe. Noch schlimmer ist, dass dieser Sketch versucht, uns etwas weiszumachen. Dieses verhasste »mi« ist herauszuhören, der falsche Ton, der entsteht, wenn die Realität nicht von der Seite betrachtet wird, auf der wir leben, also der Seite der Nichtvollendung, der Gegenwart, der erdrückenden Datenmenge, in der wir uns Tag um Tag verstricken. Sondern der Sketch beansprucht für sich, von einem Jenseits aus auf uns zu blicken, als hätte er alles überholt, als kreise er vor unserer Nase herum und hätte dem Gaul ins Maul geschaut, um auszurufen: »Ich weiß was!« Es weiß kein bisschen mehr als wir, nur wir wissen, dass es so nicht geht. Alles wäre in Ordnung, denn es ist ein sehr raffinierter Sketch, wären da nicht wir. Dürrenmatt schneidet solche Grimassen, er denkt sogar noch über dieses Sketchchen nach. Davon zeugt die Liste mit einundzwanzig Punkten, die er ans Ende gestellt hat. Der neunte Punkt ist die Offenbarung: »Träger einer dramatischen Handlung sind Menschen.«
Wie so oft denke ich mir: Warum hat der Autor keinen Radiergummi genommen und das wieder ausradiert, selbst wenn ein Übermaß an Kalorien, Unachtsamkeit oder sonst ein Grund ihn dazu verleitet haben, diesen Satz niederzuschreiben? Lag ihm tatsächlich so viel daran?
Morgen fahre ich nach Krakau, und zuvor will ich Dir noch kurz antworten. Ich habe einen Schnupfen hinter mir und mit Schnupfen geschrieben, es ging nicht anders, denn auch lesen konnte ich nicht viel, schreiben ging besser – noch ein Stück. Ein Einakter, schon der dritte, den eingerechnet, den ich Dir geschickt habe.
Wer weiß, ob ich nicht deshalb ausschließlich für das Theater schreibe, weil es unmittelbarer ist als Prosa. Aber Einakter, in denen man endlos präzise Mechanismen anwendet, verschiedene Varianten ausprobiert und feinmechanische Einzelheiten ausarbeitet, möchte ich keine mehr schreiben, es reicht mir. Wenn ich jetzt noch was für das Theater schreibe, dann ein barockes Werk, mit viel Gequassel, wo sich Wichtigeres abspielt als einzelne Situationen. Ich würde mich gerne auf zwei Hinterpfoten stellen und laut brüllen, zu blöd, dass ich nicht weiß, was ich brüllen soll, wozu und womit.
Im Grunde genommen habe ich doch keinen so großen Hass in mir, wie ihn etwa Dostojewski hatte.
Ich werde von keinen Leidenschaften geschüttelt, und wenn es stimmt, was Andrzej Kijowski4 dauernd über mich schreibt, dass Literatur nur aus Leidenschaft entsteht, dann habe ich herzlich wenig zu tun. Es ist nicht etwa so, dass mir die Leidenschaft fehlt. Sondern dass ich das, was mir sozusagen angeboren ist, nämlich diese Leidenschaften zu entladen, auf eine im Prinzip effekthascherische Art und Weise erledige: durch Schreiben. Ich habe nicht dieses berühmte Gefühl, dass ich irgendwas mitteilen muss, höchst selten muss ich das. Wenn überhaupt, dann ist es sehr allgemein und vage, und ich weiß nie, was genau. Das Motiv, »eine Botschaft zu verkünden«, weil diese vielleicht für die anderen von Bedeutung sein könnte, ist überhaupt lachhaft, keine Rede davon. Davon bin ich weit entfernt.
Mir kommt es vor, als hätte ich hier etwas Wesentliches gedacht. Bisher war das Schreiben ein Mittel für mich, um mich aufzublasen, mein eigenes Leben aufzubauschen. Weitere Kreise zu erfinden als die, die mir gegeben sind. Eher so Geschichtchen, wie man sie Kindern vor dem Einschlafen erzählt, daher die Phantasien, Grotesken und unwahrscheinlichen Konstellationen. Amüsieren und kompensieren. Das ist anscheinend sowieso eine gesonderte Strömung, eine persönliche Literaturgattung. Eine Art Wirkung über die eigenen Kreise hinaus.
Die zweite Gattung, das sind keine Gutenachtgeschichtchen mehr, sondern das Herumbohren im Leben eines anderen, der ich nicht sein konnte. Sie ist natürlich viel desperater, tragischer und schwerwiegender. Sie verzichtet auf Effekte und auf Spaß.
Nicht jeder ist sowohl für das eine als auch für das andere geeignet, die meisten sind nur für das eine geeignet. Bleibt die Frage, warum ich nicht weiterhin brav in der ersten Gattung herumtrotte, diesen Einschlaf-Geschichtchen? Genau weiß ich es selber nicht.
Noch etwas zu der Geschichte, die Du gelesen hast. Ich muss zugeben, dass sie ehrlich ist. Also, wenn ich tatsächlich der Held dieser Erzählung wäre und wenn ich sie mir selbst oder einem Freund erzählen würde, wäre ich nicht gefeit davor, dass mir – dem Helden und nicht dem Autor – einige klitzekleine Zutaten einfielen, kleine Zusätze, Umbauten und Übertreibungen. Da kann ich auch nicht einfach losheulen, das wäre an der Grenze zur Lächerlichkeit, wenn auch letztlich großartig. Da kann ich an meine Erlebnisse nicht ganz aufrichtig glauben, und dieser fehlende Glaube wird sofort sichtbar in eben diesen Übertreibungen, den Bemerkungen, die wie nebenbei fallen, die sich weder in Sujet noch in Handlung einfügen. Daher überlege ich, ob nicht gerade diese meine Erzählung auch eine meiner Grenzen markiert. Klar, ich kann sie übertreten, aber wieder nach dem alten Prinzip, nach dem ich alles gerade eben noch hinkriege. Als einer, der nicht nur ein »goldenes Händchen«, sondern auch ein »goldenes Köpfchen« hat, ein Imitator und Parodist.
So viel für heute. Über alles andere, was für mich im Moment nicht so wichtig ist, und auch über einiges aus Deinem letzten Brief werde ich schreiben, wenn ich wieder aus Kra-kau zurück bin.
Die Sache der »Polacken« sieht heute etwas anders aus als noch vor zwei Jahren, als Ihr ausgereist seid.
Es ist komplex. Vor kurzem wurde in der Zeitschrift Kulisy (Kulissen) über einen Heizer berichtet, der im Suff seine Möbel zerhackte. Betonung auf Zerhacken und Suff, aber zufällig konnte ich in Erfahrung bringen, was dieser Primitivling zerhackt hatte: einen Fernsehapparat, ein Radio und eine Waschmaschine. Wie die Polen das machen, wie sie immer wieder auf die Beine kommen, das weiß ich nicht genau, denn sogar offiziellen Angaben zufolge stecken wir immer noch in einer Krise, aber man spürt den Aufschwung. Vor allem schämen sich die Polen nicht mehr zuzugeben, dass sie verdienen und kaufen. Ganz anders als noch vor ein paar Jahren.
Im Zugabteil waren sieben Personen, mich eingerechnet. Zum vorherrschenden gesellschaftlichen Ton ist mittlerweile das Imponiergehabe geworden, was und wie teuer man etwas gekauft hat. Ich tat, was ich konnte, um nicht vereinnahmt zu werden von der Familie, die sich sofort bildete. Die drei Männer und zwei Frauen stiegen in Warschau als Geschwister aus, mit leicht inzestuösen Zügen, so dass ich mir wie der Verbrecher aus dem Film Pociąg (Der Zug) vorkam. Denn wenn einer sich verhält wie ich und stundenlang mit unter dem Mantel verborgenem Kopf stillsitzt, um sich bloß nicht am Gespräch beteiligen zu müssen, dann ist das verdächtig. Es war ein neuer Waggon, ganz wie normale internationale Erste-Klasse-Waggons, das ist deshalb wichtig, weil solche Interieurs dieses typisch polnische Gebaren unterstreichen. Diese Wichtigtuerei mit ihren ach so guten Manieren, welche so charakteristisch ist für die Polen – solange kein Bedarf aufkommt, sich einen zumindest minimalen Vorteil zu verschaffen.
Die Explosion einer extremen Zuvorkommenheit in völlig nichtssagenden Situationen, »aber gewiss doch, selbstverständlich«, ungeheures Getue, wer zuerst durch die Tür gehen darf, und das alles nur, um sich aufzuspielen und sich gegenseitig mit begeisterten Höflichkeitsbezeugungen zu überbieten, euphorisch, hysterisch. Damit wird Vornehmheit demonstriert, und man möchte sofort aufstehen und einem von ihnen eine schallende Ohrfeige verpassen, um sich Luft zu machen. Unter dem Mantel lauernd, ohne ihre Gesichter zu sehen, konnte ich ihre Stimmen besser aufnehmen, allesamt UNNATÜRLICH, alle spielten etwas anderes, als sie in Wirklichkeit waren. Ich konnte mich davon überzeugen, als ich später, schon zu Hause, ihr ganzes Gespräch haarklein niederschrieb, gedemütigt davon, dass sie mich gezwungen hatten, ihr grässliches stereotypes Verhalten zu verachten.
Die Polen überlaufen die Balkanländer, als handle es sich um ihre Kolonien. So rächen sie sich für ihre Komplexe dem Westen gegenüber. Fast jeder aus »besseren Kreisen« ist zumindest einmal in Bulgarien, in Ungarn oder in der ČSSR gewesen. Ein Handel wie an der Börse. Zum Beispiel der Herr Oberst. Er war einige Zeit irgendwie im Hintertreffen. Als er ein bisschen mit Bulgarien angab, übertrumpfte ihn die Nachbarin von gegenüber mit Budapest, woraufhin er die DDR auffuhr, wobei sich aber herausstellte, dass sie dort schon gewesen war. Da schwieg er zunächst und sammelte sich schweigend, um dann loszufeuern: Rom. Alle verstummten unangenehm, und er hätte gewonnen, wenn ihm der bebrillte Herr aus der Ecke nicht mit Belgien Paroli geboten hätte. Und da es so gut wie gewiss war, dass der Herr Oberst log und der bebrillte Herr nicht (reichlich Details gegenüber nebulösen Ausführungen des Obersts), behielt der Eck-Herr die Oberhand. Hier die Besetzung:
Oberst.
Direktor, 65 Jahre alt, ein Gesicht, so glatt und rosig wie ein Babypopo, die Seele des Abteils, technisch ausgebildet, ein Schulkollege von General Rowecki, aber wer war noch mal General Rowecki? »Sie sehen aber jung aus.« (Ich hasse alle, die 65 sind.)
Bebrillter Herr aus der Ecke, kaum identifizierbar.
Drei Damen (zwei davon stiegen in Kielce um). Alle sauber, gut gekleidet, sichtlich wohlhabend.
Der Reihe nach:
1. Eine Wohnsituation, Schilderung der Nachbarn, die Geschichte, wie man an die Wohnung gekommen ist u.Ä. Herausstreichen der Schwierigkeiten, die es gibt und gab, wenn man an eine Wohnung kommen will.
2. Urlaube, Auslandsausflüge. Einhellige und sehr heftige Empörung über den Tourismushandel, obwohl eigentlich überhaupt nicht klar ist, wer da mit was handelt, alle sind empört, ja, das habe ich schon immer gesagt, auch bei anderen Gelegenheiten!
3. Kleine Äußerungen über die Juden, die nicht als Juden bezeichnet werden, sondern als »Drecksjuden«.
4. Erinnerungen an 1939. Die Damen können sich kaum mehr erinnern, nur ganz verschwommen, weil alle noch Kinder waren.
5. Witze.
Bei den Witzen bin ich hinausgegangen. Aber im überfüllten Speisewagen hatten sich Gruppen gebildet, Rechtsanwälte, Ärzte, alle angeheitert. Auch sie waren gerade beim Witzemachen, sie brüllten sie laut und von mehreren Seiten gleichzeitig hinaus. Über Juden, über Soldaten und über Ärsche. »Halten Sie sich die Ohren zu!« Einige waren so betrunken, dass sie nichts mehr sagten, sie schwankten nur hin und her. Der beste Witzeerzähler war einer, der mir bekannt vorkam, vielleicht ein Schulkamerad, mit Halbglatze, in einem tomatenroten Sakko. Fast alle Polen tragen jetzt weiße Nylonhemden und Krawatten, zumindest im Zug.
Ich ging ins Abteil zurück. Dort fielen sie sich schon fast alle um den Hals. Offenbar waren sie mit den normalen Witzen durch, der Direktor war bereits bei den frivoleren Witzen angelangt, »aus dem Leben«:
»Wir sitzen vor dem Fernseher, die Artistin hebt ihr Röckchen (hier leuchtet seine gespannte rosige Haut fettig auf) und zeigt das Dreieck, und ich sage, könnte sie das nicht mir allein zeigen, warum muss sie das im Fernsehen tun?« Das war die Pointe.
Da sitzt er in seinem Persianerkragen, denn sie machten sich schon zum Aussteigen fertig, und er stopft seine irgendwie kurzen Beinchen in die säuberlich geputzten Stiefelchen.
Ich war an einer Namentagsfeier. Kollegen vom Büro, viele Architekten, die ich kenne, aber nicht mit Familiennamen, die Ihr bestimmt kennt, schwarze Anzüge, Gespräche über Autos, einer importiert gerade einen Motorroller, stattliche Herrschaften, die sich eine Existenz aufbauen, in guten Stellungen, ihr trinkt gar nicht mehr so wie früher. »Und der Herr, was für einen Wagen fährt der Herr?« Der Herr, dem Herrn, mit dem Herrn, des Herrn, herrlich, die Herrschaften, die Herren, bitte, der Herr.
1963
Die Geschichte der Welt ist die Geschichte der brutalen Unterdrückung von Frauen, Kindern und Künstlern durch die Männer.
Unter großen Qualen und sehr spät begann der männliche Teil der Menschheit die Existenz von etwas zu vermuten, wovon jede Frau weiß, was die Männer aber erst später mühselig entdeckten: die Ambivalenz der Gefühle, die Inkonsequenz, die Wechselhaftigkeit, das Vergessen, etwas, was ich das Prinzip des Schillerns nenne. Gewisse Dinge, wie Proust sie aufzeigte, sind so, nämlich natürlich, weiblich. Deshalb sind die Frauen »gedankenlos«. Sie müssen nämlich nicht denken, denn sie sind selbst Schlussfolgerungen aus dem Denken.
Die Männer erdachten, nach ihrem eigenen Ebenbild, das logische, also einfach gestrickte Denken, das sich zu den Dingen so verhält wie die Arithmetik zur Algebra. Es waren unerhörte Anstrengungen nötig, um auch nur ein winziges Stückchen darüber hinauszugehen. Als sich herausstellte, dass die Frauen anders denken, waren die Männer beleidigt und nannten sie dumm oder unlogisch, was in der männlichen Nomenklatur das Gleiche bedeutet. Als passende Ideologie zur eigenen Phantasielosigkeit erdachten sie den Begriff der Ehre.
Was ich bei den Frauen ebenfalls so angenehm und sympathisch finde, ist die Tatsache, dass sie sich für ein derartiges Scheinproblem nicht interessieren.
Künstler haben Erfolg bei Frauen. Der Begriff der Ehre, der Konsequenz, der Logik ist ihnen oft fremd. Sie sind intuitiv, »unberechenbar«, kurz: »verweiblicht«.
Die Bezeichnung »Verweiblichung« ist im Grunde schmeichelhaft. Es bedeutet, dass die betreffende Person sich öfter wäscht und seltener andere Menschen tötet, empathiebegabt ist, nicht brüllt und drängelt, um ihre Wichtigkeit zu beweisen.
Frauen kennen den Wert des menschlichen Lebens, nicht nur deshalb, weil sie andere Menschen in die Welt setzen, sondern auch, weil sie sie aufziehen und wissen, was das für eine Plage, Verantwortung und Mühsal ist. Männer ziehen keine Kinder auf, bestenfalls machen sie hierfür einen gewissen Geldbetrag locker. Kein Wunder, dass ein Massaker ihnen später nicht nur als ein netter, sondern möglicherweise auch als ein nützlicher Zeitvertreib erscheint.
Das Frauentrauma der Männer ist ein Resultat traumatisierter Eigenliebe. Daher die Verachtung und die Geringschätzung, als künstliche Entschädigung.
Es ist völlig normal, dass Frauen keine Kunst schaffen. Sie müssen keine Kompensation, keinen Katalysator, keinen Ersatz suchen, ebenso wenig wie die großen Mystiker, die auch keine Kunst schaffen. Frauen, ähnlich wie die Mystiker, haben einen direkten Draht zur Realität, durch die Liebe.
Ich mag keine Männlichkeit.
Die Polen, wie in allem, sind verlegen oder aufgewühlt, sie sind mal so, mal so, immer irgendwie weder noch. Der Pole ist ein individuelles Herdentier. Er spottet gerne über westlichen Uniformismus, merkt aber nicht, dass alle Polen sich wie Herdentiere verhalten.
Der Pole ist auch nicht ein Ameisenhaufenbewohner wie der Chinese, auch wenn das Gewimmel ein Ausweg aus der Situation wäre. Der Pole erinnert mich in seinem Verhalten leider sehr an ein gewisses Tier, das ich als Kind auf dem Gehöft meines Großvaters oft beobachtet habe.
Mein Großvater züchtete Schweine, oft schaute ich ihrem Treiben zu. Schweine drängeln sich ganz schrecklich, übereinander und untereinander, wobei aber jedes einzelne, für sich gesehen, individuell ist. Die Summe dieser voneinander unabhängigen, individuellen Reflexe ergibt ein schreckliches Durcheinander in der Herde. Zum Beispiel, wenn Futter in den Trog gegossen wird.
Von den Ländern, die ich ein bisschen kenne, tritt man sich in Polen am häufigsten bei täglichen Verrichtungen gegenseitig auf die Füße. Man muss hier die doppelte Last tragen. Die Last der eigenen Unerträglichkeit plus die der anderen Exemplare, die einem tagtäglich auf den Nerven herumtrampeln.
Schon wieder soll ich was schreiben. Train-train de la vie – das genügt nicht. Der Mensch ist irgendwie unbefriedigt, wenn das alles sein soll. Andererseits ist Schreiben sehr ermüdend.
Ich möchte es einfach seinlassen, doch wenn ich diesem Impuls nachgebe, wäre das wieder unbefriedigend und ungenügend. Christus, als er am Kreuz starb, hat sich wahrscheinlich einem Gesetz untergeordnet. Er wollte ganz und gar nicht sterben, aber nicht zu sterben hätte für ihn eine schlimmere, blinde Qual bedeutet, weil er nicht das vollbracht hätte, was er vollbrachte, indem er sich für den Tod entschied. Mag sein, dass eine Erhabenheit in solchen Entscheidungen liegt, aber ist das Wohlbefinden dadurch ein besseres?
Wie gerne möchte ich meinen Mechanismen, meinen Schablonen entkommen, davon muss ich mich nicht erst selbst überzeugen. Die kleine Form ist wahrscheinlich nichts für mich, weil jedes Beenden Enttäuschung bedeutet, auch wenn ich natürlich während der Arbeit ungeduldig bin und von einem Abschluss träume. Mit dem Beenden einer Arbeit verlässt man diesen kleinen Schutzraum, der einem die gefährlichen Indifferenzen der Welt vom Leibe hält. Also je größer die Form, desto länger ist man geschützt, desto gemütlicher kann man es sich im Schutzraum einrichten.
Eine größere Form also, aber um Himmels willen, welche? Zunächst vielleicht ein Embryo, ohne zu behaupten, dass es eine größere Form, überhaupt irgendeine Form annehmen soll.
Drei Herren standen, wie drei Gesandte, am Beginn meines einigermaßen bewussten Lebens. Die Vertreter eines Produktionsbetriebs von Kunstfasertextilien. Sie planten die Produktion einer neuen, besonders widerstandsfähigen Stoffart für Kinderkleidung. Sie suchten, für einen Gebrauchstest, einen Jungen, der gerne Treppengeländer hinunterrutschte, was für kurze Hosen eine maximale Herausforderung sein kann. Für ein paar Versuchshosen und eine kleine monatliche Aufwandsentschädigung wurde ich dazu verpflichtet, die Hose permanent zu tragen und Treppengeländer hinunterzurutschen, wo immer es ging. Mit welchen Konsequenzen?
Erstens: die Beziehung meiner Eltern zueinander, und ihre Haltung, die Haltung der anderen Familienmitglieder mir gegenüber. Jeder weiß, dass Treppengeländer hinunterzurutschen eine Sünde ist. Trotzdem brachte die Sünde in diesem Fall ein Einkommen, was einer Auszeichnung gleichkam und den Jungen irgendwie berühmt machte. Ein Umstand, dem sich die Eltern nicht verschließen konnten. Sie hätten es strikt verbieten müssen, aber sie verboten es nicht. Sie reagierten menschlich. Dabei spielte der materielle Gegenwert eine geringere Rolle als die Satisfaktion, dass der Junge plötzlich wer war. Wie kamen sie moralisch damit zurecht? Da gibt es mehrere Sichtweisen, je nach Einzelreaktion der erwachsenen Familienmitglieder. Gewiss ist, dass es zu einer Art Kompromiss kommen musste, zu Heuchelei und Konformismus der Erwachsenen, was nicht ohne Einfluss auf meine Weltanschauung blieb.
Weiter – wie habe ich selbst mich in der Situation zurechtgefunden? Der Ruhm, natürlich. Hat mein Interesse an Treppengeländern und am Hinunterrutschen ein wenig nachgelassen? Unzweifelhaft ja. Ich rutschte zwar weiterhin schwungvoll überall hinunter, der Wille zum Hinunterrutschen wuchs sogar. Doch meine Natürlichkeit hatte gelitten. Sagen wir: Es war nicht mehr die reine Wonne. Sie war einer komplexen Art der Ernsthaftigkeit gewichen, einer Pflichterfüllung. Das Rutschen war kein Selbstzweck mehr, sondern es diente etwas anderem.
Bleibt noch die Relation: ich und meine Spielkameraden. Das ist einfach abzuhandeln. Es gab da eine Kameradin, die einen Wettbewerb gewonnen hatte, für das schönste Kinderlächeln in einer Frauenzeitschrift. Vielmehr hatten ihre Eltern gewonnen, durch Zusenden eines Fotos. Diese Auszeichnung brachte uns einander näher. Aber vielleicht hatte mir in Wahrheit eine andere Kameradin besser gefallen, eine ohne Auszeichnung? Als ich damit begann, mit Schmirgelpapier überzogene Treppengeländer hinunterzurutschen (eine von der Firma vorgesehene Erfahrung oder ein Streich der neidischen Kameraden), hätten nicht nur die Kameraden neidisch sein müssen, sondern auch die Ergebnisse komplizierter. Kollektiver Stolz gegenüber den Nachbarskindern vom nächsten Hinterhof? Einer hatte von seinen Eltern schon den ausdrücklichen Befehl bekommen, das Geländer hinunterzurutschen, immer wieder, damit die Herren von der Firma auf ihn aufmerksam würden. Und mein Onkel sagte: Lern was! Dein Start war schon ganz gut, aber mit Geländerrutschen kannst du im Leben nicht alles erreichen. Erst verschwindet die Werbung mit den Fotos von dir auf dem Geländer, und dann ziehen die Hosen in die weite Welt. Und so kam es. Da stand ich, allein mit meinen erwachten Emotionen. Das könnte das erste Kapitel sein. Aber das zweite?
In Motyl (Schmetterling) von Jaś Szczepański wird vom Heranwachsen eines Jungen vor dem Krieg erzählt.
»Vor dem Krieg« – das ist für mich die Welt der Kindheit. Das Heranwachsen hatte in meinem Fall ausgerechnet vor dem Krieg stattgefunden.
Im Zentrum fünf Jahre Okkupation, ein seltsames Zwischenspiel, eine große Stagnation.
Als ich im Flur meinen blauen Sonntagsmantel säuberte, gleich am zweiten Tag nach der Befreiung, da kam ich mir vor wie Alexander der Große, der seine Rüstung reinigt.
Was ich heute geträumt habe. Der Traum war wie ein Stück Literatur, zwar von mir geschrieben, aber nicht in Gänze. Die Unvollständigkeit kam vielleicht daher, dass ich den Traum sehr deutlich als Literatur in reiner und definierter Konvention erlebte – wie in der Konvention von Radiguet, jedenfalls eine Erzählung mit den Realien des Ersten Weltkriegs.
Ein französischer Offizier kehrt von der Front heim, er hat Urlaub. Im Zug erfährt er, dass seine Frau ein Flittchen ist. Er steigt an der ersten Station aus. Hier lernt er eine Person kennen, die behauptet, sie erwarte ihren Mann, der Fronturlaub habe. Er bleibt bei ihr, lebt mit ihr, und ihr Mann kommt nicht. Der Offizier hat den Verdacht, dass das mit ihrem Mann ein Schwindel war, aber er findet bei ihr die Dinge so vorbereitet, als hätte sie ihren Mann wirklich erwartet. Er denkt an seine Frau und kann sie nicht vergessen. Als er den Zigarettenvorrat für den noch immer nicht heimgekehrten Mann aufgeraucht hat und sogar zu einer schlechteren Marke übergegangen ist (ich weiß noch, dass sie MD2 hießen, Kriegszigaretten für Soldaten), geht sein Urlaub dem Ende zu. Er hat übrigens auch genug von den Frauen und will die restlichen zwei Tage allein verbringen, vielleicht sogar am selben Ort wie seine Frau, wenn auch ohne die Absicht, ihr zu begegnen. Beim Abschied gesteht seine zeitweilige Gespielin, er sei für sie nur so was wie ein Inkubus gewesen, eine Gliederpuppe, für die Zeit des Wartens auf ihren Mann, der verschollen sei. Und ob er jetzt dächte, das sei Betrug? Sie hatte ihn wirklich liebgewonnen, er tat ihr auch leid, jedoch der, wie soll ich es nennen, Egoismus siegt, eigentlich siegt die Grausamkeit. Dem Mann blieb nicht einmal der Trost der Revanche für sein eigenes Betrogensein, er war doch nur Ersatzmann für einen Verstorbenen gewesen. So reist er ab.
Sollte ich das je schreiben, müsste ich einen eigenen Schlüssel finden, es von Radiguet zurück zu mir übersetzen, vielleicht in die erste Person?
Das »Land des Vorsitzenden« verlassen.6 Eine Kneipe soll mittels Rollen verschoben werden, da sie zu weit in den Marktplatz hineinragt. Eine technische Operation wie das Versetzen der Mariä-Geburt-Kirche in Warschau.7 Aber die Berechnungen sind falsch, der Schwung ist zu groß, und das kleine Gebäude mit der Kneipe springt aus den Schienen und schiebt sich, nicht allzu schnell, aber gleichmäßig, immer weiter voran. Es kann nicht aufgehalten werden. Sensation und Konsternation. Jetzt läuft noch die Familie der Route entlang und reicht warme Schals, damit sich die Leute darin einwickeln können. Schon ist die Kneipe an der Vorstadt vorbei, schon verschwindet sie im Gelände. Die Sensation in Polen. Hubschrauber. Am Weg Schaulustige, die sich durch einen Schlauch mit Wodka versorgen, wie Flugzeuge, die in der Luft betankt werden müssen. Barrikaden können keine aufgestellt werden, denn dann fiele das Gebäude auseinander und die Menschen darinnen wären in Lebensgefahr. Die UNO interessiert sich für den Fall.
Oder wenn ein tauglicher Prellbock aufgestellt wird, Richtungsänderung der Kneipe wegen starkem Wind oder wegen örtlicher Gegebenheiten, Gefälle usw. Schon sind wir nahe der Grenze. Wir bereuen, keine Waren mitgenommen zu haben, aber immerhin haben wir Spiritus und Kabanossi. Behinderungen durch Gewässer? Wo bleibt die Kneipe stehen? Vor dem Mailänder Dom? Technische Ursache: Anwendung von Gleitmitteln, die Reibung wird vermindert. Es geht weiter durch verschiedene Länder. Vorbei an einem Hügel, auf diesem Kongregation, Generalisierung, Verhandlungen mit dem General. Wir, im Hinterzimmer, haben den Heringssalat des Generals im Auge.
Proust hat natürlich recht, dass jedes Gespräch immer auch eine Entleerung der eigenen Person ist. Woher das Gefühl? Vielleicht durch die Insuffizienz der gesprochenen Sprache. Beim Denken wissen wir genau, worauf wir hinauswollen, aber wenn wir es aussprechen, sind wir ein bisschen enttäuscht. Ist es nur das? Unsere kostbaren Errungenschaften lassen sich in ein paar Sätzen ausdrücken, und damit sind sie eigentlich erschöpft und machen nicht den Eindruck, als seien sie besonders gehaltvoll. Schuld ist die gesprochene Sprache, und vielleicht gibt es noch einen weiteren Grund, dass uns tatsächlich das, was wir nur vage ahnten, größer und schöner erscheint als das Ausformulierte. Was die Sprache anbelangt, so teilen, nach größten Anstrengungen und Mühen, wohl nur eine Handvoll Bücher der Welt notdürftig das mit, was der Autor sagen wollte, und das, wie dieser mutmaßt, sicherlich auch ungenügend. Da kann man von beliebigen Sätzen, die irgendwie, beim Warten, zufällig zusammengestoppelt wurden, kaum verlangen, dass wir uns mit ihnen verständlich machen können.
Wenn wir etwas aussprechen, uns austauschen, ähneln wir einem Teekessel mit kochendem Wasser, von dem der Deckel abgenommen wurde. Der Druck fällt. Bis dahin war es ganz angenehm, sich im Besitz eines eigenen, persönlichen Geheimnisses zu wähnen. Nun teilen wir es, auch ein wenig deshalb, weil wir jemanden überraschen wollen, wir wollen den Zuhörer höchstpersönlich zum Staunen bringen. Und dann sind wir enttäuscht, denn nach dem Aussprechen breitet sich in uns eine Ebbe aus.
Aber ein entleerendes Gespräch, das Nachlassen des inneren Drucks kann auch ein Weckruf sein. Denn wir wollen uns wieder anfüllen, von neuem mit der inneren Arbeit beginnen.
Der erste ruhige Tag nach einigen unruhigen. An unruhigen Tagen sehnt man sich nach einem ruhigen, und wenn er dann kommt, fühlt man sich unbehaglich. Erst der zweite, dritte ruhige Tag bringt eine Gewöhnung, die bewirkt, dass die Vorzüge ruhiger Tage nicht weiter belastend sind.
Was soll ich mich verstellen, ich möchte diese Seite ganz füllen, mir fällt aber überhaupt nichts ein. Genauso gut könnte ich ein Stückchen aus dem Ekspress abschreiben. Vielleicht zeichne ich lieber etwas.
Die Katholiken sagen, Böses zu denken hätte in den Augen des Herrn das gleiche Gewicht, wie Böses zu tun. Das widerspricht dem Marxismus, Gombrowicz und mir. Es kommt darauf an, wie der Mensch zu Gott steht.
Literatur ist eine Art, sich zu denken, was man nicht sagen kann. Daher ist die Literatur nur schriftlich.
Mein grundlegendes Misstrauen gegenüber den Kritikern findet immer neue Berechtigungen. Wie wenn ich jemanden zum ersten Mal treffe und sage, ich hätte kein Vertrauen zu ihm, weil ihm das Böse aus den Augen schaut. Und dann stellt sich heraus, dass er ein Schurke ist.
Es stimmt, dass sich in meinem Kopf viele Gedanken zusammenballen, auch die Philosophie, und wie. Dann wieder habe ich plötzlich Watte im Kopf. Alles hebt sich gegenseitig auf, nichts bleibt übrig. Um jetzt ein Büschel dieser Watte loszuwerden, müsste ich eine Tatsache schaffen.
Mein Tennisspiel war von Beginn an etwas zu orgiastisch, bacchantisch, es musste zwangsläufig mit einem postorgiastischen Zustand enden, im vorliegenden Fall mit einem heftigen grippalen Infekt, den ich jetzt gerade überwinde, drei Tage vor dem geplanten Abflug nach Rom.
Den hier notierten Texten fehlen alle privaten Briefe. Ich hatte die Idee, einige Briefe mit Kohlepapier zu vervielfältigen, habe es aber verworfen. Ähnlich wie im britischen Parlament, wo es eine beunruhigte Petition gab, nachdem die Polizei private Telefongespräche abgehört hatte. Es wäre nützlich, aber so etwas tut man nicht.
Noch nie schien mir eine Abreise derartig irreal.
Es war schon höchste Zeit, diese Aufzeichnungen wieder einmal durchzusehen. Hier brauche ich mich nicht zu genieren, wenn die Metaphern nicht von der guten Sorte sind. Sie sind wie Wildpferde, und ich bin wie ein Hirtenbub. Die Pferde verstehen rein gar nichts, aber der Hirtenbub glaubt, dass er sie hütet.
Die Umstellung auf einen neuen Lebensstil, und zwar auf einen nach dreißig, war eine Notwendigkeit. Meine Begierden, also meine Motoren von früher, sind verschwunden. Ich begehre nichts, so wie es im zehnten Gebot steht. Ich stehe einer Salzsäule gleich vor den schönsten Landschaften der Welt, ich durchschreite die reichsten Straßen. Um nicht bis ans Ende meiner Tage in greisenhaftes Dahindämmern zu verfallen, muss ich diese Motoren mit etwas ersetzen, ich muss aus diesem Dämmer erwachen. Das alte Haus ist ganz von allein zerfallen, und um nicht in Ruinen zu hausen, muss ich ein neues bauen.
Der (geographische) Süden, das sind für mich die Grillen.
Diese Notizen sind für mich keine sportliche Leistung, aber sie halten den Spieler in Form, sie geben ihm das Bewusstsein zurück. Ich bin schon lange nicht mehr darauf aus, alles wiederzugeben, was mir zustößt.
Wenn ich morgen nicht anfange zu arbeiten, werde ich wahnsinnig.
Ich arbeite, ich bin nicht wahnsinnig geworden.
Zwei Dinge sind mir klargeworden. Erstens: Ich muss mich, wenn ich mit mir abrechne, als ganz normales Element behandeln, und nicht als heroisches. Zur Konstruktion gehört eine mittelgradige Belastbarkeit, je höher, desto besser, aber ich darf nicht erwarten, ein Held zu sein. Die eigene Normalität muss ich in Betracht ziehen, nicht die Außergewöhnlichkeit.
Zweitens: Zeit ist Bewegungslosigkeit. Der Verlauf der Zeit ist eine Illusion, gespeist von Erinnerung und Voraussicht. Der sogenannte Augenblick ist nicht die kleinste Zeiteinheit, denn eine solche gibt es nicht, es gibt gar nichts, die Zeit existiert nicht. Wenn ich versuche, das zu definieren, entferne ich mich natürlich von meiner eigenen Wahrheit. Also verdient das Ganze nicht einmal die Bezeichnung Schlussfolgerung (Definition). Man kann nicht »den Augenblick packen«, denn es gibt keinen Augenblick. Warum vermitteln Meditation und Versenkung beim Sonnenuntergang u.Ä. ein Gefühl der Vertiefung, des Näherkommens? Sie finden in praktischer Bewegungslosigkeit statt.
Ich schaue gern in den Himmel, der mich zum Zeugen hat. Durch diesen Himmel existiere ich, aber bin ich ihm irgendwie nützlich?
Der Mensch glaubt, er sei ein Gigant, aber er ist nur ein Hosenscheißer – dieser Satz von Hasek klingt so harmonisch, hier an der Riviera, in meinem Ohr, für mich. Habe ich etwa ein halbes Jahr lang geglaubt, ich sei ein Gigant, während ich doch … etc. Gigant, Hosenscheißer, diese Alternativen zu umschiffen, einfach etwas anderes sein, das wäre ein Ausweg.
Die Riviera – nicht weit von hier hat Maupassant seinen Roman Bel-Ami geschrieben, ein Stück weiter schrieb Sienkiewicz Bez Dogmatu (Ohne Dogma), Gorki weilte im Süden auf Capri, und Dostojewski in Florenz. Gogol hat seine Toten Seelen in diesem Land erfunden, und auch Turgenjew hat hier gewirkt. Da komme ich nicht mit, ich habe weder Kraft noch großes Talent, ich bin verkorkst, verkrüppelt, mittelmäßig begabt, habe nirgendwo etwas Außergewöhnliches, am ganzen Körper nicht. Ich bin genau dreiunddreißig Jahre und zwei Tage alt, ich bin verheiratet, aber ich fühle mich nirgends, ich fühle mich nicht als einer, höchstens als niemand. Ich habe keine Ahnung, was oder wie ich schreiben soll, nicht einmal, worüber. Meine Gesundheit ist durchschnittlich gut, meine Gelüste störend, aber zu schwach, als dass sie etwas anrichteten, und zu stark, um nicht zu stören. Hinter mir sehe ich keine Vergangenheit, vor mir keine Zukunft. Das Einzige, was ich schreiben kann, sind Briefe, das Einzige, was ich gut denken kann, sind Zweifel. Weder hasse ich mich selbst, von gelegentlichem Missfallen abgesehen, noch liebe ich mich, von gelegentlichen Vergötterungen abgesehen. Ich bin eine Hülle, die in jedem Moment von einem anderen ausgefüllt wird, meistens ist es eine mit Indifferenz ausgestopfte Hülle. Alles kann ich relativieren und nichts beherrsche ich wirklich, ganz und gar. Vielleicht sollte ich Schauspieler werden, aber da habe ich auch meine Zweifel, weil ich vielleicht doch ein bisschen zu viel eigenen Verstand habe. Mein Verstand ist zwar klein, aber ich habe zu viel davon. Weder besonderes Wahrnehmungsvermögen noch Gedächtnis, Phantasie kulturabhängig, Sensibilität irgendwie fruchtlos. Gut zu wissen, wo man steht.
Ich kann nicht einmal wirklich etwas für mich verlangen, weil ich nicht aufrichtig davon überzeugt bin, dass ich etwas verdiene. Es ist unwahr, was einmal einer über mich geschrieben hat, dass ich kein Talent zum »religiösen« Denken hätte. Wahr ist vielmehr, dass ich verstehe, was er gemeint hat. Ich bin alles ein bisschen, im Endeffekt bin ich gar keiner. Am besten geht es mir wahrscheinlich im Zusammenhang mit dem Theater, das heißt aber nicht, dass es mir da gutgeht, denn gut geht es mir nirgends und niemals, es sei denn, ich rede es mir ein, wozu ich aber nicht immer genug Lust oder Kraft habe.
Dreiunddreißig Jahre – das Verbrennen meiner alten Tagebücher war genauso eine schlappe Geste wie das Schreiben derselben. Nichts und wieder nichts in meiner Kasse, in meiner Rechenmaschine. Manchmal denke ich, wozu soll ich überhaupt rechnen, aber dann rechne ich doch, halt so.
Die Riviera – zum Glück schon lange unterworfen, nein, nicht unterworfen, sie ist von selbst dahingeschieden, parallel dazu, wie aus mir das Leben weicht.
In Wirklichkeit freut mich weder die Anerkennung der anderen noch meine eigene, mir wirbeln manchmal Erinnerungen aus der Kindheit im Kopf herum, und dann ist mir, als hätte es vielleicht damals irgendetwas gegeben, was verlorenging, auch das wahrscheinlich etwas Banales.
Eine Gestalt (ein Pole), deren einziges Argument es ist, geschlagen worden zu sein. In Gesellschaft klagt er: »Au weh, man hat mich geschlagen. Sehen Sie, hier, den Backenzahn, auch ausgeschlagen, gleich zeige ich es Ihnen.« Ein Fenster geht auf, ein Gesicht erscheint im Fenster, er bohrt mit dem Finger im Zahnfleisch herum: »Ausgeschlagen, ausgeschlagen«, sagt er immer wieder, langweilig. Die anderen spielen Klavier, führen Diskussionen, und er in einer Tour: »Au weh! Ausgeschlagen! Hier ist einer ausgeschlagen, da, au weh!«
Mir wird übel. Mir ist von mir übel.
Heute Hitze. Und sonst? Sonst nichts. Hitze. Die Hitze an sich. Ich habe keinen Schlüssel zu ihr, ich kann sie mit nichts in Verbindung bringen. Sie sich, ich mich. Gottes Wille geschehe, rauchen wir eine Zigarette. Mehr bleibt mir nicht übrig. Cowboys, Cowboys, wohin man schaut, jeder pafft sein eig’nes Kraut.
JA, DAS BESCHREIBT DIE SITUATION AM RICHTIGSTEN.
Cowboys, Cowboys, wohin man schaut, jeder pafft sein eig’nes Kraut. Also rauche ich mein eigenes Kraut.
Ist das jetzt die Strafe für die Selbstgefälligkeit oder was? Ja, für Selbstgefälligkeit wahrscheinlich. Die Ware ist ausverkauft, nur auf den Regalen liegen noch ein paar Restchen Meterware. Der Abend kommt, ich sitze hinter der Kasse, drehe meine Kurbel, es sollten Einnahmen da sein, aber da ist nichts. Ich drehe noch mal, weil ich es nicht glauben kann, nein, wirklich null, »o«, »ooo«, nicht mehr, nichts anderes.
Ich habe jenes Tagebüchlein weggeschmissen, ich habe jenes Tagebüchlein nicht weggeschmissen, ganz egal, wieder sitze ich da, wie im richtigen Leben, auf den Fluren von einst mit einem leinenen Brotsack, darin ein Brot mit altem Speck, gelblich, in Papier gewickelt, verschossene kurze Hosen, ich bin sechzehn oder siebzehn Jahre alt. Anscheinend ist es damit aus, die Kompression kam, dann die Rache, Explosion, stimmt nicht, Explosion gab es keine, es gab gar nichts, nichts hat sich geändert. Nur so viel, dass es jetzt auch keine Kompression mehr gibt. Nur der Himmel ist geblieben, derselbe Himmel, obwohl es die Riviera ist, aber das macht nichts, es ist derselbe.
Ich habe auch einmal selbstgefällig geschrieben, dass ich in Ruhe gelassen werden wollte, dass ich keinen Treibstoff von außen brauchte, keinen Glauben, dass ich schon wüsste, wie ich den Motor zum Laufen brächte. Und? Der Motor verreckt immer wieder, auf der letzten Reserve.
Vielleicht stört mich die Maschine? Vielleicht soll man nicht auf der Maschine schreiben, sondern wie früher mit der Feder, vielleicht ist da etwas dran? Quatsch, da ist nichts dran. Nur dass ich gleichzeitig Pfeife rauchen kann.
Die Sache ist die, dass ich wegen der langweiligen äußeren Gegebenheiten vielleicht nie mehr nach Polen zurückkehren werde.
Klar: Das würde mein Leben irgendwie verändern.
Allein die Möglichkeit hätte sofortige Auswirkungen auf mich als Ganzes. Vielfältige. Wie eine Verletzung mitten im Nervenzentrum. Ich spüre mich bis in die periphersten Nerven.
Es wäre wirklich unglaublich und hinterhältig vom Leben, wenn ich, der so überhaupt nicht dafür geeignet ist, mein ganzes elendes Leben riskieren müsste, mein Leben, das mir so zuwider ist, die Ungewissheit, die ich nicht aushalte, die politischen Deklarationen nach außen hin, das Akzeptieren dessen, was mir so verhasst ist. Jetzt verstehe ich Krzyś T., der oft über Caravaggios Bild Die Berufung des hl Matthäus sprach. Matthäus blickt auf Jesus, der plötzlich in der Tür erschienen ist und ihn mit dem Finger zu sich ruft. Seine Kollegen sind derweil fröhlich beim Würfeln. Das Gesicht von Matthäus drückt höchste Erschrockenheit aus: »Ich? Ich?« Als wollte er, überwältigt und entsetzt über die Berufung, ungläubig ausrufen: »Warum gerade ich?«
Das ist die Geschichte. Aha, und ebenso plötzlich, das ist gewiss, wird der Tod eintreten. Jedenfalls kommt es immer so, auf die gleiche Art, alles, was größer und schneller als der Mensch ist, das, was ich eben Geschichte nenne. Zu groß, zu schnell, um es zu erfassen, um es zu begreifen. Es ist wahrscheinlich in etwa so überraschend wie ein Kriegsausbruch. So schnell kannst du gar nicht schauen, und schon sitzt du, seit Tagen unrasiert, bei irgendeinem Graben, hältst zum Beispiel ein kleines Zicklein am Bein, ringsum liegen verstreute Streichhölzer herum, hinter dem Horizont grummelt es, du willst schlafen. Alle diese Elemente sind normalerweise nicht zu erklären. Aber das alles ist der Krieg. Ich erinnere mich, wie Johannes XXIII. den Kindern im Waisenhaus, die er besuchte, erklärte, was ein Papst ist:
»Das ist ein Auge«, erklärte er, wobei er auf sein Auge zeigte. »Das ist eine Nase, das ist ein Mund, das sind Ohren usw., und das alles zusammen ist der Papst.«
Wenn ich heute sterben sollte, würde ich bereits etwas Ähnliches wie eine abgeschlossene Biographie, ein Leben hinterlassen. Nicht mehr nach Polen zurückzukehren, das käme einem Selbstmord gleich, der vielleicht doch so etwas wie ein neues Weiterleben nach sich ziehen könnte, oder aber nichts als Ärger. Es könnte auch etwas ganz anderes nach sich ziehen, wovon ich nichts weiß. Ich habe in letzter Zeit die Schalkhaftigkeit des Lebens zu schätzen gelernt. Ich gebe ihm den Kurs vor und denke naiv, dass es schon etwas daraus machen wird. Eigentlich gebe ich auch gar nichts vor, sondern sehe voraus, wohin es mich treibt. So wie in den letzten beiden Jahren. Ich war sicher, dass ich in der Piekarska-Straße sterbe.9 Zu diesem Zweck habe ich mir einen Anzug aus meinen Tagen, Monaten und diesen beiden Jahren genäht, ich habe mich auf diese Art geformt, behauen. Frage: Habe ich so viel Talent, dass ich in jeder Lage ein Lied summen könnte? Würde ich in der einen Lage ein sauberes Lied summen, in der anderen ein weniger sauberes? Wäre es da nicht besser, ich würde eine bequemere Lage einnehmen? Wenn die Lage gleichgültig ist, dann haben wir trotzdem die Frage: Welche Lage soll es sein? Die bequemere, diese hier oder die da drüben? Wären die Unbequemlichkeiten da drüben der Kreativität förderlicher als die hiesigen?
Aber vielleicht habe ich ja auch Intuition? Vor einiger Zeit, also lange vor Ausbruch dieser ganzen Sache, die vor weniger als einer Woche ausbrach, wenn wir die äußeren Anzeichen als Ausbruch betrachten, sagte ich zu Bohdan:
»Ich misstraue den Perioden, in denen nichts geschieht. Dann glaube ich, dass sich in diesem Schweigen etwas zusammenbraut, dass in dieser stehenden Luft der Druck fällt oder steigt und dann ein großer Sturm losbricht. Wir tun hier so, als sei nichts, und dort bahnt sich ein Riesenschlamassel an.« Und in der Tat.
Bestimmt muss ich hier jetzt eines tun: alle Symptome analysieren, um zu verstehen, was sie für mich bedeuten.
Vor allem Apathie und Stagnation sind verschwunden. In meinem Leben gab es zwei längere derartige Phasen. Die erste hatte ich in den letzten Krakauer Jahren. Sie verschwand nach meiner Rückkehr aus Amerika, nach dem Entschluss, mich von Krakau zu lösen und ins Ungewisse nach Warschau aufzubrechen (auch wenn das Ungewisse im Vergleich zu den heutigen Ungewissheiten wenig ungewiss war). Die zweite Phase hatte ich in den letzten beiden Jahren in Warschau. Am Ende dieser Jahre hatte ich gelernt, sie bewusst und mühsam zu überwinden. Es war kein richtiges Überwinden, weil man Enthusiasmus ja nicht künstlich wecken kann. Aber ich hatte gelernt, damit zu leben.
Wie wacklig dieses Gleichgewicht trotzdem war, davon zeugt die in den letzten Warschauer Monaten verstärkte Wucht des Gegners und dann seine Überlegenheit hier in Chiavari, wo ich für mich keinen größeren Sinn und keine Rolle finden konnte (siehe einige der Notizen, die ich hier im Sommer, trotz der Hitze, noch zustande gebracht habe). Aus der Routine gerissen, die ich in Warschau so fleißig aufgebaut hatte, wurde ich immer schwächer.
Paradoxerweise fürchte ich mich nicht vor der Zukunft. Das ist paradox, denn in Warschau, wo ich mir den Verlauf meiner Zukunft bis zum Tod zurechtgelegt hatte, zermalmte mich die Zukunft. Aber hier, wo meine Perspektive so aussieht, dass ich in einigen Monaten Hunger leiden werde, obdachlos und aus der Gesellschaft ausgestoßen sein werde und Probleme mit der Administration und dem Fremdsein bekommen werde, wo mir Krankheit ohne Heilmittel und ohne Ort zum Kranksein droht: Hier habe ich keine Angst. Vielleicht weil Bedrohung und Ungewissheit einfach größer sind, als ich mir emotional ausmalen kann.
Grundsätzlich ist da mein Schreiben. Ich kann nicht sicher sein, dass diese Umstellung sich auf meine Leistungsfähigkeit niederschlägt, und wenn ja, ob es von Vorteil oder Nachteil sein wird. Was wäre ein mögliches Resultat?
Natürlich polnisch schreiben. Auch wenn ich wollte, könnte ich überhaupt französisch oder englisch schreiben, und wenn ja, was? Polnisch schreiben, der Emigrantenmarkt, die Notwendigkeit, Emigrationseditionen. Keine Genugtuung. Die Emigration ist mir verhasst und tot. Vegetieren in jeder Hinsicht.
Die Möglichkeit eines Minimums – meine Nichtbewältigung. Zusammenbruch infolge von Schwierigkeiten aller Art.
Jedenfalls – mein Thema, mein Ton, mein Material und mein Feuerstein, das ist nur das eine: die Konfrontation meiner Person, die aus dem Dort hinausgewachsen ist, mit dem Hier. Meine menschliche Beziehung zur Welt, mein Zusammenprall mit der ganzen Welt, als Mensch, der ein Pole ist. Dort war ein bisschen zu viel Polendruck. Ich war mehr Polenmensch als Menschenpole. Das könnte für die Leute von hier interessant sein.
Müde. Der Scirocco, nicht ausgeschlafen. Ich sollte mich jetzt um mich kümmern wie um ein Kleinkind. Ist mir auch nicht zu kalt, ist mir nicht zu warm?
Alles ist darauf eingestellt, dass mir, sobald ich schöne und tiefsinnige Dinge bzw. ziemlich schöne und tiefsinnige Dinge schreiben werde, nicht nur mein Lebensunterhalt garantiert sein wird, sondern noch etwas darüber hinaus. Mein Schreiben wird mir den Sinn garantieren, warum, wozu das alles. Millionen von Kleinigkeiten wie die, dass meine Schreibmaschine gerade einen Defekt zeigt und das »ą« immer zu hoch hüpft. Die Kleinigkeiten hüpfen irgendwo zwischen Entfremdung und Gleichgültigkeit, ein Raum, der mir wichtig erscheint und in dem ich mich selber gerne meiner Existenz versichern möchte. Ich habe schon oft darüber gesprochen und geschrieben, wie mich das System der Spiegel quälte, von denen ich umstellt war. Das System wird wahrscheinlich zerschlagen. Aber wie kann ich hier und heute hoffen, schöne und tiefsinnige Dinge zu schreiben, wenn ich das, was ich schreibe, als toten Müll empfinde? Ich habe weder einen eigenen Tisch noch eine eigene Stille. Die Nachbarn lärmen nebenan, ein riesiges und unablässiges »ciao, buona sera, arrivederci«. Ungeheuerlich, wie diese Leute sich in einer Tour nichts als begrüßen und verabschieden. Feiertage, morgen noch ein Feiertag, und Ruhe. Ein italienisches Kind geht mir genauso auf den Wecker wie ein Warschauer Kind, nur objektiver, weil ich nicht einfach hingehen kann und um Ruhe und Rücksichtnahme bitten.
Das wird es sein: Mit diesem Kind, das objektiver ist, das objektiv gesehen existiert, beginnt bereits das Hiersein für mich.
Es gibt aber auch Genugtuung. Ich hatte in der Piekarska-Straße erfahren, dass die Musikschul-Ausbildung der beiden Rotznasen von nebenan noch ungefähr sieben Jahre dauern würde. Die Situation schien ausweglos, ein Schritt mehr Richtung Grab. Aber heute Abend gibt es nichts, was mir gleichgültiger wäre als diese beiden Musikschüler. Die nachbarlichen Klaviere und Geigen sind hier, in eintausendzweihundert Kilometern Entfernung hinter einer scharf bewachten Grenze, nicht zu hören. Ebenso kann mir noch einiges anderes schnuppe sein. So oft habe ich von einem »Kampf in der Umzingelung« gesprochen. Plötzlich habe ich mich aus der Umzingelung losgerissen. Keine Ahnung, um welchen Preis. Um mich herum ist Wald und Gebüsch, Dunkel und Ödnis, dazu Herbst. Aber ich sitze nicht mehr im Kessel, obwohl man glaubt, ich säße noch drinnen. Allen eine derartige Überraschung zu bereiten, diesen Spaß kann mir nichts auf der Welt nehmen.
Proust hat schon alles Sagbare gesagt, über den Tod von Orten und Menschen, die uns nicht länger umgeben. Da ist Polen schon dabei, und alles, was dazugehört, auch Warschau, auch eine bestimmte Treppenstufe, eine bestimmte Türschwelle. Die gibt es zwar sicher immer noch, aber können wir uns dessen wirklich gewiss sein? Aus all dem entsteht für mich ein System aus Zeichen und Symbolen, und schon kochen mein Gedächtnis und meine Phantasie daraus ein persönliches Süppchen. Die Realität ist woanders, ich hoffe, ich kann in mir einen Ort für sie schaffen. Denn da sie schon keinen Bezug mehr zu irgendetwas hat, ist sie für mich auch nicht außerhalb von mir verankert. Und wenn ich sie nicht in mir trage und immer wieder erschaffe, verflüchtigt sie sich vollends, und ich bin im Vakuum. Dort hat mich die Realität zerdrückt, weil sie mir administrativ auferlegt wurde, wenn auch nicht im administrativen Wortsinn. Dort hat sie mich verfolgt, und hier muss ich sie verfolgen. Nichtsdestotrotz wird der ganzen Geschichte durch meine Passivität im ersten Fall sowie durch meine Aktivität im zweiten Fall vorgegriffen.
(Eben ist es mir gelungen, die Ursache für das nach oben hüpfende »ą« und den Punkt zu finden und zu beseitigen. Eine Kleinigkeit. Aber so was macht Mut.)
Entweder habe ich eine Nikotinvergiftung, oder ich bin überhaupt am Ende. Stechen im Kopf, Sandsack. Gestern gab es so etwas wie einen Hurrikan, ein paar Dächer sind weggeflogen. Aber den Kopf hat es nicht gelüftet. Erst war die Luft tot, das war übel, dann der Scirocco, noch übler, aber heute ist klares Wetter, nur das Meer aufgewühlt, riesenhaft. Es wirft tote Schweine und abgestorbene Äste ans Ufer. Die Klarheit und Helligkeit in der Luft, das ist nichts, eigentlich noch schlimmer. Und das Schlimmste, die Eigenschaften meiner Schwester nehmen in mir überhand. Ich würde stundenlang auf einem Schemel sitzen und die Hand nur nach dem Kuchen ausstrecken, wie Stefcio Otwinowski.10 Nicht einmal die Körperhaltung auf dem Sessel würde ich korrigieren, auch wenn sie unbequem ist. Unentschlossenheit, Apathie, die Unfähigkeit, mit scharfen, schneidenden Blicken um mich zu werfen, Willensschwäche. Wie Stefcio – genauso widere ich mich selbst dabei an. Die Unfähigkeit, Verantwortung zu übernehmen, Inkonsequenz, Angst.
Nur die Tagesordnung kann mich retten, die Disziplin. Ich habe kein Haus, ich habe wahrscheinlich kein Vaterland, ich habe nichts, vielleicht wird mir in Kürze etwas wie 1939 widerfahren, nur mir, extra für mich in meiner Einsamkeit, niemand würde es erfahren, niemand wäre interessiert daran, nur ich allein. In so einer Situation kommt bekanntlich die englische Schule zur Anwendung, gut rasiert zum Five O’Clock Tea, ohne Rücksicht auf die Umgebung. Ich muss mir eine kleine Stabilität schaffen, irgendeine Stabilität, Festigkeit, wenn alles instabil ist, eigentlich schon gegenstandslos.
Wie blöd müsste ich mir vorkommen, wenn ich, sollte ich zurückgehen, über die Vernichtung dieser Notizen nachdenken müsste.
Ständig dieses Gefühl, auf einmal passiere alles schneller als ich, dass es mich irgendwo hintreibt. Vielleicht habe ich mich selber in etwas verrannt, absichtlich oder unabsichtlich, ich weiß es nicht, ein Bub, der mit der Strömung spielt, das Füßchen in einen reißenden Bach hält, bis es ihn plötzlich fortreißt und wegträgt, das Füßchen im Lehm ausgleitet. Der Bub, den es fortreißt, schreit vor Angst, aber wer weiß, ob er nicht begeistert ist, halb ehrlich und halb ängstlich. Ich liebe es, mit meinem Schicksal zu kokettieren. Einige Bekannte haben mich immer »Herzliebchen« genannt. Gott gebe ihnen Gesundheit, keiner weiß, wer wen herzt.
Ja. In mir ist viel von Stefcio O. Genauso Widerwärtiges.
Staglieno, der Friedhof von Genua.
Was die Methode des Notierens betrifft, bin ich im Zwiespalt. Früher, als ich noch kein Literat war, habe ich alles genau aufgeschrieben, dann erst weitergesponnen, Schlüsse gezogen. Jetzt tut es mir leid um die Zeit, denn austoben kann ich mich beruflich. Aber werde ich später noch wissen, was ich gesehen habe, wenn ich zu meinen Notizen zurückkehre und dann nur die gezogenen Schlussfolgerungen lese? Ein Werk altert nicht so schnell, nur Briefe riechen immer gleich schimmlig.