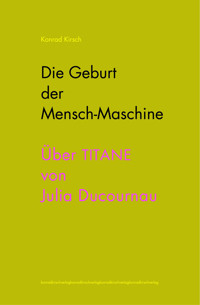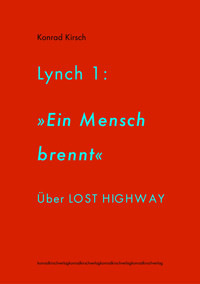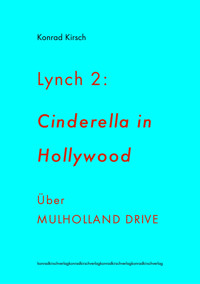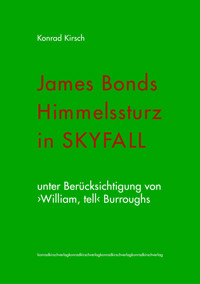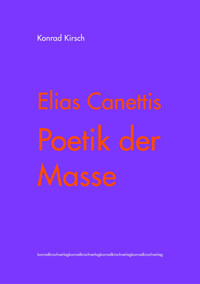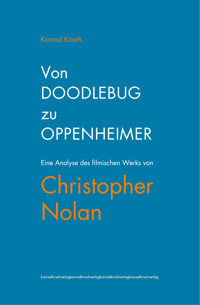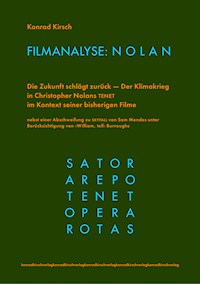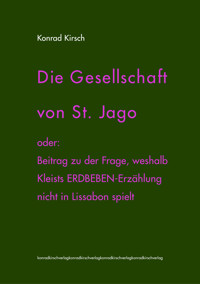
7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: konrad kirsch verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Heinrich von Kleists Erzählung DAS ERDBEBEN IN CHILI veranschaulicht an zwei antagonistischen Gruppen die Unangemessenheit religiöser Deutungen von realen Ereignissen. Das Beben fungiert dabei als Katalysator, der die konträren Positionen deutlich hervortreten lässt. Die sich als christlich verstehende Gesellschaft von St. Jago verrät ihre Ideale, indem sie die zur Heiligen Familie Stilisierten erschlägt. Der Mord an Josephe, Jeronimo und ihrem (Adoptiv-)Kind rekurriert auf die Opferung Isaaks, wodurch die Bewohner von St. Jago hinter das jüdisch-christliche Verbot des Menschenopfers zurückfallen. Die Rolle von Jeronimo und Josephe ist ambivalent: Einerseits bilden sie das Zentrum einer utopischen Gemeinschaft, andererseits ist ihr Selbstbild hybrisch, da sie sich selbst als Heilige Familie wahrnehmen, deren Rettung jedes noch so monströse Opfer rechtfertige. Ihre Selbsttäuschung verstärken die Liebenden zusätzlich dadurch, dass sie ihre Geschichte in einer Art Donquijoterie als trivialen Liebesroman erleben. Doch in einem grausigen, metatextuellen Spiel lässt der Erzähler sie statt vor dem Trau- auf dem Opferaltar enden. In THE EARTHQUAKE IN CHILE, the failure of religious interpretations of real events is illustrated by two antagonistic groups. The earthquake functions as a catalyst that throws the opposing views into relief. The society of St Jago which understands itself as Christian betrays its ideals by destroying the protagonists who are stylized as the holy family. The murder of Josephe, Jeronimo and their (adopted) child refers to the sacrifice of Isaac by which the inhabitants of St Jago regress behind the Jewish-Christian taboo on human sacrifices. The role of Jeronimo and Josephe is ambivalent: on the one hand they form the center of the utopian community, on the other their self-perception is not free from hybris because they regard themselves as the holy family whose survival justifies even monstrous actions. The lovers' self-delusion is exacerbated by the fact that they also perceive their story – in some kind of quixotism – as a trivial love affair. But in a gruesome meta-textual game the narrator leads them to the altar of sacrifice rather than marriage.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Konrad Kirsch
Die Gesellschaft von St. Jago
oder: Beitrag zu der Frage, weshalb Kleists erdbeben-Erzählung nicht in Lissabon spielt
konradkirschverlagkonradkirschverlagkonradkirschverlagkonradkirschverlagkonradkirschverlag
Impressum
Konrad Kirsch
Die Gesellschaft von St. Jago – oder: Beitrag zu der Frage, weshalb Kleists erdbeben-Erzählung nicht in Lissabon spielt
Januar 2025
eBook
isbn 978-3-929844-36-8
Copyright © 2025 by Konrad Kirsch
All rights reserved.
No part of this book may be used or reproduced in any matter whatsoever without written permission except the case of brief quotations embodied in critical articles and reviews.
konrad kirsch verlag
c/o block service, stuttgarter str. 106, 70736 fellbach
kir-v[ät]use[dot]startmail[dot]com
konrad-kirsch-verlag.de
konradkirsch.de
Abstract
Heinrich von Kleists Erzählung das erdbeben in chili veranschaulicht an zwei antagonistischen Gruppen die Unangemessenheit religiöser Deutungen von realen Ereignissen. Das Beben fungiert dabei als Katalysator, der die konträren Positionen deutlich hervortreten lässt.
Die sich als christlich verstehende Gesellschaft von St. Jago verrät ihre Ideale, indem sie die zur Heiligen Familie Stilisierten erschlägt. Der Mord an Josephe, Jeronimo und ihrem (Adoptiv-)Kind rekurriert auf die Opferung Isaaks, wodurch die Bewohner von St. Jago hinter das jüdisch-christliche Verbot des Menschenopfers zurückfallen. Die Rolle von Jeronimo und Josephe ist ambivalent: Einerseits bilden sie das Zentrum einer utopischen Gemeinschaft, andererseits ist ihr Selbstbild hybrisch, da sie sich selbst als Heilige Familie wahrnehmen, deren Rettung jedes noch so monströse Opfer rechtfertige. Ihre Selbsttäuschung verstärken die Liebenden zusätzlich dadurch, dass sie ihre Geschichte in einer Art Donquijoterie als trivialen Liebesroman erleben. Doch in einem grausigen, metatextuellen Spiel lässt der Erzähler sie statt vor dem Trau- auf dem Opferaltar enden.
In The Earthquake in Chile, the failure of religious interpretations of real events is illustrated by two antagonistic groups. The earthquake functions as a catalyst that throws the opposing views into relief.
The society of St Jago which understands itself as Christian betrays its ideals by destroying the protagonists who are stylized as the holy family. The murder of Josephe, Jeronimo and their (adopted) child refers to the sacrifice of Isaac by which the inhabitants of St Jago regress behind the Jewish-Christian taboo on human sacrifices. The role of Jeronimo and Josephe is ambivalent: on the one hand they form the center of the utopian community, on the other their self-perception is not free from hybris because they regard themselves as the holy family whose survival justifies even monstrous actions. The lovers' self-delusion is exacerbated by the fact that they also perceive their story – in some kind of quixotism – as a trivial love affair. But in a gruesome meta-textual game the narrator leads them to the altar of sacrifice rather than marriage.
Inhalt
Vorbemerkung
I. Kontraste
II. Das Erdbeben von Lissabon
III. Der Erzähler und die Heilige Familie
IV. Die Apokalypse und das Neue Jerusalem
V. St. Jago
VI. Die Opferung Isaaks
VII. La Conception oder der gelebte Liebesroman
Haftungsausschluss
Verlagshinweise
Vorbemerkung
Der folgende Beitrag erschien erstmals 2011 in der Zeitschrift für deutsche Philologie.1 Für die vorliegende Neuveröffentlichung wurde er punktuell ergänzt.
Januar 2025
I. Kontraste
Bereits der erste Satz der Erzählung ist unerhört: »In St. Jago, der Hauptstadt des Königreichs Chili, stand gerade in dem Augenblicke der großen Erderschütterung vom Jahre 1647, bei welcher viele tausend Menschen ihren Untergang fanden, ein junger, auf ein Verbrechen angeklagter Spanier, Namens Jeronimo Rugera, an einem Pfeiler des Gefängnisses, in welches man ihn eingesperrt hatte, und wollte sich erhenken«.2 Der Erzähler setzt hier eine weit zurückliegende Zeit gegen einen exakt bezeichneten Augenblick, das (von Europa aus gesehen) ferne Chile gegen den nahen Pfeiler, einen individuellen Todeswunsch gegen das massenhafte Sterben, die Sphäre des Juristischen gegen ein geologisches Ereignis. Wie sich zeigen wird, durchzieht dieses antagonistische Prinzip die gesamte Erzählung. Mit den Kontrastierungen erzeugt der Erzähler in Heinrich von Kleists das erdbeben in chili auf vielfältigen Ebenen Spannung und wirft die Leserïnnen schon mit dem ersten Satz in einen ersten Kumulationspunkt der Handlung.
Erst im Anschluss daran liefert er die Vorgeschichte dazu und berichtet, weshalb Jeronimo Suizid verüben will: Dass dieser eine verbotene Liebesbeziehung mit Josephe Asteron einging; dass man ihr Verhältnis entdeckte und Josephe daraufhin von ihrem Vater in ein Kloster verbracht wurde; dass das Paar dennoch zueinander fand und Josephe während der Fronleichnamsprozession ein Kind, Philipp, zur Welt brachte; dass sie deshalb zum Tode verurteilt und Jeronimo ins Gefängnis geworfen wurde. Just in dem Moment, als sie zum Richtplatz geführt wird und er sich erhängen will, ereignet sich das Erdbeben und bewahrt die Liebenden vor ihrem jeweils unmittelbar bevorstehenden Tod.
Detailliert werden die Institutionen aufgeführt, die sie verfolgten und nun in Trümmern liegen; mit Kirche, Staat und Vaterhaus3 scheinen auch all ihre Peinigerïnnen zermalmt. Außerhalb der zerstörten Stadt, an einem Ort, so idyllisch, »als ob es das Thal von Eden gewesen wäre« (153), findet die junge Familie erstmals zusammen. Weitere Überlebende konnten sich hierher retten, und zwischen ihnen scheint sich eine neue, harmonische Form des Zusammenlebens zu bilden. Es war »als ob das allgemeine Unglück Alles, was ihm entronnen war, zu einer Familie gemacht hätte« (156). Doch die Idylle steht ganz unter dem Zeichen des Konjunktivs: Es scheint nur, »als ob« alles Edle und Gute im Menschen »wie eine schöne Blume« (156) aufgegangen und alles Niederträchtige zuschanden wäre.
Am Tag nach dem Beben treffen die Liebenden auf Don Fernando Ormez und seine Familie. Obwohl sie erkannt werden, nimmt man sie als Gleiche in »Don Fernandos Gesellschaft« (157) auf. Die Gruppe möchte Gott für ihr Überleben danken und beschließt, in die Kirche zu gehen. Auf dem Weg dorthin tauschen die Familien beiläufig ihre Kinder aus: Fernando und Josephe führen mit dem kleinen Juan die Gruppe an, Jeronimo folgt mit Philipp und Donna Constanze, der Schwägerin Don Fernandos. Dessen verletzte Frau Elvire bleibt zurück, ebenso ihre Schwester Donna Elisabeth sowie ihr Vater Don Pedro.
Die übrigen Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt haben eine völlig andere Perspektive auf das Erdbeben: In der Kirche deutet der Chorherr die Zerstörung St. Jagos als göttliche Strafe für den »Frevel[ ]« (159) der Liebenden. Anschließend entlädt sich die Spannung, die mit den Kontrastierungen sukzessive aufgebaut wurde, in einem blutigen Exzess: Als die Gruppe aus dem »Thal von Eden« in der Kirche entdeckt wird, fällt die Menge über sie her und tötet Donna Constanze, Jeronimo, Josephe sowie den kleinen Juan. Nur Don Fernando und Philipp, der Sohn von Josephe und Jeronimo, entgehen dem Gemetzel.
II.
Das Erdbeben von Lissabon
Den Hintergrund von Kleists Erzählung bilden zwei historische Erdbeben: zum einen jenes, das sich 1647 in Chile ereignete und das im Text genannt wird. Noch zu Kleists Zeit beruhen die Kenntnisse darüber auf dem Augenzeugenbericht des Bischofs von Santiago, Gaspar de Villarroel.4 Doch an den Umständen dieses Bebens war Kleist offenkundig wenig gelegen, wie Norbert Oellers detailliert aufzeigt.5 Maßgeblicher für die Erzählung ist bekanntlich das Erdbeben, welches 1755 weite Teile Lissabons zerstörte.6 In ihrem Beitrag zu dessen Rezeption im 18ten Jahrhundert weist Maria Manuela Gouveia Delille in einer Fußnote die »Sammlung authentischer Briefe«als eine konkrete Quelle deserdbebens aus.7Einige Motive aus diesen 1779 im Hannoverschen Magazin veröffentlichten und entgegen des Titels fiktiven8Briefen finden sich fast wörtlich in Kleists Erzählung wieder. In den Briefen wird berichtet, dass während des Bebens auf den Straßen Lissabons Schwangere niederkamen, und: »Der gemeine Mann, auch zum Theil andere von Extraction, vermuthen nichts anders, als daß der jüngste Tag kommen werde, oder schon da sey. Die Mönche laufen mit dem Kreuze herum […] und schreyen immer: das Ende der Welt ist da!« während sich das Volk den königlichen Befehlen mit der Behauptung widersetzt, »sie hätten jetzo keinen König«.9 Die entsprechende Passage liest sich bei Kleist wie folgt: »Man erzählte, wie die Stadt gleich nach der ersten Haupterschütterung von Weibern ganz voll gewesen, die vor den Augen aller Männer niedergekommen seyen; wie die Mönche darin, mit dem Kruzifix in der Hand, umhergelaufen wären, und geschrieen hätten: das Ende der Welt sey da! wie man einer Wache, die auf Befehl des Vicekönigs verlangte, eine Kirche zu räumen, geantwortet hätte: es gäbe keinen Vicekönig von Chili mehr! […]« (155). Im Folgenden wird unter anderem die Frage geklärt, weshalb sich Kleists Erzählung zwar auf das Erdbeben in Lissabon bezieht, er das Textgeschehen aber nach St. Jago verlegt.
Das Lissaboner Erdbeben beschäftigte die Zeitgenossïnnen ähnlich intensiv wie die Französische Revolution, denn es erschütterte mehr als den physischen Grund der portugiesischen Hauptstadt und alles, was darauf errichtet war: Die Auseinandersetzungen mit dem Beben und den gewaltigen Zerstörungen, die es verursachte, trugen zum Bruch mit der Theodizee und dem philosophischen Optimismus bei.10 Wie konnte ein gütiger Gott, so fragten sich viele, eine solche Katastrophe zulassen? Aus welchem Grund wurde eine so gotttesfürchtige Stadt wie Lissabon fast vollständig zerstört? – Zuvor hatte Gottfried Wilhelm Leibniz die Übel in der Welt mit der Theodizee zu rechtfertigen versucht: Gott sei gut, aber selbst er habe die Welt nicht besser einrichten können, als sie ist; unsere sei daher »die beste aller möglichen Welten«.11 Alexander Pope geht in seinem essay on man darüber hinaus und hält in Majuskeln fest: »Alles, was ist, ist gut«.12 Nach der Zerstörung der portugiesischen Metropole konnten viele an dieser Einschätzung nicht mehr festhalten, und so ruft Voltaires Candide entsetzt aus: »Wenn dies die beste aller möglichen Welten ist, wie müssen erst die anderen sein?«.13 Aufgrund des Bebens lässt Johann Wolfgang von Goethe rückblickend sein kindliches Ichebenfalls an der Güte Gottes zweifeln: »Durch ein außerordentliches Weltereignis wurde jedoch die Gemütsruhe des Knaben zum ersten Mal im Tiefsten erschüttert. Am ersten November 1755 ereignete sich das Erdbeben von Lissabon, und verbreitete über die in Frieden und Ruhe schon eingewohnte Welt einen ungeheuren Schrecken. […] Der Knabe […] war nicht wenig betroffen. Gott, der Schöpfer und Erhalter Himmels und Erden, den ihm die Erklärung des ersten Glaubens-Artikels so weise und gnädig vorstellte, hatte sich, indem er die Gerechten mit den Ungerechten gleichem Verderben preis gab, keineswegs väterlich bewiesen. Vergebens suchte das junge Gemüt sich gegen diese Eindrücke herzustellen, welches überhaupt um so weniger möglich war, als die Weisen und Schriftgelehrten selbst sich über die Art, wie man ein solches Phänomen anzusehen habe, nicht vereinigen konnten«.14
Anders verhält es sich bei Kleists Figuren: Obwohl die Erderschütterung die physische Welt ins Wanken bringt, bleibt ihr Gottesbild konsistent, und sie stellen es – abgesehen von einer kurzfristigen Ausnahme – nicht infrage. Die Ausnahme besteht darin, dass Jeronimo Gott zunächst für seine »wunderbare Errettung« (151) durch das Beben dankt. Als ihm aberkurz darauf bewusst wird, dass Josephe, wenn nicht bei der geplanten Hinrichtung getötet, so doch durch das Erdbeben umgekommen sein müsse, verkehrt sich sein Gottesbild ins Negative: »sein Gebet fing ihn zu reuen an, und fürchterlich schien ihm das Wesen, das über den Wolken waltet« (151). Jeronimos Anflug von Skepsis scheint auf die Theodizee-Diskussion anzuspielen. Doch verdeckt diese Verknüpfung, dass er und Josephe keineswegs über die Katastrophe im Allgemeinen entsetzt sind, sondern ausschließlich auf ihr privates Glück beziehungsweise Unglück achten und allein danach urteilen. Sobald die Liebenden einander wiedergefunden haben, kehren sie zu ihrem positiven Gottesbild zurück und halten daran bis zum Ende der Erzählung fest. Die übrigen Einwohner St. Jagos bleiben gleichfalls bei ihrem Gottesbild, auch wenn es völlig anders geartet ist als das des Paares.
III. Der Erzähler und die Heilige Familie
Die unterschiedlichen Gottesbilder der Figuren – das der Liebenden auf der einen und das der Gesellschaft von St. Jago auf der anderen Seite – fügen sich in das Prinzip der gereihten Gegensätze, welches bereits den ersten Satz strukturiert und das die gesamte Erzählung prägt. So heißt es etwa in der Mitte des erdbebens:»Auf den Feldern, so weit das Auge reichte, sah man Menschen von allen Ständen durcheinander liegen, Fürsten und Bettler, Matronen und Bäuerinnen, Staatsbeamte und Tagelöhner, Klosterherren und Klosterfrauen: einander bemitleiden, sich wechselseitig Hülfe reichen […] als ob das allgemeine Unglück Alles, was ihm entronnen war, zu einer Familie gemacht hätte« (156); und der letzte Satz des Textes vereint Schrecken und Trauer mit der Freude über das erlebte Glück:»und wenn Don Fernando Philippen mit Juan verglich, und wie er beide erworben hatte, so war es ihm fast, als müßt er sich freuen« (163).
Die Verknüpfung und In-Eins-Setzung des Konträren erzeugt eine singuläre Situation – wie jene beiden Mauern, die, durch das Erdbeben zum Einsturz gebracht, aufeinander zufallen und eine »zufällige Wölbung« (150) bilden, durch die Jeronimo aus dem Gefängnis entfliehen kann. Während der letzte Satz des erdbebens den zwiespältigen emotionalen Gehalt der Erzählung rekapituliert, kommt es in der zitierten Szene des Mittelteils zu einem derart harmonischen Ausgleich der Gegensätze, dass er unwirklich erscheint. Das antagonistische Prinzip bestimmt jedoch vor allem das Verhältnis der Liebenden und der Gesellschaft von St. Jago.
Anders als legalisierte Verbindungen muss sich eine verbotene Liebe gegen soziale Konventionen behaupten und mit Verfolgung rechnen. Sie ist daher nicht durch die gesellschaftlichen Vorteile korrumpiert, die über eine Heirat erlangt werden können; im Gegenteil, die Liebenden nehmen durch ihre Beziehung erhebliche Nachteile für sich in Kauf.15 Das bekannteste literarische Beispiel für eine solche Liebe sind Romeo und Julia. In Kleists Erzählung ist die Umgebung den Liebenden deutlich feindlicher gesonnen als in William Shakespears Stück: Während dort die einander befehdenden Familien der Capulets und der Montagues von der Beziehung ihrer Kinder nichts ahnen (sie daher auch nicht aktiv verfolgen) und am Ende um das tote Paar trauern, sieht die Gesellschaft von St. Jago in Kleists Erzählung mit geradezu obszöner Vorfreude der Hinrichtung Josephes entgegen. Auf diese Weise wird der Gegensatz zwischen der Gesellschaft von St. Jago und den Liebenden weiter vergrößert und die Wertungen der Leserïnnen entsprechend gelenkt. Zudem gibt es im erdbeben keine Helfer-Figuren wie Mercutio, die Amme oder Pater Lorenzo, die Romeo und Julia zur Seite stehen (die einzige Ausnahme bildet in Kleists Text die Äbtissin, deren Rolle jedoch äußerst beschränkt bleibt). Dadurch erscheint die Gesellschaft von St. Jago weitgehend homogen (worin sich die Gleichheit innerhalb der »eine[n] Familie« im »Thal von Eden« ankündigt: Zusammengehörigkeit besteht schon am Anfang der Erzählung als Möglichkeit, auch wenn sie hier negativ dargestellt ist). Im Gegenzug werden die Liebenden aufgewertet: Jeder Schritt, der gegen das Paar unternommen wird und ihre Liebe nicht erschüttern kann, kommt einer bestandenen Bewährungsprobe gleich. Josephe und Jeronimo halten aneinander bis zur Selbstaufgabe fest; für sie ist die Versuchung folglich groß, ihre Liebe zu idealisieren.16 Philipp kommt als Frucht dieser Beziehung eine besondere symbolische Bedeutung zu; er verkörpert sie gewissermaßen.
Die Rettung der Liebenden und ihres Kindes erscheint so wundersam, als hätten sie einen übermächtigen Verbündeten. Bevor er Josephe und Philipp findet, »warf sich [Jeronimo] vor dem Bildnisse der heiligen Mutter Gottes nieder, und betete mit unendlicher Inbrunst zu ihr, als der Einzigen, von der ihm jetzt noch Rettung kommen könnte« (149). Das bald darauf einsetzende Beben bewahrt ihn nicht nur davor, Suizid zu begehen, und befreit ihn aus dem Gefängnis, sondern es rettet auch Josephe vor dem Henkersbeil. Als Jeronimo bald darauf die Geliebte und ihren gemeinsamen Sohn findet, heißt es: »Mit welcher Seligkeit umarmten sie sich, die Unglücklichen, die ein Wunder des Himmels gerettet hatte!« (152). In diese Deutung fügt sich, dass sie das Beben überstehen, ohne einen Kratzer davonzutragen: Jeronimo »befühlte sich Stirn und Brust […]« (150) und kann nicht die geringste Verletzung an sich feststellen; auch Josephe und der kleine Philipp überleben die Naturkatastrophe vollkommen unversehrt. Denn während um sie herum Tausende sterben, war es »als ob alle Engel des Himmels sie umschirmten« (152). Die Liebenden sind daher »sehr gerührt, wenn sie dachten, wie viel Elend über die Welt kommen mußte, damit sie glücklich würden!« (154). Mit dieser teleologischen Interpretation des Ereignisses deuten Jeronimo und Josephe das Beben zwar als ein göttliches Instrument der Rettung – aber einzig ihrer und ihres Kindes Rettung. Das erscheint ziemlich vermessen, da »der größte Theil der Stadt, mit einem Gekrache, als ob das Firmament einstürzte, versank, und alles, was Leben athmete, unter seinen Trümmern begrub« (149).
Aus welchem Grund nehmen Jeronimo und Josephe an, dass das Beben ein »Wunder des Himmels« wäre, das allein zu ihrer Rettung gesandt wurde? Dass Gott so viele Menschen töten würde, einzig um sie und ihr Kind vor dem Tod zu bewahren? Weshalb nehmen sie an, ihr Leben wäre ungleich kostbarer als das zigtausend anderer?
Um dies zu klären, muss die Erzählstrategie betrachtet werden. Zunächst sind zwei Punkte wesentlich; erstens: Der Erzähler stellt immer wieder Als ob-Vergleiche an: Es war »als ob das Firmament einstürzte«, »als ob alle Engel des Himmels sie umschirmten«, »als ob es das Thal von Eden gewesen wäre«, »Es war, als ob die Gemüther […] alle versöhnt wären« (155), um nur einige Beispiele zu nennen. Mit diesen und ähnlichen Vergleichen konnotiert der Erzähler das Geschehen sowohl religiös, als auch als fundamentale Veränderung – einerseits. Andererseits kennzeichnet er durch die Als ob-Konstruktionen die Deutung als möglicherweise – und vom Ende her betrachtet: tatsächlich – illusionär. Allerdings verfehlen weder die Tendenz noch die Quantität der irrealen Vergleiche ihre Wirkung: Geäußertes lässt sich nur eingeschränkt zurücknehmen, besonders wenn es wiederholt wird. Zudem ›vergisst‹ der Erzähler an mindestens zwei Stellen den Als ob-Vorbehalt oder die Relativierung durch den Konjunktiv; als sich Jeronimo und Josephe wiederfinden, heißt es, wie oben angeführt: »Mit welcher Seligkeit umarmten sie sich, die Unglücklichen, die ein Wunder des Himmels gerettet hatte!« (Hervh. Vf). Als Josephe den kleinen Philipp aus dem einstürzenden Kloster holt, steht gleichfalls der Indikativ: »den theuern Knaben, den ihr der Himmel wieder geschenkthatte« (152; Hervh. Vf).17 Diese ›Nachlässigkeiten‹ verstärken die Ambivalenz des Erzählmodus.18 Zusätzlich drängt die Motivstruktur die Einschränkung durch die konjunktivischen Relativierungen etwas in den Hintergrund.
Zweitens ist der Beginn der Erzählung von einem Kontrast der Quantität bestimmt: Es ist, als ständen sämtliche Stadtbewohnerïnnen gegen das Liebespaar, als wäre es ein Konflikt aller gegen zwei Einzelindividuen. Um weiteres zu verhindern, werden sie voneinander und von der Gesellschaft separiert, indem sie ins Gefängnis geworfen beziehungsweise im Kloster weggeschlossen werden. Anschließend bringt Josephe Philipp zur Welt. Mit ihm wächst die Position der Liebenden zahlenmäßig an – aus zwei wird drei. Dies erscheint marginal, da sich das quantitative Verhältnis zur Gesellschaft St. Jagos nur unwesentlich ändert. Doch deren Reaktion zeigt, dass dem nicht so ist: Aufgrund von Philipps Geburt wird Josephe nun zum Tode verurteilt, und Jeronimo will sich aus Verzweiflung darüber das Leben nehmen. Das heißt, der repressive Druck gegen die Liebenden bekommt eine eliminatorische Qualität: Nachdem aus dem Alle gegen zwei ein Alle gegen drei geworden ist, sollen sie ausgelöscht werden, als gehe von ihnen eine Bedrohung für die Gesellschaft von St. Jago aus. Das Erdbeben verhindert dies. Darüberhinaus führt es Josephe, Jeronimo und ihr Kind – die zuvor voneinander getrennt worden waren – erstmals zusammen (da Jeronimo Philipp noch nicht gesehen oder in den Armen gehalten hatte). Damit bewirkt das Beben eine qualitative Änderung: Es macht aus dem Liebespaar eine Familie. Aber auch dies ist noch kein hinreichender Grund, weshalb sich nach Philipps Geburt der Furor der Gesellschaft von St. Jago ins Eliminatorische steigert. Er liegt darin, dass Josephe, Jeronimo und ihr kleiner Sohn über die religiösen Motive zur Heiligen Familie stilisiert werden.19 Die Frage, weshalb dies eine solche Vernichtungswut gegen sie auslöst, führt zum Kern von Kleists Erzählung.
Ihrer Rolle als Mitglied der Heiligen Familie entsprechend wird Josephe als Maria-Figur konnotiert: Sie bringt als Nonne, also als mutmaßliche Jungfrau, ihr Kind in einem religiösen Raum, auf den Stufen der Kathedrale, zur Welt. Als Jeronimo die totgeglaubte Josephe mit Philipp im »Thal von Eden« wiederfindet, ruft er in einer vom Erzähler intendierten Uneindeutigkeit20 aus: »O Mutter Gottes, du Heilige!« (152). Dankt Jeronimo mit diesen Worten der Hl. Maria für die Rettung seiner Familie, oder legt sich vor seinem inneren Auge das Bild der Gottesmutter mit dem Kind über den Anblick von Josephe mit dem kleinen Philipp? Während auf sie als Maria-Figur der Name von Marias Mann übergegangen ist, nimmt Jeronimo als ihr Partner die Rolle der Josef-Figur ein. Zugleich weist sein Name auf einen anderen hin und über ihn hinaus, da Jeronimo ›Träger des heiligen Namens‹ bedeutet.
Entsprechendes gilt für Philipp: Der Zeugung Christi haftet etwas Illegitimes an, denn wie Philipp ist auch er außerehelich gezeugt. Zudem wird am Tag von Philipps Geburt, an Fronleichnam, der Transsubstantiation der Hostie in den Leib Christi gedacht, und wie sich bei dessen Tod ein Erdbeben ereignet, ist Philipps Geburt ebenfalls mit dem Beben verbunden.21 Schließlich ist mit ihm das Motiv der Adoption verknüpft: Don Fernando adoptiert Philipp nach dem Massaker, in dem sein eigener Sohn Juan ums Leben kommt. Dies kündigt sich bereits darin an, dass Fernando und Josephe auf dem Weg zum Dankgottesdienst ihre Kinder tauschen. Damit wird allerdings nicht nur Philipp, sondern auch Juan adoptiert, dessen Name auf den Vorläufer Christi, Johannes den Täufer, verweist.22 Das Motiv der Adoption ist mit der Heiligen Familie assoziiert, da Josef den Sohn Gottes als seinen eigenen annimmt; aus dieser Perspektive ist die Heilige Familie keine natürliche Familie, sondern eine soziale. Oder umgekehrt: Eine natürliche Familie entspricht nicht völlig dem Muster der Heiligen Familie; es wird in der Erzählung erst durch Juans Adoption vervollständigt. Dies zeigt sich auch daran, dass nach der Adoption die Namen ihrer Mitglieder mit dem gleichen Buchstaben beginnen: Josephe, Jeronimo und Juan. Kurz nach ihrer Komplettierung ermordet der Dom-Mob die unter dem Zeichen des dreifachen J zur Heiligen Familie Überhöhten; in religiösem Kontext heißt das: Sie werden geopfert.23 Da sie durch ihren Tod das Leben anderer retten – Josephe wird bei dem Versuch, beide Kinder zu retten, ermordet, Juan stirbt anstelle von, also für Philipp, und Jeronimo für Fernando –, verweisen Josephe, Jeronimo und Juan auf Jesus und dessen traditionell angenommenen Opfertod am Kreuz.24Neben ihnen erschlägt die Kirchen-Meute Donna Constanze; daher ergänzt der Anfangsbuchstabe ihres Namens das dreifache J, sodass die Opfer-Gruppe die gleichen Initialen wie Jesus Christus trägt. Es bestehen weitere solcher Verbindungen zwischen den Figuren: Während Jeronimo, Josephe, Juan und Constanze in Jago / Chili ermordet werden, überleben mit Fernando und Philipp zwei Figuren das Gemetzel, deren Namen mit einem F-Laut beginnen; Elisabeth sowie Elvire überleben, weil sie »Eden« nicht verlassen; Pedro schließlich, Elvires Vater, findet sein Namenspendant in dem Schuster Pedrillo, dem Anführer der Mörder.25
Durch die religiöse Motivstruktur drängt sich jedoch nicht allein den Lesenden ein bestimmtes Deutungsmuster auf. Da das Paar hinter der Naturkatastrophe einen göttlichen Plan zu seiner Rettung sieht, nimmt es seine eigene Geschichte ebenfalls entlang der religiösen Motivik wahr26 – allerdings ohne den Als ob-Vorbehalt und die konjunktivischen Einschränkungen des Erzählers. Erinnert sei an Jeronimos Ausruf, als er Josephe mit dem Kind erblickt: »O Mutter Gottes, du Heilige!«. Diese doppelte Identität findet ihr Gegenstück in den Schwierigkeiten der Einwohnerïnnen St. Jagos, das Paar und ihren Sohn zu identifizieren: Sie erschlagen Donna Constanze, weil sie sie für Josephe halten, sie greifen Don Fernando in der Annahme an, er wäre Jeronimo, und sie töten Juan, weil sie denken, es handelte sich um Philipp.
Da ihre Rettung durch das Beben so wundersam anmutet wie eine biblische Legende, erleben die Liebenden ihr eigenes Schicksal also in einer Art religiöser Donquijoterie. Die Ebenenvermischung von Fiktion und ›Realität‹ wird in einem Detail in der Kirche angedeutet; dort heißt es beziehungsreich: »an den Wänden hoch, in den Rahmen der Gemählde, hingen Knaben, und hielten mit erwartungsvollen Blicken ihre Mützen in der Hand« (159). Wie die Gemälde in den Knaben lebendig geworden zu sein scheinen,27 sehen sich Josephe und Jeronimo mit ihrem Kind als Heilige Familie. – Weshalb sollte Gott das Erdbeben gerade in dem Augenblick senden, als ihr Tod unmittelbar bevorsteht, wenn nicht, um sie zu retten, die so viele Attribute der Heiligen Familie auf sich vereinen? Aus welchem anderen Grund überstehen sie alle Gefahren gänzlich unbeschadet, »als ob alle Engel des Himmels sie umschirmten«, während um sie herum Tausende den Tod finden? Das Argument gilt auch umgekehrt: Dass so viele bei ihrer Rettung ums Leben kommen, lässt sich nur damit rechtfertigen, dass die Rettung der Heiligen Familie jedes noch so monströse Opfer wert scheint. Dies ist der Grund, weshalb Jeronimo und Josephe »sehr gerührt [waren], wenn sie dachten, wie viel Elend über die Welt kommen musste, damit sie glücklich würden!«. Das ist sowohl naiv, als auch äußerst überheblich. Die geistige Grausamkeit der Glücklichen,28 die daraus spricht, findet ihren Widerhall in der physischen Grausamkeit, die ihnen am Ende des Textes von den unglücklichen Bewohnern St. Jagos entgegenschlägt.
Die Haltung des Erzählers ist also komplex: Er gibt große Sympathien für die Liebenden zu erkennen, doch belässt er es nicht dabei, sondern überhöht sie – eingeschränkt durch die »als ob«-Struktur – zur Heiligen Familie, wodurch sich die Gesellschaft von St. Jago umso negativer zeichnen lässt. Diese Strategie führt der Erzähler allerdings weiter, indem er auch Jeronimo und Josephe sich selbst mit ihrem Kind als Heilige Familie sehen lässt. Aus einer solchen Eigenwahrnehmung resultieren aber Hybris und eine inadäquate Deutung des Geschehens.29
Eine ähnliche Selbstüberhöhung legt im übrigen auch Michael Kohlhaas in Kleists gleichnamiger Erzählung an den Tag. Er deutet seinen Vornamen als Rollenzuschreibung (wenn auch nur im Sinne eines Stellvertreters): »Er nannte sich in dem Mandat, das er, bei dieser Gelegenheit, ausstreute, ›einen Statthalter Michaels, des Erzengels […]‹«.30 Dem entsprechend inszeniert er öffentliche Auftritt gelegentlich mit »Cherubsschwerdt«: »Eben kam er, während das Volk von beiden Seiten schüchtern auswich, in dem Aufzuge, der ihm, seit seinem letzten Mandat, gewöhnlich war, von dem Richtplatz zurück: ein großes Cherubsschwerdt, auf einem rothledernen Kissen, mit Quasten von Gold verziert, ward ihm vorangetragen, und zwölf Knechte, mit brennenden Fackeln folgten ihm […]«.31 Anders als in das erdbeben von chili wird dieses erzählstrategische Element in michael kohlhaas jedoch nicht weitergeführt.
IV. Die Apokalypse und das Neue Jerusalem
Das Beben vereint die voneinander Getrennten nicht nur zu einer Familie, sondern es scheint das quantitative Moment weiter zugunsten der Liebenden zu verschieben. Josephe brachte ihr Kind während der Fronleichnamsprozession auf den Stufen der Kathedrale zur Welt, also vor den Augen der ganzen Stadt. Während des Erdbebens ist es, als vervielfache sich Philipps öffentliche Geburt: »Man erzählte, wie die Stadt gleich nach der ersten Haupterschütterung von Weibern ganz voll gewesen, die vor den Augen aller Männer niedergekommen seyen […]«. Die hyperbolischen Formulierungen evozieren das Bild von Straßen voll Neugeborener, und mit der multiplizierten Geburt Philipps scheint die Heilige Familie exponentiell anzuwachsen: Im »Thal von Eden« war es, »als ob das allgemeine Unglück Alles, was ihm entronnen war, zu einer Familie gemacht hätte« (156) – als ob nun alle Überlebenden Teil der Heiligen Familie wären.
Vollständig lautet der Satz: »Auf den Feldern, so weit das Auge reichte, sah man Menschen von allen Ständen durcheinander liegen, Fürsten und Bettler, Matronen und Bäuerinnen, Staatsbeamte und Tagelöhner, Klosterherren und Klosterfrauen: einander bemitleiden, sich wechselseitig Hülfe reichen, von dem, was sie zur Erhaltung ihres Lebens gerettet haben mochten, freudig mittheilen, als ob das allgemeine Unglück Alles, was ihm entronnen war, zu einer Familie gemacht hätte« (156). Die Szene erinnert zunächst an jene Passage, in der im Paradies »Dje Wolffe […] bey den Lemmern wonen / vnd die Pardel bey den Böcken ligen. […] vnd Lewen werden stroh essen wie die Ochsen. […] Man wird nirgend letzen noch verderben auff meinem heiligen Berge / Denn das Land ist vol Erkenntnis des Herrn / wie mit wasser des Meers bedeckt«.32 Darüber hinaus evoziert die Aufzählung der verschiedenen sozialen Gruppen und ihre solidarische Vereinigung das Bild einer allgemein realisierten Harmonie: »Es war, als ob die Gemüther, seit dem fürchterlichen Schlage, der sie durchdröhnt hatte, alle versöhnt wären« (155). Auf diese Weise entsteht der Eindruck, dass das Element der Homogenität, die die Gesellschaft von St. Jago mit der Auslöschung der Liebenden (wieder) herzustellen bestrebt war, im »Thal von Eden« von der Gegenseite realisiert worden wäre. Das anfängliche Zahlenverhältnis scheint sich nun umgekehrt zu haben: Es steht nicht mehr die gesamte Stadt gegen die beiden Liebenden, sondern es scheint, als wären im »Thal von Eden« alle Teil der Heiligen Familie geworden und der Hass hätte sich damit einhergehend in Liebe und Empathie verkehrt. Wie die Liebe von Josephe und Jeronimo bereits die gesellschaftlichen Schranken zwischen ihnen eingerissen hatte – Jeronimo war Josephes Hauslehrer, also von deutlich niederem Stand als sie –, scheint in der Idylle nun die Klassenlosigkeit des Himmels allgemein geworden zu sein.
Damit sieht es so aus, als treffe Jeronimos und Josephes Selbstbild zu, als läuteten das Erdbeben und ihre Rettung ein neues Zeitalter ein, als hätte sich das, was sie füreinander empfinden auf die gesamte Gesellschaft ausgedehnt. Was zwischen zwei Individuen als erotische Liebe im Klostergarten beginnt, weitet sich im »Thal von Eden« zur allgemeinen Nächstenliebe aus. In diese schleicht sich allerdings gleichfalls ein physisches Moment, wie das Detail zeigt, dass »die Klosterherren und Klosterfrauen« »durcheinander liegen«. Auch Jeronimo und Josephe »schlichen […] in ein dichteres Gebüsch, um durch das heimliche Gejauchz ihrer Seelen niemanden zu betrüben. […] und die Nachtigall flötete im Wipfel ihr wollüstiges Lied« (154). Ihnen muss sich das »Thal von Eden« als paradiesischer als das Paradies darstellen, denn hier verbietet kein strafender Gott die körperliche Liebe, was dort die Vollkommenheit des Glücks verhindert. Doch da im »Thal von Eden« auf den Geschlechtsakt keine Strafe folgt, ist damit auch keine Erkenntnis verbunden:33 Jeronimo und Josephe werden nicht aus dem Paradies vertrieben; stattdessen verlassen sie es freiwillig, verblendet von ihrem Selbstbild als Heilige Familie und dem Eindruck, alle wären nun ein Teil davon. Durch ihr freundliches Verhalten stützen Don Fernando und seine Gruppe diese Perspektive, und, mit Ausnahme von Donna Elisabeth, scheinen auch sie an eine fundamentale Veränderung der Umstände zu glauben.
Die Annahme, das Erdbeben habe einen »Umsturz aller Verhältnisse« (157) bewirkt und ein neues Zeitalter eingeläutet, wird dadurch untermauert, dass es Züge der Apokalypse trägt, wie David E. Wellbery und Bernd Hamacher deutlich machen.34 Es ereignet sich, wie zitiert, »mit einem Gekrache, als ob das Firmament einstürzte«, und: »Man erzählte, wie die Stadt gleich nach der ersten Haupterschütterung von Weibern ganz voll gewesen, die vor den Augen aller Männer niedergekommen seyen; wie die Mönche darin, mit dem Kruzifix in der Hand, umhergelaufen wären, und geschrieen hätten: das Ende der Welt sey da! […]«. Die nachstehende Passage der offenbarung johannis, in welcher vom »ander Weh« berichtet wird, klingt wie ein Nukleus der Erzählung: »Vnd zu derselben stund ward ein gros Erdbeben / vnd das zehende teil der Stad fiel / vnd wurden ertödtet in der Erdbebung sieben tausent namen der Menschen / vnd die andern erschracken / vnd gaben ehre dem Gott des Himels«.35
Die Apokalypse ist zwar der von Schrecken begleitete Untergang der Welt; vor allem ist sie jedoch – wie das Erdbeben in Kleists Text – ein »Umsturz aller Verhältnisse«, denn auf die Vernichtung der verderbten Welt und alles Bösen folgt dem biblischen Text gemäß das Reich Gottes. Genau diese doppelte Qualität macht das Erdbeben in der Wahrnehmung von Josephe und Jeronimo aus. Zum einen gehen darin jene Institutionen und Personen zugrunde, die die als Heilige Familie Stilisierten verfolgten:36 Josephe »hatte noch wenig Schritte gethan, als ihr auch schon die Leiche des Erzbischofs begegnete, die man so eben zerschmettert aus dem Schutt der Kathedrale hervorgezogen hatte. Der Pallast des Vicekönigs war versunken, der Gerichtshof, in welchem ihr das Urtheil gesprochen worden war, stand in Flammen, und an die Stelle, wo sich ihr väterliches Haus befunden hatte, war ein See getreten, und kochte röthliche Dämpfe aus« (152f). Zum anderen scheint das Erdbeben für die Repräsentantïnnen der wahren Liebe und für jene, die sich ihnen anschließen, im »Thal von Eden« das Neue Jerusalem einzuläuten. Aus diesem Grund lässt sich mit Bernd Hamacher der Name des Landes, in dem das erdbeben spielt, als Rekurs auf den Chiliasmus lesen, die apokalyptische Ankunft von Gottes Reich.37 Dem entsprechend werden die Überlebenden des Bebens als »Selige[ ]« geschildert: Josephe »fand ihn [Jeronimo] hier, diesen Geliebten, im Thale, und Seligkeit, als ob es das Thal von Eden gewesen wäre« (153); »Mit welcher Seligkeit umarmten sie sich [Jeronimo und Josephe], die Unglücklichen, die ein Wunder des Himmels gerettet hatte!« (152); »das heimliche Gejauchz ihrer Seelen« erklingt, und »Josephe dünkte sich unter den Seligen« (156). Das physische Leben scheint folglich wenig zu zählen: Es wird berichtet von »der göttlichen Aufopferung, von ungesäumter Wegwerfung des Lebens, als ob es, dem nichtswürdigsten Gute gleich, auf dem nächsten Schritte schon wiedergefunden würde« (156) – nämlich in der »Seligkeit« des »Thal[s] von Eden«. Es ist, als wäre alles Diesseitige transzendiert: »Und in der That schien, mitten in diesen gräßlichen Augenblicken, in welchen alle irdischen Güter der Menschen zu Grunde gingen, […] der menschliche Geist selbst, wie eine schöne Blume, aufzugehn« (156).38
Vor diesem Hintergrund gleicht Jeronimos Erwachen aus der Ohnmacht der Wiederauferstehung nach dem Tode: »Er mochte wohl eine Viertelstunde in der tiefsten Bewußtlosigkeit gelegen haben, als er endlich wieder erwachte, und sich, mit nach der Stadt gekehrtem Rücken, halb auf dem Erdboden erhob. […] ein unsägliches Wonnegefühl ergriff ihn, als ein Westwind, vom Meere her, sein wiederkehrendes Leben anwehte, und sein Auge sich nach allen Richtungen über die blühende Gegend von St. Jago hinwandte« (150). Darauf erfolgt ein Bruch, der Jeronimo zeigen müsste, dass er nicht im himmlischen Paradies erwacht: »Nur die verstörten Menschenhaufen, die sich überall blicken ließen, beklemmten sein Herz; er begriff nicht, was ihn und sie hiehergeführt haben konnte« (150). Auf den (nicht-vollendeten) Suizid folgt also Jeronimos ›Auferstehung‹ in einer paradiesischen Landschaft, was in ihm, wie es doppeldeutig heißt, ein »unsägliches Wonnegefühl« hervorruft. Zugleich löschen der (Beinahe-)Tod und die ›Wiederauferstehung‹ seine Erinnerung an die Verfolgung fast vollständig aus. Auch Josephe befällt nach ihrer (gleichfalls nicht-vollzogenen) Hinrichtung eine Amnesie im »Thal von Eden«:39»In Jeronimos und Josephens Brust regten sich Gedanken von seltsamer Art. Wenn sie sich mit so vieler Vertraulichkeit und Güte behandelt sahen, so wußten sie nicht, was sie von der Vergangenheit denken sollten, vom Richtplatze, von dem Gefängnisse, und der Glocke; und ob sie bloß davon geträumt hätten? Es war, als ob die Gemüther, seit dem fürchterlichen Schlage, der sie durchdröhnt hatte, alle versöhnt wären. Sie konnten in der Erinnerung gar nicht weiter, als bis auf ihn, zurückgehen« (155). Hierauf ist ebenfalls ein Bruch erkennbar: »Nur Donna Elisabeth, welche bei einer Freundinn, auf das Schauspiel des gestrigen Morgens« – also zu Josephes Hinrichtung – »eingeladen worden war, die Einladung aber nicht angenommen hatte, ruhte zuweilen mit träumerischem Blicke auf Josephen […]« (155). Doch der beinahe real und in der Ohnmacht symbolisch erlittene Tod, der Eindruck, die Apokalypse habe sich ereignet, das Erwachen in einer paradiesgleichen Umgebung, die partielle Amnesie, die Vertauschung von Traum und Wirklichkeit – Elisabeths Blicke sind »träumerisch[ ]« und damit in der gleichen Sphäre, in der das Paar den Richtplatz und das Gefängnis glaubt –, das Gefühl der »Seligkeit« sowie das Selbstbild als Heilige Familie machen die Illusion vom »Thal von Eden«perfekt. Dies führt dazu, dass Josephe in den Dom gehen möchte, um »ihr Antlitz vor dem Schöpfer in den Staub zu legen« (158). Die Formulierung erweckt vor dem Hintergrund ihrer religiösen Verzückung den Eindruck, als erwarte sie, dort Gott von Angesicht zu Angesicht gegenüberzustehen.
Dabei sah Josephe den Tod der Äbtissin, ihrer Fürsprecherin, mit an und müsste folglich wissen, dass in dem Erdbeben nicht nur ihre Widersacherïnnen zugrunde gingen, und daraus schließen, dass umgekehrt auch einige ihrer Verfolgerinnen und Verfolger überlebt haben könnten:40 dass das Erdbeben eben nicht mit chirurgischer Genauigkeit die Guten verschonte und die Bösen vernichtete; mithin: dass das Beben nicht von einem allmächtigen Gott gesandt wurde, dass es nicht die Apokalypse darstellt, auf die das Neue Jerusalem folgt.
V. St. Jago
Kaum hat die »Eden«-Gesellschaft die Kirche betreten, um Gott für ihre Rettung zu danken, stürzt sich »die ganze im Tempel Jesu versammelte Christenheit« (161) auf sie und erschlägt Josephe, Jeronimo, Juan und Constanze. Bezeichnend ist die Formulierung »die ganze [!] im Tempel Jesu versammelte Christenheit« – als würde die real-existierende »Christenheit« in toto die (eingebildete) Heilige Familie ermorden und mit ihr die anarchische Utopie von »Eden« vernichten. Es ist diese Konstellation, um deretwillen Jeronimo, Josephe mit ihrem (adoptierten) Kind als Heilige Familie stilisiert und mit Constanze an ihrer Seite ermordet werden. Denn der drastisch in Szene gesetzte Verrat des Christentums an seinen eigenen Grundsätzen bildet den Kern der Erzählung.41 Hierin liegt begründet, weshalb Kleist die Handlung seiner Erzählung nach St. Jago verlegt, statt sie in Lissabon spielen zu lassen.
Denn auch die Gesellschaft von St. Jago sieht im Erdbeben Gott walten – es war ihrer Meinung nach »auf den Wink des Allmächtigen geschehen« (159) –, doch interpretiert sie das Ereignis völlig anders als die Liebenden und ihr Gefolge. Als »Christenheit« müssten die Einwohner St. Jagos die Heilige Familie ehren; aber die Liebe von Josephe und Jeronimo erscheint ihnen keineswegs als wahre Liebe, schon gar nicht als eine religiös überhöhte. Es handelt sich in ihren Augen vielmehr um Unzucht und damit um ein zu bestrafendes Vergehen. Zuerst verbietet Josephes Vater die Liebe seiner Tochter zu Jeronimo und lässt sie in ein Kloster einschließen, als sie sich über sein Verbot hinwegsetzt. Mit dem Kloster als einer Art Gefängnis kündigt sich an, dass die christlichen Institutionen ihrer eigenen Lehre entgegenstehen. Als Josephe während der Fronleichnamsprozession ihr Kind gebärt, empört sich darüber die ganze Stadt und verlangt ihren Tod. Das gleiche Urteil scheint Jeronimo über sich verhängt zu haben, da sich sein Suizidversuch aus der Perspektive der Gesellschaft St. Jagos als Wunsch sehen lässt, sich selbst zu richten. Dass das Erdbeben den Vollzug dieser beiden gewaltsamen Tode(sstrafen) verhindert, deutet der Chorherr in seiner Predigt jedoch nicht als göttlichen Einspruch dagegen. Er sieht darin eine Strafe für jene vermeintliche ›zu große Milde‹, aufgrund derer Josephes Urteil vom Tod auf dem Scheiterhaufen in eine Enthauptung umgewandelt wurde. Desweiteren stellt er eine Parallele her zwischen der verbotenen Liebe des Paares und der Verderbtheit von »Sodom und Gomorrha« (159), die Gott erzürnte und die beiden Städte vernichten ließ.
Mit »Sodom und Gomorrha« ist die Warte benannt, von der aus die Gesellschaft St. Jagos auf das Geschehen blickt. Während Jeronimo und Josephe mit der Anrufung der Gottesmutter und ihrer (Selbst-)Stilisierung als Heilige Familie auf das sogenannte neue testament rekurrieren, bezieht sich der Chorherr auf einen strafenden Gott. Dies zeigt sich auch in der Formulierung aus der Perspektive der Einwohner St. Jagos, dass Josephes Hinrichtung ein »Schauspiele [sei], das der göttlichen Rache gegeben wurde« (149). das erdbeben in chili greift damit formal – und zwar ausschließlich formal – die christliche Diffamierung des jüdischen Gottes als den des Gesetzes und der Rache auf; inhaltlich handelt es sich dabei jedoch nicht um die Position des Erzählers, wie später zu sehen sein wird. Diffamierend und falsch ist diese Zuschreibung, weil im Zentrum der jüdischen Gottesvorstellung die Gerechtigkeit, nicht aber die Rache steht. In diesem Kontext ist auch die Unterscheidung von »altem« und »neuem testament« zu sehen: In ihr wirken die Ansichten Marcions (zu denen er durch eine radikalisierende Interpretation der Paulus-Briefe kam) und anderer gnostischer Denker weiter.42
Die Gnosis stellt kein einheitliches Gedankengebäude dar, da ihre Vertreter verschiedene, mitunter verschlungene und einander vielfach widersprechende Positionen einnehmen. Gemeinsam ist ihnen, dass sie von der Existenz zweier Göttern ausgehen:43 einem guten, aber untätigen Gott sowie einem niederen, unwissenden und / oder bösen Gott, der mit dem Platonschen Begriff des Demiurgen bezeichnet wird. Die Welt sei von letzterem erschaffen worden, woraus deren üble Einrichtung und das menschliche Leiden an der irdischen Existenz resultiere. Die Frage, weshalb ein guter Gott eine schlechte Welt geschaffen habe, die Leibniz mit der Theodizee zu beantworten sucht, stellt sich den Gnostikerïnnen folglich nicht.44 Dass Jeronimo »das Wesen, das über den Wolken waltet«, »fürchterlich schien« und ihn »sein Gebet […] zu reuen an[fing]« (151), lässt sich in diesem Zusammenhang sehen. Marcion und andere Gnostiker identifizieren den Demiurgen mit dem Schöpfergott der Bibel. Die christliche Kirche sah in ihnen daher eine Konkurrenz und bekämpfte sie als Häretiker.45 Aus der Auseinandersetzung mit den gnostischen Lehren übernahm sie jedoch die Diffamierung Jahwes, mit dem Ziel, den christlichen Glauben gegenüber dem jüdischen als angeblich moralisch überlegen darzustellen. Auf diese Weise kam es von christlicher Seite zu der schlagwortartigen, falschen und denunziatorischen Gegenüberstellung von christlicher Mitleidslehre contra einem unterstellten jüdischen Gesetzes- und Rachegedanken. Michael Wolffsohn zeigt hingegen auf, dass die christliche Mitleidslehre ihren Ursprung im Judentum hat, und konstatiert eine Inversion des diffamierenden Klischees in der Wirklichkeit: dass Christen in der Geschichte (nicht nur, ist zu ergänzen) gegenüber Juden weitaus unbarmherziger auftraten, als sie es dem Judentum vorwarfen.46
Strukturell geht es darum auch in Kleists Erzählung: Wird das Christentum seinen eigenen moralischen Ansprüchen gerecht? Wie würden sich gläubige Christïnnen gegenüber der Heiligen Familie verhalten? – Dass Kleist das erdbeben nicht, wie vor dem Hintergrund der Theodizee-Diskussion zu erwarten gewesen wäre, in Lissabon spielen lässt, sondern die Handlung nach St. Jago verlegt, weist auf die Antwort hin. Zwar bezieht sich der Name der Stadt auf den Apostel Jakobus, doch aufgrund dessen Namensgleichheit mit dem Patriarchen Jakob lässt er sich auch als Rekurs auf das sogenannte alte testament und den als strafend verunglimpften Gott lesen. Kleists Erzähler wendet damit die Diffamierung des Judentums gegen das Christentum selbst, indem er zeigt, dass das real-existierende Christentum entgegen seiner Propaganda nicht einem Gott der Liebe, sondern einem der Rache anhängt.
Die Erzählung vollführt also einen Dreischritt: Sie beginnt in einer repressiv-christlichen Sphäre, in der das Sittengesetz über der Liebe und dem Mitleid steht. Nachdem Jeronimo die Mutter Gottes als Schutzherrin angerufen hat, vernichtet das (aus Sicht der Liebenden) als Apokalypse fungierende Erdbeben St. Jago und stürzt die sich auf einen rächenden Gott berufende Ordnung. Aus deren Trümmern geht im »Thal von Eden« eine Gesellschaft hervor, welche die vom Christentum lediglich postulierten Tugenden, ergänzt um die die erotische Liebe, tatsächlich lebt. Den Paradigmenwechsel durch das Erdbeben gibt es aber nur in der Wahrnehmung der Liebenden. Denn obwohl die Stadt zerstört ist, besteht die repressive Theologie weiter, weshalb Jeronimo, Josephe, Juan und Constanze wie Märtyrer hingemetzelt werden, als sie nach St. Jago zurückkehren. Der Ruf »steinigt sie! steinigt sie!« (161), mit dem dies einhergeht, rekurriert zum einen auf den Hl. Stephan, den ersten christlichen Märtyrer; die Angreifer erweisen sich dadurch erneut als Feinde der Mitleids- und Liebeslehre. Zum anderen verweist der Ruf auf einen Ausspruch Christi, der in einer ähnlichen Situation sagt: »Wer vnter euch on sunde ist / der werffe den ersten stein auff sie«.47
VI. Die Opferung Isaaks