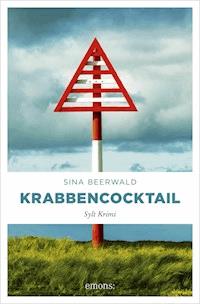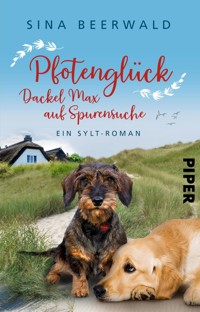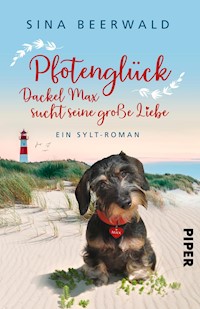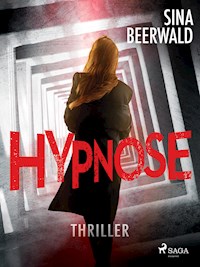4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein geheimnisumwobenes Handwerk, eine mutige junge Frau und ein Wettlauf gegen die Zeit: der farbenprächtige historische Roman um die Entstehung der Kaiser-Krone Karls des VII. Für seine Krönung zum Kaiser im Jahre 1742 wünscht Karl der VII. sich eine Haus-Krone, die an Pracht und Strahlkraft der Krone der Ottonen gleichkommen soll. Nur ein einziger Goldschmied im Reich scheint geeignet, diese anspruchsvolle Aufgabe binnen 15 Tagen bis zur Krönung bewältigen zu können: der berühmte Meister Philipp Drentwett aus Augsburg. Niemand weiß, dass der Goldschmied an einer tückischen Krankheit leidet, die ihm sein Augenlicht raubt. Und Drentwett ist nicht bereit, den Auftrag seines Lebens abzulehnen. Stattdessen lehrt er seine Magd Juliane die Geheimnisse seiner Kunst. Tag und Nacht müht sich die junge Goldschmiedin, das kostbare Material zu filigranen Mustern zu formen. Doch die Zeit ist nicht ihr einziger Gegner: Jemand ist bereit, alles zu tun, um Juliane an der Vollendung der Krone zu hindern. »›Die Goldschmiedin‹ hat alles, was ein gutes Buch braucht: Spannung, Überraschung, Liebe und die farbenfrohe Schilderung einer fremden Welt, von der wir uns nur allzu gern verzaubern lassen. Am Ende gipfeln die fesselnden Schilderungen und ineinander verschachtelten Handlungen in einer absolut überraschenden Wendung.« WDR 4 Entdecken Sie weitere historische Romane von Sina Beerwald bei Knaur: »Das Mädchen und der Leibarzt« »Das blutrote Parfüm« »Die Herrin der Zeit«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 568
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Sina Beerwald
Die Goldschmiedin
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Für seine Krönung zum Kaiser im Jahre 1742 wünscht Karl der VII. sich eine Hauskrone, die an Pracht und Strahlkraft der Krone der Ottonen gleichkommen soll. Nur ein einziger Goldschmied im Reich scheint geeignet, diese anspruchsvolle Aufgabe binnen 15 Tagen bis zur Krönung bewältigen zu können: der berühmte Meister Philipp Drentwett aus Augsburg.
Niemand weiß, dass der Goldschmied an einer tückischen Krankheit leidet, die ihm sein Augenlicht raubt. Und Drentwett ist nicht bereit, den Auftrag seines Lebens abzulehnen. Stattdessen lehrt er seine Magd Juliane die Geheimnisse seiner Kunst. Tag und Nacht müht sich die junge Goldschmiedin, das kostbare Material zu filigranen Mustern zu formen. Doch die Zeit ist nicht ihr einziger Gegner: Jemand ist bereit, alles zu tun, um Juliane an der Vollendung der Krone zu hindern.
Inhaltsübersicht
Prolog
1. Tag
2. Tag
3. Tag
4. Tag
5. Tag
6. Tag
7. Tag
8. Tag
9. Tag
10. Tag
11. Tag
12. Tag
13. Tag
14. Tag
15. Tag
16. Tag
Epilog
Glossar
Nachwort
Danksagung
Prolog
Unser Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster und Unüberwindlichster Fürst und Herr, nunmehro Römischer König und künftiger Kaiser, geruht dem berühmten Goldschmied zu Augsburg, Meister Philipp Jakob VI. Drentwett, den Auftrag zu erteilen, binnen 19 Tagen zur kaiserlichen Krönung am 12. Februar 1742 eine Hauskrone in Nachahmung der ottonischen Reichskrone zu erschaffen. Golden, mit kostbaren Steinen und Perlen besetzt und von feiner Hand gefertigt soll sie sein. Ferner wird zur Krönung ein Tafelservice aus 50 Teilen und diverses Zubehör sowie ein silberner Buchbeschlag für die Hausbibel Ihro Römisch-Kaiserlichen Majestät erwünscht. Es soll nur das edelste Material verwendet werden. Zur allgefälligen Ausführung liegt ein Musterbuch mit detaillierten Zeichnungen anbei.
Die Überbringung des Materials erfolgt durch uns vertraute Boten in mehreren Chargen, auf verschiedenen Routen und in unterschiedlichen Zeitabständen, um einer Behelligung durch Räuber und ähnlichem Gesindel zu entgehen. Auch innert der Werkstatt soll wegen der Diebstahlgefahr erhöhte Umsicht herrschen. Damit keine verdächtigen Subjekte angelockt werden, ist bis zur Lieferung über die Sache vollkommenes Stillschweigen zu bewahren!
Bei erfolgreicher Ausführung wird dem werten Goldschmiedemeister und seiner Familie nebst der Entlohnung eine Einladung in die Reichsstadt Frankfurt zum Akt der Krönung und den anschließenden Feierlichkeiten in Aussicht gestellt.
Actum, den 24. Januar 1742, am Tage der Erwählung Karl Albrechts zum Römischen König und künftigen Kaiser.
1. Tag
Sonntag, 28. Januar 1742, noch 15 Tage bis zur Krönung
Ich habe auch Verstand wie ihr, ich falle nicht ab im Vergleich mit euch. Wer wüsste wohl dergleichen nicht?
Hiob 12,3
Die nächtlichen Schatten wichen der aufgehenden Wintersonne, als die ersten Glockenschläge über Augsburg erklangen. Milchige Lichtstrahlen schoben sich zum Fenster der Goldschmiede herein, gaben dem Tisch seine Konturen zurück, erhellten den Dielenboden und das Werkzeug an der Wand. Juliane schaute auf. Im Nachbarhaus regten sich die ersten Stimmen und vermischten sich mit den Geräuschen der erwachenden Stadt. Ein Fuhrwerk zog vorbei, die Pferde schnaubten und die Räder pflügten mit malmenden Seufzern Spuren in den frischen Schnee.
Juliane unterdrückte ein Gähnen und legte das Fangleder auf ihrem Schoß zurecht, damit kein Gran des kostbaren Silbers verloren ginge. Auch in dieser Nacht war ihr Bett kalt geblieben. Sie atmete tief durch. Ihr Rücken schmerzte, die Augen brannten, und selbst die Finger wollten ihr nicht mehr gehorchen. Wie gerne hätte sie sich jetzt ausgeruht und die Arbeit einfach vergessen, sich in ihr behagliches Federbett gelegt und geschlafen. Doch der Brief des Römischen Königs und künftigen Kaisers lag auf der Werkbank und gemahnte sie an ihre Disziplin. Nur noch fünfzehn Tage und Nächte, bis dahin mussten alle kaiserlichen Wünsche erfüllt und die Hauskrone erschaffen sein. Und noch in dieser Stunde wollte sie ihrem Meister beweisen, dass eine Goldschmiedsmagd ebenso viel leisten konnte wie ein Geselle. Der Meister durfte seine Entscheidung nicht bereuen, sie bei sich aufgenommen zu haben.
Juliane zog die mit Wasser gefüllte Glaskugel näher, in der sich das schwache Morgenlicht bündelte. Es fiel auf ein Ornament aus dünnen Silberdrähten, das vor ihr auf dem zerfurchten Holztisch lag. Juliane warf einen letzten Blick in das Musterbuch, in dem mit erfahrener Hand eine Zeichnung angefertigt worden war. Sie wollte ganz sichergehen. Es musste perfekt werden. Der schwierigste Arbeitsgang stand ihr unmittelbar bevor. Noch nie hatte sie diesen Schritt selbst ausgeführt, sie könnte das silbern schimmernde Ergebnis dieser Nacht mit einem Schlag zunichtemachen.
Vor ihr lagen zahllose Blüten, Blätterranken und Zierdrähte, die sich nach dem Löten zu einem prächtigen Buchbeschlag für die Hausbibel des Kaisers vereinen sollten – oder bei zu starker Hitze zur Unkenntlichkeit verschnurren würden. Juliane hob die filigran geformten Kunstwerke auf einen Holzkohlescheit, ließ genügend Tragant darüberfließen und schob die Teile in der zähflüssigen Masse in die richtige Lage. Nachdem der Brei leicht angetrocknet war, bepinselte sie das zarte Drahtwerk mit Boraxlösung und streute die Lotpaillen darüber.
Dass mit dem Silber womöglich etwas nicht stimmte, durfte sie sich gar nicht vorstellen. Es erschien ihr leicht rötlich, es war nur ein Hauch, aber genug, um ihre ohnehin blank liegenden Nerven anzugreifen. Der Gedanke an minderwertiges, sogar verbotenes Silber keimte in ihr auf. Aber das war ausgeschlossen, schließlich stammte es vom königlich-kaiserlichen Boten, der ihnen vor zwei Tagen die erste Charge Schmelzsilber überbracht hatte. Trotzdem war irgendetwas damit nicht in Ordnung. Sie beschloss dem Meister ihren Verdacht mitzuteilen, falls er heute geneigt sein würde, mit ihr zu sprechen.
Gedankenverloren verfolgte Juliane die verschlungenen Pfade ihres silbernen Buchbeschlags. Während sie das Öl in der Lötlampe entzündete und nach dem Lötrohr griff, hielt sie unwillkürlich die Luft an. Sie schmeckte das trockene Holzmundstück an ihren Lippen, rückte ihr Kunstwerk noch einmal mit den Fingerspitzen zurecht, und nach einem flehenden Blick zur Decke stieß sie den Atem durch das dünne Rohr. Eine gelbe Feuerzunge schoss hervor, rauschte über die silberne Fläche, und als sie die Augen öffnete, offenbarte sich das angerichtete Unheil. Das Silber war zu heiß geworden, die glatte Oberfläche hatte sich zu eigenwilligen Formen gefaltet, glich der Haut eines Greises. Juliane starrte den Buchbeschlag mit geweiteten Augen an. Das durfte nicht wahr sein. Die Blüte in der Mitte war bis zur Unkenntlichkeit verschmolzen, die Blätterranken wie Herbstlaub zusammengefallen, und die Zierdrähte hatten nur noch Ähnlichkeit mit Wurzelwerk. Fassungslos schob sie das Lötrohr beiseite. Aus und vorbei. Die nächtelange Arbeit vergebens.
Auch in dieser Nacht habe ich dich beobachtet, meine Sonne. Jeden deiner Handgriffe, während du an der Werkbank sitzt und ein Kunstwerk aus deinen Händen entsteht. Es wird dir nicht gelingen, das weiß ich. Du wirst das missglückte Stück wieder über dem Feuer einschmelzen müssen, und mit einem Lächeln werde ich zusehen, wie deine Träume zerfließen. Deine Arbeit wird auch dieses Mal nicht von Erfolg gekrönt sein. Die zahllosen Stunden, in denen du gebeugt über dem Brett sitzt, die Hoffnungen, die du dir vergebens machst – ein wunderbares Gefühl. Deine Verzweiflung wird meine Wunden lecken, und ich werde mich an deinem Kummer weiden, weil es das Einzige ist, was mich noch glücklich macht. Ich komme meinem Ziel immer näher. Doch leider ein wenig zu langsam, denn du bist beharrlich und dickköpfig. Und das macht mich ungeduldig. Du bist sehr geschickt, aber du musst auf deine zarten Fingerchen achtgeben. Wenn du sie zu weit ausstreckst, berührst du Dinge, die dich nichts angehen, und das könnte ziemlich unangenehm für dich werden.
Ich habe einen guten Rat für dich, meine Sonne: Gib auf, bevor ich dich dazu zwingen muss.
Nachdem Juliane eine Weile reglos dagesessen hatte, erhob sie sich mit schweren Beinen, um ihr Meisterstück in einen der bereitstehenden Schmelztiegel bei der Feuerstelle zu werfen. Dabei vergaß sie das Fangleder auf ihrem Schoß. Wie ein feiner Regenschauer fielen die kostbaren Silberstückchen auf den Boden und verschwanden in den trockenen Rissen des Dielenholzes. Ihr Blick schoss instinktiv zur Tür. Hatte sie eben die Schritte des Meisters gehört? Schnell ließ sie ihr verunstaltetes Werk in einem Schmelztiegel verschwinden, bevor sie niederkniete, um in fieberhafter Eile ein Körnchen nach dem anderen aufzusammeln.
»Guten Morgen, Blümlein. Hörst du schlecht? Ich habe nach dir gerufen.«
Juliane fuhr herum und schaute zu Meister Drentwett auf, der mit verschränkten Armen wie das Abbild eines Reiterdenkmals in der Tür stand. Seine wuchtige Gestalt und die straffe Haltung hätten jedem Feldherrn zur Ehre gereicht. Einzig die nachlässig frisierte Perücke und die schief geknöpfte goldfarbene Seidenweste gaben ihm menschliche Züge. Sein Blick irrte durch den Raum. »Blümlein? Komm sofort her und hilf mir. Ich kann meinen Ausgehrock nicht finden.«
Juliane räusperte sich. »Ich sitze hier auf dem Boden.« Zaghaft fügte sie hinzu: »Könnt Ihr mich vielleicht nicht mehr richtig sehen, Meister Drentwett?« Schon seit Tagen hegte sie diesen Verdacht, hatte ihn aber bisher nicht auszusprechen gewagt. Stattdessen hatte sie in den letzten Nächten für zwei gearbeitet. Heimlich. Denn er erklärte seine wellenförmigen Teller, ovalen Trinkpokale und verzogenen Besteckgabeln nach wie vor für formvollendet und eines Kaisers würdig.
Ihr wiederum fehlte es neben der Routine am nötigen Wissen, denn der Meister hütete seine Kenntnisse wie sein vergoldetes Werkzeug. Kein Wort der Erklärung kam je über seine Lippen. Jeden Handgriff musste sie sich bei ihm abschauen, jeder Bewegung nachlauern, wissend, dass er sie nur duldete wie ein König seine Mätresse. Seine Gunst konnte jeden Augenblick ein Ende haben.
Eine Zornesfalte erschien auf der Stirn des Meisters. »Ich pflege meine Augen nicht auf Bettler zu richten, also erheb dich gefälligst und hilf mir.«
Juliane stand auf. Unwillkürlich schloss sich ihre Hand um die aufgesammelten Silberkörnchen. »Gewiss, Meister Drentwett. Aber nennt mich nicht immer Blümlein. Ich habe einen richtigen Namen.«
»Namen sind nur dazu da, dass der Mensch sie vergessen kann. Du wiederum solltest dich daran erinnern, deinem Meister dienstbar zu sein und ihm aufs Wort zu gehorchen. Außerdem ist Blümlein doch ein hübscher Name, ich weiß gar nicht, was du hast.«
Juliane lag eine Erwiderung auf der Zunge, aber sie blieb stumm.
»Was hast du überhaupt die ganze Nacht gemacht? Wieder einmal aus dem kostbaren Material des Händlers Kunstwerke für den Misthaufen geschaffen? Hätte dich dein Vater nicht irgendwo in der Kirche unterbringen können? Ist ihm als Pfarrer nichts Besseres eingefallen?«
Es verletzte sie, wie abfällig er von ihrem geliebten Vater sprach, um den sie seit einigen Monaten trauerte und den sie so sehr vermisste.
»Aber Ihr habt doch zugestimmt, dass ich als Goldschmiedsmagd bei Euch lernen darf.«
»Weil ich klug genug war, mich nicht dem Letzten Willen deines Vaters zu widersetzen! Ein Goldschmied, der das Testament eines Pfarrers missachtet – glaubst du, ich würde noch einen Auftrag bekommen?«
Juliane schwieg und ballte ihre Hände zu Fäusten. Aus ihr würde eine Goldschmiedin werden, ihr Vater hatte ihr diesen Weg geebnet, und nun wollte sie ihn gehen. Niemand hatte behauptet, dass es einfach werden würde.
»Ich will wissen, was du heute Nacht in der Werkstatt getrieben hast! Wenn einer der Verordneten vom Handwerksgericht das Licht gesehen hat … man wird uns Fragen stellen! Ganz abgesehen davon versteht der Rat keinen Spaß, was nächtliche Arbeit angeht, das weißt du! Da braucht kein Weibsbild am Brett gesessen zu haben.«
»Ich glaube nicht, dass einer der Handwerksverordneten etwas bemerkt hat.«
»Sodann bete lieber, wenn der Glaube helfen soll. Ich werde dir jedenfalls nicht helfen, so man dich in den Turm stecken will. Im Gegenteil. Alsdann wäre ich dich endlich los. Der Herrgott hat mich schon lang genug mit dir gestraft. Wenn ich nur wüsste, womit ich das verdient habe. Einen Gesellen wollte ich, eine echte Hilfe! Nicht so jemanden wie dich! Such jetzt gefälligst meinen Ausgehrock, damit ich deine Nützlichkeit vielleicht doch noch erkenne, und sag meinem Weib, sie soll mir eine Fleischsuppe kochen.«
»Wir haben kein Fleisch mehr im Haus …«
»Dann eben einen deftigen Gemüseeintopf.«
»Es fehlt uns auch am Gemüse.«
»Dann soll mir mein Weib ein Schmalzbrot machen.«
»Auch das haben wir nicht.«
»Ja, Himmelherrgott! Was haben wir denn dann?«
»Nichts. Nur noch zwei Scheiben trockenes Brot und ein fingerbreites Stück Rauchschinken. Das ist alles.« Weil die Kundschaft ihre Rechnungen ohne Ermahnung nicht bezahlt, wollte sie hinzufügen, verkniff es sich aber. Sie wusste, dass er die Eintragungen in seinen Büchern nicht mehr erkennen konnte, doch das würde er niemals zugeben. Er war ein Mensch ohne Fehler und Schwächen.
»Gut. Sodann soll mir mein Weib das Brot und den Schinken bringen.«
»Das kann ich nicht.« Friederike war hinter ihrem Mann in der Tür erschienen und schaute ihn wehklagend an. Die achtundvierzig Jahre ihres Lebens hatten sie gezeichnet, Kummer und Arbeit hatten sich als tiefe Falten in ihrem runden Gesicht verewigt. Aber in ihren welligen grauen Haaren, die sie zu einem Nackenknoten gebunden trug, hielten sich wie zum Trotz immer noch einige dunkle Strähnen. Zeichen eines stummen Kampfes gegen das Unvermeidliche. Angsterfüllt duckte sich Friederike wie eine Katze vor dem knurrenden Hofhund, alle Muskeln ihrer zierlichen Gestalt waren angespannt, aber sie floh nicht.
»Was hast du da gesagt, Weib?«
»Das Brot ist schimmlig geworden … und … den Rauchschinken habe ich gestern Abend einer Frau mit einem Säugling gegeben, als sie an unserer Tür um eine milde Gabe bat. Die beiden hatten Hunger, und da habe ich … ich dachte, wir hätten noch genug Geld, um uns …«
»Sei still, Weib! So wie du wirtschaftest, wundert es mich nicht, dass du selbst kein Kind ernähren konntest!« Mit hochgezogenen Augenbrauen wanderte sein leerer Blick über seine Frau wie über eine unaufgeräumte Werkbank. Er verharrte bei ihren Händen, die Friederike vor dem Schoß gefaltet hielt. Juliane wusste, dass er dem Bernsteinring galt, auch wenn die Augen des Meisters ihn vermutlich nur noch unscharf erkennen konnten. Der Stein war von honiggelber Farbe mit braunen Sprenkeln, in wertvolles Gold gefasst und zierte Friederikes linken Ringfinger.
Der Goldschmiedemeister holte tief Luft, als wolle er etwas sagen, überlegte es sich dann aber anders. Juliane ahnte, was ihm angesichts der Geldnot auf der Zunge lag, er verlor jedoch kein Wort über diesen Ring. Nicht heute und auch früher nicht. Juliane wusste nur, dass Friederike ihn als Erinnerung trug. Seit dem Tod ihres kleinen Sohnes. Ihres ersten und einzigen Kindes. Doch wie so viele Kinder hatte der Herrgott ihn nach einigen Monaten auf der Erde wieder zu sich geholt. Danach war die Frau des Meisters nie mehr schwanger geworden. Ihr verstorbener Sohn war durch den Bernsteinring und darüber hinaus allgegenwärtig, denn Friederike schloss ihn in ihr Morgengebet ein, versank bei Kummer oft in Zwiesprache mit ihm, und jeden Abend erzählte sie ihm flüsternd alle Geschehnisse des Tages.
Seit ihrer Aufnahme bei den Drentwetts teilte sich Juliane mit Friederike eine Kammer, und anfangs hatte sie krampfhaft versucht wegzuhören, doch in den vergangenen Wochen hatte sie sich daran gewöhnt. Nur der Meister grollte, weil sein Weib dem ehelichen Lager entflohen war. Er hätte deswegen zwar niemals die Hand gegen sie erhoben, doch seine Worte und Gesten sprachen Bände.
Friederike sah ihren Mann lange an, legte dann schützend eine Hand über den Ring und ging wortlos hinaus in die Küche, die sich an die Werkstatt anschloss. Eine Stube gab es in diesem Haus nicht. Wozu auch? Schließlich drehte sich alles nur um die Bedürfnisse des Meisters. Neben der Arbeit waren dies ein paar Stunden Schlaf, wofür ihm die zweite Kammer im oberen Stockwerk diente, und für die seltenen Mahlzeiten gab es einen großen Holztisch in der Küche.
Friederike kam mit einem Stück Speck zurück – wo auch immer sie diesen noch aufgetrieben hatte – und stellte ihrem Mann den Teller wortlos auf die Werkbank.
»Na also, geht doch.« Noch während sich der Meister auf seinem Schemel niederlassen wollte, hämmerte es gegen die Werkstatttür.
»Meister Drentwett? Hier ist Geschaumeister Biller!«
Juliane fuhr zusammen. Sie ließ das Krümelsilber aus ihrer Faust in die Rocktasche gleiten.
»Was will denn dieser Spitzel hier?«, zischte der Gerufene und wandte sich im selben Atemzug an Juliane. »Schnell, lass das kaiserliche Pergament von der Werkbank verschwinden!«
Ein ungeduldiges Pochen folgte. »Das Handwerk hat eine allgemeine Visitation angeordnet.«
Juliane wurde vom Goldschmiedemeister am Arm gepackt. »Das hier sind alles Waren für die Frankfurter Messe, verstanden?«, raunte er. »Und du hast keines dieser Stücke hier gefertigt. Du bist niemals am Brett gesessen, hast nur Gold und Silber eingeschmolzen, die fertigen Stücke abgewischt und aufgeräumt. Nichts weiter! Ist das klar?«
Es klopfte erneut. »Ich als Geschaumeister habe diese Kontrolle durchzuführen. Man möge mir öffnen.«
Friederike schüttelte den Kopf. »Er wird dir niemals glauben, dass du all die Sachen allein geschaffen hast. Wenn du Juliane nicht aus dem Raum schickst, wird ihm sofort klar sein, wer dir geholfen hat! Er nimmt dir deine Meistergerechtigkeit, er nimmt uns alles, falls ihm hier irgendetwas auffällt.«
»Ich wusste, dass das mit ihr nicht gut geht!«
Juliane spürte, wie sich der Griff um ihren Arm verstärkte. Es brannte, als wäre sie in Brennnesseln geraten.
»Will man mir nicht öffnen? Muss ich zur Anzeige schreiten?«, rief die Stimme wie durch ein blechernes Rohr.
»Juliane muss sich verstecken!«, drängte Friederike. »Mich kennt er. Gegen mich wird er keinen Verdacht hegen.«
»Los, geh!«
Juliane wurde vom Meister in Richtung Küche dirigiert, gleichzeitig scheuchte er seine Frau mit einer wedelnden Handbewegung zur Tür. »Worauf wartest du? Mach ihm auf!«
Juliane bemerkte, wie der Blick des Meisters die Tür verfehlte und er stattdessen die Wand fixierte. Sie atmete tief durch. Mit vier schnellen Schritten gelangte sie in die Küche und versteckte sich dort hinter der Tür. Wie um alles in der Welt sollte Friederike seine schlechte Sehkraft verheimlichen?
Juliane wusste, wen sie zu erwarten hatten. Geschaumeister Biller war stadtbekannt, ebenfalls Goldschmied, und für die nächsten zwei Jahre hatte er das Beschauamt inne. Jeder andere hätte sich über diese zusätzliche Bürde beschwert, aber Juliane wurde den Eindruck nicht los, dass Biller diese Kontrollaufgaben mehr liebte als seinen Beruf.
In der Werkstatt erschien ein hagerer Mann mit einer schwarzen Klappe über dem rechten Auge, ein Andenken an den letzten Krieg, wie man sich erzählte. Seine gewellte Perücke reichte ihm bis über die Schultern, akkurat geformte Locken, kein Haar tanzte aus der Reihe, als wäre die Allonge aus Stein gemeißelt. Wie immer hielt er ein ledergebundenes Heft unter dem Arm, und in seiner Rocktasche steckte die Feder bereit.
Er schaute sich um, sein gesundes Auge schien alle Gegenstände zugleich zu erfassen, wachsam wie das eines Greifvogels. »Geduld ist nicht eben meine Stärke. Ich hoffe, Ihr hattet einen triftigen Grund, mich warten zu lassen. Andernfalls könnte Euch das noch leidtun, werter Drentwett.«
Juliane duckte sich, spähte aber trotzdem weiter durch den Türspalt.
»Gott zum Gruße, Herr Geschaumeister«, entgegnete der Goldschmiedemeister ruhig.
»Seit wann so fromm, lieber Drentwett? Ihr werdet doch nichts zu verbergen haben?« Biller zog das Heft unter dem Arm hervor und blätterte. »Ihr wart schon lange nicht mehr in der Kirche. Mein diesbezüglich letzter Eintrag ist vom …« Mit spitzem Finger fuhr er die Zeilen entlang. »August letzten Jahres. Überhaupt sieht man Euch in letzter Zeit sehr selten auf der Gasse. Ihr habt wohl viel zu tun?«
Juliane hielt den Atem an, als der Geschaumeister zu dem langen Werktisch ging, der den Raum in zwei Hälften teilte, und sich ungefragt auf dem Schemel in der Nähe des Fensters niederließ, dort, wo sie eben noch gesessen hatte.
Das Werkzeug an der Wand gegenüber erregte seine Aufmerksamkeit. Die zahlreichen Feilen, Stahlscheren, kleineren Schlaghämmer, Prägestempel und unterschiedlichen Zangen hatten vergoldete Griffe und trugen die Initialen PD, wie auch alles andere Werkzeug, das einzig für die Hände des Meisters bestimmt war. Die Pendants in gewöhnlicher Ausführung hingen griffbereit auf ihrer Seite.
Juliane erstarrte, als Biller den unaufgeräumten Tisch und das noch aufgeschlagene Musterbuch ins Visier nahm.
»Hier wurde vergangene Nacht gearbeitet?« Es klang weniger nach einer Frage, denn nach einer Feststellung. Sein hellbraunes, fast gelbes Auge richtete sich auf den Meister. »Oder wollt Ihr mir weismachen, dass Ihr ausgerechnet heute den helllichten Morgen ausgenutzt habt, wo Ihr Euch doch sonst nicht vor der zehnten Stunde aus Eurer Bettstatt erhebt?«
Friederike stellte sich dicht neben ihren Mann und lenkte seinen massigen Körper unauffällig in die richtige Blickrichtung.
»Ich habe viel zu tun, wie Ihr schon festgestellt habt«, entgegnete der Goldschmied knapp.
»So, so.« Der Geschaumeister zückte seine Feder, ließ sich von Friederike ein Tintenfass reichen und machte sich einige Notizen. Mit einem Kopfnicken deutete er auf das Musterbuch. »Ich wusste gar nicht, dass Ihr so gut zeichnen könnt, werter Drentwett. Hübscher Buchbeschlag, den Ihr da fertigen wollt.«
Julianes Magen krampfte sich zusammen.
»Ihr habt mich von jeher verkannt«, antwortete der Meister mit einem feinen Zittern in der Stimme.
Biller erhob sich, verschränkte die Hände mit dem Pergamentheft hinter dem Rücken und durchwanderte gemessenen Schrittes die Werkstatt. »Ihr erlaubt, dass ich mich ein wenig umsehe? In Anbetracht der bevorstehenden Warenmesse in Frankfurt hat unser Rat beschlossen, sämtliche Goldschmiede einmal mehr einer Visitation zu unterziehen, alle Vorgänge zu kontrollieren und minderwertige Ware zu konfiszieren, damit der hervorragende Ruf unserer Stadt über die Grenzen des Reichs hinaus erhalten bleibt.«
»Nur zu. Ich habe nichts zu verbergen.«
Der Geschaumeister lächelte. »Gewiss.«
Sein erstes Augenmerk galt dem dicken Brett, das über die Länge des Werktisches unter der Decke hing. Darauf lagerten die Kunstwerke für die Frankfurter Messe. Wie jedes Jahr. Schließlich durfte auch ihr ständiger Händler nichts vom kaiserlichen Auftrag erahnen. Aus dessen Gold- und Silberlieferung hatte Meister Drentwett mit letzter Mühe und nachlassender Sehkraft drei filigrane Kerzenleuchter, Schmuckschatullen unterschiedlicher Größe und mindestens 30 Paar Eheringe gefertigt.
Das Ergebnis ihrer nächtlichen Arbeit waren ein Stapel getriebener Teller, einige Schalen und Kelche, eine Suppenterrine, Löffel und ein Beutel mit Ablasspfennigen aus Messing, manche mit einem Goldrand eingefasst.
»Eine beachtliche Menge«, murmelte Biller, und etwas lauter fügte er hinzu: »Für die Arbeitskraft eines Mannes ungewöhnlich viel, findet Ihr nicht?«
Meister Drentwett schwieg.
»Nun, wie ist das zu erklären?« Der Geschaumeister zückte seine Feder.
Der Goldschmied senkte den Kopf, als stünden die richtigen Worte am Boden geschrieben. In ihm arbeitete es. Er furchte die Stirn und starrte ohne zu blinzeln auf einen Punkt. Es blieb still in der Werkstatt.
Gerade als Biller ungeduldig wurde und eine Antwort einfordern wollte, verschränkte der Meister die Arme vor der Brust und holte tief Luft. »Ich habe seit Jahresbeginn einen Gesellen.«
»Einen Gesellen?« Billers fragender Blick streifte durch die Werkstatt und blieb für einen endlos langen Moment an der Küchentür haften. »Und wo ist er?«
»Er macht Besorgungen. Dagegen werdet Ihr ja wohl nichts einzuwenden haben.«
»Gewiss nicht. Merkwürdig nur, dass er mir bisher nicht auf dem Amt unter die Augen gekommen ist. Überhaupt habe ich keines Eurer Werke seit Jahresbeginn auf meinem Prüftisch gehabt. Oder erinnere ich mich nur nicht? Bei über zweihundert hiesigen Goldschmieden wäre das kein Wunder. Vor allem, weil Eure Kunstwerke ziemlich nichtssagend sind. Irgendwie … Einheitsware.«
»Das verbitte ich mir! Ich habe erst letztes Jahr als einer der wenigen auserwählten Goldschmiede am vierhundertteiligen Tafelservice für den Kurfürsten Karl Albrecht mitgearbeitet, und er war hochzufrieden.«
Der Name des künftigen Kaisers ließ Juliane zusammenzucken.
Der Geschaumeister lächelte. »Ach ja, natürlich. Ich vergaß. Der neue Kaiser. Allerdings kann Eure Arbeit so herausragend nicht gewesen sein. Oder hat Euch etwa ein neuer Auftrag vom Hofe erreicht?«
Der Meister schwieg mit eisiger Miene.
»Nun ja, mein lieber Drentwett. Ich für meinen Teil wäre ja schon zufrieden, wenn die hier herumstehenden Waren alle die Stadtbeschaumarke tragen würden.«
»Mein Geselle hätte die Werke morgen auf das Beschauamt gebracht, um den Pyr aufstempeln zu lassen. Der Händler für die Frankfurter Messe kommt erst in drei Tagen.«
»So, so, morgen hätte er es gebracht.«
»Lasst Euren Argwohn sein. Das Jahr ist schließlich erst 28 Tage alt. Außerdem weist mein Gold wie vorgeschrieben einen Feingehalt von 18 Karat auf. Gemäß der Verordnung habe ich dem reinen 24-karätigen Gold also lediglich sechs Teile Kupfer hinzugefügt, um den gewünschten Härtegrad zu erzielen. Ebenso hat mein Silber wie gefordert 13 Lot, kein Gran weniger! Ich habe es nicht nötig, mein Material mit Messing oder Zinn zu strecken und geringlötig zu arbeiten!«
»Ach, demzufolge steht es mit Eurem Verdienst recht gut? Gratulation. So darf ich Euch an die vierteljährliche Kollekte zur Unterstützung mittelloser Meister erinnern? Gerne dürft Ihr mir Euren Pflichtbeitrag sogleich entrichten.«
»Nun, so viel Geld habe ich gerade nicht im Haus.«
»Ach?« Mit hochgezogenen Augenbrauen steckte Biller seine Feder wieder in die Rocktasche. Er ging weiter um den Tisch in der Mitte des Zimmers, am Amboss vorbei und spielte an der Ziehbank mit dem Rad zum Aufwickeln des Drahtes. Danach wandte er sich scheinbar gelassen der gemauerten Feuerstelle zu. Die kümmerlichen Flammen nagten an den letzten Kohlen, die noch nicht zu Asche zerfallen waren.
Als habe er nichts Besseres zu tun, nahm Biller den kleinen Blasebalg von der Wand und versetzte der Glut noch ein paar Luftstöße. Unter gebrechlichem Knistern bäumten sich die Flammen ein letztes Mal auf. Zufrieden setzte der Geschaumeister seinen Rundgang fort. Wie durch ein Wunder hatte er die Schmelztiegel neben dem Feuer außer Acht gelassen.
»Ich würde mir gerne Eure Materialvorräte besehen. Würdet Ihr mir bitte den Schrank aufschließen, Drentwett?«
Glücklicherweise lagerten die kaiserlichen Vorräte unter dem Dielenboden versteckt, doch wie sollte der Meister diesem Biller plausibel erklären, warum Friederike, seine Frau, den Schrankschlüssel für die Vorräte verwaltete? Etwa, weil er den Schlüssel nicht mehr selbst ins Schloss führen konnte? Juliane wurde es heiß und kalt.
Auch der Meister wand sich zusehends. »Ich habe den Schlüssel verlegt.«
Biller lächelte. »Wie leichtsinnig. Sodann solltet Ihr ihn suchen, sonst macht Ihr Euch verdächtig, findet Ihr nicht? Schließlich habe ich das Recht und die Pflicht, alles zu kontrollieren. Alles.« Biller schaute sich um, und sein Blick blieb erneut an der Küchentür haften.
Für einen Moment glaubte Juliane, der einäugige Geschaumeister könne in sie hineinschauen. Seine gelbliche Pupille war starr auf sie gerichtet.
»Ich habe den Schlüssel.« Friederike stellte sich vor Biller, sah ihn aber nicht an.
»Oh, Ihr habt aber sehr viel Vertrauen in Eure Frau, Drentwett. Bemerkenswert.«
Friederike ging auf den bemalten Schrank zu, den das Konterfei des Meisters zierte. Er hielt eine Goldwaage in der Hand, um ihn herum waren einige seiner Werke dargestellt, darunter ein mannshoher Leuchter, ein silberner Tisch mit Stuhl sowie einige prachtvoll verzierte Goldgefäße. Im Hintergrund erhoben sich schemenhaft zwei Burgen und ein Königsschloss, auf das der Meister mit der anderen Hand deutete. Es war sein Ziel, der einzige Sinn seines Daseins, eines Tages zu Reichtum und höchstem Ansehen zu gelangen.
Als die Meistersfrau die weiten Flügeltüren des Schranks öffnete, schimmerten nur ein paar wertlos gewordene Münzen und ein wenig Bruchsilber matt aus der Dunkelheit hervor.
»Mhm«, machte der Geschaumeister. »Fast keine Vorräte mehr. Merkwürdig. Habt Ihr noch etwas auf der Schmelze, Drentwett?«
Juliane hielt den Atem an, als Biller sich zum zweiten Mal der Feuerstelle zuwandte. Der Geschaumeister nahm alle Tiegel in die Hand und prüfte deren Inhalt. Beim vorletzten stutzte er. Juliane wusste, was er entdeckt hatte.
Stirnrunzelnd fischte Biller ihr misslungenes Meisterstück wie ein Haar aus der Suppe. Mit spitzen Fingern untersuchte er das Corpus Delicti, und ein gefährliches Lächeln breitete sich auf seinem Gesicht aus. »Eine interessante Kreation, Meister Drentwett. Eine neue Mode aus Frankreich?«
Juliane hielt sich die Hand vor den Mund, ließ sich zu Boden sinken und schloss die Augen.
Philipp Drentwett versuchte den Geschaumeister zu fixieren. Er bewegte die Augen hin und her, um diesem verdammten dunklen Fleck auszuweichen. Es war, als ob ihn eine Stichflamme geblendet hätte, doch es war über Nacht gekommen und wurde mit jedem Tag schlimmer. Er sah nur noch einen großen Kreis, in dem sich das Nichts befand. Als würde er sich die Fingerspitzen zu dicht vor die Augen halten. Am Rande dieses Nichts erkannte er noch unscharfe Bruchstücke seiner Umgebung, aber sobald er seinen Blick darauf richtete, war da wieder dieser dunkle Fleck. Darin löste sich die Person auf, die er ansehen wollte, der Gegenstand, an dem er arbeitete, der Becher, aus dem er trank, und die Tür, die er öffnen wollte. Er konnte nicht einmal davonlaufen. Selbst wenn er bis auf die Straße käme – keine drei Schritte, und er würde der Länge nach auf diesen gottverdammten Erdboden donnern. Dort könnte er dann mit ansehen, nein, nicht einmal mehr das, er müsste tatenlos dasitzen und erleben, wie alles, was er sich aufgebaut hatte, langsam um ihn herum zusammenbrach. Zuerst würden die Aufträge ausbleiben, dann würde sein Weib ihn verlassen wollen, schließlich müsste man ihm wegen seiner schlechten Arbeit die Meistergerechtigkeit nehmen, und er fände sich in der Gosse wieder. Doch so weit würde er es nicht kommen lassen. Seine letzte Hoffnung war der kaiserliche Auftrag. Sein Meisterzeichen sollte die Krone zieren und ihn für die Nachwelt unsterblich machen. Allerdings musste jemand an seiner Stelle die Hauskrone für den künftigen Kaiser fertigen, er bräuchte einen fähigen Gesellen, der ihm seinen Lebenstraum verwirklichte – keine Goldschmiedsmagd. Und diesen Gesellen würde er bekommen.
»Meister Drentwett? Wollt Ihr mir nicht antworten?«
Er neigte den Kopf, um Billers schemenhafte Gestalt im Augenwinkel einzufangen. Es machte ihn fast wahnsinnig, dessen Gesichtsausdruck nicht erkennen zu können, ihn nicht mehr einschätzen zu können. Biller hatte sich in einen verschwommenen Schatten verwandelt. Aus der weißen Perücke war ein heller Fleck geworden, irgendwo dort war sein Gesicht. Und das schwarze Tuch, das langsam auf ihn zukam, war Billers Körper. Philipp Drentwett wich einen Schritt zurück.
Er spürte die Hand seiner Frau am Arm. »Ist dir nicht gut? Du bist so bleich! Willst du dich nicht besser hinlegen?«
»Ich kann mir gut vorstellen, warum Euer Mann plötzlich unpässlich ist, gnädige Frau. Er ahnt schon, was passieren wird. Ich habe nämlich allen Grund anzunehmen, dass es in dieser Werkstatt schlimmer zugeht als dereinst im Haus des biblischen Zöllners! Ich muss mich doch sehr wundern, wie Ihr zu diesem Mann stehen könnt.«
Philipp Drentwett hörte, wie sein Weib tief Luft holte. »Allerdings waren unserem Herrn Jesus die Zöllner allemal lieber als die Pharisäer, die sich für etwas Besseres hielten!«
Mit einem Schlag herrschte Stille in der Werkstatt. Warum lernten die Weiber nicht endlich, ihr Maul zu halten!
»Verzeihung, werter Geschaumeister Biller.« Seine Stimme bebte. »Mein Weib weiß nicht, wovon es spricht. Nehmt seine Ausdünstungen nicht weiter zur Kenntnis.«
»Immerhin hat sie die Bibel gelesen, ganz im Gegensatz zu Euch.«
»Seid Ihr gekommen, um Euch mit mir über meinen Glauben zu unterhalten? Meine Zeit ist leider äußerst knapp bemessen. Da mit meinem Gold und Silber alles in Ordnung ist, dürfte ich Euch nun bitten zu gehen.«
»Ach? Und woher seid Ihr Euch so sicher, dass das Material den geforderten Feingehalt aufweist? Hat es der Händler auf die Probe gebracht, bevor er es an Euch auslieferte?«
»Nein«, gab Philipp Drentwett zu.
»Ihr habt die Ware also ohne Probzettel angenommen? Und was war der Grund für diesen Leichtsinn, wenn ich fragen darf? Gesetzt den Fall, der Händler hat geringlötiges Silber gekauft, damit ihm mehr Geld für seine eigene Tasche bleibt, und er übergibt Euch das verbotene Material zur Verarbeitung. Woher soll ich wissen, dass Ihr mit dem Händler nicht unter einer Decke steckt?«
»Weil Ihr gar nichts wisst! Das Material ist einwandfrei!«
»Ein Händler macht Geschäfte. Gute Geschäfte. Besonders, wenn er billiges, verbotenes Material einkauft und die Ware alsdann teuer verkauft. Dazu braucht es nur ein paar Menschen in seiner Umgebung, die für ein paar Münzen die Augen geschlossen halten. Und so ein paar zusätzliche Gulden sind schließlich nicht zu verachten, nicht wahr, mein lieber Drentwett? Oder kann ich etwa Eure Schulden beim Metzger, beim Weinhändler und beim Köhler aus meinem Berichtsheft streichen?«
»Darüber bin ich Euch keine Rechenschaft schuldig! Und was Eure wahren Amtspflichten betrifft, so werdet Ihr nichts Verdächtiges bei mir finden.«
»Sodann dürfte es Euch ja nicht stören, wenn ich dieses … nun ja, sagen wir, seltene Stück zur Prüfung mit auf das Beschauamt nehme?«
»Tut, was Ihr nicht lassen könnt. Ich habe ohnehin keine Wahl. Ihr seid der Geschaumeister. Ihr habt das Recht, alles zu überprüfen, und meinetwegen könnt Ihr meine ganze Werkstatt auf den Karren laden und in Euer Spitzelnest überführen! Ihr werdet nichts finden!«
Er hörte, wie Biller durch den Raum ging, und versuchte dem dumpfen, schlurfenden Geräusch mit seinem Blick zu folgen. Sein Gefühl sagte ihm, dass der Geschaumeister zur Tür gegangen sein musste, doch als er sich dorthin wandte, wurde er von seiner Frau sanft in die Gegenrichtung geschoben. Er schüttelte ihre Hand ab, als wäre er in Dornengestrüpp geraten. Er wollte Biller ohne ihre Hilfe finden. Wenigstens das wollte er alleine können.
Das trockene Knirschen von Schuhleder verriet den Geschaumeister vor dem Werktisch. Ein länglicher Schatten streckte sich zur Decke, dorthin, wo das Brett mit den Waren hing.
»Ich nehme noch den goldenen Leuchter zur Überprüfung mit, mein lieber Drentwett. Hm, sieht ein bisschen aus wie der Schiefe Turm zu Pisa, meint Ihr nicht auch? Wenn Ihr noch einen Unterteller für das tropfende Wachs beigebt, so wird man sich auf der Messe bestimmt darum reißen.«
»Wir werden ja erleben, wer von uns beiden bald mehr Münzen in der Truhe hat!«
»So?«, fragte Biller gedehnt. »Ihr meint wohl, wenn Ihr Euren Prägestock zweckentfremdet? Da hättet Ihr aber nicht lange Freude an Eurem Reichtum. Ihr wärt nicht der erste Goldschmied, der wegen Falschmünzerei am Galgen aufgeknüpft wird.«
»Und Ihr wisst hoffentlich, wie man mit Verleumdern umzugehen pflegt?«
»Ich kläre Euch lediglich über Gesetz und Strafe auf. Insbesondere darüber, dass ich diese beiden sonderbaren Werkstücke konfisziere. Die Ware wird am morgigen Tag vor Zeugen geprüft und im Zweifelsfall eingeschmolzen. Über die weiteren Konsequenzen, bis hin zum Entzug der Meistergerechtigkeit, dürftet Ihr Euch im Klaren sein. Ich erwarte Euch also morgen zur neunten Stunde auf dem Beschauamt. Einen schönen Tag noch.«
Seine Frau eilte zur Tür, um den Schatten mit dem weißen Perückenfleck hinauszulassen.
»Ach, da fällt mir noch ein, Drentwett: Falls ich morgen keine Gnade mit Euch kennen sollte, so wundert Euch nicht. Das ist erst der Anfang. Wir sind noch nicht fertig miteinander. Und der Tag der Abrechnung wird kommen, das verspreche ich Euch. Und noch etwas: Ihr solltet die Leute ansehen, mit denen Ihr sprecht. Euer ausweichender Blick wirft ein schlechtes Licht auf Euch.«
Juliane hastete die Stiege hinauf und beobachtete vom Kammerfenster aus, wie Friederike den Geschaumeister bis zum Hoftor begleitete und ihn so freundlich wie möglich verabschiedete. Er legte ein breites Grinsen auf, verbeugte sich und ging dann hinaus.
Friederike lehnte sich schwer atmend gegen die mannshohe Mauer und schaute ihm nach, wie er im Gegenlicht der Wintersonne die Pfladergasse hinunterging. Die orangegelb leuchtenden Dachfirste der Häuser berührten sich fast über ihm, sie beugten sich über den engen Weg, als wollten sie die Passanten beobachten, die dort entlanggingen.
Juliane überlegte für einen Moment, die Goldschmiede über die schmale hölzerne Außentreppe zu verlassen, die sich von der Hofseite her an das Haus schmiegte, doch sie traute sich nicht. Zurück in die Werkstatt wollte sie aber auch nicht gehen. Solange der Meister nicht nach ihr rief, würde sie in der Kammer ausharren. Friederike hingegen ging kurz zurück in die Werkstatt, um dann den Hof zu verlassen und in Richtung Marktplatz zu verschwinden.
Juliane wandte sich vom Fenster ab, und mit einem Seitenblick auf die Tür holte sie das Krümelsilber aus der Schürze. Sie barg es unentschlossen in der Hand. Sollte sie das Silber verstecken? Sie wusste, dass es falsch war, aber sie tat es dennoch. Vielleicht war es Trotz, eine kleine Rebellion gegen den Meister, vielleicht aber auch der schlichte Wunsch, etwas zu besitzen. Etwas zu haben, das man ihr verweigerte. Und da man Liebe bekanntlich nicht stehlen konnte, wollte sie wenigstens dieses Krümelsilber behalten. Sie wickelte die Körner in ein Taschentuch, verknotete es und vergrub das Bündel unter dem Kissen. Danach setzte sie sich aufs Bett und horchte in die Werkstatt hinunter. Es war still.
Sie zog die großformatige Bibel ihres Vaters aus dem Nachtkasten hervor und zündete eine Kerze an. Das in schwarzes Leder gebundene Buch wog schwer auf ihren Knien. Einige der dicken Seiten waren bereits lose oder leicht eingerissen, doch das störte sie nicht. Im Gegenteil. Es waren die Seiten, die ihr Vater besonders gerne gelesen hatte. Die Erinnerung an ihn schmerzte und war doch gleichzeitig von schönen Gefühlen durchwoben.
Jedes Kapitel begann mit einem farbig verzierten Buchstaben, und immer wieder stieß sie auf Seiten mit Holzschnitten, Kompositionen aus schwarzen und weißen Linien, die sich wie durch ein Wunder zu einem Bild fügten. Sie blätterte und vertiefte sich schließlich in das Kapitel über den Einzug Jesu in Jerusalem.
Plötzlich hörte sie in der Werkstatt Stimmen. Juliane sah auf. Sprach dort unten ein Mann oder eine Frau? Sie schlug die Bibel zu und schlich aus der Kammer zum schmalen Treppenabsatz, der in die Küche hinunterführte.
Es war Friederike. Sie stellte gerade ihren Marktkorb auf den Küchentisch. Er war leer.
»Wo warst du, Weib?«
Friederike füllte einen Eimer mit Wasser und ging mit Bürste und Lappen bewaffnet zurück in die Werkstatt. »Auf dem Markt, aber bei keinem der Händler durfte ich mehr anschreiben lassen.«
Nach kurzer Überlegung trat Juliane leise die Stiege hinunter und stellte sich wieder hinter die offene Küchentür, um durch den Spalt in die Werkstatt zu sehen.
Friederike bearbeitete die Werkstatttür mit der Bürste und wandte ihrem Mann den Rücken zu.
»Was hat er noch gesagt?«
»Wer?«
»Wer wohl? Biller natürlich!«
»Nichts mehr.« Friederike ging weiter zur Feuerstelle. »Wir brauchen dringend Geld, sonst verhungern wir.« Sie wischte mit dem Lappen über die Tiegel und schließlich über den Schemel, auf dem Biller gesessen hatte.
»Hat er dir gedroht, oder war er freundlich?«
»Beim Metzger am Jakobertor könnte ich vielleicht noch fragen.« Friederike kniete sich auf den Boden und arbeitete sich mit der Bürste zur Tür vor.
»Hör endlich auf mit dieser verdammten Putzerei. Was bist du nur für ein Weib? Sobald du dich morgens gewaschen hast, putzt du, und wenn du geputzt hast, dann wäschst du dich. Bald hast du keine Haut mehr auf dem Leib, und die Dielenbretter haben sich aufgelöst!«
»Lass mich!«
»Sag mir, was ich gegen Biller tun kann, verdammt noch mal!«
Friederike richtete sich auf. »Nichts. Vermutlich.«
Meister Drentwett schaute sich um. »Blümlein? Bist du in der Küche? Die Stiege hat doch vorhin geknarrt, ich habe es gehört. Komm her!«
Schamesröte stieg ihr ins Gesicht. Unsicher, als ginge sie über Ackerschollen, betrat Juliane mit wackligen Knien die Werkstatt.
»Und?«, fragte er mit scharfem Unterton. »Was sagst du?«
Unschlüssig schaute Juliane zwischen Friederike und ihrem Meister hin und her. Noch bevor sie antworten konnte, schlug der Goldschmied mit der Faust auf den Tisch.
»Ihr Weiber seid doch zu nichts zu gebrauchen. Die Männer ins Verderben reißen, mehr könnt ihr nicht! Was glaubt ihr denn, was morgen auf dem Beschauamt los sein wird?«
»Es wird schon nicht so schlimm werden«, wandte Juliane vorsichtig ein.
»Nicht so schlimm?«, donnerte der Goldschmied »Ich stehe am Abgrund und soll die Aussicht bewundern? Was hat Biller überhaupt in dem Schmelztiegel gefunden? Rede!«
»Es war der Buchbeschlag für die Hausbibel des …«
»Was in drei Teufels Namen hatte das Stück auf der Schmelze zu suchen?«
»Es ist mir … misslungen. Beim Löten. Letzte Nacht. Es ist zu heiß geworden.«
»Da sieht man es wieder! Ein Weib sollte kein Werkzeug in die Hand nehmen. Dafür ist euer schwaches, von Gefühlen durchweichtes Hirn einfach nicht geschaffen! Ihr werdet mich morgen beide auf das Beschauamt begleiten, Juliane wird ihren Ungehorsam erklären und ihre Strafe für die nächtliche Arbeit bekommen! Vielleicht bin ich sie dann sogar los und kann mir endlich einen Gesellen leisten.«
»Das stellst du dir vielleicht so vor!«, ergriff Friederike mit bebender Stimme das Wort. »Biller wird dein Material trotzdem konfiszieren. Oder willst du ihn glauben machen, deine Magd hätte freiwillig mehr gearbeitet? Ohne dein Wissen? Noch dazu eine Arbeit, die ihr als Frau verboten ist?«
Der Meister schwieg.
»Außerdem erwartet er einen Gesellen an deiner Seite!«
»Den werde ich bis morgen früh auch haben, nur keine Sorge! Und jetzt verschwindet! Alle beide! Ich will euch heute nicht mehr sehen!«
Sehen, dachte Juliane bitter, als sie die Tür hinter sich zuschlug und die Pfladergasse hinauf in Richtung Barfüßerkirche rannte. Die Kälte drängte sich unter ihren Rock, der eisige Wind schnitt ihr ins Gesicht und trieb ihr die Tränen in die Augen. Trotzdem hörte sie nicht auf zu laufen, bis sie vor dem schmalen Haus stand, das sich im Schatten der Kirche duckte. Hier wohnte der alte Goldschmied Jakob. Juliane legte den Kopf in den Nacken und schaute an dem bauchigen Kirchenschiff hinauf zur kleinen Kuppel des Glockenturmes. Er saß wie ein zu groß geratener Hut auf dem Kirchendach, überhaupt wirkte das Gebäude wie ein einfaches Haus, das man in die Länge und in die Höhe gezogen hatte. Jede Strebe, jedes Fensterglas, selbst das fleckige Mauerwerk, von dunkelgrün über ockergelb bis hin zu schießpulverschwarz, kannte sie in- und auswendig. Oft genug hatte sie im gegenüberliegenden Pfarrhaus hinter ihrem Kammerfenster gestanden und abwechselnd die Wirkungsstätte ihres Vaters und das Kommen und Gehen in Jakobs kleiner Goldschmiede beobachtet.
Juliane drehte sich langsam um. In ihr altes Zuhause war bereits der neue Pfarrer eingezogen. An der Fassade hatte sich nichts verändert, sie sah aus wie immer, und trotzdem war ihr alles fremd geworden. Unwirklich. Hier hatte sie also noch bis vor Kurzem mit ihrem Vater gelebt. Aufgewachsen war sie in einem kleinen Dorf vor den Toren der Stadt, obwohl sie in Augsburg, der Heimat der Familie, geboren worden war. Kurz nach ihrem vierzehnten Geburtstag starb ihre Mutter an Typhus, und sie zogen zurück in die Stadt. Der Umzug war furchtbar gewesen. Juliane konnte sich noch gut an den Tag erinnern. Sie hatte nicht aus ihrem Dorf weggewollt, nicht fort von ihren Freunden, besonders nicht von Mathias. Er war als Findelkind bei ihrem Vater abgegeben worden, sie waren zusammen aufgewachsen, hatten Streifzüge in die Umgebung unternommen, gemeinsam die Welt entdeckt. Mathias hatte zurückbleiben müssen, weil er alt genug geworden war, um im Dorf eine Lehre bei einem Kaufmann anzufangen, und somit nicht mehr der Fürsorge des Pfarrers bedurfte. Stumm hatte Mathias beim Beladen des Fuhrwerks geholfen, und Juliane erinnerte sich genau, wie er unsicher nach ihrer Hand gefasst und gesagt hatte: »Wir sehen uns bestimmt bald wieder.« Obwohl er nur ein Jahr älter war als sie, hatte er sich schon immer reifer verhalten als seine Altersgenossen. Und das hatte sie an ihm gemocht.
Bei dem Gedanken an ihn krampfte sich etwas in ihrer Brust zusammen. Vielleicht war es ihr Herz, auf jeden Fall aber der Ort, wo all jene Menschen und Dinge eine Heimat gefunden hatten, die sie vermisste. Das galt besonders für die Zeit mit Mathias.
In Augsburg war der alte Goldschmied Jakob ihr Trost geworden. Sobald sie daheim ihre Aufgaben erledigt hatte, war sie zu ihm in die Goldschmiede gegangen. Stundenlang hatte sie mit angezogenen Beinen auf einem Stuhl gehockt und ihm über den Rand ihrer Knie zugesehen, jeden seiner Handgriffe verfolgt. Bald durfte sie kleinere Aufgaben übernehmen, er lehrte sie die Grundlagen der Goldschmiedekunst, und sie revanchierte sich, indem sie ihm die Werkstatt sauber hielt und manchmal für ihn kochte. Ihr Vater hatte die Besuche bei dem alten Goldschmiedemeister nicht nur geduldet, sondern diese sogar gefördert und mit seinem Testament dafür Sorge getragen, dass sie nach seinem Tod als Goldschmiedsmagd bei Meister Drentwett eingestellt wurde. Ausgerechnet Meister Drentwett. Aber ihr Vater hatte es gut gemeint.
Juliane wandte sich dem Werkstattfenster zu, mit einem Seufzer vertrieb sie ihre Erinnerungen und klopfte an. Sie hörte Jakobs schlurfende Schritte. Als er die Tür öffnete, war sie in die Gegenwart zurückgekehrt.
Ein Lächeln stand in Jakobs hellblauen wässrigen Augen, eingerahmt von schneeweißen buschigen Brauen. Auch seine langen Haare waren weiß, mit einem leichten Stich ins Gelbliche. Niemand kannte sein genaues Alter, auch er selbst nicht. Im Kirchenbuch hatte sich nie ein Taufeintrag gefunden, und der alte Jakob war mittlerweile der Meinung, Gott habe ihn darum auf Erden vergessen.
»Juliane! Mein Mädchen! Schön, dass du kommst! Ich dachte schon, du hättest den alten Jakob vergessen.«
»Natürlich nicht! Verzeiht, Meister Jakob, dass ich so lange nicht mehr bei Euch war, aber …«
»Dafür freut's mich nun umso mehr! Nun komm erst mal herein. Und lass endlich den ollen Meister weg. Bin's nicht mehr wert, dass man mich so nennt.«
»Doch. Schließlich arbeitet Ihr immer noch, trotz Eurer Gicht.«
»Ach, die paar Broschen, Marienmedaillen und Kruzifixe, die noch von zwei, drei alten, betuchten Damen bei mir in Auftrag gegeben werden. Aber du hast recht, ohne Arbeit kann ich nicht sein. Und solange ich noch alle fünf Sinne beieinander habe …«
Im Gegensatz zu Meister Drentwett, hätte sie beinahe gesagt, doch stattdessen fragte sie: »War der Geschaumeister heute auch bei Euch?«
»Gewiss.«
»Aber er konnte nichts bei Euch beanstanden, oder?«
»Ach, mach dir um einen alten Mann wie mich keine Sorgen, Kind. Der Tod stand schon genauso oft mit begehrlichem Blick auf meiner Türschwelle wie dieser scheinheilige Teufel Biller. Und doch sind beide wieder gegangen. So, wie alle fortgehen.«
Juliane senkte den Kopf. »Es tut mir leid, ich wäre gerne bei Euch geblieben, aber mein Vater meinte wohl, es wäre besser …«
»Du musst dich nicht grämen! Du hast dein Leben noch vor dir. Ich bin sehr froh und stolz, dass du eine Goldschmiedsmagd bei Meister Drentwett geworden bist.«
»Und ich dachte, Ihr hegt vielleicht einen Zorn gegen mich, weil ich nicht mehr so oft zu Euch kommen kann, seit ich dort bin.«
»Unsinn!« Seine Stimme schwankte zwischen Überzeugung und Enttäuschung. »Erzähl mir lieber, wie ergeht es dir bei dem anderen Meister?«
Es war Abend geworden, als Juliane das Haus des alten Goldschmieds Jakob verließ. Nach und nach hatte sie ihm erzählt, was sie bedrückte. Von der nachlassenden Sehkraft ihres Meisters, von dem missglückten Buchbeschlag, von Biller, dem Termin auf dem Beschauamt und schließlich von der Hauskrone, die in zwei Wochen fertig sein sollte. Jakob hatte nicht schlecht gestaunt, aber Juliane wusste, dass das Geheimnis bei ihm gut aufgehoben war. Vielmehr nagte das schlechte Gewissen an ihr, weil Jakob ihr seine Hilfe angeboten hatte. Sie dürfe jederzeit kommen, falls sie es bei den Drentwetts nicht mehr aushalten könne oder einen Rat bräuchte.
Juliane atmete tief durch und bog in die Hauptstraße ein. Sogleich stieg ihr der Geruch von frisch gebratenem Fleisch in die Nase. Ihr Magen reagierte mit einem heißen, schmerzhaften Knurren. Mit dem Wind wehten auch die Geräusche aus dem Gasthof Zu den drei Mohren zu ihr herüber. Die Zecher lärmten, Krüge schlugen dumpf gegeneinander, und plötzlich brandete Applaus auf. Jubelnde Zurufe, trampelnde Füße.
Juliane näherte sich dem Gasthaus, von dessen stuckverzierter Fassade die drei steinernen Mohrenbüsten herunterschauten. Daneben schwebte ein vergoldetes Schild an einer eisernen Angel über der Straße, um Gäste werbend. Auch sonst tat der Wirt alles, um den großen Schankraum bis auf den letzten Stehplatz zu füllen. Heute war es bestimmt wieder ein Theaterstück, das nur vordergründig von erbaulichem Inhalt war. Alle Ratsherren, die sich deshalb zu einer Beschwerde veranlasst sehen könnten, bekamen wie immer einen Platz in der ersten Reihe und ein paar Gulden aus den üppigen Einnahmen.
Selten jedoch hatte Juliane die Leute derart begeistert erlebt. Vorsichtig trat sie an eines der vielen Fenster nahe der Tür und stellte sich an dem kalten Steinsims auf die Zehenspitzen. Durch die verrauchte, graue Luft hindurch sah sie am anderen Ende des Raumes einen Zauberer auf der Bühne stehen, nicht viel älter als sie selbst. Seine Hosen hatten Löcher, die Kniestrümpfe waren geflickt, und sein dunkelgrüner Rock hing ihm weit wie einer Vogelscheuche am Körper. Das Publikum näherte sich ihm wie eine Rabenschar und suchte mit Schrecken und Erstaunen erfüllt sein Geheimnis zu ergründen. Als er ankündigte, das Papier in seinen Händen in einen Feuerball verwandeln zu wollen, wichen einige zurück. Ein Mann jedoch schrie, das sei mit einem Brennglas keine Kunst, und ein anderer hob grölend seine Tabakspfeife in die Luft.
Der Zauberer brachte das Publikum mit einem kaum sichtbaren Lächeln zum Schweigen, es umspielte seine Grübchen und wanderte über das kantige Gesicht hinauf zu den Augen, wo es sich in kleine Fältchen auffächerte.
Er nahm das Papier und zeigte es in die Runde. Die Leute nickten und schauten einander nach Sicherheit suchend an. Der Zauberer deutete auf seine Zunge und benetzte das Papier. Beschwörend rieb er es zwischen den Fingern, und im nächsten Moment fiel es lichterloh brennend zu Boden. Ein Raunen wanderte durch den Saal und mündete in tosendem Applaus. Der Zauberer verbeugte sich mehrmals, ein paar Strähnen lösten sich aus seinem Zopf und fielen ihm ins Gesicht. Er warf der kellnernden Magd eine Kusshand zu, nach einer weiteren Verbeugung sprang er vom Rand der Bühne und ließ sich von der Menge feiern. Juliane beobachtete die Magd, wie sie verzückt mit hochrotem Kopf stehen blieb, unbeweglich mit Tellern und Krügen in den Händen, und versuchte, den Augenblick des Kusses festzuhalten. Wie kindisch. Wie konnte man sich von einem wildfremden Menschen nur so faszinieren lassen?
Einige Augenblicke später wurde ihr bewusst, dass sie selbst wie gebannt am kalten Fenstersims hing. Es wäre wohl angebracht, wenn sie sich jetzt auf dem schnellsten Weg zurück in die Goldschmiede begeben würde.
Unvermittelt ging neben ihr die Tür auf.
»Guten Abend. Ganz schön stickig die Luft da drinnen.«
Blitzschnell wandte sie sich vom Fenster ab und trat einen Schritt zurück. Der Zauberer. Schamgefühl breitete sich mit einem heißen Schwall in ihrem Gesicht aus.
»Ich bin Raphael Ankler.«
Sie erwiderte nichts. Er war zwar ein Zauberer, aber auch die kochten nur mit Wasser.
»Wie ist Euer Name, wertes Fräulein?«
»Ich wüsste nicht, was Euch das angeht.«
»Verzeihung.« Er lächelte. »Hat Euch die Vorstellung gefallen?«
»Es ging so. Ich habe nicht viel davon mitbekommen.«
Sein Lächeln wurde breiter. »Kein Wunder von diesem Fensterplatz aus.«
»Ich war nicht Euretwegen hier. Ich bin auf dem Weg nach Hause.«
»Darf ich Euch begleiten?«
»Danke, ich finde selbst nach Hause.«
»Arbeitet Ihr als Bauernmagd und habt Ausgang bekommen?«
»Ich bestimme meinen Ausgang selbst. Abgesehen davon arbeite ich bei dem berühmtesten Goldschmied Augsburgs.« Hoffentlich genügte das, um ihm Respekt einzuflößen und das Gespräch zu beenden.
»Oh. Sodann seid Ihr Juliane, die Goldschmiedsmagd des Meisters Drentwett?«
Ihr blieb vor Überraschung die Erwiderung im Hals stecken.
Der Zauberer zog zwei Münzen aus der Tasche seines übergroßen Rocks und legte die goldene in die linke, den Silberling in die rechte Handfläche. »Goldschmiedsmagd bei Meister Drentwett«, wiederholte er. »Bestimmt keine leichte Aufgabe.« Er schloss die Finger um die Münzen und streckte die Arme zur Seite aus. Seine Augen suchten ihren Blick und hielten ihn fest. Nach geraumer Zeit zog er die Arme wieder an sich und öffnete die Fäuste. Die Geldstücke hatten die Plätze getauscht. Der Silberling lag jetzt in der linken, die Goldmünze glänzte in der rechten Hand. »Vor allem weiß man nie, woran man ist«, sagte er sanft. »Gute Nacht, Juliane.«
Bevor sie etwas erwidern konnte, drehte Raphael sich um und ging davon.
Die Begegnung mit dem Zauberer hielt Juliane gefangen, während sie am Stadtfluss entlang nach Hause ging. Warum hatte er ihr dieses Kunststück gezeigt? Und wie hatte er das gemacht? Wahrscheinlich hatte er die Münzen irgendwie vertauscht oder aus dem Ärmel gleiten lassen. Bestimmt nur ein billiges Kunststück, nichts weiter. Hauptsache, er konnte die Leute damit beeindrucken.
Trotzdem ging ihr der Mann nicht aus dem Sinn. Wie sie zurück zur Drentwett'schen Goldschmiede gelangt war, konnte sie sich nicht erinnern. Plötzlich stand sie vor der Tür.
Juliane betrat die dunkle Werkstatt. Es war still im Haus. Friederike und Meister Drentwett lagen wohl schon oben in ihren Kammern. Der Rauch des Feuers hing noch immer beißend in der Luft. Sie entzündete eine Öllampe, ging wie gewohnt zu der leeren Truhe in der Ecke und schob sie beiseite, um unter der Bodenluke nach den kostbaren Materialvorräten für den kaiserlichen Auftrag zu sehen. Silber im Wert von einigen Zehntausend Gulden schimmerte ihr entgegen. Wieder beschlich sie ein ungutes Gefühl. Sie kniete sich an den Rand der Luke, angelte sich etwas von dem Bruchsilber und hielt es vor die Öllampe, drehte es und suchte nach einem Hauch von Rot, der auf zu viel Kupfer hindeuten könnte. Hatte das Silber ihres Buchbeschlags nur den Schein des Feuers widergespiegelt? Was würde die Probe morgen ergeben? Ihre Faust schloss sich um das Silberstück, bis ihr Arm zitterte. Raphaels Worte gingen ihr durch den Kopf. Man weiß nie, woran man ist.
Zögerlich setzte sie sich an den Werktisch und griff nach dem Musterbuch für den kaiserlichen Auftrag. Das Licht der Öllampe erhellte die Zeichnung für den Buchbeschlag. Es grenzte an ein Wunder, dass ihr die Filigranarbeit gelungen war, doch das Löten war zu kompliziert. Juliane blätterte weiter. Niemals würde sie den Auftrag erfüllen können. Eine Vorlage für silberne Tafelbecher, getrieben und punziert, unzählige Winkel und Maßangaben, um die Kronenplatten akkurat auszusägen und zurechtzufeilen, verzierende Reliefdarstellungen, die sie nicht einmal auf dem Papier zuwege bringen würde, und zu guter Letzt noch die Vergoldung der Krone und das Einfassen der Juwelen und Perlen. Juliane schlug das Buch zu und löschte die Öllampe. In der Küche hing noch die Wärme des Tages, und Juliane überlegte, ob sie sich zum Schlafen auf die Bank neben dem Herdfeuer legen sollte, aber dann ging sie doch die Stiege hinauf zur Kammer. Leise betrat Juliane ihr Zimmer.
Sofort erklang Friederikes Murmeln: »Ach mein Junge, was muss ich noch aushalten? Nur du weißt, wie schwer das alles für mich ist, du siehst, wie ich Tag für Tag unter ihm leiden muss.«
Juliane räusperte sich. Friederike verstummte, setzte sich auf und zog die Bettdecke bis über ihre Schultern. Im Mondschein sah sie aus wie ein Gespenst
»Guten Abend, Juliane. Wo bist du so lange gewesen?«
»Bei Meister Jakob.«
»Wie geht es ihm?«, fragte Friederike geistesabwesend.
»Soweit gut«, gab Juliane unsicher zurück. »Und du, was ist mit dir? Ich habe gerade gehört, was …«
»Ach, ich bin erschöpft. Manchmal wird mir einfach alles zu viel. Aber das geht auch wieder vorüber. Nun bin ich seit dreißig Jahren verheiratet, und schwere Zeiten hat es immer wieder gegeben. Doch die Ehe ist etwas sehr Wichtiges. Nur der Tod darf scheiden, was der Herrgott zusammengefügt hat. Nicht der Mensch … und ich schon gar nicht. Ich bleibe bei ihm, egal, was geschieht.«
»Ja, wir müssen jetzt zusammenhalten. Der …« Sie senkte die Stimme. »Der Auftrag unseres künftigen Kaisers. Die Krone, das Silber für die Festtafel. Der Meister wird es nicht mehr alleine schaffen.«
»Der Meister, der Meister!« Friederike seufzte. »König Philipp ruft, und seine Untertanen gehorchen! Hoffentlich reicht meine Kraft, seine Wünsche zu erfüllen.«
»Bitte, Friederike. Mir ergeht es doch nicht besser. Der Meister lehrt mich nichts, und doch muss ich seit ein paar Tagen all die Arbeit für ihn tun. Dafür bekomme ich nicht einmal Anerkennung. Ich habe Tag und Nacht gearbeitet und höre keinen Dank von ihm. Denn in seinen Augen müsste ich das ja nicht tun. Schließlich will er nicht zugeben, dass er beinahe blind ist. Dafür war sein Zorn umso größer, als er von dem misslungenen Buchbeschlag erfuhr. Aber das Löten zeigt er mir ja nicht!«
»Gehst du morgen mit auf das Beschauamt?«
»Gewiss.« Juliane verzog den Mund zu einem Lächeln. »König Philipp hat es schließlich so befohlen.«
»Bald wird er dich genauso behandeln wie mich. Aber lass dir das nicht gefallen, hörst du? Wenn er nicht aufhört, musst du gehen. Ich bin seit dreißig Jahren für ihn da und habe nie ein Wort des Dankes von ihm gehört.« Friederike richtete ihren Blick in die Ferne. »Ach, aber ich darf mich nicht beschweren. Schließlich will ich ihm ein gutes Eheweib sein. Du darfst ihm keins meiner Worte verraten. Schwörst du mir das?«
»Natürlich.« Juliane hob die Hand. »Wir halten zusammen. Gemeinsam schaffen wir das.«
»Wenn du meinst? Schlaf jetzt, Juliane. Wir brauchen beide Kraft.«
»Friederike? Darf ich dich noch etwas fragen? Was hat Biller gemeint, als er sagte, er sei mit Meister Drentwett noch nicht fertig?«
»Ach das!« Friederike lachte trocken auf. »Das ist schon so lange her, und er hat es immer noch nicht verwunden.« Sie zuckte mit den Schultern. »Seinerzeit war ich Biller versprochen, wir waren allerdings nicht einmal verlobt. Er und seine Eltern hatten nur Interesse bekundet. Bald darauf habe ich Philipp kennengelernt, und er hat bei meinem Vater um meine Hand angehalten. Dann sind meine Eltern am Fieber gestorben, und die Meistergerechtigkeit meines Vaters ging auf mich über. Biller und Philipp waren zu dieser Zeit Gesellen und warteten darauf, zum Meisterstück zugelassen zu werden oder besser gesagt einen der sechs freien Plätze im Jahr zu ergattern. Bei über zweihundert hiesigen Goldschmieden und dementsprechend wohl ungefähr sechshundert Gesellen fast unmöglich. Wenn aber ein Geselle durch ein Eheversprechen eine Handwerksgerechtigkeit in Aussicht gestellt bekommt, wird er außerordentlich zum Meisterstück zugelassen. Schließlich will der Rat keine Werkstatt verwaist und keine Frau unverheiratet sehen. Ich wurde also plötzlich von beiden Männern mehr begehrt denn je zuvor. Nun ja. Ich habe Philipp Drentwett den Vorzug gegeben. So war das, und Biller plagt die Eifersucht wohl bis auf den heutigen Tag. Deshalb sein Ausspruch.« Friederike lächelte. »Das ist ein alter Hut. Denk dir nicht zu viel dabei und lass uns schlafen.«
Juliane nickte. Gerade als sie sich ausziehen wollte, hörte sie ein Geräusch auf dem Flur. Nur einen Augenblick später breitete sich die Gestalt des Meisters im Türrahmen aus. Er trug noch immer seinen Hausrock, die Knöpfe seiner Weste bildeten nun allerdings eine schnurgerade Linie wie Soldaten an der Front, die Perücke war frisiert und saß ordentlich auf seinem Kopf. Er musste den ganzen Abend dazu gebraucht haben.
»Blümlein? Friederike?«
»Ja?«, antworteten sie beide wie aus einem Mund.
»Gebt mir einen Stuhl, ich will mich setzen.«
Pflichtbewusst führte Friederike ihren Mann zwischen den Betten hindurch und half ihm, sich auf dem Schemel am Fenster niederzulassen.
»Was wünschst du?«, fragte Friederike höflich, aber ihr Unterton ließ keinen Zweifel daran, dass sie ihn nicht hereingebeten hatte.
»Ich habe nachgedacht.«
»Und?«, fragte Friederike.
»Wie gefällt euch der Name Julian?«
Juliane wurde es siedend heiß. Sie suchte Friederikes Blick.
»Was willst du damit sagen?«, hakte Friederike an ihrer Stelle nach.
»Dass ich dem Mädchen seinen größten Wunsch erfüllen werde. Sie wird mein Geselle. Sie wird für mich arbeiten und mich begleiten.«
Der Meistersfrau blieb vor Entsetzen der Mund offen stehen. »Das kannst du nicht machen! Wie willst du das den Leuten erklären? Das geht nicht! Hör auf mit dem Unsinn!«
»Julian ist mein Patenkind, er war Geselle bei einem meiner Brüder, nun kam er aus dem fernen München zu mir, besagter Bruder ist verstorben. Julian wird mir werktags zur Hand gehen, Juliane lässt sich falls nötig sonntags mit Haube und Kleid in der Barfüßerkirche sehen. Damit wäre auch für das Kirchgängervolk die Welt in Ordnung.«
»Das glaubst du! Wenn das auch nur einem Menschen in der Stadt auffällt, können wir unsere Sachen packen, man wird uns mit Schimpf und Schande davonjagen.«
»Und wenn ich morgen früh nicht mit einem Gesellen auf dem Beschauamt erscheine, kann ich schon morgen früh meine Meistergerechtigkeit abgeben, und dann sitzen wir schon morgen früh auf der Straße! Ist das vielleicht besser? Biller erwartet einen Gesellen an meiner Seite und …«
»Aber doch nicht Juliane!«
»Wir können uns keinen richtigen Gesellen und damit noch einen hungrigen Magen ins Haus holen! Es ist auch nur so lange, bis wir den kaiserlichen Auftrag erfüllt und die Hauskrone nach Frankfurt gebracht haben. Das sind nur noch vierzehn Tage! Keine Ewigkeit! Bis dahin werden wir die Leute täuschen können, vor allem diesen Biller! Danach habe ich bis zum Lebensabend ausgesorgt, und wir können uns gleich in Frankfurt niederlassen. Was meinst du dazu, Blümlein?« Seine Augen suchten ihre Gestalt.
Juliane sah ihren Meister unverwandt an. »Ich stelle eine Bedingung: Ihr müsst mir alles beibringen, was ein Geselle können muss. Ohne Unterschied! Und Ihr werdet mich nie mehr Blümlein nennen!«
Der Goldschmied streckte seine Hand aus. »Abgemacht – Julian.«
Sie zuckte bei dem Namen zusammen, als hätte er den Allmächtigen gefrevelt, doch dann erhob sie sich und schlug mit einem Seitenblick auf Friederike ein. Seine schwielige Hand hinterließ ein raues Kratzen, als hätte sie versucht, einen zu hohen Baum hinaufzuklettern.
»Juliane«, jammerte Friederike. »Weißt du denn nicht, was das heißt? Du musst dich benehmen wie ein Junge, Hosen tragen und deine Brüste einschnüren. Willst du das wirklich? Dein Vater, Gott hab ihn selig, hätte das niemals geduldet. Du musst das nicht tun.«
»Red ihr nicht drein!«, zürnte Meister Drentwett.
Juliane kaute auf der Unterlippe. »Mein Vater würde verstehen, warum ich mich als Junge ausgebe, auch wenn es eine Lüge ist. Außerdem ist es ja nur für zwei Wochen.«
»Gut«, sagte der Goldschmied mit einem erleichterten Seufzer. »Alsdann müssen wir dir nur noch die Haare schneiden. Weib, hol die Schere aus der Werkstatt!«
»Meine …?« Juliane griff nach ihrem Nackenknoten. Ihre dichten Haare ließen sich kaum mit einer Hand fassen.
»Willst du nun, oder willst du nicht?«, fragte der Meister in ihre Richtung.