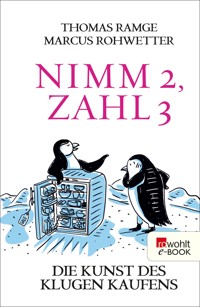Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Campus Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Immer wieder in ihrer Geschichte wurde die Bundesrepublik von politischen Skandalen erschüttert. Dabei hat jedes Jahrzehnt seine eigenen Anstößigkeiten hervorgebracht. Thomas Ramge lässt die wichtigsten Affären Revue passieren.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 352
Veröffentlichungsjahr: 2003
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
|4|Meinen Eltern
|7|Vorwort
Ausgestopfte Tiere schauten Konrad Adenauer in seinem ersten Amtszimmer bei der Arbeit zu. Im Herbst 1949 waren die Kanzlerbüros provisorisch in einem Bonner Naturkundemuseum untergebracht. Die Arbeiten am Palais Schaumburg, dem späteren Sitz des Regierungschefs, gingen nur zögerlich voran, und der betagte Staatsgründer wurde ungeduldig: »Ich höre die Leute schon sagen: ›Der Alte sitzt bei den Affen, und da gehört er ja auch hin!‹« Eigentlich hatte Adenauer nur wenig Grund, sich zu beschweren. Die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland begann mit einer politischen Sünde, die er zu verantworten hatte – wenn auch mit einer kleinen. Als Präsident des Parlamentarischen Rates sorgte Adenauer mit einer Reihe politischer Taschenspielertricks dafür, dass Bonn und nicht Frankfurt Hauptstadt des westdeutschen Staates wurde. Als skandalös wurde diese Entscheidung im Jahr 1949 nur von wenigen wahrgenommen.
Ein politischer Skandal ist ein kommunikativer Prozess. Das Fehlverhalten eines Politikers, einer Partei oder der politischen Klasse wird erst zum Skandal, wenn die Öffentlichkeit sich über ein undemokratisches Vergehen empört und Konsequenzen fordert. Vier Jahre nach Kriegsende war für Empörung keine Zeit. Deutschland musste wieder aufgebaut und demokratische Rituale mussten erst erlernt werden. Denn der politische Skandal ist ein demokratisches Ritual der Selbstreinigung. Mit der Bestrafung der Schuldigen versichert sich die Demokratie, dass sie funktioniert, getreu dem |8|Motto: Bei uns fliegen Schweinereien auf und werden geahndet. Die Gesellschaft der Bundesrepublik sollte schon bald ausreichend Gelegenheit haben, dieses Ritual zu üben. Die Schatten der Nazivergangenheit, Geheimdienstpannen, Machtanmaßung, Polizeigewalt, illegale Parteispenden und persönliche Bereicherung boten zahlreiche Gründe zur Empörung, und eine freie Presse verfügte über die Mittel, diese zum Ausdruck zu bringen. Einzig gegen das Genre des Sittenskandals schien die Bundesrepublik resistent. Die Affäre Kießling sollte erst Mitte der 80er Jahre auch diese Lücke schließen.
Dieses Buch zeigt an zwölf Beispielen, wie in der Bundesrepublik Deutschland politische Skandale hochkochten und welche Spuren sie hinterließen. Wer trieb einen Skandal aufgrund welcher Interessen voran, und mit welchen Mitteln setzten sich die Beschuldigten zur Wehr? Unter welchen Umständen überstand ein Politiker einen Skandal relativ unbeschadet, wann musste er seinen Hut nehmen? Welche Konsequenzen wurden gezogen, und was wurde aus den Hauptfiguren? Dies sind die Leitfragen für die kommenden Seiten. Dabei soll kein theoretisches Modell entworfen werden, das historische Skandale nach definierten Parametern analysiert und den Verlauf kommender Affären vorhersagt. Hiermit haben sich bislang auch Politikwissenschaft und Soziologie ausgesprochen schwer getan. Dieses Buch nähert sich dem Phänomen des Politskandals über seine Protagonisten. Franz Josef Strauß lief stets zur Hochform auf, wenn wieder einmal eine Lawine von Vorwürfen auf ihn zurollte. Dem wortgewaltigen Bayern gelang es, Skandale für seine Zwecke zu instrumentalisieren. Willy Brandt brach zusammen, als sein Referent Günter Guillaume als Stasi-Kundschafter enttarnt wurde. Für beide Reaktionen gibt es Gründe in Biografie und Charakter der Politiker, die genauso erforscht werden sollen wie der historische Kontext, in dem über Rücktritte und politische Comebacks entschieden wurde.
Politische Skandale brauchen freie Presse, Opposition und Öffentlichkeit. Die DDR kannte entsprechend das Ritual des Skandals |9|nicht. Im demokratischen Sinne war sie selbst ein Skandal. Auf die politischen Affären in Westdeutschland nahm die Regierung in Ostberlin dafür umso stärker Einfluss. Sie belieferte Staatsanwälte mit echten und gefälschten Akten, die Adenauers Staatssekretär Hans Globke belasteten, spannte Verfassungsschutzpräsident Otto John vor ihren Propagandakarren und unterstützte die Westberliner Studenten nach dem Tod von Benno Ohnesorg. Im Gegenzug geriet im Westen der Kampf gegen den Kommunismus zur Standardrechtfertigung, wenn Politiker Gesetze übertraten. Politische Skandale waren in der Bundesrepublik fast immer auch ein Derivat des Ost-West-Konfliktes. Dies galt sogar noch für die Affären nach der Wiedervereinigung. Helmut Kohl begründete seine illegalen Parteispenden mit dem Satz: »Wir standen mit dem Rücken zur Wand.« Das Geld aus den schwarzen Kassen sei in den Aufbau der Ost-Union geflossen. Die DDR und ihr Einfluss sowie die antikommunistische Identität des Westens stehen daher unter besonderer Beobachtung in diesem Buch.
Ob getragen von einzelnen Personen wie »Super-Ossi« Günther Krause oder von der gesamten politischen Klasse wie im Spendenfall Flick: Skandale sind wohl das spannendste politische Ritual, das die Demokratie kennt. Sie polarisieren, schaffen Zweckbündnisse und stellen Loyalitäten auf die Probe. Sie machen Politik emotional und gleichzeitig zum kühlen Strategiespiel. Im Skandal beweist sich, wie tief eine Gesellschaft – Beschuldigte und Skandalierer eingeschlossen – die selbst gesetzten Spielregeln verinnerlicht hat. Oft genug zeigt die Skandalgeschichte der Bundesrepublik, dass es weder Moral noch Anstand sein müssen, die hinter der »Aufklärung« stehen. Aus Opfern wurden, siehe Björn Engholm, strahlende Sieger, die bei genauerem Hinsehen selbst nicht frei von Fehlverhalten waren. Aus Tätern wurden, siehe Uwe Barschel, tragische Figuren, bei denen die Schuldfrage keineswegs geklärt war. Die »Waterkant-Affäre« wurde für die Medienkritiker zum Paradebeispiel einer fehlgeleiteten Jägermentalität vieler Journalisten.
|10|Ein Rückblick auf die großen Skandale der Bundesrepublik sagt viel über die politische Geschichte Deutschlands aus, mischten in der Konfrontation von Anklägern und Beschuldigten doch stets die wichtigsten Politiker der Zeit mit. Dieses Buch unternimmt den Versuch, auch die politische Atmosphäre der einzelnen Epochen einzufangen. Es will erzählen, historisch genau und dennoch unterhaltsam. Denn dazu lädt das Thema des Buches förmlich ein. Eine perfekte Demokratie kennt keine Skandale. Der Autor hält es daher mit Theodor Fontane, der einmal schrieb: »Unser Leben verläuft, offen gestanden, etwas durchschnittsmäßig, also langweilig, und weil dem so ist, setz ich dazu: ›Gott sei Dank, dass es Skandale gibt.‹«
Berlin, Juli 2002
|11|Bonn bei Rhöndorf – Adenauer und die Hauptstadtfrage (1949)
Die Tagesordnung war extra geändert worden. Der Parlamentarische Rat entschied zum ersten Mal in geheimer Abstimmung. Schriftführer Jean Stock rief die 63 Abgeordneten dem Alphabet nach einzeln auf, die Stadt ihrer Wahl handschriftlich auf den Stimmzettel zu schreiben: Frankfurt oder Bonn. Die Zuschauertribüne des provisorischen Bonner Plenarsaals, in dem der Rat bis dahin über das Grundgesetz beraten hatte, war bis auf den letzten Platz besetzt. Vor dem Gebäude warteten Hunderte von Bonner Lokalpatrioten auf die Entscheidung: Wo würden Regierung und Parlament der Bundesrepublik Deutschland nach der Staatsgründung und den ersten freien Wahlen ihre Arbeit aufnehmen?
Die Urne mit den Stimmzetteln wurde auf dem Präsidententisch geleert. Der Ratsvorsitzende Konrad Adenauer ließ es sich nicht nehmen, jeden einzelnen Zettel persönlich zu entfalten und das Votum bekannt zu geben. Die Zuschauer auf der Tribüne zählten laut mit, bejubelten jede Stimme für die bislang eher unbedeutende Universitätsstadt am Rhein. Adenauer mahnte mehrmals: »Ich bitte, jedes Zeichen des Missfallens und des Beifalls zu unterlassen.« Das Ergebnis ging trotzdem im Jubel unter: Frankfurt erhielt 29 Stimmen, für Bonn stimmten 33 Abgeordnete, eine Stimme war ungültig.
In den späten Abendstunden des 10. Mai 1949 war die Vorentscheidung für Bonn als »provisorische« Hauptstadt der Bundesrepublik gefallen. Gegen Mitternacht wurde die schwarz-rot-goldene |12|Fahne, die erst zwei Tage zuvor als Bundesflagge deklariert worden war, auf dem Tagungsgebäude der Pädagogischen Akademie aufgezogen und angestrahlt. Die Bonner jubelten. Adenauer ließ sich seinen Triumph über die Sozialdemokraten und die Gegner innerhalb der Union nicht anmerken.
Seine innere Genugtuung muss gleichwohl groß gewesen sein. Die Entscheidung für Bonn im Parlamentarischen Rat, dem verfassunggebenden Vorparlament der Bundesrepublik, war das Ergebnis eines machtpolitischen Intrigenspiels. Adenauer hatte es mit Unterstützung des Landes Nordrhein-Westfalen und der Stadt Bonn in den vergangenen Monaten gegen eine Übermacht an Frankfurt-Befürwortern betrieben. Am Tag der Abstimmung gipfelte es in einer Mischung aus taktischem Geniestreich und alberner Provinzposse, die nach heutigen Maßstäben gehöriges Skandalpotenzial hatte.
Noch am Morgen des 10. Mai sah es so aus, als ob Frankfurt als der sichere Sieger aus der Abstimmung hervorgehen würde. In einer Probeabstimmung der Union votierten 21 Abgeordnete für Bonn, sechs für Frankfurt. Bei den Abweichlern handelte es sich vermutlich um die bayrischen CSU-Vertreter. Es war bekannt, dass die Spitze der Christlich-Sozialen Union in München eine Hauptstadt nördlich der Mainlinie ablehnte. Nachdem sie schon dem Grundgesetz nicht zugestimmt hatte, übte sie jetzt erneut Druck auf die bayrischen Delegierten aus. Zudem galten die beiden hessischen CDU-Abgeordneten Heinrich von Brentano und Walter Strauß als Wackelkandidaten. Das Stuttgarter CDU-Ratsmitglied Paul Binder, der sich mehrfach mit Adenauer in der Hauptstadtfrage angelegt hatte, schien ebenfalls noch unentschieden.
Die SPD hingegen wollte ihre 27 Abgeordneten per Fraktionszwang auf Frankfurt verpflichten. Zwei Stimmen der FDP galten der Mainmetropole ebenso als sicher. Die beiden Kommunisten im Rat wollten sich enthalten. Bonn konnte noch mit drei Stimmen der Freien Demokraten und jeweils zwei Stimmen von Deutscher Partei und Zentrum rechnen. Unter dem Strich hieß das: Sollte die CSU |13|bei ihrem Votum bleiben, wäre Frankfurt der künftige Sitz der Bundesregierung. Auch die drei unentschiedenen CDU-Abgeordneten konnten Adenauers Plan noch endgültig zunichte machen, selbst wenn sich die CSU zugunsten Bonns umstimmen ließe.
Hangenauer, Fräulein Moritz und die Warteklinke
Fast alle politischen Beobachter gingen am Morgen der Abstimmung davon aus: Die künftige Bundeshauptstadt würde Frankfurt heißen. So wäre es wohl auch gekommen, hätte Adenauer nicht in letzter Minute eine »geheime Meldung« der Nachrichtenagentur Deutscher Pressedienst, einem Vorläufer der dpa, in die Finger bekommen. Die Meldung berichtete von der soeben beendeten Sitzung des Parteivorstandes der Sozialdemokraten in Köln. Dort hatte der SPD-Vorsitzende Kurt Schumacher angeblich »eine Wahl Frankfurts als Bundessitz als eine Niederlage für die CDU/CSU« bezeichnet. Für die SPD sei »die Entscheidung des Bundessitzes von großer politischer Bedeutung«.
Die SPD feierte also vorab den Sieg Frankfurts als politischen Sieg über die CDU, ermöglicht durch, wie es in der Meldung mokierend hieß, »einige starrköpfige Außenseiter« in der Union! Adenauer las den Text in der Fraktion vor. Er warf den Abweichlern vor, den Sozialdemokraten eine Steilvorlage für die kommende Bundestagswahl zu liefern. Nun behauptete auch Adenauer: »Die Hauptstadtfrage ist eine politische geworden.« Seine Schlussfolgerung lautete: Die Union konnte gar nicht mehr anders als geschlossen für Bonn zu stimmen, sonst machten die Roten das Rennen. Wer wollte dafür schon die Verantwortung tragen? Der Kanzler in spe rang seinem schwäbischen Widersacher Paul Binder das Eingeständnis ab, sich wenigstens der Stimme zu enthalten. Der ungültige Stimmzettel am Abend stammte wahrscheinlich von ihm. Den beiden hessischen CDU-Abgeordneten wurden offenbar persönliche |14|Zugeständnisse gemacht. Heinrich von Brentano, später Außenminister, rückte noch vor der Abstimmung in die Fraktionsspitze auf. Walter Strauß wurde auf ausdrücklichen Wunsch Adenauers zum Staatssekretär im Justizministerium berufen. Auch die CSU knickte ein. Was zu diesem Zeitpunkt keiner der Abgeordneten wusste: Die dpd-Meldung war gar keine echte Meldung.
Formuliert worden war sie von zwei Journalisten, die der CDU nahe standen: dpd-Korrespondent Franz Hange, Spitzname »Hangenauer«, und Heinrich Böx, Redakteur der konservativen Allgemeinen Kölnischen Rundschau. Getippt wurden die Zeilen auf dem dpd-Fernschreiber in Hanges Büro. Bevor die beiden loslegten, drückten sie jedoch die so genannte »Warteklinke« des Gerätes. Damit wurde die Standleitung zur Hamburger Zentralredaktion des Deutschen Pressedienstes gekappt. Der Fernschreiber mutierte zur einfachen Schreibmaschine. Hange und Böx verfassten ein Schriftstück, das nur aussah wie eine Meldung, die über den Ticker gegangen war. Das Blatt mit der vermeintlichen Meldung spielten sie Adenauer zu.
Was Kurt Schumacher auf der SPD-Vorstandssitzung in Köln tatsächlich sagte, wird wohl immer ein Rätsel bleiben. Ein Protokoll gibt es nicht mehr. Seine Informationen über die Sitzung erhielt »Hangenauer«, soviel ist sicher, von seiner jungen Kollegin Elfriede Moritz, die er sehr gut kannte. Er war heimlich mit ihr verheiratet. Die Liaison musste geheim gehalten werden, weil »Fräulein Moritz« für die konkurrierende Deutsche Nachrichten Agentur (DNA) in Hanges Nachbarbüro arbeitete. Die 25-jährige Journalistin verfügte über beste Kontakte zur SPD-Parteispitze. Sie stammte aus einer sozialdemokratischen Familie und war selbst im Besitz eines roten Parteibuches. Offenbar hatte ihr ein SPD-Fraktionsmitglied telefonisch von Schumachers Rede berichtet: unter der Auflage, diese Hintergrundinformation nicht zu veröffentlichen. Hange und Böx hingegen versorgten nicht nur Adenauer mit ihrer dubios frisierten Meldung, sondern auch einige Kollegen, die sich umgehend aufmachten, das Gerücht vom siegesgewissen Schumacher zu verbreiten.
|15|Die Meldung sorgte bei allen Fraktionen für gehörige Aufregung. Auch der Verdacht, es handele sich um eine Fälschung Hanges, stand schnell im Raum, zumal Schumacher die vermeintliche Nachricht umgehend dementierte. Die CDU/CSU-Fraktion nutzte eine Unterbrechung der Plenarsitzung, um noch einmal über die Meldung zu diskutieren. Nach diskreter Befragung weiterer Journalisten kamen die Abgeordneten zu dem Ergebnis: Die Meldung mag zwar auf der »Warteklinke« geschrieben worden sein, ihr Inhalt jedoch war korrekt. Die CSU lenkte daraufhin endgültig ein. Die Mehrheit für Bonn war gesichert.
Für die Journalisten Hange und Böx zahlte sich die nicht gemeldete Meldung langfristig aus. Franz Hange bekam zwar ein wenig Ärger mit seiner Chefredaktion, öffentlich wurde er aber vom dpd in Schutz genommen. Noch 1949 fiel er auf der Karriereleiter nach oben und stieg zum Chefkorrespondenten für die unmittelbare Berichterstattung über Adenauer auf. Vor Kollegen brüstete er sich damit, die gesamte Postablage des Kanzlers nach Meldungen abfischen zu dürfen. Schließlich landete Hange, nach einer Zwischenstation als Referent im Kanzleramt, als Ministerialrat im Bundespresseamt. Heinrich Böx wurde alsbald direkt von Adenauer zum Leiter des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung berufen. Nur bei Elfriede Moritz zeigte die Schumacher-Meldung keine karrierefördernde Wirkung. Die DNA schickte ihr die Kündigung. Außerdem musste sie sich in einem Verfahren wegen »Schädigung der Bundesrepublik Deutschland« verantworten, das allerdings im Sande verlief. Mehrere Sozialdemokraten ließen sich schriftlich von der Journalistin bestätigen, dass sie ihr keine Informationen hatten zukommen lassen.
Der politische Verlierer der Meldungs-Finte hieß Kurt Schumacher. Drei Wochen nach der Hauptstadtentscheidung donnerte er auf dem Landesparteitag der bayrischen SPD: »Am Nachmittag jenes Tages sind einige Personen, darunter zwei Journalisten, eine kleine Madame von der DNA und ein Herr vom dpd, in ganz Bonn herumgeschickt worden, über die Frage des künftigen Sitzes der |16|Bundeshauptstadt eine Falschmeldung zu kolportieren, indem man mir etwas in den Mund legte, was ich nie gesagt habe.« Seine Bewertung lautete: »Eine solche Handlungsweise kann nur einer unvorstellbar niederen politischen Vorstellungsweise entspringen, denn jeder verantwortungsbewusste Mensch kann eine so realpolitisch bedeutsame Frage nicht zum Gegenstand der Konkurrenz zweier Fraktionen machen.« Schumachers Empörung fand außerhalb der SPD kaum Beachtung. Die Entscheidung war gefallen, und die »Nachricht« vom siegesgewissen Schumacher hatte die Wende zugunsten Bonns gebracht. Der Spiegel-Korrespondent Lothar F. Ruehl schrieb: »Sie stülpte die Stimmung CDU/CSU-Oppositioneller um und machte aus heißen Frankfurtern frische Bonner.«
Die Nachrichtenente vom 10. Mai 1949 war nur der vorläufige Höhepunkt einer Reihe trickreicher bis skandalträchtiger Schachzüge, die eine kleine Gruppe von Bonn-Befürwortern zugunsten der späteren Hauptstadt unternahm. Zum Sitz des Parlamentarischen Rates war Bonn nur geworden, weil sich die Ministerpräsidenten der Westzonenländer sicher waren, mit der Stadt am Rhein eben keine Vorentscheidung über eine spätere Hauptstadt zu treffen. Bonn schien zu unbedeutend, um ernsthaft mit den Kandidaten Frankfurt, Stuttgart und dem zentral gelegenen Kassel konkurrieren zu können. Diese Rechnung hatten die Ministerpräsidenten allerdings ohne Adenauer gemacht. »Der Alte« hatte schon lange Gefallen an dem Gedanken gefunden, die künftige Hauptstadt in seiner rheinischen Heimat zu platzieren.
Ratskantine und Rechenspiele
Bereits im Frühherbst 1948 verabredeten Adenauer, das Land Nordrhein-Westfalen und die Bonner Stadtverwaltung, Bonn hauptstadttauglich auszubauen. Das Kabinett in Düsseldorf bewilligte im Oktober zehn Millionen Mark für neue Tagungs- und Verwaltungsgebäude|17|. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Parlamentarische Rat gerade seine Arbeit aufgenommen. Vor Ort sorgte der Düsseldorfer Ministerialdirektor Hermann Wandersleb dafür, dass die Bauplanung zügig vorankam. Gleichzeitig tat die Stadtverwaltung alles, damit sich die Abgeordneten, die letztlich über die Hauptstadtfrage zu entscheiden hatten, in Bonn auch wohl fühlten. Das Restaurant der Pädagogischen Akademie übertraf den Standard einer üblichen Parlamentskantine im Jahr 1948 um Klassen. Für die süddeutschen Abgeordneten wurden »heimische« Gerichte wie Käsespätzle, Leberknödel und Griesnockerln in den Speiseplan aufgenommen. Die Hotels wurden von Politikern und Journalisten angewiesen, in Küche und Keller nicht zu sparen. Mit einigen kommunalen Subventionen war da viel zu machen. Selbstverständlich erhielten die Abgeordneten und Pressevertreter Freifahrscheine für die öffentlichen Verkehrsmittel. Die Bonner Fürsorge reichte sogar bis auf den Nachttisch. Hermann Wandersleb ließ in den Leselampen der Presseleute die schwachen 25-Watt-Birnen durch stärkere Leuchten ersetzen. Seine Begründung: »Journalisten arbeiten vorwiegend im Bett.« Der Unterstützung Adenauers konnte sich der umtriebige Beamte sicher sein. Der Rat hatte gerade vier Wochen getagt, da stellte der spätere Kanzler zufrieden fest: »Es geht ja ganz ausgezeichnet. Die Leute fühlen sich hier so wohl, dass sie gar nicht mehr wegwollen. Jetzt können wir darangehen, einen Vorschlag in der Richtung zu machen, dass Bonn vorläufige Bundeshauptstadt wird.«
Während Wandersleb organisierte, trickste Adenauer im politischen Verfahren. Als Präsident des Parlamentarischen Rates sorgte er dafür, dass zunächst nur das Land Nordrhein-Westfalen vor dem Ältestenrat die Vorzüge der Stadt Bonn darlegen konnte. Die hessischen Vertreter blieben außen vor, obgleich bekannt war, dass die Wiesbadener Landesregierung darauf brannte, Frankfurt wieder in Position zu bringen. Auch Wandersleb nutzte den Heimvorteil. In regelmäßigen Abständen legte er den Parlamentariern und der Presse geschönte Baukalkulationen vor. Das Fazit seiner Berechnungen |18|blieb immer gleich: »Bonn ist die günstigere Lösung.« Die Hauptstadtfrage geriet zum Preiskampf, und die vorgeblich geringen Baukosten zum wichtigsten Argument der Bonner Taktiker.
Früh regte sich Kritik an Wanderslebs Rechenspielen – auch innerhalb der CDU. Reinhold Maier, Ministerpräsident von Württemberg-Baden und stolz, Stuttgart aus dem Rennen geworfen zu haben, um dessen Bewohnern die »Hauptstadtplage« zu ersparen, merkte an: »Die Zahlen sind ganz unseriös kalkuliert und für schwäbische Genauigkeit im Nachrechnen voll von Fragezeichen.« Tatsächlich wurden die vom Hauptstadtbüro Bonn avisierten Baukosten in keinem einzigen Fall eingehalten. Dies galt für die Erweiterung des Bundeshauses, den Umbau von Kasernen sowie für die Restaurierung des Palais Schaumburg. Nach der Entscheidung nutzte man die hohen verbauten Summen wiederum als Argument, auf jeden Fall in Bonn bleiben zu müssen. Sonst wären die immensen Investitionen ja Fehlinvestitionen gewesen! Das Bundeshaus lieferte das sichtbarste Beispiel. Frühzeitig hatte Adenauer einen renommierten Düsseldorfer Architekten beauftragt, in der Pädagogischen Akademie Platz für Bundestag und Bundesrat zu schaffen. Nordrhein-Westfalen sprang mit der ersten Finanzierungsrate von 1,5 Millionen Mark ein. Ohne vorliegende Baugenehmigung trieb Wandersleb den Ausbau seit Februar 1949 voran. Adenauer freute sich: »Das schönste Geräusch hier bei dem ganzen Betrieb ist für mich das Hämmern und Klopfen am Neubau des Plenarsaals.« Der Richtkranz stieg am 5. Mai über dem späteren Parlamentsgebäude auf, fünf Tage bevor der Parlamentarische Rat darüber entschied, wo der Bundestag seine Arbeit aufnehmen würde.
Show-down Kapitale
Nach dem 10. Mai mussten Adenauer und die Bonn-Fraktion noch eine weitere Hürde nehmen. Die endgültige Entscheidung, wo bis zu einer Wiedervereinigung Regierung und Parlament |19|der Bundesrepublik Deutschland sitzen sollten, traf der erste Bundestag. Auch diese Abstimmung verlief unter dubiosen Umständen.
Die Bundestagswahlen vom 14. August verschafften der CDU/ CSU einen knappen Vorsprung von acht Sitzen gegenüber den Sozialdemokraten. Am 7. September – fünf Monate, nachdem der Parlamentarische Rat die Vorentscheidung für Bonn getroffen hatte – trat der Bundestag zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen. Kaum hatte Parlamentspräsident Erich Köhler die feierlichen Eröffnungsworte gesprochen, meldete sich der SPD-Fraktionsvorsitzende Erich Ollenhauer zu Wort und forderte: »Regierung und Parlament sollen schnellstmöglich in Frankfurt zusammenkommen.« Das erste Bundestagsprotokoll verzeichnet: »Beifall bei der SPD, Lachen rechts.« Das Parlament verfügte zu diesem Zeitpunkt weder über eine Geschäftsordnung noch über Ausschüsse oder einen Arbeitsplan. Parlamentspräsident Köhler konterte: »Der Ältestenrat bestimmt die Tagesordnung, nicht einzelne Fraktionen.«
In der elften Sitzung des Bundestags, am 30. September, wurde Ollenhauers Antrag endlich zugelassen. Die SPD drängte, über die Hauptstadtfrage direkt abzustimmen. Die Union schlug vor, eine Kommission einzurichten, die nochmals Fakten über die tatsächliche Eignung der beiden Städte sammelte. Union und FDP stimmten diesem Vorschlag zu.
Die Befürworter Frankfurts sahen sich vom Abschlussbericht klar bestätigt. Dieser kam durchaus nicht zu dem Ergebnis, dass Bonn die billigere Alternative darstellte. Zwar besaß Bonn zu diesem Zeitpunkt in der Tat ein Parlamentsgebäude, das Frankfurt noch fehlte. Für die Exekutive allerdings verfügte die Stadt am Main mit den Gebäuden der Wirtschaftsverwaltung der Westzonen über ideale Räumlichkeiten, bei denen nur die Türschilder hätten ausgetauscht werden müssen. Für die Ministerialbürokratie standen in Frankfurt 45 800 Quadratmeter Bürofläche bezugsfertig bereit. Bonn |20|hatte rund 12 000 Quadratmeter zu bieten. Für den Rest mussten mehrere Kasernen der alten Garnisonsstadt erst noch umgebaut werden. Auch was die Unterbringung von Politikern und Beamtenschaft anging, war Frankfurt die offensichtlich bessere Wahl. Bonn konnte laut Berechnungen der Kommission nicht einmal so viele öffentliche Wohnungen bieten, wie in Frankfurt noch fehlten, nämlich 512. Ferner arbeiteten bereits 4 000 Beamte in den Behörden des Wirtschaftsrates der Westzonen. Die Kosten für deren Umzug nach Bonn würden den ersten Bundeshaushalt ebenfalls belasten. Für Frankfurt sprachen zudem die wesentlich bessere Verkehrsanbindung durch Zug und Autobahn, der Flughafen sowie ein modernes Fernsprechnetz, das in Bonn mit 20 Millionen zusätzlich zu Buche schlug.
Grob gerechnet kam der Hauptstadtausschuss in seinem 18 Seiten umfassenden Bericht zu folgendem Ergebnis: In Frankfurt waren bereits über 100 Millionen Mark aus Mitteln des Vereinigten Wirtschaftsgebietes verbaut worden. Weitere 25 Millionen müssten investiert werden, um die Hauptstadt vorerst funktionstüchtig zu machen. Für Bonn fiel das Zahlenverhältnis umgekehrt aus. 20 Millionen Mark waren hier bereits investiert worden, weitere 120 Millionen an öffentlichen Geldern waren nötig. Private Kosten und Investitionen waren nicht eingerechnet.
Die Kommission legte ihren Bericht am 28. Oktober vor. Eine knappe Woche später, am 3. November, stimmte der Bundestag endgültig über den »Sitz der Bundesorgane« ab. Auf Bonn entfielen 200 Stimmen, auf Frankfurt 176. Ein beachtlicher Teil der Abgeordneten fehlte bei der Abstimmung. Wandersleb wurde als »Sieger von Bonn« gefeiert, Adenauer dankte dem Finanzminister von Nordrhein-Westfalen für sein Engagement, und das Bonner Studentenkabarett »Wintergärtchen« bekam 300 Mark Gage angewiesen. Unermüdlich hatte es mit einem Lied für Bonn geworben: »Bonn, Bonn, nur du allein.«
|21|Frühe Amigos
Sechs Tage hatten Adenauer gereicht, um das Blatt erneut zu wenden. Sofort nach dem Erscheinen des Abschlussberichtes zweifelte er die Recherchen der Ausschussmitglieder an. Von den Amerikanern holte er schnell eine Stellungnahme über die Kosten ein, die mit einer Räumung Frankfurts von Besatzungstruppen verbunden wären. Diese gab er dann unvollständig und verzerrt wieder. Am Morgen der Bundestagsabstimmung landete in den Fächern von allen Abgeordneten eine »Stellungnahme der Bundesregierung zur Frage des vorläufigen Sitzes der leitenden Bundesorgane«. Das Papier hatte Hermann Wandersleb, inzwischen Staatssekretär, in der Nacht zuvor auf Weisung Adenauers zusammengestellt. Es enthielt Zahlen, die mit denen des Abschlussberichts wenig gemein hatten. Nur noch drei Millionen Mark, so rechnete Wandersleb dieses Mal vor, sollten in Bonn notwendig sein. Ein Umzug nach Frankfurt brächte »Verlust und Neuaufwendungen« in Höhe von 110 Millionen Mark. Die Zahlen waren völlig aus der Luft gegriffen.
Die Zustimmung der CSU hatte sich Adenauer vor der Bundestagswahl mit politischen Versprechungen gesichert. Den bayrischen Ministerpräsidenten Hans Ehard köderte er mit dem ersten Vorsitz im Bundesrat, was dann allerdings nicht klappte, sowie mit seiner Unterstützung im CSU-internen Machtkampf gegen Josef »Ochsensepp« Müller. Die CSU sollte zudem, so war ihr bereits im Mai versprochen worden, nach der gewonnenen Wahl das Finanzministerium und zwei weitere Ministerposten erhalten.
Auf Betreiben von Wandersleb hatten seit Ende 1949 überraschend viele bayrische Firmen den Zuschlag für öffentliche Bauaufträge in Bonn erhalten – gerne auch auf persönliche Empfehlung. So schrieb der spätere Justizminister Dehler am 4. November 1949 einen Brief an Wandersleb mit der Bitte: »Ich hatte mir vor einiger Zeit gestattet, Sie auf das Installationsunternehmen meines Jugendfreundes Georg Pabst in Bamberg hinzuweisen. Ich wäre Ihnen sehr |22|dankbar, wenn Sie ihm Fingerzeig geben wollten, wie er sich bei der Bewerbung um Aufträge verhalten soll. Ich danke Ihnen für Ihre Bemühungen.« Knapp ein Drittel der frühen Bauvorhaben wurde letztendlich von bayrischen Firmen erledigt.
Mit der CSU konnte Adenauer rechnen, mit den 17 Abgeordneten der Bayernpartei (BP) nicht. Bei einer knappen Entscheidung des Bundestags konnten ihre Stimmen ausschlaggebend sein. Aus sicherer Quelle glaubte Wandersleb zu wissen, dass die BP geschlossen für Frankfurt stimmen werde: nicht, weil es ihr um die Sache gegangen wäre, sondern um »dem Alten« einen Denkzettel zu verpassen, da Adenauer sie wiederholt lächerlich gemacht hatte. Im »Büro Bundeshauptstadt« war man der Ansicht, der Kanzler solle noch vor der Abstimmung mit den Abgeordneten der Bayernpartei sprechen. Ob er dies tat, ist unklar. Die Voten der BP sorgten jedoch für gehörigen Wirbel. Mindestens die Hälfte der Freistaatler stimmte überraschenderweise doch für Bonn.
Viele Frankfurt-Anhänger innerhalb der SPD, unter ihnen Carlo Schmid, waren fest davon überzeugt: Die Entscheidung für Bonn war gekauft worden. Im Februar beantragten sie einen Parlamentarischen Untersuchungsausschuss – den ersten in der Geschichte der Republik. Im September erhärtete der Spiegel die Gerüchte. Aus einem Gedächtnisprotokoll des Bayernpartei-Vorsitzenden Josef Baumgartner zitierte das Nachrichtenmagazin ein Gespräch zwischen Baumgartner und dem zwielichtigen Abgeordneten Hermann Aumer, der ebenfalls der BP angehörte. Dieser behauptete, dass 100 Abgeordnete aller Fraktionen bestochen worden waren: »20 000 DM für diejenigen, die mitzureden haben, 10 000 DM für diejenigen, die ein Gewicht haben und 1 000 für diejenigen, die nur ihre Stimme hergegeben haben.« Als Geldgeber nannte Aumer CSU-Finanzminister Fritz Schäffer und den Bankier Robert Pferdemenges, der Adenauers Finanzen in Ordnung hielt.
Völlig abwegig klangen die Bestechungsvorwürfe nicht. Von der Bayernpartei war bekannt, dass sie permanent Geldsorgen hatte |23|und sich in internen Machtkämpfen zerrieb. Der Spiegel deckte in den folgenden Wochen auf, dass dubiose Gelder, die Aumer vermittelt hatte, plötzlich von BP-Abgeordneten als Parteispenden zur »persönlichen Verwendung im Wahlkreis« deklariert worden waren. Insgesamt 36 Mal tagten die Obleute des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses. Im Mai 1951 legte dieser ein 2 000 Seiten starkes Abschlussprotokoll vor. Echte Erhellung brachte es nicht. »Versuchte oder erfolgte Bestechung sind nicht klar nachzuweisen«, hieß es in dem Papier. Wegen diverser Widersprüche in ihren Aussagen wurde aber den Abgeordneten Hermann Aumer, Anton Freiherr von Aretin, Ludwig Volkholtz und Wilhelm Schmidt trotzdem empfohlen, ihre Mandate niederzulegen.
Der Spiegel begründete im Verlauf der Affäre seinen Ruf als wachsames Auge über dem Bonner Treiben. Zum ersten Mal musste er sich wegen seiner »tendenziösen Berichterstattung« von rechts den Vorwurf anhören, das Ansehen der Republik beschädigt zu haben. Die beschuldigten Abgeordneten sahen sich als Opfer journalistischer Hetze – ein Vorwurf, der bei allen kommenden Skandalen der Republik laut werden würde. Rudolf Augstein resümierte in einem Kommentar: »Die Verfehlungen einzelner Abgeordneter waren nur möglich und ihre Vertuschungsmanöver vor dem Ausschuss können nur Bestand haben, weil alle Parteien seit Jahr und Tag das Grundgesetz gründlich missachten, das in seinem Artikel 21, Absatz 1, bestimmt: Die Parteien müssen über die Herkunft ihrer Mittel öffentlich Rechenschaft geben.« Wie zukunftsweisend seine Kritik sein sollte, konnte er zu diesem Zeitpunkt sicher nicht ahnen.
Die Rache der Kanalarbeiter
Die Bestechungsvorwürfe waren der unrühmliche und konsequente Abschluss der Entscheidung über die künftige Hauptstadt. Die Bonner Republik nahm ihren Anfang mit einer Serie von verdeckten |24|Operationen, Intrigen und dubiosen Manipulationen, die einige Jahre später mit Sicherheit heftigere Reaktionen in der politischen Öffentlichkeit ausgelöst hätten. Damals kam es kaum zu Widerspruch. Der Spiegel und einige hessische Zeitungen mühten sich zwar redlich, mit dem »Hauptstadtskandal« Schlagzeilen zu machen. Kurt Schumacher nannte die Entscheidung für Bonn das Ergebnis des »autoritären Wahns gewisser Leute der CDU« und »die Rache der Kanalarbeiter«. Die neuen Bundesbürger teilten diese Empörung nicht. Deutschland musste aufgebaut werden, schnell und effektiv. Die meisten Nachkriegsdeutschen fanden vorerst keine Zeit, sich genauer mit politischen Entscheidungsprozessen zu beschäftigen. Das Verhältnis von Politik und Moral war ein unangenehmes Thema. Die Verbrechen der Vergangenheit wollten sie nur zum kleinen Teil aufarbeiten, in der Mehrzahl jedoch lieber verdrängen. Ein Gespür dafür, wann demokratische und rechtsstaatliche Regeln übertreten wurden, hatten die Deutschen im Jahr 1950 noch nicht entwickelt.
Adenauer hielt sich persönlich stets geschickt genug im Hintergrund und verschanzte sich hinter vermeintlichen Sachargumenten, um nicht allzu direkt dem Vorwurf der Manipulation ausgeliefert zu sein. Neben den Rechenspielen mit den Bau- und Umzugskosten hob er immer wieder die historische Verbindung des Rheinlands zu Frankreich als Standortvorteil hervor. Dies kam seinem Plan der Wertbindung entgegen. Eine rheinische Hauptstadt stellte für Adenauer zudem einen sympathischen Bruch mit preußischer Tradition dar. Politisch war ihm vor allem die tief sozialdemokratische Atmosphäre in Südhessen ein Dorn im Auge. Außerdem mochte er die »lärmende und amerikanisierte« Stimmung in Frankfurt nicht.
Persönliche Motive zugunsten Bonns leugnete der Kanzler treuherzig, etwa auf einer Pressekonferenz Ende August 1949: »Ich habe mich als Präsident des Parlamentarischen Rates bewusst und völlig von den Auseinandersetzungen um den Bundessitz fern |25|gehalten, weil eine höchst naive Betrachtungsweise auf die Vermutung gefallen wäre, da ich in Rhöndorf drüben wohne, sollte der Bund nach Bonn gehen.« Wenig später dankte er der Bonner Fährgesellschaft für ihre Glückwünsche zur Kanzlerwahl mit den Worten: »Die Rheinfähre Königswinter–Mehlem gehört zu meinem Leben.« So sollte es, dafür hatte Adenauer gesorgt, in den kommenden 14 Jahren seiner Kanzlerschaft auch bleiben.
|26|Der verlorene John – Der Verfassungsschutzpräsident zu Diensten der DDR-Propaganda (1954)
Otto John verhielt sich schon seit einigen Tagen sonderbar. Am 15. Juli 1954 war der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz (BfV) von Köln nach Berlin geflogen. Nach der Landung ließ er alle anderen Passagiere zuerst aussteigen, obwohl er direkt an der Ausgangstür saß. Dabei drehte er sich in Richtung Bordwand, als ob ihn niemand erkennen durfte. Auf dem Rollfeld erklärte John den zu seiner Sicherheit bestellten Personenschützern: »Ich bin Manns genug, auf mich selbst aufzupassen.« Entgegen den üblichen Regeln hielt er es für ausreichend, alle paar Stunden in seinem Sekretariat anzurufen und mitzuteilen, wo er sich gerade befand. Zusammen mit seiner Frau Lucie-Marlén stieg John im Hotel Schaetzle im Grunewald ab. Dort wohnte für einige Tage auch sein Freund Prinz Louis Ferdinand, Kaiserenkel und Chef des Hauses Hohenzollern.
Johns Kalender war mit Terminen gespickt. Zahlreiche Gespräche in der Westberliner Filiale des Verfassungsschutzes standen an. Am 17. Juli wurde Theodor Heuss als Bundespräsident wiedergewählt, am 20. Juli jährte sich zum zehnten Mal das missglückte Attentat auf Hitler. Die Gedenkfeiern waren der Hauptgrund für die Reise des Verfassungsschutzpräsidenten in die ehemalige Hauptstadt. Otto John hatte selbst zum Kreis der Widerstandskämpfer um Graf Stauffenberg gehört und der Gestapo durch die Flucht nach Spanien nur knapp entkommen können. Sein Bruder Hans, ebenfalls Mitverschwörer, war geschnappt und von den |27|Nazis ermordet worden. Am Abend vor den Feierlichkeiten gab der Senat der Stadt Berlin einen Empfang. John wirkte seltsam abwesend. Alte Freunde gaben später zu Protokoll: »Wir wurden von Otto nicht einmal begrüßt.« Einen Kollegen stellte John dafür gleich drei Mal seiner Frau vor. Zu vorgerückter Stunde schimpfte er lauthals: »Auch hier sind lauter Nazis!« Auf der offiziellen Gedenkfeier an der Hinrichtungsstätte Plötzensee brach John in lautes Schluchzen aus und erntete irritierte Blicke. Prinz Louis Ferdinand nahm seinen aufgewühlten Freund zur Seite und lud ihn für den Abend in seine Suite ein. John lehnte ab: »Ich kann nicht.«
Zurück im Hotel zog sich Johns Frau mit Kopfschmerzen in ihr Zimmer zurück. Auf Reisen wohnte das Ehepaar immer getrennt. Auch John ging auf sein Zimmer und leerte dort seine Taschen. Portemonnaie, Dienstpass und Schlüssel zum Kölner Büro sowie zu seiner Geheimkassette landeten auf dem Nachttisch. Stattdessen steckte er 750 Mark in bar und einen gefälschten Personalausweis ein. Von denen besaß der Chef des deutschen Inlandsgeheimdienstes gleich mehrere, die ihn unter anderem als hohen Funktionär der Wasser- oder Forstwirtschaft auswiesen. Um 19.40 Uhr ließ er sich von einem Wagen, den das Hotel seinen Gästen zur Verfügung stellte, Richtung Kurfürstendamm fahren. Vorgebliches Ziel: das Maison de France. Dort warteten zwei britische Geheimdienstoffiziere, mit denen sich John um zwanzig Uhr verabredet hatte.
Im Maison de France tauchte John nie auf, sondern er spazierte in die nahe gelegene Uhlandstraße und besuchte einen alten Freund, den stadtbekannten Arzt und Lebemann Wolfgang »WoWo« Wohlgemuth. Der schenkte ihm eine Tasse Kaffee ein. So weit sind die Fakten unstrittig. Was dann genau geschah, blieb bis heute ungeklärt. Fest steht nur: Wohlgemuth verschwand mit John im Wagen über die Sektorengrenze nach Ostberlin.
|28|Einmal Verräter, immer Verräter!
Der Präsident des Verfassungsschutzes verschwunden in Ostberlin! Die Nachricht erschütterte die junge Bundesrepublik, wie es später nur noch einmal der Fall Guillaume vermochte. Der mysteriöseste Spionageskandal der deutsch-deutschen Geschichte hatte begonnen. Bundesinnenminister Gerhard Schröder gab sich sicher: John wurde vom KGB entführt und wider seinen Willen in der DDR festgehalten. Es wäre nicht der erste Fall von Spionagekidnapping in der Frontstadt des Kalten Krieges gewesen. Zeitungen mutmaßten, dass John auf der Jagd nach geheimen Informationen freiwillig in den Osten gefahren und dabei der Stasi in die Hände gefallen war. Aber welche Rolle spielte sein Freund »WoWo«? Wohlgemuth war nicht nur ein blendend aussehender Playboy mit dickem Amischlitten und ein hervorragender Jazztrompeter. Er war zudem als »Salonbolschewist« bekannt und hatte das erklärte Berufsziel, Direktor der berühmten Ostberliner Charité zu werden – ein Posten, über den 1954 in Moskau entschieden wurde. Der britische Geheimdienst MI 5 hielt den Arzt für einen Ostagenten und hatte John eindringlich vor Wohlgemuth gewarnt.
Drei Tage blieb Zeit für wildeste Spekulationen. Dann meldete sich John im Rundfunk der DDR zu Wort. Er sei freiwillig in der DDR und protestiere damit gegen die Politik Adenauers, die auf eine dauerhafte Spaltung Deutschlands hinauslaufe. Die Bundesregierung hielt offiziell an der Entführungsthese fest: John stehe vermutlich unter Drogen und sei zu der Aussage gezwungen worden. Schadensbegrenzung. Immer mehr Indizien sprachen dafür, dass der Verfassungsschutzpräsident tatsächlich freiwillig die Fronten gewechselt hatte. Ein westdeutscher Zöllner sagte aus, er hätte Wohlgemuths Wagen am Abend des 20. Juli gegen neun Uhr angehalten und nach kurzem Gespräch über die Sektorengrenze gewunken. Der Arzt habe am Steuer gesessen, John entspannt auf dem Beifahrersitz. Nach Entführung sah das nicht aus. Eine Verwechslung |29|konnte ausgeschlossen werden: Der Beamte hatte sich die drei Endziffern des Fahrzeugkennzeichens gemerkt. Am Morgen des 21. Juli fand Wohlgemuths Sprechstundenhilfe zudem einen handschriftlichen Zettel ihres Chefs. Darauf teilte der Arzt mit, John habe im Osten Gespräche mit Kollegen geführt und sich entschlossen, nicht mehr in den Westen zurückzukehren. Auch Wohlgemuth wolle erst einmal im Osten bleiben, »bis sich die Lage geklärt hat«.
Die Öffentlichkeit glaubte schnell an Verrat und war überzeugt: Die Bundesrepublik hatte im Kampf der Systeme ihre erste »große Schlappe« erlitten. Innenminister Schröder erntete Hohn und Spott, als er 500 000 Mark Belohnung für die Aufklärung des Falles aussetzte.
Drei Wochen später, am 11. August, folgte die vermeintliche Gewissheit. Otto John stellte sich in Ostberlin der staunenden Weltpresse. Dicht gebeugt über sein Manuskript, fast ohne aufzublicken, verlas er eine 25-minütige Erklärung. Die zentrale Aussage lautete: »Ich habe mich nach reiflicher Überlegung entschlossen, in die DDR zu gehen und hier zu bleiben, weil ich hier die besten Möglichkeiten sehe, für eine Wiedervereinigung und gegen die Bedrohung durch einen neuen Krieg tätig zu sein.« Heftig kritisierte er die Pläne Adenauers, Deutschland im Rahmen der Europäischen Verteidigungsgemeinschaft zu remilitarisieren. In der EVG sollten westdeutsche Truppen einem europäischen Kommando unterstellt werden. Das Vorhaben scheiterte letztlich am Veto des französischen Parlaments. Die strikte Westbindung der Bundesregierung verhindere, so John, die mögliche Wiedervereinigung – ein Vorwurf, der auch auf Adenauers direkte Ablehnung der Stalinnoten von 1952 abzielte. In ihnen hatte die Sowjetunion eine Wiedervereinigung in Aussicht gestellt, falls sich Gesamtdeutschland zu politischer Neutralität verpflichte. Ferner machte John seinem Ärger über die »Renazifizierung« der Bundesrepublik Luft. Namentlich nannte er den Vertriebenenminister Theodor Oberländer, Mitstreiter beim Hitler-Putsch von 1923 und später Führer des »Bundes |30|Deutscher Osten«, sowie Reinhard Gehlen, seinen Widersacher im Dienst des neuen Auslandsgeheimdienstes.
Im Anschluss an die Erklärung durften Journalisten Fragen stellen. Zumindest die Westjournalisten hatten diese nicht mit den SED-Organisatoren abgesprochen. Alle warteten auf ein Zeichen. John wirkte zwar nervös, ließ aber zu keinem Zeitpunkt durchblicken, mit der Pistole im Nacken zu sprechen. Der Eindruck in der westlichen Welt einschließlich der Bundesrepublik war verheerend. Der Chef des westdeutschen Inlands-Geheimdienstes stellte sich ohne Wenn und Aber in den Propagandadienst des Ostberliner Regimes. Auch Innenminister Schröder nannte John nun einen »verächtlichen Überläufer«. Der Fall schien immer klarer. Nach viermonatigen Verhören durch den KGB in Moskau und am Schwarzen Meer trat John als eine Art Handlungsreisender in Sachen Wiedervereinigung auf. Im Auftrag des »Ausschusses für Deutsche Einheit« hielt er in den großen Städten der DDR Vorträge und veröffentlichte zahlreiche Artikel. Die Themen waren stets die gleichen: die Vereinigung eines neutralen, der Sowjetunion freundlich gestimmten Deutschlands, die Altnazis in der Bundesrepublik und die Wiederbewaffnung. Für seine Propagandatätigkeit erhielt John ein großes Büro mit zwei Sekretärinnen, ein komfortables Haus direkt am Zeuthener See, eine Stadtwohnung und einen Mercedes mit Chauffeur. Zwar waren ihm rund um die Uhr zwei Bewacher zur Seite gestellt, dennoch zeigte sich John nach außen hin in seiner Rolle rundum zufrieden.
Die Westpresse reagierte immer aggressiver. Der Stern beschuldigte John, den Engländern im Krieg den Standort der Raketenanlage Peenemünde verraten zu haben. Die Bombardierung durch die Royal Air Force hatte Hunderte von deutschen Toten zur Folge. Der Welt-Chefredakteur Hans Zehrer schrieb: »Vor zehn Jahren ließ er die Kameraden, darunter seinen Bruder, in den Fängen Hitlers und Freislers zurück. Wenig später lieferte er selbst Deutsche ans Messer … Und heute wiederum liefert er Deutsche in der Sowjetzone |31|an das Messer Wollwebers (des Geheimpolizeichefs) und seiner Organe.« General Gehlen brachte Johns Verhalten auf die viel zitierte Formel: »Einmal Verräter, immer Verräter.«
Die Rache der Generäle
Gehlens Hieb traf ins Mark. Er offenbarte, wie zerrissen die fünfjährige Republik hinter der frisch verputzten Wirtschaftswunderfassade war – und was die schweigende Mehrheit der Deutschen von den Widerstandskämpfern hielt, die emigriert waren und aufseiten der Alliierten gegen Deutschland gekämpft hatten. Es besteht kein Zweifel daran, dass John fest hinter seinen Vorwürfen vom 11. August stand. Seine gesamte Biografie stand hinter ihnen. Er hasste die Nazis abgrundtief, er hasste das Militär, und wie die Verschwörer des 20. Juli wünschte er sich, dass ein geeintes Deutschland seinen eigenen, friedlichen Weg ging. Der Blick auf Johns bisheriges Leben ließ seinen Wechsel über die Fronten des Kalten Krieges erklärbar erscheinen, wenn auch nicht weniger verächtlich.
Otto John, Jahrgang 1909, wuchs als Sohn eines Beamten in Wiesbaden auf. Er studierte Jura und ging als Syndikus zur Deutschen Lufthansa. Die Nazis waren ihm von Anfang an unsympathisch. In der Hauptverwaltung der Fluggesellschaft lernte er den Abteilungsleiter Klaus Bonhoeffer kennen, den Bruder des oppositionellen Pastors Dietrich Bonhoeffer. Über ihn fand er Zugang zur Widerstandsgruppe um den liberalen Richter Hans von Dohnanyi, aus der sich einige der Verschwörer des 20. Juli rekrutieren sollten. Als Jurist bei der Lufthansa durfte John in neutrale Länder reisen. Für die Widerstandsgruppe übernahm er fortan Kurierdienste, insbesondere nach Spanien, wo er Kontakt mit britischen Geheimdienstagenten aufnahm. Als das Attentat in der Wolfsschanze scheiterte, setzte sich John per Flugzeug von Berlin nach Madrid ab. Da es dort von Gestapo-Spitzeln nur so wimmelte, floh er mithilfe der |32|Briten über Lissabon weiter nach England. Hier arbeitete er, wie viele deutsche Hitler-Gegner, für den deutschsprachigen »Soldatensender Calais«, der die Moral der deutschen Soldaten untergraben sollte.
Nach dem Krieg überprüfte John im Auftrag der britischen Entnazifizierungsbehörde »Control Office for Germany and Austria« deutsche Militärs und SS-Führer auf deren Rolle und Schuld im Dritten Reich. Mehrfach trat er auch als Zeuge, Übersetzer und Rechtsberater bei Kriegsverbrecherprozessen auf, unter anderem in dem Verfahren gegen den ehemaligen Feldmarschall Erich von Manstein, das im Jahr 1949 für großes Aufsehen sorgte. Von Manstein hatte sich auch unter den Alliierten den Ruf eines fähigen und ehrbaren Soldaten erworben, der im Krieg »sauber« geblieben war. Nicht zuletzt seiner Aussage verdankte der deutsche Generalstab, dass er in Nürnberg nicht als »verbrecherische Organisation« verurteilt worden war. Churchill hatte sich gegen eine Anklage von Mansteins ausgesprochen und sich persönlich einer Spendenaktion zu dessen Verteidigung angeschlossen.
Wie viele seiner Kameraden behauptete von Manstein, von den Judenmorden in Russland erst nach Kriegsende erfahren zu haben. Otto John hatte das Kriegstagebuch von Mansteins 11. Armee als juristischer Treuhänder der Briten aufbewahrt. Einige Zeilen darin waren überklebt. John legte die Stelle wieder frei, folgende Sätze traten hervor: »Der neue Befehlshaber (von Manstein) wünscht nicht, dass Offiziere bei der Erschießung von Juden zusehen. Das ist eines deutschen Offiziers nicht würdig.« John erschütterte damit die Glaubwürdigkeit des militärischen Denkmals. Die Militärrichter verurteilten von Manstein zu achtzehn Jahren Haft. Die deutschen Generäle, die wie Gehlen in der Bundesrepublik wieder zu Einfluss kamen und mehr oder weniger offen die Restauration betrieben, sollten John diese Aussage nie verzeihen.
Die Rückkehr nach Deutschland wurde John nicht gerade leicht gemacht. Eine Bewerbung im Auswärtigen Amt scheiterte trotz |33|bester Referenz: Theodor Heuss setzte sich für ihn ein. John vermutete wohl mit Recht, dass sich die Manstein-Verehrer im Ministerium quer legten. Auf den Posten im neu gegründeten Bundesamt für Verfassungsschutz geriet er dann durch Zufall. Zwölf Bewerber waren durchgefallen. »Wir hatten keinen anderen mehr. Wir waren ausverkauft«, entschuldigte sich die Bonner Ministerialbürokratie später. Auch die drei alliierten Sicherheitsdirektoren hatten die Suche nach einem idealen Bewerber offenbar aufgegeben. Adenauer, der John nur ein einziges Mal empfing, war von Anfang an skeptisch: »Er gefällt mir nicht«, lautete das knappe Urteil des Kanzlers bereits 1950. Vier Jahre später sah er sich bestätigt und war froh, von Anfang an Gehlens Spionageorganisation in Pullach mehr Gewicht eingeräumt zu haben.