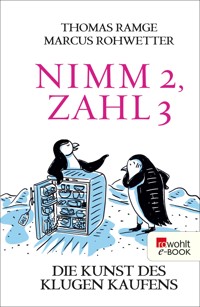
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Klüger shoppen! Flüge gibt es angeblich für 19 Euro, Wimperntusche verspricht «Killer Black Big & Beautiful Boom Volume», Facebook wird zur digitalen Tupperparty und bei Maklern sind immer «schon mehr als 80 Prozent aller Wohnungen verkauft». Wie soll man in diesem Marketing-Tollhaus eigentlich gute Kaufentscheidungen treffen? In welche psychologischen Fallen tappen wir als Käufer, und wie können wir uns dagegen wappnen? Kluge Konsumenten sind entspannt. Sie lassen sich nicht über den Tisch ziehen, weil sie die Tricks der Werber und Verkäufer durchschauen. Sie lassen sich ihren Spaß am Konsum aber auch nicht durch oberkritische Verbraucherschützer vermiesen. Dieses Buch lehrt die Kunst des klugen Kaufens. Denn natürlich werden wir gelegentlich für dumm verkauft – aber selbst dann können wir immer noch den Preis hochtreiben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 191
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Thomas Ramge • Marcus Rohwetter
Nimm 2, zahl 3
Die Kunst des klugen Kaufens
Über dieses Buch
Klüger shoppen!
Flüge gibt es angeblich für 19 Euro, Wimperntusche verspricht «Killer Black Big & Beautiful Boom Volume», Facebook wird zur digitalen Tupperparty und bei Maklern sind immer «schon mehr als 80 Prozent aller Wohnungen verkauft». Wie soll man in diesem Marketing-Tollhaus eigentlich gute Kaufentscheidungen treffen? In welche psychologischen Fallen tappen wir als Käufer, und wie können wir uns dagegen wappnen?
Kluge Konsumenten sind entspannt. Sie lassen sich nicht über den Tisch ziehen, weil sie die Tricks der Werber und Verkäufer durchschauen. Sie lassen sich ihren Spaß am Konsum aber auch nicht durch oberkritische Verbraucherschützer vermiesen.
Dieses Buch lehrt die Kunst des klugen Kaufens. Denn natürlich werden wir gelegentlich für dumm verkauft – aber selbst dann können wir immer noch den Preis hochtreiben.
Vita
Thomas Ramge, Jahrgang 1971, ist Technologie-Korrespondent des Wirtschaftsmagazins brand eins und schreibt als Contributing Editor regelmäßig für The Economist. Er war Redakteur beim SWR, Politischer Korrespondent bei Deutsche Welle TV und Chefredakteur des Berater-Magazins think:act. Thomas Ramge wurde mit diversen Journalistenpreisen ausgezeichnet. Er hat bis heute zehn Sachbücher veröffentlicht, zuletzt erschien bei Rowohlt «Montags könnt ich kotzen».
Marcus Rohwetter, Jahrgang 1973, ist Wirtschaftsredakteur und Kolumnist bei der Wochenzeitung Die Zeit. Er wurde für seine Arbeiten vielfach ausgezeichnet, zuletzt mit dem Georg-von-Holtzbrinck-Preis für Wirtschaftspublizistik, dem Helmut-Schmidt-Journalistenpreis und mit dem Otto-Brenner-Preis für kritischen Journalismus. Seit 2012 schreibt er im Wirtschaftsteil der Zeit seine wöchentliche Kolumne «Quengelzone».
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, Juni 2016
Copyright © 2016 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Umschlaggestaltung ZERO Werbeagentur, München
Umschlagabbildung Oliver Weiss Illustration
ISBN 978-3-644-56771-9
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Inhaltsübersicht
Vorwort
Kapitel 1 Kampfzone Supermarkt
Widerstand ist zwecklos
Die Logik der Supermärkte
Kochen wie in Bullerbü
Käseschulden
Das Rätsel der Küchenrolle
Fliegende Eier
Limitierte Edition aus kontrolliertem Anbau
Kapitel 2 Im Wellness-Rausch
Wimperntusche mit Black-Boom-Volume-Effekt
Bis zu 70 Prozent auf alles
Salze, Kugeln, Zaubertränke
Dermatologisch getestet
Charity-Slalom
Haben Sie mal 1,12 Euro?
Love me Tinder
Kapitel 3 Edler Wein und feine Speisen
Das Ankergericht
All you can beat
Jesus und die vollen Teller
Nackte Zahlen
Vollmundig abgerundet
Mondschein und Rosenquarz
Behalten Sie den Rest
Kapitel 4 Unterwegs in der mobilen Gesellschaft
Strandnah und verkehrsgünstig
Das Venedig des Nordens
Flüge ab 19 Euro
Heul doch, HON!
Sparpreis-Tickets und andere optische Täuschungen
Tankeschön
Freude am Fahren
Kapitel 5 Irrgarten Internet
Kuratiertes Shoppen
Retarget the target
Die iPhone-Falle
Freunden gefällt das
Quengelware
Luftpaketpost
Schrei vor Glück – und schick’s zurück
Kapitel 6 Reich sind immer nur die anderen
Massagen für die Schweine
Hilfe, meine Rentenlücke!
Vollpfosten-Fonds
Hochstapeln für Anfänger
Bankberater oder Robo Advisor
Der Duft des Geldes
Totgefürchtet ist auch gestorben
Kapitel 7 Vier Wände, viele Fragen
In guten wie in schlechten Lagen
Schon mehr als 80 Prozent aller Wohnungen verkauft
Der Immobilienkredit als Zeitmaschine
Der Fluch des Selbermachens
Betongold?
Der menschliche Makler
Finca-Phantasien
Nachwort
Vorwort
Ratgeber sind doof. Deswegen ist dieses Buch auch kein Ratgeber. Sie finden hier keine Tipps, welcher Stromtarif momentan der günstigste ist oder welcher Bäcker die billigsten Brötchen anbietet. Das ändert sich ohnehin jeden Tag. Und wahrscheinlich haben Sie genauso wenig Lust und Zeit wie wir, sich ständig damit zu befassen, wie sich 20 Cent sparen lassen. Sie haben Besseres zu tun. Aber für dumm verkaufen lassen wollen Sie sich auch nicht – stimmt’s?
Dann sind Sie hier richtig. Die Kunst des klugen Kaufens besteht nicht in der Schnäppchenjagd. Sie besteht in einem aufgeklärten – und im Rahmen Ihres Budgets – entspannten Umgang mit Geld. Kluge Käufer wissen, wie sie informierte Kaufentscheidungen treffen, und lassen sich nichts aufschwatzen.
Erlernen Sie diese Kunst. Sie besteht darin, Verhaltensmuster der Werber und Verkäufer zu erkennen.
Wir haben uns in die Welt des Konsums gestürzt, Marketingkampagnen auf uns wirken lassen, Verkaufsgespräche belauscht, Selbstversuche unternommen und dabei Moden und Methoden untersucht. Wir sind immer wieder auf die im Kern gleichen Maschen gestoßen, mit denen wir verführt, abgelenkt und manipuliert werden sollen. Das ist mal sympathisch, mal hinterhältig, mal offenkundig und mal kaum zu bemerken. Aber es passiert im Supermarkt genauso wie im Restaurant oder bei Online-Vergleichsportalen für Urlaubsreisen.
Achtung, Verkaufstrick!
Wenn Sie dieses Buch gelesen haben, gehen Sie mit offeneren Augen durch die Warenwelt. Dann werden auch Sie diese Muster erkennen und verstehen, wie oft unser Alltag nur ein ökonomisches Spiel ist – bei dem besser dasteht, wer die Regeln beherrscht.
Mal gewinnen wir bei diesem Spiel, mal verlieren wir. Und natürlich werden wir gelegentlich für dumm verkauft. Aber selbst dann können wir immer noch den Preis hochtreiben.
Thomas Ramge & Marcus Rohwetter
Kapitel 1Kampfzone Supermarkt
Der Wochenendeinkauf für die ganze Familie
Widerstand ist zwecklos
Warum wir kaufen, was wir eigentlich gar nicht wollen
Wir möchten, dass die Milchbauern anständig bezahlt werden, wählen am Wochenende aber das Sonderangebot im Discounter. Wir kennen die Zustände in asiatischen Textilfabriken, finden die Sneaker aber so cool, dass wir sie unbedingt haben müssen. Und packen schnell noch zwei Tafeln Schokolade, Kartoffelchips und ein Glas Erdnussbutter ein, obwohl wir ganz genau wissen, dass wir eigentlich schon dick genug sind.
Immer wieder tun wir, was wir eigentlich nicht wollen. Oder, präziser gesagt, was unser Verstand nicht will. Unser gieriges Inneres will das schon. Es will es billig, schnell, schön, süß und kalorienreich. Manche Forscher nennen das den Neandertaler in uns. Andere sprechen vom Reptilien-Teil des Gehirns oder von dem Kampf zwischen Bauch und Kopf, zwischen Verstand und Gefühl. Letztlich geht es aber immer um das Gleiche: um die starken und die schwachen Momente, die jeder von uns kennt.
Meine schwachen Momente habe ich unter anderem jeden Abend. Zwischen 20 und 23 Uhr, wie ich durch konsequente Selbstbeobachtung herausgefunden habe. Nicht davor und nicht danach, aber in dieser Zeit bin ich bereit, zu fast allem «Ja» und «Amen» zu sagen. Meine Widerstandskräfte sind in diesen drei Stunden völlig erschöpft, weil ich während des zurückliegenden Tages im Büro schon zu oft «Nein», «Jetzt nicht» oder «Kommen Sie später wieder» gesagt habe, um mir unangenehme Arbeit vom Hals zu halten. Nach 23 Uhr schlafe ich für gewöhnlich ein, aber bis dahin möchte ich einfach mal «Ja» sagen dürfen. Und zugreifen. Dann suche ich in meinem Küchenschrank nach einer Tafel Schokolade und rede mir ein, dass ich mich jetzt guten Gewissens belohnen darf. Immerhin habe ich es bis hierhin geschafft. Meine Tage sind schließlich äußerst anstrengend. Es geht nicht nur Ihnen so.
Nachdem ich «Ja» gesagt habe, fühle ich mich schlecht. Zum einen, weil ich nachgegeben habe. Und zum anderen, weil ich mir die Falle, in die ich getappt bin, selbst gestellt habe. Warum kaufe ich das Zeug auch und lege es mir griffbereit in den Küchenschrank?
Natürlich kenne ich die Antwort: damit ich, sobald ich Lust auf Schokolade verspüre, sofort welche bekomme. So weit ist es schon gekommen. Niemals würde ich mir abends noch mal die Schuhe anziehen, zur Tankstelle oder zum Kiosk gehen und dort eine Tafel kaufen. Dazu bin ich zu faul. Nach einem langen Arbeitstag habe ich gerade noch genügend Kraft, um den Arm zu heben, den Schrank zu öffnen und gierig meine Schätze zu plündern.
Das ist der Impuls. Impulse zu erzeugen und auszubeuten gilt als höchste Kunst des Verkaufens. Das funktioniert prinzipiell genauso wie in der Physik: Bei Impulsen geht es darum, einen Körper in Bewegung zu setzen. In diesem Fall meinen Körper in Richtung Schokolade.
Das Problem mit Impulsen ist, dass sie sich schnell verflüchtigen. Noch während meine Hand zur Schokolade greift, beginnt der Verstand im Kopf dagegen zu arbeiten: Das ist ungesund! Du bist eh schon zu fett! Lass es besser sein! Gelingt es dem Verstand, die Handbewegung zu unterbrechen, verpufft der Kaufimpuls und geht ökonomisch gesehen ins Leere. Dann droht Stagnation.
Stagnation wollen Schokoladenfabrikanten und Einzelhändler als Allerletztes, und sie wollen auch nicht, dass mein Kühlschrank vielleicht einmal leer ist. Ein leerer Schrank bedeutet ebenfalls Stagnation. Schokoladenfirmen wollen, dass ich sofort bekomme, was ich will. Bevor ich zu denken beginne und es mir vielleicht auch einmal anders überlege. Denken hält vom Kaufen ab. Denken ist aus betriebswirtschaftlicher Perspektive eine Gefahr. Kunden sollen kaufen, nicht denken.
Sehr schön kann man das am Beispiel von Nestlé beobachten. Nestlé ist einer der größten Hersteller von Lebensmitteln weltweit, und der Konzern mit Sitz im schweizerischen Vevey investiert tatsächlich Geld, um Menschen zu gesunder Ernährung anzuhalten. Das ist die Sache mit dem Verstand, und damit wird auch kräftig geworben. Allerdings setzt Nestlé auch jedes Jahr knapp zehn Milliarden Schweizer Franken mit dem Verkauf von Süßigkeiten um, Eiscreme noch nicht einmal mit eingerechnet. Das ist die Sache mit dem Gefühl, und die ist finanziell viel attraktiver.
Während eines Besuchs bei Nestlé vor etlichen Jahren bin ich mal in eine Veranstaltung gestolpert, bei der Konzernmitarbeiter diskutierten, wo sich noch zusätzliche Verkaufsautomaten für Süßigkeiten aufstellen ließen. Idealerweise dort, so wurde man sich schnell einig, wo Menschen warten und sich langweilen. An Bahnsteigen beispielsweise. Dort ist es kalt und windig, die Leute sind genervt und somit empfänglich für kleine süße Verführungen. Dort lassen sich Kaufimpulse am allerbesten in Umsätze verwandeln. Irgendwann werden die Wartenden schon schwach.
Dass dieses Konzept noch sehr stark erweiterbar ist, hat das Unternehmen Wrigley im vergangenen Jahr herausgefunden. Der Kaugummi-Konzern hat dazu «die größte Impulsivitätsstudie seiner Firmengeschichte» durchgeführt, die Besucher von 50 Supermärkten drei Monate lang komplett analysiert und so «die impulsivsten Standorte identifiziert». Jene Orte also, an denen wir kaufen, ohne zu denken. Wrigley gibt ja selber zu, dass niemand in einen Laden geht mit «Kaugummi» auf der Einkaufsliste. Das Zeug verkauft sich eben nur, weil es im richtigen Moment da ist.
Künftig sollen Wrigley zufolge Kaugummi-Displays dort zu finden sein, wo Kunden ihren Einkaufskorb aufnehmen (dann haben sie gleich etwas, das sie reinlegen können). Auch die Wartezeit an Käse- und Fleischtheken will das Unternehmen nutzen, um Impulse auszulösen. Und selbst bei Tiefkühlkost will es Potenzial für spontane Kaugummikäufe ausgemacht haben.
Impulsmäßig unschlagbar bleibt aber nach wie vor der Bereich an der Kasse. Dort sieht es nicht ohne Grund so aus wie in meinem Küchenschrank: überall Schokoladenriegel. Mit Nüssen und Mandeln. Mit Keks und ohne. Lang und kurz, breit und dünn, einlagig oder doppelstöckig. Kaugummi natürlich auch. Bunt verpackt, klein, schnell und billig. Was immer ich will.
Alles ist nur eine Armlänge entfernt so angeordnet, dass ich es mit einem einzigen Griff erreichen kann, sobald mich der Impuls packt. Und das tut er zuverlässig. Das EHI Retail Institute hat herausgefunden, dass die Kassenzone, obwohl sie in der Regel nur ein Prozent der Fläche eines Supermarkts ausmacht, für bis zu sieben Prozent des Umsatzes sorgt.
Kein Wunder. Hier muss ich zwangsläufig vorbei, hier komme ich nicht weg. Wenn ich in der Warteschlange eingepfercht bin und das ganze Zeug ständig vor der Nase habe, kann ich dem Impuls schwer widerstehen. Manchmal hilft es, eine bewusste Trotzhaltung einzunehmen. Dann sage ich mir: Ich kaufe dieses Zeug schon deshalb nicht, weil ich beweisen will, dass mein Verstand jeder Verkaufspsychologie überlegen ist.
Auf diese Weise kann ich widerstehen. So etwa eine Minute lang.
Fatal wird es, wenn vor mir in der Schlange eine Rentnerin steht. Erst müht sie sich ab, ihr Zeug aufs Band zu legen. Dann überlegt sie, ob sie vielleicht lieber drei statt zwei Dosen Ananas kaufen sollte, weil doch heute Abend Besuch kommt. Und schließlich fängt sie an, umständlich nach Kleingeld zu kramen, bevor sie lieber mit Karte zahlen will, deren Geheimzahl sie doch sicher irgendwo notiert hat. Nur wo?
Und während der ganzen Zeit stehe ich vor der Schokolade. Irgendwann werde ich schwach.
Ich habe nichts gegen Rentner. Allerdings frage ich mich, ob Rewe, Edeka und andere Einzelhändler bewusst Ruheständler als menschliche Kaufhindernisse beschäftigen. Damit sie Kunden wie mich absichtlich aufhalten und ungesunden Krempel kaufen lassen. Ein perfider Plan wäre das. Ich kann ihn aber nicht beweisen.
Die Logik der Supermärkte
In zehn Schritten zum vollen Einkaufswagen
Die Waren hoch stapeln, die Preise niedrig halten. Oder, im amerikanischen Original: «Pile it high, sell it low». Das war der Werbeclaim von King Kullen, dem ersten echten Supermarkt der Wirtschaftsgeschichte. Er eröffnete 1930 in einer Garage im New Yorker Stadtteil Queens. Sechs Jahre später gab es in New York schon 17 King-Kullen-Filialen. Der Siegeszug der Selbstbedienung im Lebensmitteleinzelhandel hatte begonnen – und damit die Verbannung von Tante Emma in die ökonomische Nische.
Der Gründer der ersten Supermarkt-Kette, Michael J. Cullen, beließ es nicht beim Hochstapeln und Preisdrücken. Er feilte am Aufbau seiner Läden mit dem simplen Ziel: An der Kasse sollte der Kunde möglichst viele Waren im Einkaufskorb haben. An Cullens Ziel hat sich bis heute nichts geändert, aber die Methoden sind weit raffinierter als damals. Supermarkt-Designer verführen mit vielen psychologischen Tricks zum Kauf, es beginnt beim Parkplatz und endet in der Quengelzone. Das sind die zehn wichtigsten Schritte, um unsere Einkaufwagen zu füllen:
Erster Schritt: Auf die Wagengröße kommt es an. Und nein, Sie sind nicht geschrumpft, das sieht nur so aus. In Wahrheit werden die Einkaufswagen größer. Denn bei doppelter Wagengröße kaufen Kunden im Schnitt 40 Prozent mehr ein. Weil eine kleine Packung Spaghetti im großen Wagen so einsam und verloren aussieht. So, als hätte man noch fast gar nichts gekauft.
Zweiter Schritt: Rechts rein! Warum liegt der Eingang von Lebensmittelmärkten immer rechts? Weil die Konsumforschung herausgefunden hat: Die meisten Kunden fühlen sich wohler, wenn sie ihre Einkaufsrunde gegen den Uhrzeigersinn drehen. Wer sich besser fühlt, kauft mehr.
Dritter Schritt: Wohlfühltemperatur. Aus dem gleichen Grund sollte es in einem Supermarkt immer exakt 19 Grad haben. So sieht es zumindest das Einzelhandels-Lehrbuch vor. 19 Grad sind nicht zu warm, um träge zu werden. Nicht zu kalt, um zu frösteln. Das ist die ideale Kauf-Temperatur.
Vierter Schritt: Frischer Start. Eigentlich ist es ja total unpraktisch, dass es Erdbeeren und Salat ganz vorn im Geschäft gibt. Später auf der Einkaufstour, wenn die Tomatendosen, Milchtüten und Getränke in den Wagen kommen, müssen wir die empfindlichen Frischwaren immer wieder nach oben sortieren. Aus Sicht des Händlers ist das dennoch sinnvoll. Im Frischeparadies am Eingang gehen den Kunden die Sinne auf. Sie bekommen Appetit und gute Laune. Sie vertrödeln Zeit. Das fördert unvernünftige Kaufentscheidungen im späteren Verlauf.
Fünfter Schritt: Die Regaltrichter. Schauen Sie bitte mal ganz bewusst geradeaus, wenn Sie durch die Gänge laufen. Unbewusst tun Sie das sowieso. Deshalb stehen an den Stirnseiten der Regale – den sogenannten Endcaps – immer Waren mit besonders hoher Marge, die überdurchschnittlich oft gekauft werden.
Sechster Schritt: Auf Augenhöhe. Dass sich die günstigen Produkte auf Kniehöhe und darunter befinden, weiß jeder preisbewusste Kunde. Bücken lohnt sich. Nur wenigen Kunden ist bewusst, dass die Regale auf Augenhöhe nicht nur für sie teuer sind. Wollen die Hersteller, dass ihre Produkte dort stehen, müssen sie den großen Einzelhandelsketten oft «placement fees» zahlen. Das sind Gebühren für den besonderen Platz. Die der Kunde natürlich mitbezahlt, wenn er diese wohlplatzierten Waren kauft.
Siebter Schritt: Der lange Weg zum Kühlregal. Butter, Milch und andere schnell verderbliche (also häufig zu kaufende) Produkte finden Sie meist im hinteren Teil des Marktes. Der Weg dorthin ist weit, und wir müssen ihn immer wieder hinter uns bringen. Was viele weitere Gelegenheiten zu unvernünftigen Impulskäufen mit sich bringt.
Achter Schritt: Backstuben-Inflation. Selbst Discounter wissen mittlerweile, dass der Duft von frischem Brot hungrig macht. Hungrige Kunden laden den Wagen eher voll. Die Aufbacköfen hinter den Selbstbedienungs-Brot-Theken stehen deshalb oft ebenfalls im hinteren Teil des Ladens. Sie regen die Sinne an, wenn die Verführungskräfte der Obst- und Gemüse-Abteilung abgeklungen sind.
Neunter Schritt: Der Shop im Shop. Im Innern von Supermärkten wirken die Abteilungen für Kosmetik oder Wein meist wie eigene Welten. Schöneres Licht, edle Regale, mehr Platz – all das ergibt Sinn, weil wir in anderen Welten auch andere Preise akzeptieren. Höhere nämlich. Aber keine Angst: Direkt neben der Luxus-Welt finden sich oft die Bereiche mit den Sonderangeboten. Wenn wir dort zugreifen, können wir unser Spargewissen gleich wieder beruhigen und den Luxuskonsum innerlich rechtfertigen. Nebenbei lassen wir noch etwas mehr Geld im Laden.
Schritt zehn: Die Quengelzone heißt Quengelzone, weil Kinder in ihr nach Süßigkeiten quengeln. Für alle Kunden, die keine kleinen Kinder bei sich haben, wäre der Begriff Belohnungszone passender. Sie haben einen anstrengenden Einkauf hinter sich gebracht. Das verdient eine Belohnung!
Kochen wie in Bullerbü
Unsere weltfremde Sehnsucht nach natürlichen Lebensmitteln ohne Chemie
Es gibt immer einen Grund, sich Sorgen zu machen. Weil immer mehr gefährliche Stoffe in Lebensmitteln auftauchen. Das sind Stoffe, mit denen Menschen regelmäßig in Berührung kommen, oft ohne es zu wissen, und die ihre Gesundheit massiv beeinträchtigen können.
Einer dieser Stoffe ist Dihydrogenmonoxid. Diese Chemikalie wird von Landwirten traditionell zur Steigerung ihrer Ernteerträge verwendet und im großen Stil auf die Felder gesprüht. Sie ist deshalb so beliebt, weil sie vergleichsweise billig und leicht zu bekommen ist. Und abgesehen davon ist die Verwendung von Dihydrogenmonoxid, das auch als Mittel zur Brandbekämpfung eingesetzt wird, in der Landwirtschaft sogar völlig legal. Es findet sich in nahezu allen Lebensmitteln, in Obst und Gemüse, in Brot, Limonaden, Fertigsoßen und sogar in Babybrei. Dabei ist der Stoff äußerst gefährlich und kann – etwa in reiner Form eingeatmet – sogar tödlich wirken. Eine wahrhaft teuflische Chemikalie.
Die naturwissenschaftlich Interessierten haben wahrscheinlich längst erkannt, um was es hier geht. Um Wasser. Ganz normales Wasser. Auch bekannt als H2O, was schon etwas chemischer klingt. Doch erst die unkonventionelle, gleichwohl ebenfalls zutreffende Bezeichnung Dihydrogenmonoxid lässt es so richtig gefährlich erscheinen. Was bei Wasser ja auch wiederum nicht ganz falsch ist, denken Sie nur an das Risiko des Ertrinkens. Das Beispiel soll nur eines illustrieren: unseren teilweise irrationalen Umgang mit Chemie.
Ausgedacht haben sich den Spaß Studenten oder Professoren an der Universität von Kalifornien in Santa Cruz schon in den späten achtziger Jahren. Ein wunderbarer Schocker für all jene verunsicherten Konsumenten, die auch heute permanent glauben, sie würden sich durch ihre Nahrungsmittel vergiften. Dass die Lebenserwartung permanent steigt, vermag als Gegenargument ebenso wenig zu überzeugen wie die Tatsache, dass man heute wahrscheinlich eher an Verfettung und Überzuckerung stirbt als an irgendwelchen Giftstoffen in der Nahrung. Aber geschenkt. Menschen sind so.
Aus diesem Grund lässt sich die Angst vor der Chemie auch wunderbar instrumentalisieren – und zwar von praktisch allen Unternehmen, die Lebensmittel herstellen. Die ganze Biobranche lebt von dieser Furcht. Zwar sind auch ihre Produkte letztlich nichts anderes als das Ergebnis von chemischen Prozessen. Aber es dürfte kein Zufall sein, dass sich gerade in Bio-Supermärkten Produkte von Firmen häufen, deren Namen an eine Bullerbü-artige und irgendwie naive Märchenwelt erinnern. Oder woran denken Sie bei Markennamen wie Zwergenwiese und Rapunzel?
Kein Wunder, dass das zieht. Die klassische Lebensmittelwirtschaft steht ja auch schlecht da. «Drei Viertel der befragten Verbraucher stimmen der Aussage zu, dass die Angaben auf der Verpackung Lebensmittel oft besser darstellen, als sie in Wirklichkeit sind», ergab 2013 eine repräsentative Umfrage der Göttinger Unternehmensberatung Agrifood Consulting im Auftrag der Verbraucherzentralen. Für viele Unternehmen ist das allerdings kein Grund, ihre Verpackungen zu ändern. Ganz im Gegenteil, sie arbeiten an immer raffinierteren Methoden der Vertuschung.
Gut beobachten lässt sich das im Deutschen Zusatzstoffmuseum in Hamburg. Das ist eine kleine, feine und liebevoll kuratierte Ausstellung über die Zaubertricks der Lebensmittelhersteller. Denen geht es vor allem darum, verhasste E-Nummern von den Zutatenlisten verschwinden zu lassen. Weil die nach böser Chemie klingen. «Clean Label» heißt das erklärte Ziel.
Im Zusatzstoffmuseum findet sich die Erklärung dafür, warum beispielsweise E210 (das ist der Konservierungsstoff Benzoesäure) oder der Geschmacksverstärker Natriumglutamat inzwischen seltener auf Zutatenlisten stehen. Die E-Nummer 210 putzen Lebensmittelhersteller beispielsweise von der Packung, indem sie spezielle Fruchtzubereitungen aus Blaubeeren verwenden. Die enthalten von Natur aus Benzoesäure, tauchen dann aber nur in unverfänglicher Form in der Zutatenliste auf – eben als Fruchtzubereitung. Und für Natriumglutamat stehen längst mehr als ein Dutzend Alternativen parat, die ebenfalls den Geschmack verstärken. Zunächst war es Hefeextrakt, inzwischen macht eine Essenz aus Tomatensaft Karriere. Der Name ändert sich, die Wirkung bleibt identisch. Chemie ist es in jedem Fall.
Das gilt erst recht für die Milch, die zu jeder Bullerbü-Idylle gehört wie dunkelrot gestrichene Schwedenhäuschen. Milch ist ein klassisches Naturprodukt und zugleich der Traum eines jeden Lebensmittelchemikers. Denn sie lässt sich im Labor in zahllose Bestandteile aufspalten, taucht auf Zutatenlisten aber immer nur als harmloses Milcherzeugnis auf. Dabei lassen sich aus Milchproteinen ebenfalls Geschmacksverstärker gewinnen, billige Fett-Ersatzstoffe basteln oder Konservierungsmittel für Würste. Sie lassen sich sogar in Fasern verwandeln, aus denen Unternehmen bereits heute Stoffe für Kleidung fertigen oder Teile für den Innenausbau von Autos. Kühe machen’s möglich.
Bei genauer Betrachtungsweise verhält es sich mit Milch also nicht anders als mit Dihydrogenmonoxid. Beides ist Natur. Beides ist Chemie. Und zwar immer und überall. Es kommt lediglich darauf an, was genau man damit anstellt.
Käseschulden
Warum Probierhappen nur wenig mit probieren zu tun haben
Mögen Sie mal unseren Käse kosten?» Das kennen Sie. Ein Würfel, aufgespießt auf einem Zahnstocher, gerne national markiert mit einem Schweizer, französischen oder niederländischen Fähnchen. Eine Dame in weißer Schürze lächelt hinter einem kleinen Stand im Supermarkt. Sie zögern, zuzugreifen, zumindest wenn Sie nicht zu den rund zehn Prozent gehören, die sich in Experimenten zu Kooperationsverhalten als eiskalte Ego-Spieler outen. Denn Sie wissen ja bereits, bevor Sie probieren: Es wird Ihnen ein ungutes Gefühl bereiten, den Käse zu essen und dann ungerührt Ihren Einkaufswagen weiterzuschieben. Und zwar völlig egal, ob Ihnen das Produkt geschmeckt hat oder nicht, ob es Ihnen womöglich zu teuer erscheint oder Sie die Packungsgröße nicht mögen.
Die Käseprobe ist ein Marketing-Evergreen. Vermutlich gab es sie schon auf Märkten im Mittelalter. Der Betreiber eines Supermarktes im US-Bundesstaat Indiana erfand in den fünfziger Jahren eine besonders effektive Variante: Er bot seinen Kunden an, sich selbst ein beliebig großes Stück abzuschneiden. Sie durften probieren, so viel sie wollen, beschreibt es der frühe Konsumkritiker Vance Packard in seinem Buch «Die geheimen Verführer». Zwar kostete das den Supermarktinhaber ein paar Kilo seines Probierkäses. Zugleich aber verkaufte er binnen weniger Stunden fast eine halbe Tonne von dem eher mittelmäßig schmeckenden Produkt.
Der Begriff «Käseprobe» führt dabei allerdings in die Irre. Korrekt müsste es «Käseschulden» heißen.





























