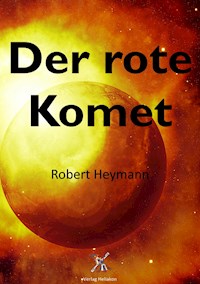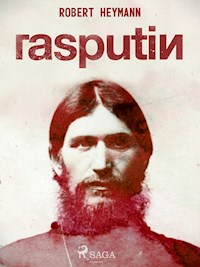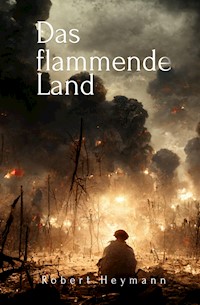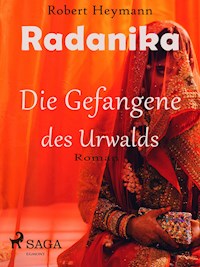Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
In diesem Roman ist keine Hauptfigur erfunden. Dieser italienische Untersuchungsrichter hat so gelebt, wie es hier geschildert wird, die unglückliche Heldin trägt zwar nicht ihren eigenen Namen, aber alles, was sie hier erlebt, erlebte sie auch in echt. Robert Heymann schreibt mit diesem Roman einen Beweis für die Ungerechtigkeit des Justizsystems. Alles beginnt in Bologna, wo Julia Straglia sich vom jungen Grafen Martini Geld leihen soll – für ihren Freund Vittorio. Doch Martini öffnet nicht, Vittorio rastet aus, und Julia rennt nach Hause, wo sie all seine Sachen wutschnaubend aus dem Fenster werfen will. Da entdeckt sie ein Messer, mehr als das: ein Stilett! Und es ist besudelt mit frischem Blut ...-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 267
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Hölle um Maria Giotti
Robert Heymann
SAGA Egmont
Die Hölle um Maria Giotti
Copyright © 1950, 2018 Robert Heymann und Lindhardt og Ringhof Forlag A/S
All rights reserved
ISBN: 9788711503737
1. Ebook-Auflage, 2018
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für andere als persönliche Nutzung ist nur nach
Absprache mit Lindhardt og Ringhof gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com und Lindhardt og Ringhof www.lrforlag.dk – a part of Egmont www.egmont.com
Einleitung.
„Die Hölle um Maria Giotti“ ist ein Kriminalroman aus dem Leben. Unwesentliches hat dichterische Freiheit hinzugefügt, Nebensächliches ist zeitlich verändert worden. Ich habe den Versuch unternommen, dem Kriminalroman die Form zu geben, die unsere Zeit, ihre Probleme und die Wahrheit, der jede Feder dienen soll, zu fordern haben. In diesem Roman ist keine Hauptfigur erfunden, keiner dieser verschiedenartigen Charaktere ist willkürlich gezeichnet. Dieser italienische Untersuchungsrichter lebt, er hat gelebt, er hat so, wie es geschildert ist, nicht anders, seine Sache, die nicht die Sache des göttlichen Rechtes war, geführt.
Diese unglückliche Heldin trägt aus rein menschlichen Rücksichten — wie alle Personen — nicht ihren wahren Namen. Alles aber ist wahr, alles, was sie erlebt, erlitten, erduldet hat! Jeder Schimpf ist wahr, keine dieser schreienden Ungerechtigkeiten einer in sich selbst erstarrten Justiz ist erfunden.
Dieser Roman beweist, daß das System der Justiz, die Voruntersuchung, die Allmacht des Richters, die Hilflosigkeit überraschter Angeklagter, daß die forensischen Martern, die Spitzfindigkeit der Untersuchung, die Heuchelei der öffentlichen Meinung, der Ehrgeiz von Beamten, die Abhängigkeit der Geschworenen von dieser „Öffentlichen Meinung“ —, daß dies zusammen immer von neuem „Stimmungsurteile“ begünstigt. — Dies ist der nicht gewollte, aber nicht zu verbergende Sinn dieses Romans. — Es gibt keinen Kriminalfall, der nichts bewiese — und wäre es schließlich nur die immer wiederkehrende Wahrheit von der Unvollkommenheit aller menschlichen Einrichtungen.
Wenn das Leben die besten, spannendsten und vielleicht aufregendsten Romane schreibt — dann haben sie vor den erfundenen Romanen den Vorzug, eine Moral zu enthalten. Die gewollte Tendenz, die Tendenz um der Tendenz willen, die Absicht, tendenziös zu schildern, verstimmt. Aber die Wahrheit, die aus den lebendigen Bildern gelebter Geschehnisse heraustritt, ist klar und funkelnd wie ein Edelstein. Es ist eine alte Schwäche der Menschen, schneller zu urteilen als zu begreifen. Und es ist ein Rückfall ins Mittelalter, daß auch wir modernen Menschen so leicht geneigt sind, nach der Beurteilung schon zu verurteilen, daß so oft die Person abgeurteilt wird, nicht die Sache.
Es gibt keinen Roman ohne Problem, und wäre es das uralte der Liebe. Es sollte kein Kriminalroman geschrieben werden ohne die lebendige Wahrheit.
Berlin, Januar 1930.
Robert Heymann.
1.
Es war Herbst in Bologna, aber es herrschte sommerliche Wärme. Auch über die Via Mazzini schüttete die Sonne noch ihre Gluthitze, schmal und dürftig lag der Schatten vor dem Palazzo Bisteghi.
Julia Straglia schritt unschlüssig auf und ab. Sie schlenderte, spielte mit ihrer Tasche, griff sich in das nußbraune Haar und äugte zu Vittorio hinüber, der eben träge vom Rüsterlagäßchen herkam. Hände in den Taschen der engen Beinkleider, den Strohhut schief über dem Ohr, Zigarette im Mund. Auf dem schwarzen Rock leuchtet eine rote Nelke, aus der linken Brusttasche hängt ein gelbseidenes Tuch wie eine kleine Fahne.
Vittorio hat ein brutales, vortretendes Kinn, er schaukelt beim Gehen wie ein Weib, aber die Beine setzt er voreinander wie ein Raubtier.
„Geh schon! Geh!“ murmelt er zwischen den Zähnen, die groß und gelb vom Rauchen zwischen dem halbgeöffneten Mund sichtbar werden.
Julia zuckt die Achseln, ihre beweglichen Augen mustern nochmals schnell die verschlossenen Fenster der Wohnung des Grafen Martini. Sie zaudert, denn die Portière steht unter der Tür, die Achtzigjährige, sauber, mit schneeweißem Haar. Sieht und hört noch alles.
Was glotzt sie mich so an, denkt die Junge, steht herum wie nicht abgeholt, krumm, wie einer unserer schiefen Türme. Schließlich tritt sie mit einem Ruck ein. Geht die kühle Steintreppe empor und klingelt an der Wohnung Martinis. Nichts regt sich. Sie klingelt nochmals, horcht mit schiefgehaltenem Kopf. Julia ist von robuster römischer Schönheit. Den kleinen Kopf trägt ein kräftiger runder Hals. Ihr Gesicht ist leicht verschlafen, erinnert an eine Katze, die sich sonnt, aber der aufgeworfene Mund ist lebendig, und die roten Lippen leuchten über das ganze Gesicht.
„Madonna!“ sagt sie, geht zaudernd, kehrt noch einmal um, klingelt wieder. Wartet aber den Erfolg nicht mehr ab, geht langsam nach unten. Sie schüttelt sich und starrt in die forschenden Augen der Alten, die keinen Blick von ihr gewandt hat. Diese Augen sind die Treppe hinauf hinter ihr hergewandert und kleben noch an ihr, während Julia unschlüssig am Haustor verharrt.
Die leuchtende Straße liegt mit überhellen Konturen in dem dunklen Ausschnitt des Tores, mitten drin steht lauernd Vittorio.
Was sage ich ihm? denkt Julia, und woher Geld nehmen? Es war so fein ausgedacht, aber doch bin ich froh, daß der Graf nicht zu Hause ist. Ja, ich freue mich schon auf das enttäuschte Gesicht Vittorios, weil er mich immer quält, dieser Jettatore, dessen böser Blick mich nicht losläßt.
„Eh?“ beginnt die Alte. „Was wollen Sie hier?“
„Graf Martini öffnet nicht!“
„Hat er Sie eingeladen?“
„Das nicht. Ich wollte nur —“
„Geld fordern?“
„Geht es Sie etwas an?“
„Ja! Eine Schande und Pfui sage ich, wenn ein Mann verheiratet ist! Diese arme Frau, diese schöne Frau! Wie sie leidet! Solch ein vornehmer Mann, und gibt sich noch mit Weibern ab!“
„Ich reiße dir alle Haare aus, alte Giftkröte!“ stammelt Julia, weiß vor Zorn, mit plötzlich ganz wachen Augen. Fäuste in die Hüften gestemmt, legt sie los. Ein Wasserfall von Beschimpfungen.
Die Alte hält die Hände an die Ohren und geht, so schnell die matten Beine sie tragen, in die Wohnung.
Vittorio ist langsam über die Straße gekommen.
„Öffnet nicht?“
„Nein. Nicht zu Hause!“ Julia macht ein verängstigtes Gesicht, die Wutausbrüche Vittorios gehen ihr auf die Nerven. Aber er bleibt sonderbar ruhig, sie wundert sich. Hat er es denn gewußt?
„Gestern nicht zu Hause, vorgestern nicht zu Hause! Er hat eine andere, sage ich dir!“
Julia wiegt sich einige Augenblicke nachdenklich in den Hüften.
„Er hat keine andere. Er kennt mich lange genug. Aber warum schickst du mich zu ihm, wenn du doch siehst, daß die Fensterläden geschlossen sind, daß es zwecklos ist?“
Sie schaut ihn forschend an. Das ist gerade der Blick, der Vittorio die gute Laune verderben kann.
„Brütest du schon wieder über was?“ schreit er sie an, zerrt sie am Arm mit. „Warum soll ich das nicht tun! Woher soll ich wissen, daß er nicht da ist? Warum richtest du immer die aller dümmsten Fragen der Welt an mich, du rote Hexe?“
„Ich dachte mir doch nichts dabei!“ entgegnet Julia eingeschüchtert. „Gehen wir!“
„Gehen wir! Gehen wir!“ äfft ihr Vittorio nach. „Hast du Geld? Wovon sollen wir die Miete bezahlen, he? Es ist ein Elend! Warum sollte ich wissen, daß er nicht zu Hause ist? Habe ich ihn vielleicht umgebracht? Warum hast du ihn alle die Tage her nicht getroffen? Oder hast du ihn getroffen? Lügst du mich an?“
Er krallt die fünf Finger in ihr dichtes Haar und reißt ihr den Kopf zurück, daß sie taumelt.
„Geld! Ohne Geld ist nichts!“ Er schauspielert, ahmt Julias Stimme nach, sogar ihre Bewegungen: „Lieber Vittorio! Teurer Vittorio! Mein König! Ich liebe dich! — — Tante grazie! — Liebe! — Schaff Geld, Närrin! Geld!“
Er steht mit erhobenem Arm und spielt den tragischen Helden, mitten auf der Straße, ohne auf die Wagen zu achten, die vorüberkommen. Er spielt so oft sein Theater vor Julia, aber immer tut es seine Wirkung. Ungezählte Rollen hat er sich eingeübt, er lebt in ihnen, er glaubt, was er zusammenlügt. Bald mimt er den Sentimentalen, bald den Leidenschaftlichen, bald den Kopfabschneider. Er ist Sizilianer, — ohne Komödie kann er nicht leben. Seine verschleierten Augen schimmern manchmal dunkel wie ein Sumpf, grün wie Oliven. Wenn er eine Träne in ihnen zerdrückt, wie jetzt, sieht er erbärmlich aus — nur nicht für Julia.
„Ich habe kein Glück“, deklamiert er. „Tante Nana hat es immer gesagt, ich habe die schlechtesten Karten, die sie je einem Manne gelegt hat! Immer Pique Zehn neben Herzdame!“
Julia tröstet ihn. Sie wird Geld besorgen! Sie liebt ihn! Er hat doch Glück in der Liebe! —
Aber er gibt ihr einen Stoß, daß sie in den Rinnstein fällt.
„Du hast Geld von ihm bekommen“, schreit er sie plötzlich an. „Aber du hast mir nichts gegeben! Du hast dir Stiefelchen dafür gekauft! Natürlich! Du! Du bist wie ein widerspenstiger Esel, und nun geh allein nach Haus, ich verziehe mich ins Café Corso.“
Julia schaut ihn erstaunt, musternd an.
„Hast du Geld?“
„Natürlich!“
„Woher hast du Geld?“ Mit zwei Schritten ist sie neben ihm. „Hast du etwa von Maria Battista Geld? Ja? Von dieser Ziege, die überall herummeckert, der jeder Mann recht ist, wenn er nur die Nase in der Mitte des Gesichtes hat?“
„Gerade! Ja! Von ihr habe ich Geld! Sie gibt mir Geld! Sie hat immer Geld! Du bist ja zu dumm! Sogar für Francesco Martini bist du zu dumm! Wirklich, scusi, sogar für Martini! Zu allem zu dumm!“
Er redet sich in Wut. Er haßt Julia, einfach, weil er sie satt hat, weil er sie nicht mehr mag und von ihr los will. Schließlich bricht er in ein Gelächter aus: „Sie war vor fünf Tagen bei dem Grafen, daß du es weißt!“
„Wer? Maria?“
„Veramento! Maria! Ich wollte es dir noch nicht sagen! Starr nicht so! Ja! Während er dich nicht einließ oder nicht zu Hause war, was weiß ich, fand sie ihn zu Hause! Ecco! Die Maria Battista! Das ist ein Weib! Mit Absicht öffnet er nicht, wenn du klingelst! Wird sich hüten! —
Giulietta! — — Was ist Giulietta? —“ Er macht eine laszive Bewegung. „Aber Maria! He! Ho!“ Weg ist er.
Julia steht wie betäubt. Sie starrt noch immer die Straße entlang. Sie hat gewußt, daß Vittorio ihr etwas verbarg. Seit Tagen belog er sie, das fühlt ein Weib, aber daß es Maria sein soll, diese Chantant-Tänzerin, diese magere Sorte, dieses verderbte Luder, das macht Julia rasend.
Sie rennt nach Hause. Atemlos kommt sie in der kleinen Stube an, die von den Trillern zweier Kanarienvögel dröhnt und nach dem Stall riecht, dessen Mist vor dem Hoffenster liegt. Mit fliegenden Händen rafft sie zusammen, was Vittorio gehört: Die Mandoline, die paar Hemden, die Stiefel, Kamm, Pomade, — raus damit! Raus! Raus!
Der ganze Plunder fliegt vor die Tür in das Gäßchen. Die Weiber draußen kreischen vor Vergnügen, die Männer schmunzeln.
Aus einem Stiefel fällt da klirrend ein Messer.
Sie sieht, wie es fällt! Madonna! Ein Stilett! Ein langes Messer, die Schneide ist schmutzig, voll sonderbarer Flekken!
Mit einem leisen Schrei ist Julia draußen.
Blutflecken!
Sie schaut links und rechts. Augen! Überall Augen! Blitzschnell läßt sie das Messer in den Blusenausschnitt gleiten. Fühlt eine Schnittwunde an der linken Brust! Achtet es nicht, stürzt in das Zimmer zurück, holt das Messer heraus, stößt es in die hölzerne Tischplatte. Da steht es, leise wippend.
Wie von einem Rausch erfaßt, starrt sie auf die Flecken. Nie hat sie dieses Messer bei ihm gesehen! Es ist neu. Warum hat er ihr nichts davon gesagt? Wozu hat er es gebraucht? Wen hat er gestochen? Den von Maria?
Pah! Den wirft er mit dem kleinen Finger, da braucht er kein Messer.
Aber schon während der letzten Tage war er so sonderbar. — Sentimental!
Wenn Vittorio sentimental wird, hat er etwas auf dem Kerbholz!
Da tönten Stimmen. Die Weiber draußen halten es nicht länger aus. Sie hat doch den Vittorio auf die Straße gesetzt! Darüber muß man näheres erfahren! Man hat nicht viel zu tun in der kleinen Gasse. Man redet von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang, dazwischen bereitet man den Thunfisch in Öl für den Mann, dann redet man über das Geredete.
Julia wirft eine Schürze über das Messer und reißt es aus dem Tisch.
*
Inzwischen ist nach Julias Weggang die Tatsache, daß Graf Martini sich seit fünf Tagen nicht hat sehen lassen, wie ein Feuer in Frau Cicognani gefahren, die in der Via Mazzini 39 Portière ist. Plötzlich kommt ihr die Gleichgültigkeit wie eine schwere Unterlassungssünde vor. Zwei Freunde haben auch bereits nach dem Grafen gefragt, sind kopfschüttelnd wieder fortgegangen. Weder Tür noch Fenster öffnet er, fünf Tage schon hat sie ihn nicht gesehen! Madonna! Wie konnte sie nur solange warten! Wo hatte sie ihren Kopf? Da muß etwas geschehen sein! — Ganz gewiß ist etwas geschehen, und von ihr, der Cicognani, wird es heißen, sie ist eben zu alt, sie hat ihre Gedanken nicht mehr beisammen — — —
Sofort geht sie zur Wache. Der Polizist will erst wissen, was geschehen ist, aber sie will den Leutnant selber sprechen, sie geizt jetzt mit Minuten, die verloren sein könnten.
Also erscheint sie vor dem Gendarmerieleutnant Sonzo und erzählt mit ihren kurzen, sprechenden Handbewegungen, die Wohnung des Grafen Martini sei schon seit dem 28. August verschlossen.
„Und heute ist der 2. September, und er hat sich noch immer nicht gezeigt!“
Der Leutnant nimmt gleichmütig ein kurzes Protokoll auf. Die Angelegenheit scheint nicht weiter wichtig. Martini? Kennt er nicht. Was wird sein? Ein galantes Abenteuer! Überhaupt die Portierfrauen! Die hören das Gras wachsen!
Die Aussage der Cicognani ergibt, daß Graf Martini am 28. August abends aus Venedig gekommen ist. Er fuhr im Wagen vor dem Hause vor.
„Wir mußten noch lachen, die Nachbarin und ich, Herr Leutnant! Der Wagen fällt knapp vor dem Hause um, und der Herr stürzt heraus. Ein so großer, schwerer Mann! Wie das aussah! Er hat sich glücklicherweise nicht verletzt —“
„Wer bewohnt außer dem Grafen die Räume?“
„Die Frau Gräfin, zwei Kinder, der Kammerdiener, die Köchin, die Zofe, aber alle sind in Venedig, nur der Herr Graf kam, um den Zins zu zahlen!“
„Ganz allein?“
„Ganz allein. Ich sah ihn am 28. abends kommen, etwa um acht Uhr, dann ging er nicht mehr fort. Seitdem ist die Wohnung verschlossen, alles still —“
„Dann wartet man nicht bis zum 2. September“, sagt der Leutnant und gibt Befehl, zwei Carabinieri sollen sich nach der fraglichen Wohnung begeben.
Da tritt der Gendarmerieoberst Amago mit einem Schriftstück in der Hand ein.
„Die Gräfin Martini telegraphiert, man möchte Nachforschungen nach ihrem Gatten, Palazzo Bisteghi, Via Mazzini 39, anstellen. Er wollte am 29. August nach Venedig zurückkommen, sie hat kein Lebenszeichen von ihm.“
„Heilige Madonna!“ ruft die Alte. Ihre noch immer lebhaften und sprechenden Augen heben sich zu dem Oberst. „Habe ich es nicht gesagt? Es ist ein Unglück geschehen! Ein großes Unglück! Heute morgen, als ich aus dem Hause trete, was sehe ich zuerst? Einen Leichenwagen! Auf der rechten Seite! Was das schon bedeutet! Vielleicht ist der gnädige Herr gar ermordet worden! Ermordet! Madonna! Ermordet!“
Sie steht hilflos mit offenem Munde da. Der Leutnant macht sich nun selber fertig. Läßt noch den Kommissar Grassi benachrichtigen, er möchte sich bereit halten für den Fall, daß wirklich etwas an der Sache wäre. In Begleitung dreier Carabinieri begibt er sich in die Via Mazzini. Sofort sammeln sich Leute an. Der Leutnant hat nach einem Schlosser gesandt. Der kommt gleich und beginnt, die verschlossene Wohnungstür aufzubrechen.
Auf jedem Flur des Palazzo befinden sich zwei Wohnungen. Der Leutnant orientiert sich mit einigen Blicken, während der Schlosser arbeitet. Die Portière gibt Auskunft:
„Hier gegenüber wohnen zwei Schwestern namens Aldini. Oben rechts über dem Herrn Grafen wohnt Signora Santoni, auf der anderen Seite, der Santoni gegenüber, hat Herr Pizotti vier Zimmer. Ein seltsamer Herr, den man nie sieht! Darüber rechts ein alter Herr Salvatini, gegenüber eine Dame mit Papagei, Signora Sighi, die einst an der Oper war.“
Eben kommt die Dame Santoni, deren Wohnräume über denen des Grafen liegen, die Treppe herab, die schwarz ist von Neugierigen.
„Sie lassen aufbrechen?“ ruft die Dame. „Ich habe einen Schrei gehört! Jawohl! Vor einigen Tagen — warten Sie! Es war in der Nacht vom 28. zum 129. August! — Da tönt ein durchdringender, entsetzlicher Schrei zu mir empor. Ich war eben eingeschlummert, aber ich schlief noch nicht fest. Ich fahre hoch. — Jemand schreit auf! — Dann wird es unheimlich still. Aber noch lange klang dieser Schrei in meinen Ohren nach!“
„Warum haben Sie das nicht gemeldet?“ fragt der Leutnant, schon unter der Tür, denn sie ist bereits geöffnet.
„Ich wußte doch nicht — vielleicht hatte es nichts zu bedeuten — vielleicht war es auch eine Frau, es klang so schrill …“
Sie spricht zu den Umstehenden, denn der Leutnant ist mit zweien seiner Leute bereits in der Wohnung verschwunden, der dritte bleibt vor der Tür stehen.
— — „Eine Frau! Wie kann man wissen? Kennen Sie den Herrn Grafen Martini? Hat er nicht immer Frauen mitgebracht? Gab es nicht oft Spektakel? Machte er nicht auch seiner eigenen Frau Szenen über Szenen? Soll ich mich in Dinge mischen, die mir widerwärtig sind? Was weiß man?“
Die Leute nicken beifällig. Die Tür der gegenüberliegenden Wohnung wird leise geöffnet, die eine der Schwestern Aldini schaut durch den Spalt.
„Was für ein Lärm! Was ist geschehen? Graf Martini ermordet? Daran habe ich doch immer schon gedacht!“
„Wieso ermordet?“ mischt sich der Carabiniere ein. „Wieso? Was wissen Sie denn?“
„Nichts weiß ich! Aber wenn Sie die Wohnung aufbrechen! — Tun Sie das, um ihn zu besuchen?“
Der Polizist schweigt.
„Seit fünf Tagen ist er in der Wohnung“, sagt der Zeitungshändler. „Abends um acht Uhr gekommen —“
„Und seitdem nicht mehr fortgegangen!“ ergänzt die Portière.
„Ein Irrtum“, erwidert Fräulein Aldini, ohne die Tür nur eine Spanne weiter zu öffnen. „Der Herr Graf ist am 28., gleich nachdem er eingetroffen ist, noch einmal weggegangen.“
„Da hätte ich ihn doch sehen müssen!“ widerspricht die Cicognani.
„Aber ich sage Ihnen —“ das Kinn des Fräuleins wird spitz, und ihre Stimme klingt schrill, „ich sage Ihnen, er ist nochmals fortgegangen! Wie können Sie sagen, er sei nicht fortgegangen?“ Sie wendet sich mit ausgestrecktem Zeigefinger gegen den Carabiniere: „Meine Schwester Maria und ich, wir saßen auf dem Balkon, wir sahen den Grafen ankommen, und nach fünf, vielleicht sechs, acht Minuten ist er wieder fortgegangen. Ich rief meiner Schwester, die eben ins Zimmer zurückgetreten war, noch zu: ‚Da geht Graf Martini durch die Rüsterlagasse fort!’ Er trug einen eleganten Abendmantel und hatte sicherlich noch allerhand vor! Die Männer! So sind sie!“
In diesem Moment betritt der dritte Carabiniere aufgeregt die Wohnung, und dann wissen es alle, und es geht wie ein Lauffeuer durch die ganze Stadt:
Graf Francesco Martini ist ermordet worden!
Dreizehn Messerstiche!
2.
Als Gendarmerieleutnant Sonzo den Korridor der Wohnung Martini betrat, warf er sofort einen prüfenden Blick auf das Fenster, das nach dem Hof ging. Es war fest geschlossen. Ein Vorhang verbarg den Eingang in das Arbeitszimmer. Dort sah es wüst aus. Der Schreibtisch war erbrochen, der Boden mit Schriftstücken übersät, Bilder von der Wand gerissen, Bücher von den Regalen gezerrt. „Als ob ein Wilder hier gehaust hätte“, sagt leise einer der Carabinieri.
Im anschließenden Bibliothekzimmer sieht man schon von der Tür aus den Toten.
Er liegt auf dem großen, gelbroten Teppich.
Der weite Raum ist in Halbdunkel gehüllt. Der Tod hat ein ernstes, strenges Milieu gefunden. Längs der einfach grün gestrichenen Wände stehen riesige Schränke mit Büchern wie stumme Wächter. Das Feuer ist aus dem Kamin gerissen worden und hat weitrandige schwarze Brandmale in den Teppich gezeichnet. Wollte der Täter Feuer anlegen?
Der Tisch am rechten Ende des Raumes ist umgeworfen, die Lampe zur Erde gefallen, der Schirm liegt über einen Schemel gestülpt. Zwei breitlehnige, mit grünem Damast bezogene Sessel sind umgeworfen, ein dritter zertrümmert. Ein kleiner, in die Wand gebauter Schrank steht weit offen. Er ist beraubt, Papiere liegen umher, Briefe, Geldscheine, an denen noch die rostbraunen Male der Mörderhände sichtbar sind.
„Raubmord“, sagt Leutnant Sonzo zu den Carabinieri.
„Rufen Sie schleunigst Herrn Inspektor Beghi an! — Straße absperren!“
Auch die Schränke in den angrenzenden Zimmern sind erbrochen, Schubladen aufgerissen, Schreibtische durchwühlt. In dem Schlafzimmer des Grafen sind sogar die Betten zerfetzt. Ein Spiegelschrank in dem Damenschlafzimmer (das offenbar von der Gattin des Grafen bewohnt wird), ist eingestoßen. Dieses Zimmer ist in Weiß und Purpur gehalten, ein Stil zwischen Biedermeier und Empire, mit steifen Möbeln und domartig gewölbter Decke. Es ist ein feierliches Zimmer ohne Freude. Das Speisezimmer dagegen hat eine lilablaue, blumenreiche Tapete mit hellen Vorhängen an den hohen Fenstern. Kostbares Porzellan steht auf der mahagonifarbenen Anrichte. An der Wand hängt ein Bild in lodernden Farben, der Tisch ist von windhundschlanken Stühlen umstanden. Eine gelbe Tür, flankiert von einer kleinen, jonischen Säule, führt zurück in ein Kinderzimmer, das wieder mit dem Schlafzimmer der Gräfin zusammenhängt. Da sind bunteste Bilder, da ist alles hell und rosa und voller Licht und Duft.
Alle Fenster in allen Räumen, auch in der Küche, sind verschlossen.
Nachdem der Leutnant seinen Rundgang beendet hat, stellt sich der herbeigerufene Arzt ein. Er erklärt, daß der Tod schon vor mehreren Tagen eingetreten ist. „Dreizehn Stiche! Drei davon unbedingt tödlich! Ein heftiger Kampf muß stattgefunden haben. Der Überfallene hat verzweifelten Widerstand geleistet!“
Die Beamten treffen ein. Kommissar Grassi, Polizeiinspektor Beghi, ein Stab von Begleitern, der Photograph, Carabinieri. Man hört die kühlen, kräftigen Stimmen durcheinanderklingen.
Leutnant Sonzo geht den Beamten entgegen, erstattet kurz und schnell Bericht. Kommissar Grassi hört zu, die Augen auf den Boden gerichtet. Deutet auf die Kokosmatte: „Hier — da, Herr Inspektor Beghi: Der Mörder ist hier durchgegangen. Wenn Herr Leutnant Sonzo alle Fenster verschlossen gefunden hat, dann gibt uns diese Spur sichere Anhaltspunkte.
Eine deutliche Fußspur! — Sofort photographieren, bitte, Abdruck nehmen, muß in der Kriminalabteilung rekonstruiert werden. Blutspritzer!“ Der Kommissar, dessen Untersuchung der Inspektor schweigend und zustimmend folgt, deutet auf das Parkett im Arbeitszimmer. „Laufspuren! Nach vorne, in der Gehrichtung, immer nochmals ein kleinerer ovaler Spritzer. Der Täter verließ hier das Zimmer, ging zur Tür. Bitte, Herr Inspektor, die zugespitzten, gezackten Ränder der Spuren weisen deutlich die Gehrichtung. Hier —“, der Kommissar geht den Weg zurück zur Wohnungstür — „hier am Fenster blieb der Verbrecher stehen. Bitte, diese runden Spuren — wie Blumendolden — kaum gezackt — Stehtropfen!“
Der Kommissar öffnet die Wohnungstür, blickt hinaus, sein Auge schweift die Treppe empor. Er lächelt, auch der Inspektor hat bereits gesehen, daß die äußere Tür ganz oben Einschnitte eines Messers zeigt.
„Das ist uns in der Dunkelheit des Treppenhauses entgangen! Versuche, die Wohnungstür auszuschneiden“, sagt Grassi. „An der dicksten Stelle! Der Mann hält uns für Narren. Ein Verbrecher schneidet so die Türfüllung nicht aus. Das ist Mache! Wir sollen glauben, ein Berufsverbrecher sei am Werk gewesen. Diese Komödie zeigt uns aber, daß kein Berufsverbrecher die Tat begangen hat.
Avanti, meine Herren! Zu dem Toten!“
Alle Beamten arbeiten bereits. Peinlich werden die Fingerabdrücke festgestellt. Der Inspektor bemerkt, daß der Mörder Gummiabsätze getragen hat. Der Absatz läßt sich rekonstruieren.
Grassi kniet neben dem Toten. „Nie läßt es ein gewiegter Verbrecher auf solch einen ungleichen Kampf ankommen. Und dieser Kampf war furchtbar.“
Die Beamten gehen durch alle Zimmer. Blitzschnell flammt es da und dort auf. Der Photograph macht Aufnahmen.
„Der Täter ist mit einem Nachschlüssel eingedrungen. Er hat die. Wohnung auf dem gleichen natürlichen Wege wieder verlassen und die Tür hinter sich abgeschlossen“, sagt der Kommissar. „Allem Anschein nach war er mit der Örtlichkeit gut vertraut. Kaum anzunehmen, daß niemand ihn gesehen haben soll.“
„Weibergeschichten“, bemerkt Cavaliere Beghi, der Polizeiinspektor, lakonisch. Er steht in dem Schlafzimmer des Grafen, hat in dem Papierkorb gekramt und eine in der Mitte durchgerissene Karte herausgeholt, die noch halb im Briefumschlag, steckt. Die Karte geht von Hand zu Hand, nachdem sie sofort auf Fingerabdrücke untersucht worden ist. Sie lautet:
„27. August
Ich komme um zehn Uhr zu Dir, wie immer,
Carissimo! Laß die Tür offen!
Deine Giulietta.“
„Diese Giulietta werden wir ja wohl bald gefunden haben“, meint Leutnant Sonzo. „Die Art der Handschrift verrät gewöhnlichen Durchschnitt. Eine kleine amica — man kennt diese Art Briefchen —“
Der Inspektor betrachtet finster das entfärbte Gesicht des Toten. Seine Hand streicht langsam über das Kinn.
„Die Gräfin Martini ist eine rührend schöne Frau“, sagt er. Die Bemerkung ist ganz unmotiviert.
Cavaliere Beghi, der mit seinen Gedanken öfters abseits ist, wirft einen schnellen Blick auf seine Kollegen. Aber nur Sonzo fragt: „Kennen Sie die Gräfin, Herr Inspektor?“
„Vom Sehen. Eine Tochter Professor Giottis.“
„Giotti?“
„Ja. Eine berühmte Persönlichkeit. Ein großer Arzt.“ Die Leiche Martinis wird mit einem Teppich bedeckt. Die Portière wird hereingerufen, die Gräfin Scudellari, eine Kusine des Toten — die Cicognani kennt sie —, telephonisch benachrichligt. Sie sagt ihr sofortiges Erscheinen zu, um Aufschlüsse zu geben.
Carabinieri haben das Treppenhaus gesäubert, die Straße ist in weitem Umkreis abgesperrt.
Inzwischen erscheint aufgeregt der bekannte Außenredakteur eines der meistgelesenen Morgenblätter: Erneste Grandi. Ein Berichterstatter, der nicht vorgelassen worden war, hat ihm die Alarmnachricht gemeldet. Grandis Aufsätze gegen die Opposition finden seit Jahren das stärkste Interesse Bolognas. Eine Kampfnatur, ergeht er sich sofort in den wildesten Verwünschungen des unbekannten Mörders.
„Das mußte so kommen! Die Frauen! Die Frauen! Was sollte Martini denn beginnen? Ich kenne die Geschichte seiner Ehe mit der Gräfin. Mit dieser Frau könnte kein Mann leben! Die Familie! Der Vater Atheist, der Bruder hemmungslos, die Mutter unterdrückt, die Tochter Maria eine eigenwillige, sich selbst hofierende Frau, emanzipiert. Der Graf mußte ja schließlich galante Abenteuer suchen!“
Inspektor Beghi mahnt den Redakteur zur Ruhe. Es sei hier nicht der Ort, seinem Temperament die Zügel schießer zu lassen und das Eheleben des Grafen zu schmähen. Trotzdem läßt sich Beghi einige Auskünfte erteilen. Ob die Gräfin etwa keinen gemeinsamen Haushalt mit dem Grafen führte? Es seien getrennte Schlafzimmer in der Wohnung, ferner sei es seltsam, daß der Graf allein nach Bologna komme — oder ob das Ehepaar in Venedig eine zweite Wohnung besitze?“
„Ja! Sie wohnen augenblicklich in Venedig, das ist mir bekannt! Es konnte auch kein Geheimnis bleiben, daß Maria Giotti ihren Gatten bereits einmal böswillig verlassen hat. Dann kehrte sie wieder reumütig zurück. Der Graf, ein Mensch von beispielloser Güte, nahm sie wieder auf. Sie lebten aber bald wieder getrennt in der gemeinsamen Wohnung, und Martini trug sich mit dem Gedanken, die Kinder in einem vornehmen Erziehungsheim unterzubringen, um sie dem Einfluß der Mutter zu entziehen!“
„Das ist alles sehr traurig, für uns aber nicht uninteressant“, entgegnet Beghi nachdenklich. „Sind Sie ein Freund der Familie?“
„Ich? Im Gegenteil. Martini ist mir zwar oberflächlich bekannt. Aber die Familie Giotti! Verkehr mit dieser? Ausgeschlossen! Professor Giotti ist ein Führer der Oppositionspartei. Unser politischer Gegner! Sein Sohn gehört zum extremsten Flügel! Wie sollte ich da der Freund dieser Familie sein?“
„Aber Ihre Informationen über diese Ehe —“
„Man hat sie uns eingesandt! Immer wieder! Seit langem schon werden wir bestürmt, auch einmal gegen Professor Giottis Privatleben zu schreiben.“
Ernesto Grandi macht sich eilig Notizen und entfernt sich schließlich, nachdem er von Grassi einige Auskünfte über den Stand der polizeilichen Feststellungen erlangt hat. Die Vernehmung der Portière durch Leutnant Sonzo hat nichts Neues ergeben.
Lisetta Aldini, eine der Schwestern aus der Wohnung gegenüber, ist von sich aus erschienen. Sie bleibt bei ihrer Aussage, sie habe gesehen, daß Graf Martini am Abend des 28. August noch einmal das Haus verlassen hat. Wann er zurückgekehrt ist, kann niemand sagen, mutmaßlich erst spät in der Nacht. Dann aber meldet sich noch ein Zeuge, der Tabakhändler Nipulos, ein Grieche. Er hat gesehen, daß ein Mann am Abend des 28. August aus der Wohnung des Grafen gekommen ist.
„Wann?“ fragt Grassi.
„Gegen acht Uhr. Ich wollte Herrn Pizotti sprechen, er ist aber verreist. Ich sah zufällig auf meine Uhr, weil ich noch eine Verabredung hatte. Wenige Minuten später also sah ich den Menschen.“
„Das muß ein Irrtum sein“, erwidert Inspektor Beghi. „Wenn Graf Martini am 28. abends in Bologna eingetroffen ist, dann kann er nicht um acht Uhr aus der Wohnung gegangen sein. Der Expreßzug trifft, ich weiß das zufällig genau, erst nach acht Uhr in Bologna ein, der Graf kann also in Minuten nicht den weiten Weg vom Bahnhof hierher zurückgelegt haben und wieder ausgegangen sein! Übrigens wird er auch einige Minuten auf dem Bahnhof aufgehalten worden sein. Alles Umstände, die es ausschließen, daß Graf Martini um acht Uhr in seiner Wohnung war oder sie etwa schon wieder verlassen hat!“
Der Grieche kann kaum erwarten, daß er zu Worte kommt.
„Es war ja gar nicht der Herr Graf, den ich sehr gut kenne. Es war ein Fremder, den ich gegen acht Uhr aus der Wohnung treten sah.“
„Am 28. August?“
„Si, Signore!“
„Wie sah er aus? Gewöhnlich?“
„Nein! Er machte den Eindruck eines gebildeten Mannes, war schlank und nicht schlecht gekleidet. Mir fiel aber sein verstörter Blick auf, die Eile, mit der er fortlief.“
Der Polizeiinspektor schüttelt den Kopf. „Vor dem Mord? Verstört? Sie werden sich in der Zeit irren! Es war später. Vielleicht neun Uhr!“
„Wo denken Sie hin, Herr Inspektor!“ ereifert sich der Händler „Ich bin doch bei Sinnen! Ich sagte schon, es war zehn Minuten vor acht, meine Uhr ist durchaus verläßlich! Im übrigen hatte mich Herr Pizotti um acht Uhr bestellt. Ich bin eine Viertelstunde früher gekommen, aber, wie gesagt, ich habe meinen Kunden nicht angetroffen!“
„Wer ist Herr Pizotti?“ wendet sich der Inspektor an die Portière, die noch immer im Zimmer ist.
„Herr Pizotti?“ Die Alte zieht die schmalen Schultern hoch.
„Uno straniero — ein Fremder, Herr Inspektor, fast nie zu Hause!“
„Wieso? Er wohnt doch schräg über dieser Wohnung?“
„Si! Si! Aber er kommt oft wochenlang nicht — ist viel auf Reisen, ich habe ihn schon lange Zeit nicht gesehen!“
„Seit dem 28. August nicht?“
„Länger nicht! Wochen nicht!“
„Das stimmt nicht!“ wirft Nipulos ein. „Ich habe ihn vor vierzehn Tagen besucht!“
„Ein Beweis, daß Sie nicht alle Leute sehen, die aus und eingehen“, sagt der Kommissar zur Portière. „Graf Martini kann also doch noch abends ausgegangen sein! Es ist nun von ungeheurer Wichtigkeit, daß wir feststellen, welcher Mann um acht Uhr aus der Wohnung des Grafen Martini gekommen ist. Verstört, wie Herr Nipulos behauptet.“
„Ja, Herr Inspektor. Mit irrem Blick, ich sah ihn vorbeirennen, aber er bemerkte mich nicht. Raste die Treppen hinab, verschwand — wie ein Wahnsinniger!“
Die Beamten lassen bei Herrn Pizotti nachforschen. Die Wohnung ist verschlossen, an der Tür ein Schild: „Verreist!“
Die Bewohnerin der Räume über dem Grafen Martini, Signora Santoni, hat auf ihre Vernehmung gewartet. Sie erklärt mit Bestimmtheit, daß sie schon in der Nacht vom 27. zum 28. August Lärm in der Wohnung gehört habe.
„Ich leide an Schlaflosigkeit. — Der 27. August bedeutet für mich ein besonderes Ereignis — eine Jugenderinnerung —“ sie macht eine kleine Pause —, „ich weiß also, daß es die Nacht vom 27. zum 28. August war, da hörte ich deutlich ein Möbelstück fallen, dann die Stimme einer Frau und eines Mannes. Und die Nacht darauf, vom 28. zum 29. August, vernahm ich einen Schrei. Aber ich habe ihm, obwohl ich sehr erschrocken war, keine weitere Bedeutung beigemessen!“
Die Gräfin Scudellari wird gemeldet.
Der Polizeiinspektor geht ihr entgegen, will sie schonend über das Verbrechen, dem ihr Vetter zum Opfer gefallen ist, aufklären. Aber sie weiß schon alles. Sie ist sehr blaß, erregt, doch bleibt sie seltsam kühl, will den Toten nicht mehr sehen und bedauert in bewegten Worten die Witwe und die beiden Kinder, die der Tote hinterläßt. Den Beamten fällt diese Teilnahmlosigkeit auf, sie beobachten die Gräfin. Eine Frau von vierzig Jahren, schon etwas stark geworden, eine interessante Erscheinung mit großer, edler Nase und guter Haltung, kann sie noch immer für schön gelten. Aber der wohl einmal lebensfreudige Mund hat eine seltsame Starre, die Pupillen sind erweitert wie unter der Einwirkung von Belladonna. Alles in allem das Antlitz einer Aristokratin, doch nicht ohne Geheimnisse. Der ironische Mund scheint sich über die Beamten lustig zu machen. Sie weiß nichts Neues zu sagen. Ihrer Meinung nach ist es ausgeschlossen, daß vor dem 28. August Leute in der verschlossenen Wohnung waren.
„Sie brauchen nicht weit zu suchen, meine Herren! Die Korrespondenz des Grafen wird Ihnen genügend Aufklärung geben!“
„Sie glauben also auch, Frau Gräfin, daß ein galantes Abenteuer der Hintergrund dieser Tragödie war?“
„Was sonst? Nur eine derartige Affaire! Mein Vetter hatte sich durch seine Torheiten viel Sympathien verscherzt.“
„Sie sind mit der Frau Gräfin Martini befreundet?“
„Sehr!“
Der Inspektor beendet die kurze Aussprache mit einer Verneigung. Die Gräfin wirft einen kurzen Blick durch halbgeschlossene Augen ins Arbeitszimmer, wo die Leiche unter dem Teppich liegt. Der Kommissar beobachtet sie. In seinem kalten Gesicht ist nicht zu sehen, welche Gedanken ihn bewegen.