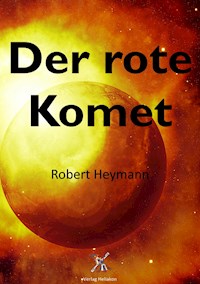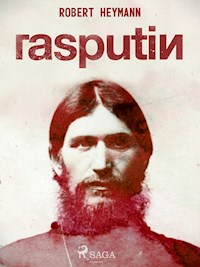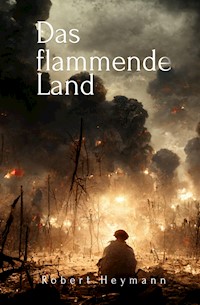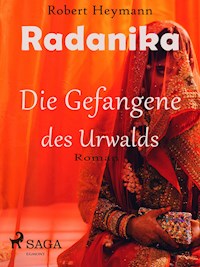Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Als Maria Stilke ihre erste Stelle als Lehrerin im bayrischen Dorf Aschbach beginnt, glaubt sie, endlich die Schwierigkeiten ihres jungen Lebens hinter sich zu lassen. Vorbei das zweideutige Getuschel von der "Pfarrerstochter" in Tannenau. Jetzt kennt sie das Geheimnis ihrer Eltern – ihr Pflegevater, der Herr Pfarrer, hatte ihr alles erzählt. Und vorbei die einfältige Seminaristinnenausbildung dort im Kloster, die der neue Lehrer Thomas Förster damals ordentlich aufwirbelte. Bald hatte er wegen fortgesetzter Verleumdungen den Dienst quittiert. Als sie ihn während des Referendariats in München wiedertrifft, wird aus der Schwärmerei Liebe. Wenn Thomas endlich Erfolg als Schriftsteller hat, wird geheiratet. Doch auch in Aschbach wird Maria, der nie bewusst ist, wie sehr ihr feiner und stiller Charakter aneckt, wieder Opfer des Klatsches. Ihre harmlosen Spaziergänge mit Kaplan Reinhold, der die große Begabung Marias als Pädagogin erkennt, wird als Liebesbeziehung denunziert. Auch ihre Gesangsstunden bei dem verkrüppelten Hilfslehrer Semmerau gelten als unschicklich. Maria wehrt sich, ohne zu sehen, wie sehr beide sie lieben. Geduldig wartet sie auf Thomas, während ihr besonderer Unterricht über Aschbach hinaus bekannt wird. Eines Tages kommt Thomas. Doch die Fäden ihres Lebens haben sich in dem kleinen Dorf unentwirrbar verknotet.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 325
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Robert Heymann
Maria Stilke Der Roman einer Lehrerin
Saga
Maria Stilke Der Roman einer LehrerinCopyright © 1913, 2019 Robert Heymann und SAGA Egmont All rights reserved ISBN: 9788711503515
1. Ebook-Auflage, 2019
Format: EPUB 2.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für andere als persönliche Nutzung ist nur nach Absprache mit SAGA Egmont gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com und Lindhardt og Ringhof www.lrforlag.dk – a part of Egmont www.egmont.com
Wo Kinder sind, da ist ein goldenes Zeitalter.
Novalis.
I. Kapitel.
Maria Stilke schritt langsam und gesenkten Hauptes durch die Wiesen von Tannenau. Wo die Wege nach Niederbuchbach und Dreihügelfeld sich trennen, steht eine Madonna unter grob geschnitztem Holzdach, von Seraphinen umgeben, die eine plumpe, gläubige Hand auf hellblauen Hintergrund gemalt hat. Dieses Bildnis ist nicht ohne Kunstfertigkeit geschnitzt; dem Antlitz der Heiligen hat sein Schöpfer die natürliche helle Farbe gelassen, während die steifen Falten des Gewandes in grelle rote und blaue Farben getaucht sind. Der Betschemel davor, in Haselnussgesträuch versteckt, von Astern umstanden, ist wurmstichig und von vielen Knien gehöhlt.
Maria zählte die goldenen Schwertspitzen, die das Herz der heiligen Mutter durchbohren.
Wie sie in der Glorie ihrer Leiden dastand, hatte sie als Ausdruck naiven Glaubens und bedingungsloser Liebe etwas überwältigend Schönes. Das junge Mädchen sank in die Knie und bedeckte ihr Antlitz mit beiden Händen. Es waren Hände, die in der Reinheit ihres Geäders an ein Kunstwerk aus Elfenbein gemahnten; sie waren weiss und schlank und fein.
Ihr Gesichtchen war trotz des Schmerzes, der augenblicklich in ihr war, in die frohe Heiterkeit der Siebzehnjährigen getaucht. Freudige Lebensbejahung goss den Glanz der Jugend über ihre Züge, deren pikanter Reiz durch kleine Unregelmässigkeiten erhöht wurde.
Maria Stilke hatte rehbraune Augen. In ihrem Blick war ein geheimnisvolles Licht, das aus dem Grunde ihrer Seele auftauchte und die grossen Pupillen seinem Zauber erschloss.
Diese Augen beschatteten lange, schwere Wimpern. Wenn sie sich hoben, sah man in zwei lautere Quellen der Unschuld. Diese spiegelten bis jetzt keine andere Frage, als: was ist das Leben?
Doch die Frage war hinreichend gewaltig, um in Maria Stilkes jungem Herzen die Fackeln der Sehnsucht zu entzünden. Solche Sehnsucht war ihr Erbteil. Das Erbteil der Berufenen, denen bestimmt ist, zu leiden und zu irren, um dieses einzigen Paradieses willen, das nie verloren ging. Sehnsucht war der Grundzug ihres Wesens. Ungeklärt, ohne bestimmte Form, rein als Symbol des Gottgedankens in der Natur, verklärte sie die junge Gestalt und wob um ihre Flechten den Schein der Verheissung. Helle Flechten, die nicht blond und nicht dunkel waren; die bald sattrot, bald golden, bald kastanienbraun erschienen, je nachdem sich das Licht über sie breitete oder in den Zöpfen dunkle Schatten walteten.
So lag Maria Stilke, ein Bildnis der Schönheit, auf den hölzernen Stufen vor der Madonna und faltete die Hände andachtsvoll unter dem weichen Kinn.
Bauern, die vorübergingen, achteten ihrer kaum. Doch zwei Betschwestern, die keine Stunde je versäumten, Gott durch gedankenlosen Götzendienst zu erzürnen, lächelten hämisch. Die zwei alten Frauen hatten welke, runzelige Lippen von unnachahmlicher Beweglichkeit. Mit diesen Gebetmühlen glaubten sie dem Herrn zu dienen und spotteten über die stille Andacht des Kindes, dessen Seele in Wahrheit bei Gott weilte, weil sie litt.
„Die Pfarrerstochter“, sagte eine der beiden Stimmen. Der Wind aber nahm das Wort mit sich und zerpflückte es über den Feldern; so drang es nicht an das Ohr der Betenden.
Gestern erst war sie mit einer Freundin aus dem Münchener Seminar angekommen, die Ferien bei dem Pflegevater zu verbringen. Pfarrer Händel hatte sie vor vielen Jahren an Kindesstatt angenommen. Das war alles, was sie von ihm, von sich und ihren Eltern wusste. Seitdem war sie im Kloster herangewachsen, ohne dass ihr je auf die stumme, brennende Frage, die ständig auf den schmalen Lippen lag, Antwort geworden wäre. Diese Frage, durch die ihr Gesicht einen Zug rührender Nachdenklichkeit bekommen, liess sich in das beseligendste Wort jugendlicher Sehnsucht fassen: Mutter . . .
Maria Stilke erhob sich und schritt dem Dorfe zu. Sie hatte eine feine Gestalt, deren spätere Vollkommenheit jetzt schon in sicheren Konturen angedeutet war.
Das Pfarrhaus lag in der Mitte des Ortes, in ein Meer von Obstbäumen gebettet. Es hatte weisse Mauern mit hellen, grünen Fensterläden, zwischen denen Blumen blühten. Eine Mauer zog sich um den Garten, über die man mühelos blicken konnte.
Der Pfarrer stand auf der andern Seite; seine hohe Gestalt in dem schwarzen Rocke hob sich gegen die hellen Steine ab. Er hielt ein Heft in der Hand und memorierte die Predigt.
Denn es war Sonnabend.
Die Sonne stand sichtbar und flammend, wie ein goldenes Rad, an dem blauen Himmel und goss ihr weisses Leuchten über das Dorf, das Pfarrhaus und den Pfarrer selbst, dass er ganz im Lichte stand.
Maria Stilke trat schnell in das Haus. Die Köchin, die am ersten des nächsten Monats wegen übler Nachreden den Dienst verlassen sollte, wich dem Kinde aus, als sei es von giftiger Atmosphäre umgeben. Maria sah und fühlte es wohl. In ihre klaren Augen traten Tränen; sie konnte sie nicht schnell genug trocknen, um dem Pfarrer ihre Verwirrung zu verbergen.
„Was ist Dir, Maria?“ fragte er und nahm sie bei der Hand.
„Nichts, Herr Pfarrer . . . wirklich nichts . . .“
Sie versuchte, ihre Verlegenheit hinter einem erzwungenen Lächeln zu verbergen.
Er ging mit ihr tiefer in den Garten hinein. Die Köchin schlug geräuschvoll ein Fenster zu, dass einige Vögel erschreckt aus den Zweigen des Holunderstrauches aufflatterten.
„Hat man Dich gekränkt?“
„Nein, Herr Pfarrer.“
„Sprich die Wahrheit, mein Kind!“
„Anna Wagner ist mir heute ausgewichen.“
„Hattest Du Dich mit ihr verabredet?“
„Wir wollten gemeinsam einen Spaziergang untersnehmen.“
„Sie wurde vielleicht verhindert?“
„Sie liess sich verleugnen, Herr Pfarrer, denn ich habe ihr Kleid hinter dem hohen Gitter, das die Besitzung ihrer Eltern abschliesst, schimmern sehen!“
Sie schwieg eine Weile, dann setzte sie hoffnungslos hinzu, während sie nur mit Mühe die Tränen zurückhielt:
„Sie ist meine beste Freundin — wir siebten uns — ich fühle deutlich, dass sie sich von mir lossagen will. Man muss etwas über mich gesagt haben, das sie enttäuscht hat, und doch bin ich mir keiner Schuld bewusst.“
Der Pfarrer führte seine Pflegetochter zu einer grün gestrichenen Bank und nahm neben ihr Platz. Sein Kopf war weiss; sein Gesicht aber strafte dieses Symbol des Alters Lügen. In seinen Mienen zeigte sich jener überlegene Adel des Friedens, den die Natur nur nach schweren, geistigen Kämpfen verleiht. Seine Augen hatten für gewöhnlich einen stählernen Glanz, denn er war ein überzeugter Streiter seiner Kirche. Jetzt aber war sein Blick nur gütig. Seine Stimme hatte nicht den sonstigen sicheren Ton, da er fragte:
„Hast Du etwa — Bestimmtes — erfahren, Maria?“
Sie schüttelte das Haupt.
„Nein, Herr Pfarrer. Aber im Kloster sagte schon einmal eine andere zu mir —“
„Was sagte sie, mein Kind?“
„Ich hätte keine Mutter . . .“
Pfarrer Händel schwieg. Nach einer Pause erwiderte er mit Anstrengung:
„Ist das eine Sache, daraus man Dir einen Vorwurf machen kann, Maria? Ist es nicht vielmehr sehr traurig, keine Mutter zu haben?“
„Ja, das ist sehr traurig“, entgegnete Maria in einem Ton, der den Priester betroffen aufsehen liess. „Aber“, fuhr sie fort, „jene wollte mich kränken. Es war im letzten Präparandenkurs, als sie das sagte. Ich habe es Ihnen nur bisher verschwiegen, Herr Pfarrer. Sie fügte ihren Worten bei: Du hast keine Mutter, weil man Deinen Vater nicht kennt . . .“
Die Sonne stand hoch, es war erdrückend heiss.
„Gehen wir in das Haus“, sagte der Priester.
Maria gehorchte und es wurde nicht weiter über diese Frage gesprochen, die einen Sturm schmerzlicher Gefühle in ihr geweckt.
Der Pfarrer war bei Tische schweigsam und verschlossen; der Kooperator bemühte sich vergeblich, ihn aufzuheitern.
Schliesslich wandte er sich an Maria.
„Heute über ein Jahr haben sich die Pforten des Seminars bereits hinter Ihnen geschlossen. Freuen Sie sich darauf?“
„Ich fürchte mich vor dem Alleinsein, Herr Kaplan. Die Schwestern sind sehr gut zu mir und besonders Schwester Benedikta habe ich ins Herz geschlossen.“
Der Pfarrer sah flüchtig auf. Sein Blick haftete eine Weile an seiner Pflegetochter und wanderte dann durch das offene Fenster. Wie Gold stand das Getreide. Davor dehnten sich die Wiesen reif zum Mähen. Übersät mit falschem Schirling, erweckten sie den Eindruck schneeiger Flächen; sattrot schimmerte dazwischen der Klee. Am Ende der Ebene tauchte der Horizont in einen blauen Dunstschleier gehüllt, in den Himmel.
„Du wirst in München praktizieren!“ sagte er. „Ich mache mir bereits Sorge darüber, wo ich Dich am besten unterbringe!“
„Anna Wagners Eltern wollten mich so gerne bei sich haben“, erwiderte Maria. „Aber es ist, als hätten sie sich eines anderen besonnen.“
Der Kaplan warf dem Pfarrer einen fragenden Blick zu. Die Köchin trat ein und brachte die Post. Er warf einige Schreiben zornig beiseite:
„Den Inhalt kenne ich schon an der Schrift. Schmähungen über Schmähungen!“
„Es scheint, als wollte diese Flut kein Ende nehmen“, murmelte Pfarrer Händel. Darauf der Kaplan:
„Wann findet die Gemeindeversammlung statt?“
„In einigen Tagen.“
„Und Sie haben wirklich die Absicht, im Falle eines Misstrauensvotums zurückzutreten?“
„Ja, kann ich länger meines Amtes in der Gemeinde walten, wenn die Saat des Misstrauens und der Verleumdung erst solche Früchte getragen hat?“
„Verleumdet man Sie, Herr Pfarrer?“ fragte Maria Stilke. Ihre Augen bekamen plötzlich einen leidenschaftlich erregten Ausdruck, Pfarrer Händel schien über die Frage zu erschrecken, denn er antwortete schnell, verwirrt:
„Du hast uns missverstanden“, und an den Kaplan gewandt: „Ich habe jetzt Unterricht zu erteilen und dann eine Beschwerde zu erledigen, die mir in meiner Eigenschaft als Lokalschulinspektor zugegangen ist.“
„Ich halte um vier Uhr den Rosenkranz ab.“ —
Maria war wieder allein. Die Einsamkeit drückte auf sie. Sie empfand sie doppelt schwer, da die Köchin sie keines Blickes würdigte, ihr kein gutes Wort gönnte. So nahm sie ihre Bücher vor und studierte. Die Zeit bis zur Seminarschlussprüfung würde schnell vorüber sein. Dann kam das letzte Examen, und schliesslich würde sich ihr die Welt öffnen, die ihr bis jetzt verschlossen gewesen, von der sie kaum etwas wusste. Sie würde in engste Verbindung mit dem Leben da draussen treten, das ihr ein Buch mit sieben Siegeln war.
Dann war sie Praktikantin, — Lehrerin.
Dann waren ihr, wenn auch noch unter Aufsicht, junge Menschenkinder anvertraut. Sie wollte wahrlich gut zu ihnen sein. Wenn sie an diese Kinder dachte, die sie noch gar nicht kannte, machte sie sich ganz bestimmte Vorstellungen. Der Knabe würde braune Augen, jener blonde Haare haben. Der würde ganz schwarz sein, und dann musste sie ein Mädchen in ihrer Klasse haben, das nie müde werden würde, zu fragen.
Sie stellte sich im Geiste vor, was sie auf allen Wissensdurst der Kinderseelen antworten würde. Von ihrem Geiste wollte sie ihnen geben, von ihrer Sehnsucht, von allem, was in ihr nach Leben und Betätigung drängte.
Und von ihrer Liebe . . .
Sie setzte sich an’s Fenster und sah auf die Strasse hinab. Dem Pfarrhof gegenüber lag das Gasthaus zur Post.
Vor der Posthalterei standen die gelbgestrichenen Wagen der Postillone. Einer tränkte eben die Pferde und sang:
Im Garten ein rot Blümelein
Steht leuchtend wie Blut,
Das brech’ ich am Abend fein
Und steck’ mir’s an Hut.
Dann schenk’ ich’s der Liebsten mein,
Die busselt’s und lacht.
Und da brennt das rot Blümelein
Wie ein Licht’l zur Nacht.
Über dem Eingang an der Wand, links und rechts in gleicher Höhe von der eichenen Tür mit schwerem Schnitzwert, befanden sich die verwitterten Bilder des Heiligen Antonius und Florian, der eine betend, auf einer Wolke schwebend, der andere in kriegerischer Rüstung, ein Miniaturbauernhaus löschend.
Marias Aufmerksamkeit wurde durch einen Fremden angezogen, der, ein Ränzel auf dem Rücken, einen derben Stock in der Hand, mit schnellem, elastischem Schritt dem Gasthof zustrebte.
In dem sonngebräunten, energisch geschnittenen Gesicht lag ein offener Ausdruck. Die hellen Augen waren voll Frohsinn und Heiterkeit. Maria Stilke beobachtete, wie er jedes Haus betrachtete, wie ihm nichts von jenen Einzelheiten entging, die auch ihre Freude bildeten, wenn sie durch das Dorf schritt: vor dem Bürgermeisterhof die breite Linde, das alte Bauernhaus, in dem sich die Käserei befand, und der geschmückte Ziehbrunnen davor, den ein goldverzierter heiliger Nepomuk beschützte.
Der Staub auf den Stiefeln des Wanderers lag dicht und zeugte von langem Marsch.
Wie er sich dem Pfarrhaus näherte, warf er einen Blick herauf. Da sah er das jugendliche Mädchen, und da sie nicht schnell genug über ihn hinwegblicken konnte, so begegneten sich ihre Augen.
Er zog den Hut, den er wohl auf früheren Wanderungen durch das bayrische Hochland mit Edelweiss geschmückt, und grüsste herauf; dabei lachte er übermütig. Maria aber wurde purpurrot und so verlegen, dass sie augenblicklich vom Fenster zurücktrat und sich in die Tiefe des Zimmers flüchtete. Eine heisse Welle ging über sie hinweg. Sie zitterte vor Aufregung.
Was war dem Fremden eingefallen? Wenn das Schwester Benedikta mit angesehen hätte!
War es nicht Sünde, sich von einem Unbekannten grüssen zu lassen?
Dann aber lächelte sie über sich selbst. Er hatte nichts an sich gehabt, das ihr Misstrauen gerechtfertigt hätte. Er war einfach und heiter gewesen und sein Gruss hatte sicher nur Höflichkeit ausgedrückt.
Sie war nun ärgerlich über sich selbst, ihm nicht wenigstens gedankt zu haben.
Als sie wieder an’s Fenster trat, sah sie ihn unter der Türe des Gasthauses stehen.
Er blickte verstohlen herüber. Sie setzte sich hinter die gehäkelten Vorhänge und beobachtete ihn.
Er mochte kaum dreissig sein. Das Gesicht beherrschten kühne, trotzige Augen. Die Lippen waren halb geöffnet und sogen begierig die mit Heu- und Blumenduft gesättigte Luft ein.
Eben kam der Kaplan aus der Kirche. Die Glocke läutete schon seit einer Weile; die Kirchtüren oben auf der kleinen Anhöhe standen weit offen und liessen die letzten Nachzügler heraus, die schwerfällig über die steinernen Stufen herabkamen.
Der Kaplan und der Fremde sahen sich einen Augenblick an, dann traten sie schnell auf einander zu und wechselten einige Worte. Sie hörte den Kaplan laut lachen. Er war immer lustig und guter Dinge. Der Fremde lächelte und nickte mehrmals, dann folgte er ihm in den Pfarrhof. Sie hörte unten die Glocke gehen, die immer anklang, wenn jemand eintrat.
Ihr Herz schlug hörbar; sie wurde bald blass, bald rot und flüchtete sich schnell über die dunklen Gänge in ihr Zimmer. Dort verriegelte sie die Tür hinter sich, als fürchte sie, man könnte sie verfolgen.
Indes hörte sie auch bald die sonore Stimme des Pfarrers. Eine Weile später rief er nach ihr. Sie ging zögernd hinab.
„Wo steckst Du denn, mein Kind?“ fragte er und führte sie in das grosse Wohnzimmer. Der Fremde, der dem Kaplan gegenüber an dem grossen Eichentisch sass, stand auf und verneigte sich.
„Das ist ein famoser Zufall“, sagte der Kooperator. „Thomas Förster wird voraussichtlich in diesem Jahre Ihr Lehrer werden, Fräulein Maria!“
Sie erschrak ordentlich und wagte kaum, den Fremden anzusehen. Er reichte ihr über den Tisch die Hand:
„Sind Sie mir noch böse?“
„Was haben Sie ihr denn schon getan?“ fragte Pfarrer Händel mit einem Lächeln.
„Ich habe die Kühnheit gehabt, sie bei meinem Einzug in Tannenau lachend zu grüssen — wirklich, mein Fräulein, es war nicht schlimm gemeint! Es schien mir nur ein gutes Zeichen für meine Ferienfahrt, solch reizendes Gesichtchen gerade im Pfarrhof zu finden, sozusagen als ersten Gruss, den mir das Leben jenseits der Schule spendete.“
„Maria Stilke ist meine Pflegetochter“, sagte der Pfarrer. Das passte eigentlich gar nicht hierher. Die Fröhlichkeit des Kaplans verstummte plötzlich und es lag wieder die alte, drückende Stimmung über dem Pfarrhaus. Maria wagte kaum, aufzuatmen. Der Kaplan brach schliesslich die Stille. Er erzählte, dass Thomas Förster sein bester Jugendfreund gewesen sei; vor ein paar Jahren hatten sie sich aus den Augen verloren.
„Ich wollte eigentlich erst Medizin studieren, aber schliesslich neigte ich doch mehr dem geistlichen Berufe zu. Es war auch der Wunsch und Wille meiner alten Mutter.“
„Und bei mir reichten die Mittel nicht aus für ein langjähriges Universitätsstudium“, warf Thomas Förster ein. „Nun habe ich es glücklich zum Seminarlehrer gebracht und komme Ihnen zweifellos furchtbar wichtig vor, was, Fräulein Stilke?“
Sie nickte ernsthaft und wollte nicht begreifen, dass der Kaplan sie deshalb auslachte.
Der Pfarrer bat, ihn zu entschuldigen. Er musste sich noch mit der morgigen Predigt beschäftigen. Auch der Kooperator hatte zu tun.
„Ich möchte gern die Kirche sehen“, sagte Thomas Förster.
„Maria mag Sie begleiten, Herr Seminarlehrer“ — Händel wandte sich an seine Pflegetochter — „Du kennst ja die Kirche und magst darum Herrn Förster am besten als Führerin dienen.“
Maria brachte nicht sogleich eine Antwort heraus. Fast fürchtete sie sich, allein mit dem Fremden zu gehen.
Wie sie aber in das Sonnenlicht hinaustraten und die schwere, mit geschnitzten Engelsköpfen gezierte Eichentüre des Pfarrhofes sich hinter ihnen schloss, fand sie ihren natürlichen Frohsinn wieder. Sie vergass, dass der Herr neben ihr in kurzer Zeit ihr Lehrer sein sollte. Er war ihr schon gar nicht mehr so sehr fremd, obgleich er plötzlich schweigsam und in sich gekehrt war.
„Sind Sie schon lange hier, Fräulein Stilke?“ fragte er schliesslich.
„Seit einem Tag, Herr Seminarlehrer. Ich verbringe meine Ferien bei dem Herrn Pfarrer.“
Er hob ihr Kinn sanft in die Höhe und blickte ihr unter den Strohhut mit dem schwarzen Samtband.
„Sprechen Sie doch nicht immer dieses greuliche „Herr Seminarlehrer“ aus! „Förster“ genügt! Sie haben gewiss keine Eltern mehr?“ Sie stockte.
„Vater ist wohl tot . . .“ stammelte sie fassungslos. Er sah sie betroffen an.
„Verzeihen Sie . . . natürlich . . . ich konnte mir doch denken, dass Sie keine Eltern mehr haben, wenn Pfarrer Händel an Ihnen Vaterstelle vertritt.
Sie traten in die kühle Kirche; dieser Ort, der ihr so sehr vertraut war, gab ihr Ruhe und Sicherheit wieder. Thomas Förster betrachtete mit grosser Aufmerksamkeit die kostbaren Einzelheiten, über die Maria ihn nicht ohne Stolz aufklärte:
„Dies Bildnis der stabat mater hier zur linken Bankreihe, wo die alten Frauen sitzen, ist uralt und gewiss nicht ohne grossen Wert. Betrachten Sie, bitte, den Glanz der Farben, der heute kaum mehr erreicht wird.“
Er sah eine Weile das Gemälde an, dann Maria.
„Wer hat über das Bildnis zu Ihnen gesprochen?“
„Der Herr Pfarrer lobte mehrmals den unbekannten Meister . . . ich habe gewiss eine Torheit gesagt . . . aber ich meine, heutzutage fände kein Künstler Farben von so unmittelbarem Glanz . . .“
„Haben Sie denn Kunstausstellungen besucht?“
„Im verflossenen Jahr fuhr der Herr Pfarrer während der Ferien mit mir nach München. Ein Studienfreund von ihm führte mich in den Glaspalast.“
„Das war ein gutes Werk . . .“ murmelte Thomas Förster. Sein Blick streifte sie mit seltsamem Ausdruck.
„Hier, Herr Förster, auf der anderen Seite, sehen Sie die Maria Hilf mit Sonne, Mond und Wolken . . . ein wertvolles Gemälde, wenn es auch die stabat mater an Ausdruck nicht erreicht. Dies hier ist das marmorne Taufbecken mit Johannes dem Täufer auf dem Deckel. Die Figur ist ganz aus Holz geschnitzt und übermalt . . . und hier, der Engel auf erzenem Sockel, wurde zum Gedächtnis unserer Soldaten gestiftet, die im Kriege 1870 vor dem Feinde fielen.“
Er sah kaum auf die Dinge, die sie ihm zeigte, und behielt von diesem Guss eigentlich nur den alten Raupenhelm in Erinnerung, der als Skulptur unter anderen Waffen das Denkmal schmückte. Maria erklärte indes die Seitenaltäre — den der Heiligen Antonius und Mathias, den Nepomukaltar und den des heiligen Saturninus . . . und dann die kostbaren Statuen an den Seitenwänden, den heiligen Sebastian und Franziskus, die heilige Apollonia und Notburga. Zwischen diesen stand ein kunstvoll geschnitzter Beichtstuhl. Der Vorhang hatte eine warme, blaue Farbe, Thomas Försters Auge ruhte einige Sekunden darauf, um sich schliesslich dem Muttergottesaltar zuzuwenden, unter dem die sterbliche Hülle eines Heiligen, in Edelstein und Stickereien gekleidet, hinter schützendem Glase lag.
„Gehen wir ins Freie“, sagte er. Sie zeigte ihm aber noch die Kanzel mit der strahlengeschmückten Maria auf der Schalldecke und den Hochaltar mit den prächtig geschnitzten Chorstühlen, ehe sie ihm nach dem Kirchhofe folgte. Sie berichtete, was sie von diesen Toten wusste. Seitwärts, wo die Kirchhofmauer steil den Hügel hinaufstieg — man sah hier über blühende Felder hinweg in den Pfarrgarten — lag ein vereinzeltes Grab.
Ein Grab mit einem einfachen Kreuz und einem Namen. Die Inschrift besagte, dass die, welche da ruhte, in erster Jugendblüte gestorben sei.
„Ein Findling“, sprach Maria Stilke.
Er blieb stehen und betrachtete eine Weile den Efeu, der sich um Kreuz und Grab rankte, und wunderte sich, wer die Blutstropfen dazwischen gesät . . . schwere, volle Geranien.
„Ich“, entgegnete Maria scheu und blickte zur Seite. In seine Augen trat ein warmer Glanz.
„Sie! Kannten Sie diesen Findling?“
Sie schüttelte den Kopf.
„Ich habe nur weniges über das Mädchen gehört. Es soll mit einer fahrenden Truppe gezogen sein. Man sagt aber, es sei sehr schön gewesen. Es muss schwer sein, so früh zu sterben.“
„Wer weiss . . ,“
„O ja! Sie wurde geliebt.“
Sie sagte das ganz leise, als fürchtete sie, es laut auszusprechen, und fügte nach einer Weile hinzu: „Es würde sonst niemand ihr Grab pflegen . . . die Truppe zog weiter, und dann hatte sie wohl niemanden mehr auf Erden . . .“
Sie bogen vom Friedhof ab und gelangten auf freies Feld.
Mächtige Ahornbäume und Linden standen in stolzer Kraft in den Sommer hinein. Wenn der Wind durch ihre Blätter fuhr, dann wiegten sie sich in ihrer Pracht wie Wogen auf bewegter See.
In den Wiesen flimmerte die Sonne. Nirgends schienen die Felder so üppig, so strotzend zu stehen wie hier. Da und dort, wo ein Obstbaum seine Arme hochreckte, als wollte er Fruchtbarkeit vom Himmel erbitten, fiel ein dunkler Schatten in das Meer von lichtem Grün.
„Sie werden also mein Lehrer in Raubingen sein?“ fragte Maria schüchtern.
„Voraussichtlich. Ich bin an das dortige staatliche Seminar versetzt und im Anschluss daran von der Frau Oberin des Klosters aufgefordert worden, im geistlichen Seminar den Unterricht in Naturgeschichte und Historik zu übernehmen.“
„Bisher lehrte Schwester Alfonsa in diesen Fächern. Wie freue ich mich, von nun an Sie zu hören . . . Sie werden uns gewiss viel, viel mehr zu sagen wissen! Ach, man dürstet förmlich nach mehr lebendigen Kenntnissen. Was erfahren wir denn eigentlich? Aus der Geschichte des Altertums kaum einige tote Zahlen, gerade so aus dem Mittelalter; höchstens, dass Schwester Alfonsa uns einen Vortrag über Klosterwesen und die Bedeutung der Geistlichkeit im Mittelalter hält . . .“
„Die Bedeutung des Klosterwesens als Trägerin aller Gelehrsamkeit und Bildung ist gewiss nicht zu unterschätzen“, warf Thomas Förster ein. „Aber es wäre einseitig, nicht auch der gewaltigen Individualitäten zu gedenken, die aus den bewegten Zeitläuften hervorwuchsen und ihre beste Kraft und Ritterlichkeit leider an dem weltlichen Starrsinn der Päpste zersplittern mussten. Denken Sie an Canossa — an Gregor VII. und den deutschen Kaiser Heinrich IV.!“
„Ich weiss nichts von Kanossa“, erwiderte sie und senkte beschämt das Köpfchen. Er lachte:
„Das werden wir nachholen, Fräulein Stilke! Die geschichtlichen Daten sind tote Monumente der Geschehnisse. Wahre, lebendige Kenntnisse können wir nur aus den Ereignissen selbst schöpfen . . . am tiefsten aus der Quelle der Kulturgeschichte.
Das Altertum zum Beispiel — diese kraftstrotzende Zeit der Schönheit — wie kann man diesen Spiegel des höchsten Menschtums, da die Götter auf die Erde stiegen, um Menschen zu werden, und die Helden von Troja sich Söhne der Götter nannten, aus belanglosen Ziffern verstehen wollen? Die Zeit, da sich um den Ruhm, Homer geboren zu haben, sieben Städte stritten! Wer weiss, ob aus der Ära, in der wir leben, ein Name zwei Jahrtausende überdauern wird! Völkerwanderungen, zerbrochene Reiche und Kronen konnten den Witz eines Horaz, die Liebenswürdigkeit des schönen Vergilius, die Werke Juvenals nicht zum Erlöschen bringen. Kann man die Geschichte der Menschheit verstehen, ohne das Altertum zu begreifen? Ohne Praxiteles, Phydias, ohne Apollo und Aphrodite?“
„Wir bekommen nichts von alle dem gelehrt! Aber wir sehnen uns danach!“
Er sprach sich voll Begeisterung in seinen Lehrplan hinein, der allerdings wenig mit dem Schema der Schule gemein hatte: „Ich werde Ihnen von den Nadeln der Kleopatra erzählen, die zu Persepolis im Glanze des Morgens gegen Himmel strahlten, von den Pyramiden zu Memphis, wo Weltenkönige schlafen, von den üppigen Ufern des syrischen Nil, wo Babylon thronte, die Königin der Städte, wo die Gärten der Semiramis in Blüte standen.
Wir werden mit Griechenlands Gottheiten noch einmal die Welt, die nicht mehr ist, erstehen sehen, wie Gäa, Tartaros und Eros sich zum Leben vereinigten, die Welt zu schaffen.
Ich werde Ihnen von Aegyptens Sonnengott Ra erzählen, der auf goldener Barke durch die Fluten des Himmels segelte, von Lybiens Neith und Pelusiens Bastet, von Osiris und Iris . . .“
„Sie lieben diese versunkene Zeit?“ fragte Maria; sie las seine Worte mit den Augen von seinen Lippen, obgleich sie kaum verstand, was er sprach.
„Ja, Wir haben so vieles verloren und unsere Kultur hat uns kaum etwas dagegen gegeben . . .“ Er unterbrach sich lächelnd. „Wenn ich in Raubingen nur mehr solch aufmerksame Schülerinnen finde wie Sie find, Fräulein Stilke, dann wird mir reichlicher Lohn für meine Tätigkeit werden!“
„Alle werden Ihnen so zuhören, denn alle tragen das Verlangen in sich, zu lernen . . . Glauben Sie nicht, Herr Förster, dass wir, wenn wir erst das Seminar verlassen haben und draussen stehen im Leben, vor den Kindern, deren Geist wir nicht nur bilden, sondern auch erheben sollen, denen wir nicht nur Weisheit, sondern auch Schönheit geben müssen, recht arm find an Erfahrung?“
„So ist es! Aller Schematismus ist Schatten. Im Leben scheint die Sonne! Böhm und Helm werden Ihnen nicht über die Klippen, die Sie in der Praxis finden werden, hinweghelfen, nicht Rousseau, nicht Fröbel oder Pestalozzi werden Ihnen die Probleme, vor denen Sie sich finden werden, lösen. Die rechte Fühlung mit der Schönheit im Leben finden, heisst erst, es zu verstehen. Wer aber das Leben versteht und liebt, der findet sich in jedem Beruf leicht mit allen Schwierigkeiten ab.“
„Sie haben viel gelesen!“
„Ich habe mich bemüht, einiges zu lernen. Und dann war ich doch auch schon in der Praxis Lehrer, habe nach dem Staatskonkurs die Universität besucht und es schliesslich über den Präparandenlehrer hinweg zum Seminarlehrer gebracht. Mein Streben ging allerdings einstmals weiter“, schloss er mit leiser Stimme. Als wollte er sich selbst von dem Thema abbringen, fragte er unvermittelt:
„Gefällt Ihnen Raubingen?“
„O ja! Wir kommen allerdings kaum aus dem Kloster heraus. Aber muss man denn immer alles sehen, um davon zu träumen? Da ist das Schloss des Herzogs Albrecht III., und in der St. Peterskirche das Grabmal der schönen Agnes, über das sich eine Kapelle wölbt.“
„Gewiss schwärmen Sie für die berühmt gewordene Tochter des Augsburger Baders?“ fragte er lächelnd.
„Ja . . . weil selbst ihr schrecklicher Tod durch die Treue ihres herzoglichen Gemahls verklärt ist . . .“
Er nickte.
„Treue ist der wahre Adel im Leben, denn sie birgt alle Tugenden.“
„Wie schön das ist, was Sie da sagen. Doch meine ich, dass dieser Adel nicht ererbt werden kann und alle Vorrechte aufhebt. Denn er ist ein Privilegium des Charakters.“
Er sah in ihre Augen und erstaunte über die Schätze ihrer Seele, die sich blitzschnell vor ihm entschleierten. Die Pupillen verloren für Sekunden die mädchenhafte Herbheit und wurden frauenhaft und tief.
Ich werde lange über das nachdenken können, wovon Sie sich heute mit mir unterhielten“, sagte sie nach einer Weile. „Niemals hat jemand so schön zu mir gesprochen. Nie hat mich jemand gelehrt, so zu sehen.“
„Es ist das Geheimnis eines schönen Lebens, Fräulein Stilke, dass man die Schönheit sehen lernt.“
Das Kind blieb stehen, legte die Arme ein wenig zurück und liess das Haupt in den Nacken sinken. Sie sah visionär aus mit dem bleichen Antlitz und dem schwarzen Kleid, das knapp die junge Figur umspannte.
„Wollen Sie es mich lehren?“
Er erschrak und antwortete nicht.
Da senkte sie das Haupt; schweigend schritten sie dem Pfarrhause zu. —
Am Abend begab er sich in Gesellschaft des Pfarrers und des Kaplans hinweg. Sie hatte keine Gelegenheit mehr, ihn zu sehen. Abends blieb sie auf, bis der Pflegevater zurückehrte.
„Seminarlehrer Förster konnte sich nicht mehr verabschieden, Kind. Er setzt seine Reise schon morgen um fünf Uhr fort.
Sie nickte scheu und atmete auf, als sie in ihrem Mädchenzimmer angekommen war. Sie löste das schwere Haar, aber sie wagte nicht, in den Spiegel zu sehen. Stunden sass sie auf ihrem Lager und blickte in das Mondlicht, das durch das Fenster flutete. Drunten auf dem Marktplatz plätscherte eintönig der Brunnen.
Sie dachte: einer von jenen, die die Schönheit suchen, ist auch er.
In ihrer Phantasie, die noch halb im Kindlichen wurzelte, verglich sie ihn mit glänzenden Vorbilden: Mit Siegfried, dem Nibelungenhelden, oder St. Georg, dem Drachentöter, oder den Rittern Parzival und Lohengrin, und der goldene Schein des heiligen Gral, der die Sehnsucht aller Edlen im Geiste bleibt, leuchtete auch über ihm.
Während sie sich am Morgen noch voll inbrünstiger Freude der Freiheit der Ferien hingegeben, wünschte sie jetzt schon wieder sehnlichst, in das Seminar zurückkehren zu können.
Er sollte ihr Lehrer werden . . .
Immer von neuem kehrten ihre Gedanken zu dieser Aussicht zurück. Sie meinte, ihre Ungeduld bis dahin kaum meistern zu können. Wohin er wohl von hier aus ging? Und ob es auch wahr werden würde? Ob sie ihn wiedersehen durfte? — —
Als die Morgenröte ihre feurigen Schwingen über die Ebene breitete, harrte sie wieder hinter den Vorhängen des Fensters. Sie sah ihn aus der Post treten. Er blieb eine Weile stehen und sah herauf. Dann griff er nach dem Stock, den er seitab an die Mauer gelehnt, und ging. Sie verfolgte seine Gestalt mit den Augen, bis er am Ende der Dorfstrasse im Buschwerk verschwand. —
Von nun an war ihr die Einsamkeit eine vertraute Freundin. Stundenlang träumte sie in die hellen Sommertage hinein, oder sie machte sich mit Fiebereifer über die Bücher. In Ehren wollte sie vor ihm bestehen. Doch weiter noch reichte ihr Ehrgeiz.
Ein heiliges Feuer loderte in der Tiefe ihres Wesens. Das hatte Thomas Förster entzündet.
Es ist das Geheimnis eines schönen Lebens, dass man die Schönheit sehen lernt — hatte er gesagt. Bald würde sie andern das sein dürfen, was er ihr war und fernerhin sein würde.
Die Schönheit sehen — das wollte sie einmal das junge Menschengeschlecht lehren . . . und wenn es ihr gelang, herrliche Saat zu streuen, so wollte sie ihm sagen: Das ist Ihr Werk.
So wollte sie ihm danken, dass er ihre schlummernde Seele zu einem neuen Leben erweckt.
An Liebe dachte sie nicht.
II. Kapitel.
Maria hielt sich jetzt meist im Speisezimmer auf, denn im Wohnzimmer standen Pfarrer und Kooperator fast unausgesetzt vor den Stehpulten oder sie arbeiteten am Schreibtisch, wenn der Beruf sie nicht abrief. Es kamen wechselweise Schreiben von der Regierung in München oder vom nahen Bezirksamt; die Stimmung wurde immer gedrückter. Dichter noch als früher lag der Schnee des Alters auf des Priesters Haupt. Die Fröhlichkeit des Kaplans war verstummt; er ging mit finsteren Mienen umher.
Einmal hörte sie vom Fenster aus, wie er am Marktplatz einen Trunkenbold zur Rede stellte, der dem Pfarrer den schuldigen Respekt versagte. Seine Augen glühten, zornige Worte kamen von seinen Lippen.
Sie konnte nicht verstehen, was jener antwortete. Aber aus dem Knäule der Worte löste sich eines heraus und schlug hart an ihr Ohr: „Pfarrerstochter!“
Sie dachte den ganzen Tag darüber nach, was sie getan haben könnte, dass sich der Zorn dieses Menschen gegen sie richtete. Die hässliche Bedeutung des Wortes blieb ihr noch verschlossen. Sie folgerte nur aus dem Ton und den Mienen des Trunkenen die Bösartigkeit, die gegen sie oder gegen den Pflegevater gerichtet war. Pfarrer Händel war ihr zweiter Vater, also war sie seine Tochter.
Aber das Wort klang in ihr nach. Instinktiv versuchte sie, die üble Bedeutung, die ihm innewohnen musste, zu enträtseln.
Sollte etwa die schwere Zeit, die über dem Pfarrhaus lastete, auf ihre Schuld zurückzuführen sein?
Sie durchforschte ihr Gewissen, aber sie fand nichts, dessen sie sich anklagen durfte. —
In dem Speisezimmer stand ein altmodischer Glaskasten, reich geschnitzt, voll alten Porzellans. Der braune Divan, der schon Generationen gesehen, schmiegte sich warm an die dunkle Vertäfelung der Wand. In den Mauern befanden sich Nischen, wo Bücher standen; in einer sah man ein geschnitztes Kästchen mit dem heiligen Öl.
Pfarrer Händel setzte sich früher gerne vor das Harmonium und spielte. Das kam in letzter Zeit gar nicht mehr vor. Maria goss mechanisch die Fuchsien und Geranien, deren rote Blüten über die Fensterstöcke hingen, und mit besonderer Sorgfalt die Lieblinge des Pflegevaters, die sorgsam gehegten Kaktusstöcke.
Dann setzte sie sich unter das Gemälde der Madonna.
Wenn jemals Traurigkeit sie überkam, flüchtete sie hierher. Sie wusste selbst nicht, warum gerade dieses Bild solche Anziehungskraft auf sie ausübte. Vielleicht nur, weil Pfarrer Händel es mit fast zärtlicher Liebe hielt und oft ihr Auge darauf lenkte.
Der dunkle Rahmen schien eigens geschaffen, die schweren, feurigen Farben zu mildern. Nur Raffael hatte eine solche Harmonie irdischer Schönheit und frauenhaft-mütterlicher Güte in seinen spätesten Madonnenbildern gefunden. In der alten Pinakothek in München hatte sie ein solches Gemälde von seiner Meisterhand gesehen. Seitdem war sie bestrebt, zwischen diesem Bildnis und der Madonna Raffaels Übereinstimmungen festzustellen. Denn sie liebte die Marien des italienischen Meisters und verehrte ihn voll idedaler Kindlichkeit.
Neben der Muttergottes hingen die uralten Familienbilder in ebensolchen schwarzen Rahmen.
Aber nichts konnte ihr Ruhe und Frieden geben angesichts der wachsenden Unruhe im Pfarrhaus. Die Köchin ging mit verärgertem Gesicht umher und schlug die Türen, je näher der Tag ihrer Entlassung rückte. Im Dorf war eine seltsame Bewegung. Irgend jemand hatte in der Nacht aufreizende Plakate vor den Wirtshäusern angeschlagen. Sie hörte nur davon sprechen; denn morgens, als sie ausging, hatten die Bauern sie schon entfernt. Wenn sie durch das Dorf ging, fiel ihr auf, dass man sie sonderlich betrachtete. Auch über Anna Wagners Benehmen hatte sie sich nicht getäuscht. Die Freundin und deren Eltern zogen sich von ihr zurück.
Was hatte sie getan?
Sowohl der Pfarrer wie der Kooperator gingen nicht weiter darauf ein, wenn sie auf solche Erfahrungen zu sprechen kam. Pfarrer Händel sagte, das sei Einbildung, und der Kaplan bemerkte, die Niederbayern seien ein wenig zugängliches und leicht zu Roheiten neigendes Volk, was ihm der Pfarrer strenge verwies.
Die Wahrheit aber war die: als nach dem Tode der seit nahezu dreissig Jahren im Pfarrhaus treu und gottesfürchtig tätigen Köchin eine neue aus München angekommen war, hatte sie es sich gleich angelegen sein lassen, die Verhältnisse im Pfarrhof nach ihrer Weise auszulegen. Dass in Raubingen eine gewisse Maria Stilke erzogen wurde, für die Pfarrer Händel regelmässig Geldbeträge einzahlte, weil er Vaterstelle an ihr vertrat, fiel ihr bald auf und stimmte sie nachdenklich.
Pfarrer Händel gehörte nicht zu jenen Geistlichen, die in religiöser Überzeugung schematische Gedankenlosigkeit duldeten. Er räumte mit den alten Privilegien der Betschwestern auf und suchte in seinen Predigten durch einen neuen, freien Geist die Frömmigkeit der Gemeinde in edler Weise zu wecken. Der Erfolg war, dass im Laufe der Jahre säumige Kirchgänger fleissig wurden, dass an Stelle der grossgezogenen Gewohnheit ehrliche. Überzeugung, wahrer Glaube trat. Vielen aber war diese Art ein Greuel, denn sie wollten nicht aus ihrer dumpfen Gedankenlosigkeit aufgeschreckt werden und waren ärgerlich über des Pfarrers Predigten, dass nur dessen Gebet Gott gefällig sein könnte, der aus reinem Willen zum Glauben heraus seinem Schöpfer sich näherte.
„Der Wille, Gott zu finden, führt immer zum Glauben, und der Glaube ist die Brücke zur Erlösung. Wo aber diese Brücke nicht auf den Fundamenten des wirklichen Gedankens steht, den inneres Suchen zum Grundstein wahrer Religiosität geschliffen, da ist sie wirklich auf Sand gebaut . . .“
So wandte sich der Pfarrer gegen geschwätzige, gedankenlose Beter. Es gab manchen, der ihm übel wollte, als er vor etwa sechzehn Jahren von einem kleinen Pfarrdorf am Chiemsee zu seiner jetzigen Gemeinde versetzt ward. Bald aber fanden die, welche es ehrlich mit ihrem Glauben meinten, den wahren Kern. Ohne dass die Neider und Wühler schwiegen, mehrten sich von Jahr zu Jahr das Ansehen und die Liebe, die Pfarrer Händel genoss.
Da brachte plötzlich die neue Köchin die Mär unter die Leute: Der Pfarrer hat eine Tochter!
Da er nicht den Mut besitzt, sie öffentlich anzuerkennen, dies Kind der Sünde aber nicht verleugnen will, so lässt er sie als seine Pflegetochter in Raubingen erziehen!
Die alten Weiber schworen auf die Wahrheit dieser Entdeckung. Mit den Einzelheiten hatte es ja seine Richtigkeit. Seit Jahr und Tag wusste man, dass in den Ferien die Pflegetochter auf den Pfarrhof kam. Die Mär wurde ausgebaut und aufgebauscht. Schliesslich kam sie der Regierung zu Ohren.
Pfarrer Händel wurde vor das Bezirksamt gerufen. Der Regierungsrat ersuchte ihn um Rechtfertigung.
Der Pfarrer, der immer aufrecht das Haupt getragen, sprach:
„Maria Stilke ist mein Pflegekind. Das ist alles, was ich zu sagen habe. Beweise lehne ich ab.“
Der Bezirksamtmann befand sich in Verlegenheit. Die bösen Stimmen verstummten nicht. In Nachbardörfern ging das Gerücht weiter, nahm immer grösseren Umfang an und drohte, in die breite Öffentlichkeit überzugehen.
Der Regierungsrat in München schwankte, was er glauben sollte. Schliesslich liess der Bezirksamtmann eine Gemeindeversammlung in Tannenau einberufen, die entscheiden sollte, ob Pfarrer Händel je durch sein Leben Ärgernis gegeben und welche Ansicht die Gemeinde in bezug auf Maria Stilke vertrat.
Diese Versammlung fand im Schulhaus statt. Fast alle Männer des Dorfes waren erschienen, der Amtmann selbst war zur Stelle. Zum ersten Male nahm der Lehrer des Ortes in dieser Sache das Wort. Er verstand sich nicht gut mit dem Pfarrer; denn während er gegen die geistliche Aufsicht in der Schule kämpfte, vertrat der Pfarrer das Prinzip, Schule und Kirche seien untrennbare Begriffe. Diese gegenteiligen Überzeugungen, die keine persönlichen waren, sondern von der gesamten Lehrerschaft wie der Geistlichkeit vertreten wurden, gaben zu manchem Konflikt den Anlass, mehr noch zu wachsender Erbitterung auf Seiten des Lehrers, weil Händel als Lokalschulinspektor sein Vorgesetzter war.
Um so schwerer fiel es ins Gewicht, dass der Lehrer rückhaltslos für das makellose Leben des Pfarrers eintrat. Die Versammlung endete, wie vorauszusehen war, mit einer für die Bewohner von Tannenau geradezu grossartigen Vertrauenskundgebung für ihren Priester. Am Sonntag, als der Pfarrer wieder die Kanzel bestieg, um zum ersten Male nach vielen Wochen die Predigt zu halten, dankte er der Gemeinde in rührenden Worten. Damit war seine Stellung gesichert, und die Stimmen, die ihn anklagten, mussten öffentlich schweigen. Aber im geheimen wühlten sie weiter und verbitterten dem Seelsorger das Leben.
Die neue Köchin nahm sich erst das Schicksal ihrer Vorgängerin zu Herzen; aber alsbald zogen Geschwätzigkeit und Klatschsucht auch sie von Treue und Vertrauen zum Pfarrhaus ab. —
So gingen zwei Monate um; die Zeit nahte, wo Maria nach Raubingen zurückkehren musste.
Sie hatte wohl bemerkt, dass man sie wieder freundlicher grüsste; aber viele, die zum Hut vor ihr griffen, blieben hinter ihr stehen und verfolgten sie mit den Augen. Schliesslich erfasste sie eine krankhafte Angst.
Diese Angst kreiste um das eine verhängnisvolle Wort: Pfarrerstochter. Sie liess alles Gefühl beiseite und begann mit scharfem Verstand das Wort zu zergliedern, Tag für Tag. Mitten in der Nacht fuhr sie einmal aus solchen Gedanken auf, setzte sich auf ihrem schmalen Lager hoch und starrte mit brennenden Augen vor sich hin.
Blitzartig hatte sich ihr Verstand erhellt. Sie hatte die Lösung: