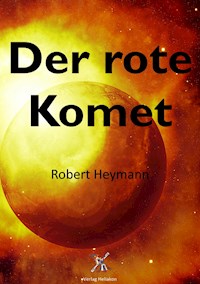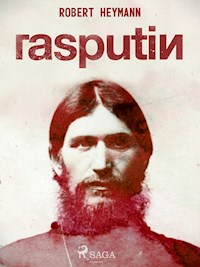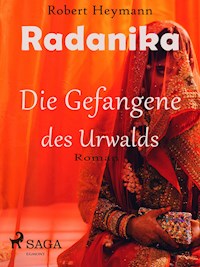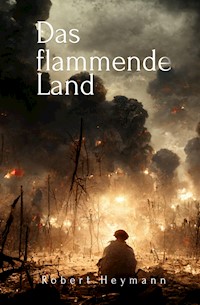
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
Es klopfte. Hohe Reichsbeamte traten ein, Sekretäre kamen und gingen. Mit jeder Stunde wurde es in dem Arbeitszimmer des Ministers lebhafter, bis er sich endlich erhob und sich in den großen prunkhaften Saal begab, wo eine geheime Konferenz des gesamten Kabinetts stattfand. Dort legte Sir Edward Grey seinen Kollegen die Gründe dar, die ihn veranlaßten, schon seit zehn Jahren auf den Weltkrieg hinzuarbeiten. "Entweder Deutschland oder wir — eine Nation muß von der Erde verschwinden", sagte der Mann mit dem Raubvogelgesicht pathetisch. "Die Einkreisung ist vollendet. Ich habe vor Jahren mit dem französischen Minister des Äußeren diese Politik festgelegt, ich habe erst vor kurzem mit Rußland ein Marineabkommen getroffen. Ein Zurück gibt es nicht mehr, es handelt sich um Englands zukünftige Stellung als Weltmacht. Die Verletzung der Neutralität Belgiens durch die deutsche Armee bietet uns den Vorwand, sofort den Krieg zu erklären, denn wir haben die Garantie für die Unabhängigkeit dieses Landes übernommen. Ich hoffe, daß Sie mit mir einig gehen, Deutschland in diesem Jahre mit Hilfe des halben Europa zu vernichten!"
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 336
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dasflammende Land
Kriegsroman
von
Robert Heymann
_______
Erstmals erschienen im:
Verlag von Paul List,
Leipzig, 1914
__________
Vollständig überarbeitete Ausgabe.
Ungekürzte Fassung.
© 2018 Klarwelt Verlag
ISBN: 978-3-96559-159-2
www.klarweltverlag.de
Inhaltsverzeichnis
Titel
Erstes Kapitel.
Zweites Kapitel.
Drittes Kapitel.
Viertes Kapitel.
Fünftes Kapitel.
Sechstes Kapitel.
Siebentes Kapitel.
Achtes Kapitel.
Neuntes Kapitel.
Zehntes Kapitel.
Elftes Kapitel.
Zwölftes Kapitel.
Dreizehntes Kapitel.
Vierzehntes Kapitel.
Fünfzehntes Kapitel.
Sechzehntes Kapitel.
Siebzehntes Kapitel.
Achtzehntes Kapitel.
Neunzehntes Kapitel.
Zwanzigstes Kapitel.
Einundzwanzigstes Kapitel.
Zweiundzwanzigstes Kapitel.
Dreiundzwanzigstes Kapitel.
Vierundzwanzigstes Kapitel.
Erstes Kapitel.
Die Uhr der Kathedrale Saint Pierre schlug elf, als Dr. Hans Scholz mit großen Schritten über den breiten Platz eilte, um, an dem Rathaus vorüber, in die Rue de la Station einzubiegen.
Er konnte nie an dem Hotel de Ville vorüberkommen, ohne einige Sekunden zu verweilen und die unvergleichliche gotische Fassade zu betrachten, wohl auch einen raschen Blick in die mittelalterliche Säulenhalle zu tun. Heute aber hatte er es eilig. Er hatte kaum ein Auge für das Leben und Treiben auf dem Grand place, denn er hatte sich ohnehin etwas verspätet.
Als er vor dem alten Patrizierhaus stand, das seltsam abstach von den neuen Häusern der weiten Nachbarschaft, da holte er aus seiner inneren Rocktasche ein Schreiben, dann zog er die Klingel. Ein Fenster im Keller öffnete sich und ein spitznasiger Diener fragte mit honigsüßer französischer Höflichkeit nach dem Wunsche des Besuches.
„Ich möchte den Herrn Archivrat Rambaud sprechen.“
„Sofort mein Herr!“
Das schwere Tor öffnete sich. Dr. Scholz wurde in ein schwer und behaglich ausgestattetes Empfangszimmer geleitet. Der Diener ging mit der Karte durch einen endlosen Korridor.
Neben dem Zimmer, in welchem der junge Deutsche stand, spielte eine Dame Klavier. Dr. Scholz sah zwischen den Portieren hindurch, welche die Räume trennten, nur die schlanke Figur in dem weißen Kleide, dichtes braunes Haar, ein paar helle Hände, die wie verloren über die Tasten glitten.
Die junge Dame war so sehr in ihre musikalischen Träumereien versunken, dass sie den Eintritt des Gastes offenbar gar nicht bemerkt hatte; denn sie erhob sich und schritt ohne jede Benommenheit dem Empfangszimmer zu.
Dr. Scholz trat rasch zurück. In diesen wenigen Augenblicken konnte er den Liebreiz der Erscheinung, die jetzt ganz im Lichte stand, auf sich wirken lassen.
Die hohen Bogenfenster ließen die Sonne in das Gemach strömen. Ein Blick in ihr Antlitz brachte ihn auf die Vermutung, die etwa achtzehnjährige junge Dame müsste eine Deutsche sein, und sogleich bekam er durch sie selbst die Bestätigung.
„Ach“, sagte sie erschreckt und in der ersten Verwirrung in deutscher Sprache, als sie plötzlich den Fremden vor sich sah. „Entschuldigen Sie“, und dann setzte sie etwas in Französisch hinzu. Aber Dr. Scholz unterbrach sie mit hastiger Freude:
„Wie ich höre, sind Sie Deutsche!“
„Ja, mein Herr, und Sie — Sie kommen aus meiner Heimat?“ Der Klang ihrer Stimme verriet die innere Bewegung. Er erwiderte rasch: „Ich bin aus der Mark!“
„An der Aussprache merkte ich es. Meine Eltern wohnen in Berlin, ich selbst entstamme einer kleineren Stadt.“
Dann erlauben Sie, dass ich Ihnen die Hand küsse, gnädiges Fräulein — es tut so wohl, in diesem welschem Lande die Laute der Heimat zu hören!“
Impulsiv führte er die Hand an seine Lippen. Sie gestattete es zögernd. Ihr Blick überflog sein Gesicht, die sehnige große Gestalt. Die schmal gefasste goldene Brille konnte die hellen Augen nicht verbergen, die klar und sicher und voll Frohsinn in die Welt sahen.
„Sind Sie schon lange in Belgien?“ fragte Dr. Scholz in leichter Verlegenheit.
Ein halbes Jahr etwa. Ich erziehe die Kinder des Hauses.“
„Und ich bin hier, um archivarische Aufzeichnungen zu machen. Mein Name ist Dr. Scholz.“
Sie neigte ein wenig das Haupt.
„Elsa von Sandern.“
In diesem Augenblick wurde die Tür hastig geöffnet. Ein belgischer Offizier trat ein.
Kaum hatte die junge Deutsche einen Blick auf ihn geworfen, als eine fahle Blässe ihr Antlitz überzog. In einer Verwirrung, die dem Gast nicht entgehen konnte, sagte sie:
„Guten Tag, Eugen!“
Es lag etwas Gequältes und Erzwungenes in dem Ton ihrer Worte, und das Lächeln, das um ihre Lippen spielte, war so schmerzlich, dass der Besucher unwillkürlich den neuen Gast fest ins Auge fasste.
Jener erwiderte den Blick, aber mehr mit Gehässigkeit als mit Festigkeit. War es Eifersucht oder sonst ein unerklärliches Gefühl? — es schien dem Deutschen, als messe ihn der Belgier mit einem Ausdruck des Hasses, der im gegebenen Moment durch nichts begründet war. „Herr Eugen Rambaud, Leutnant, mein Bräutigam“, stellte die Dame vor.
Sie hielt dabei die Augen niedergeschlagen, als hätte sie sich dieses Geständnisses zu schämen. —
Die Sonne war aus dem Gemach geglitten. Es war dem Besucher, als ströme ein eisiger Hauch über ihn hinweg. Er konnte sich, als er das Zimmer verlassen hatte, nicht mehr erinnern, wie dieser Offizier aussah. Er hatte nur die Vorstellung von einer feindlichen, gefährlichen Macht, und als er, von dem Diener geleitet, der lautlos wie eine Katze eingetreten war und ihn aufgefordert hatte, ihm zu folgen, durch den düsteren Korridor schritt, da verstärkte sich dieses Gefühl des Unbehagens noch mehr. —
Es erlosch auch nicht, als Dr. Scholz dem Archivrat gegenüberstand.
Professor Henri Rambaud war höchstens fünfzig. Er trug einen Knebelbart, der bereits stark meliert war, aber das dichte Haar und eine gewisse Frische in den Zügen ließen ihn eigentlich jünger erscheinen als er — seinem Sohne nach — sein musste.
Mit jener Verbindlichkeit, die sich in die Herzen schmeichelt und die natürliche Vorsicht, die der Deutsche im Verkehr mit Leuten anderer Nationalität an den Tag legt, einschläfert, wurde der bis dahin unbekannte Besuch empfangen.
Der Deutsche stellte sich vor und übergab dem Archivrat einige Briefe:
„Ich erlaube mir, Ihnen Empfehlungen vorzulegen, die meine Vorgesetzten mir in der Heimat übergeben haben. Der Zweck meines Aufenthaltes in Löwen ist, gleichwie in Brüssel die Handschriften der Archive zu studieren, um mein Teil zu dem Werke beizutragen, das im Auftrage des Kultusministeriums herausgegeben wird . . .“
„Es ist mir eine ganz besondere Ehre, mein Herr, dass Sie meine Hilfe in Anspruch nehmen. Seien Sie überzeugt, dass ich Ihnen gerne jede Gefälligkeit erweisen werde, die Sie wünschen. Wollen — und dürfen Sie mir verraten, welches Werk das ist, welches in offiziellem Auftrag Ihres Ministeriums herausgegeben wird und an dem Sie — so will es mir wenigstens scheinen — den Hauptanteil haben sollen?“ „Dies ist kein Geheimnis“, erwiderte Dr. Scholz lächelnd. „Sie als geborener Belgier, Herr Professor Rambaud, kennen wohl am besten die historischen und sprachlichen Dissonanzen, die dieses Land spalten. Sie werden auch wissen, welchen großen Einfluss die deutsche Kultur auf Bestand und Entwicklung dieses Staates genommen hat. Dies zu untersuchen, nach Quellen geschichtlicher Angaben, ist meine Aufgabe, und mein Buch soll lauten: Deutsches Wesen in Belgien.“ Es war die Art des Deutschen, in das Licht zu sehen, wenn er sprach.
Darum blickte er auch jetzt zum Fenster hinaus und übersah den lauernden Ausdruck in dem Gesicht des Archivrates. Es entstand eine kleine Pause. Als Scholz Herrn Rambaud fragend ansah, hatte dieser schon wieder ein verbindliches Lächeln aufgesetzt:
„Ich fürchte, Herr Dr. Scholz, Sie werden in einem allerdings begreiflichen germanischen Optimismus — wenn dies das rechte Wort für das ist, was ich ausdrücken will — den deutschen Einfluss auf die hohe Entwicklung, die Belgien in den letzten Jahrhunderten genommen hat, überschätzen. Denn in der Tat haben wir unser bestes Teil aus französischer Kultur übernommen.“ „Nun, das bestreite ich entschieden“, erwiderte der Deutsche beinahe heftig. „Wer hat Belgien denn überhaupt zu einem bedeutenden Staate gemacht? Karl V.! Ein Herrscher, den wir Deutschen wohl mit gutem Recht als einen der Unsern ansehen dürfen, denn in erster Linie war er deutscher Kaiser, wenn auch in seinem Reiche die Sonne nicht unterging. schließlich war er doch ein Mehrer deutscher Macht . . .“ „Und ein geborener Belgier“, setzte der Archivrat spitzig hinzu. „Unser keizer Karel de Vyfde — so sagen wir heute noch in Flämisch. Belgische Edelleute regierten damals die Welt, Herr Dr. Scholz!
Hatte Belgien bis dahin 60 Millionen Einfuhr, so stieg sie unter diesem Kaiser auf 390 Millionen. Antwerpen war die Hauptstadt der Welt, und . . .“ „Oho, Herr Rambaud . . .“
„O bitte. Ein Sprichwort sagt: Die Welt ist ein Ring und Antwerpen darin der Diamant. Sie sehen, ich bin in der Geschichte unseres Landes beschlagen, und wenn Sie auf den deutschen Einfluss Karls V. in Belgien hinweisen“ so darf ich von dem belgischen Einfluss unter der Regierung unseres Karl reden . . .“
„Und was hat Ihnen sein Nachfolger gebracht, Philipp II.? Den blutigen Herzog Alba sandte er Ihnen ins Land — und dieser Herr war ein Spanier. und was hat Ihnen Frankreich gebracht? Ludwig XIV. führte hier seine Eroberungskriege, die Revolution von 1792 verwüstete Ihr Land und düngte die Felder mit Flüchen und Blut. Nach der kriegerischen Affäre mit den Holländern wollte Napoleon III. — ich verweise auf Benedettis Anerbieten an Bismarck — Belgien zu Frankreich schlagen. Gewiss, das sind nur politische Fragen gewesen. Aber die von Osten nach Westen gehende Sprachgrenze teilt Belgien deutlich in ein rein flämisches, also germanisches Gebiet . . .“
„. . . und in eine wallonische, als französische Hälfte. Und dann vergessen Sie nicht, dass das deutsche Wesen wie ein überwundener Gegner langsam, aber auffällig vor der französischen Sprache zurückweicht. Ich werde Ihnen darüber sehr interessantes statistisches Material zur Verfügung stellen können. Daran ändern auch deutsche Schulen in Brüssel und Antwerpen nichts — doch, mein Herr, wir streiten hier um des Kaisers Bart. Sparen wir uns solche Auseinandersetzungen für gelegenere Zeit und seien Sie heute zum Souper mein Gast, wenn Sie mir die Ehre geben wollen.“
Er reichte Dr. Scholz mit einem gewinnenden Lächeln die Hand. Und wieder war der aufsteigende Groll vergessen. Der junge Deutsche war froh, eine Gelegenheit gefunden zu haben, dieses Haus wieder zu betreten. Er versprach, sich pünktlich einzufinden. Als er an dem Empfangszimmer vorüberschritt, vernahm er eine heftige Männerstimme, in der er die des belgischen Leutnants zu erkennen glaubte. Sie verstummte aber sofort auf das Geräusch von Schritten hin, und es war Dr. Scholz nur noch, als vernehme er leises Schluchzen. Es war wie stilles, verzweifeltes Hilfeflehen, und das unheimliche Gefühl, das in ihm war, wuchs. Warum also in aller Welt zog es ihn nach diesem Hause zurück, in dem er gar keine Berührungspunkte zu seinem ureigensten Wesen fand? Warum übte es trotzdem eine solche Anziehungskraft auf ihn aus? Wie eine kleine Festung stand es mit seinen gotischen Türmchen da, finster und verschlossen. Es lag in der Unheimlichkeit der Bauart etwas Großartiges, Machtvolles. Wie eine Belfriede war es, wie ein mächtiger Wachtturm, der die Vergangenheit schützen sollte. Und während der Deutsche noch unter dem Eindruck des Baues stand, den er lange betrachtete, war es ihm wieder, als dringe das geheimnisvolle Schluchzen an sein Ohr, übertönt von dieser rauen, brutalen Männerstimme. Und ohne dass er es selbst recht begriff, fasste ihn ein Hass gegen dieses Haus, ein dumpfer Hass, in den sich eine unerklärliche Furcht vor etwas Unbestimmtem mischte wie vor einem Schicksal, gegen dessen Entfaltung er machtlos war.
Zweites Kapitel.
Der Sommer hatte in diesem Jahre trübe und mit kalten Winden eingesetzt. Als er sich aber seiner Höhe und Entfaltung näherte, da zeigte er seine ganze Pracht und Wärme. Man konnte sich kaum erinnern, jemals das Getreide so schön gesehen zu haben. Jeder Tag erwachte mit einem wundervollen blauen Himmel, jeder Abend stand mit Milliarden klarer, heller Sterne über dem gesegneten Land.
Obwohl Belgien in eigentlichem Sinne ein industrieller Staat ist, steht die Landwirtschaft auf voller Höhe. Liebkosend strich die Hand des Doktors über die vollen Ähren, die sich geschmeidig in dem leisen Winde wiegten, als er auf der Chaussee nach Malines dahinschritt. Er machte gerne große Tagestouren, und ein Marsch nach Mecheln gehörte fast in jeder Woche einmal zu seinem Programm.
Diesmal allerdings machte er schon am Reeselberg halt. Er setzte sich an dem Denkmal, das an die blutigen Ereignisse der belgischen und französischen Revolution von 1830 erinnert, in den Schatten und blickte über das Land, als ein malerisches kleines Häuschen seine Aufmerksamkeit erregte.
Es lag zwischen Ulmen gebettet und schien einem reichen Löwener Bürger als Sommervilla zu dienen. Oder es war das Besitztum eines fleißigen kleinen belgischen Beamten, der sich nach des Lebens Dienst und Einerlei hierher zurückgezogen hatte.
Merkwürdig nur, dass man den Garten so verwildern ließ. Wilder Wein rankte sich ungepflegt an der Veranda empor. Und — seltsam — alle Fensterläden waren dicht verschlossen, die Jalousien herabgelassen.
Einige Bauernburschen gingen singend an dem einsamen Wanderer vorüber. Sie schienen in das nächste Dorf zu gehören.
Dr. Scholz redete sie in französischer Sprache an:
„Bon jour, messieurs! Könnt ihr mir sagen, wer dieses hübsche Häuschen drüben bewohnt?“
„Das wird selten besucht, mein Herr“, erwiderte einer nach einem flüchtigen Blick hinüber. „Es gehört einem französischen Grafen, der hier — je nun — der hier —“
Er verstummte. Seine Freunde brachen in ein schallendes Gelächter aus, und einer von ihnen schlug dem Sprecher auf die Schulter:
„Wie kann man nur so zimperlich sein, Pierre! Wenn Sie es interessiert, mein Herr, sollen Sie es wissen: In diesem Häuschen trifft der Herr Graf seine Liebste, eine wunderschöne Dame, die ein Geheimnis umgibt. Viele sagen, sie wäre eine Deutsche, aber ich denke mir, dann wäre sie nicht so schön. Sie sieht aus, als wäre sie in Flandern geboren . . .“
„Tölpel“, fiel ihm der ins Wort, welcher mit Pierre angesprochen worden war. „Als ob du je Gelegenheit gehabt hättest, sie aus der Nähe zu sehen! Immer kommt sie dicht verschleiert im Automobil an, und was du da sagst, ist nichts weiter als alberne Renommisterei.
Der Vorwurf schien den, dem er galt, nicht wenig zu treffen. Während sich die Burschen entfernten, ohne den Fremden noch zu beachten, entspann sich ein Streit, der immer heftigere Formen annahm.
Die geringfügige Kleinigkeit hatte die Gemüter so erhitzt, dass sich schnell zwei Parteien bildeten; und plötzlich begannen sie mitten im Felde zu raufen. Dr. Scholz sah eben, wie der, welcher Pierre hieß, etwas Blitzendes in der Luft schwang, aber schon rissen ein Dutzend Fäuste den Messerhelden nieder. Der Zwischenfall schien auf alle ernüchternd gewirkt zu haben, denn sie setzten nun ihren Weg fort, wenn die Unterhaltung auch immer noch mit welscher Lebhaftigkeit und Lautheit fortgeführt wurde.
Dr. Scholz war nicht zum ersten Mal, seit er in Belgien weilte, Zeuge solcher Auseinandersetzungen, bei denen das Messer eine Rolle spielte. Es gibt kaum ein Volk in Europa, das so schnell mit der Waffe zur Hand ist, wie das belgische, und selbst der heißblütige Bayer greift niemals so unvermittelt zum Messer, wie der belgische Bauer, von dem der flämische Historiker Vanderkindere sagt: „Nur zu oft noch spielt das Messer in unseren Dörfern eine verhängnisvolle Rolle.“
Der Lärm war verhallt und die Aufmerksamkeit des Wanderers galt wieder dem stillen Häuschen, das für ihn eine merkwürdige Anziehungskraft besaß.
Also eine geheimnisvolle Geschichte voller Romantik hegen diese weißen Mauern mit dem grünen Laubgewinde, dachte er lächelnd. Ein französischer Graf verbirgt hier vor den Augen der neugierigen Welt sein stilles Liebesglück . . .
Es war nicht Neugierde, die die Gedanken des Geschichtsforschers immer wieder in die gleiche Bahn lenkten. Es war Lust und Freude an dem romantischen Stoff, der sich da vor seiner spielerischen Phantasie erschloss, und schon sah er im Geiste das braune Reiseauto anrattern, sah einen verschwiegenen Lakaien, der blitzschnell den Schlag öffnete und der vornehmen jungen Dame aus dem Wagen half, sah den schlanken Grafen in den Garten eilen und sich über die schmale Hand der Dame neigen . . . Diesmal stand die kleine Türe offen, und sie traten beide, still und glücklich lächelnd, in das kühle Haus
Da — näherte sich nicht wirklich eine Gestalt dem Häuschen? Die Ulmen entzogen den Beobachter dem forschenden Blick, den ein Mann drüben auf dem Ackerweg rundum warf. Unwillkürlich duckte sich Dr. Scholz auch zusammen, als fürchte er, die friedliche Romanze zu stören, die dieser Sommernachmittag gebar . . .
Jetzt winkte der Mann, und nun trat ein zweiter in das Licht. Er war kleiner als sein Begleiter, auch weniger beweglich, wenngleich der vordere älter erschien.
Dr. Scholz legte die Hand über die Augen und betrachtete den zweiten, dessen Bewegungen ihn an jemanden erinnerten, er wusste nur nicht an wen.
Und obgleich jener jetzt keine Uniform trug, sondern einen eleganten Zivilanzug, erkannte er plötzlich den belgischen Leutnant.
Den Sohn des Archivrats Rambaud.
Ehe er sich noch von seiner Überraschung erholt hatte, sah er, wie beide sich dem Häuschen näherten.
Der Ältere, der einen dunklen Spitzbart trug, schloss auf — und nun verschwanden beide im Innern.
Und das Häuschen lag wieder still und verlassen.
Der Deutsche schüttelte den Kopf. Er konnte sich gar nicht vorstellen, dass der belgische Leutnant mit der rauen Stimme und dem stechenden Blick in die Idylle des französischen Grafen verwickelt sein könnte.
Da durchschnitt ein ratterndes Geräusch die schwüle Stille des Sommertages. Ein Automobil mit verschlossenem Coupé — sogar die Vorhänge waren an den Fenstern herabgelassen — glitt gespenstisch an dem Lauscher vorüber — flitzte vorbei und bog in kühner Kurve in die Felder ein. Einem schmalen Wege folgend, arbeitete es sich bis zu der Auffahrt an dem kleinen Hause vor.
Es hielt. Und es kam genau, wie der Träumer sich das ausgemalt hatte: Ein betresster Lakai stürzte auf die Straße und öffnete den Schlag. Man sah nur einen wehenden Frauenschleier, dann fuhr das Auto weg und verschwand in einer Staubwolke.
Und das Häuschen lag wieder verschlossen und träumend da mit herabgelassenen Jalousien, als sei es verwunschen und verlassen.
Kopfschüttelnd setzte der Doktor seinen Weg eine Weile fort. Sollte es doch nicht so ganz seine Richtigkeit haben mit dem französischen Grafen? Welche Rolle spielte Leutnant Rambaud bei diesem geheimnisvollen Besuche?
Und dann der Diener!
Der war schon in dem Landhaus gewesen, ehe der Besucher gekommen war.
Aber nichts hatte seine Anwesenheit verraten. Warum versteckte er sich?
Sollte sich ein anderes Geheimnis in dem Hause verbergen als das, welches der geschwätzige Volksmund weitergab?
Unwillkürlich, ohne es zu wollen, folgte Dr. Scholz dem Weg, den das Automobil durch die Felder genommen hatte.
Und so gelangte er vor das Häuschen. Er erschrak ein wenig über sich selber, als er sich vor der Steintreppe fand. Und schnell ging er weiter, fand ein altes, halb verfallenes Gartentor und konnte sich’s nun doch nicht nehmen, in diesen reichen, verwilderten Garten einen Blick zu werfen.
An das morsche Tor gelehnt, sah er hinein. Da drinnen blühten Geranien, Rosen, Nelken in wilder Pracht. Dazwischen war Mohn in roter Glut aufgeschossen, Margueriten streckten ohne Scheu ihre unschuldigen Köpfchen durch das Wirrwarr von Blumen und Farben, und hohe Bäume breiteten schützend ihre Zweige über die vielen Pfleglinge der Sonne.
Da drang eine laute Stimme an das Ohr des Deutschen.
„Wir müssen die Pläne einfach haben“, schrie jemand. Er schrak zusammen.
Pläne??
Und wie er, sich aufstraffend, zu dem Fenster hinübersah, woher die Stimme gedrungen war, da riss jemand plötzlich heftig die Jalousie in die Höhe.
Der Kopf des Fremden wurde sichtbar. Einige Sekunden sahen sich der unfreiwillige Lauscher und der Franzose — dafür hielt ihn der Deutsche — in die Augen.
Dr. Scholz fühlte, dass der Fremde sich sein Gesicht einprägte für alle Zeiten. Er sah in ein paar finstere, lauernde Augen. Eine große vorspringende Nase gab den sonst regelmäßigen Ziegen etwas Unschönes und doch wieder Verwegenes, Romantisches. Der Mund mit den brutal gewölbten Lippen war halb geöffnet:
„Oh, là, là — voyez, mon Lieutenant!“
Jetzt erschien auch der Kopf Rambauds, verschwand aber sofort wieder und rief etwas in das Innere des Zimmers.
Daraufhin schnellte die Jalousie wieder herunter und es wurde still.
Dr. Scholz fasste seinen Stock fester und setzte nun seinen Weg fort, nicht ohne von Zeit zu Zeit einen Blick nach rückwärts zu werfen, wo das kleine Häuschen mit seiner verdächtigen Idylle immer mehr im Laubgewirr der Ulmen versank.
So dämmerte es schon, als er sich Löwen näherte.
Die ersten Häuser reckten sich über die flache Landschaft. Dort drüben lagen nach Krautäcker und Wiesen.
Ein breiter Graben lief längs der Chaussee.
Durch eine jener Ideenverbindungen, deren Zusammenhang wir niemals anzugeben vermögen, dachte der Deutsche in diesem Augenblick:
Was für prachtvolle Schützengräben das gäbe! Angenommen, dort drüben an der Waldlisiere säße der Gegner und überstriche die Felder mit Gewehrfeuer und hier drinnen lägen wir, Unsere Jungens und ich in meiner Eigenschaft als Leutnant der Reserve — holla, wir wollten’s ihnen schon zeigen . . . Schnellfeuer — und dann: Sprung! Marsch! Marsch! Gewehr zur Attacke rechts — —
Unsinn, lachte er dann über sich selber. Wie oft meine Phantasie mit dem Verstande durchgeht!
Überhaupt in diesem Lande werden wir unsere Kraft wohl nie zu erproben haben. Ein neutraler Staat . . .
Und wieder glitt sein Blick über die blühende Landschaft.
Da tönte es in seinen Ohren nach:
„Wir müssen die Pläne einfach haben!“
Er zog die Stirne kraus.
Was für Pläne? Und was ging überhaupt in diesem Häuschen vor?
. Und wer war die Dame, die so geheimnisvoll im Auto angefahren war?
Die Bäume warfen lange Schatten. Er musste sich beeilen, wollte er noch rechtzeitig zu dem Archivrat Rambaud kommen. Gerne folgte er der Einladung nicht. Aber er wollte die deutsche Erzieherin wiedersehen.
Das hatte er sich erst nur nicht gestehen wollen. Schnell ausschreitend, bog er in einen Feldweg, um abzuschneiden, als plötzlich ein scharfer kurzer Knall sein Ohr erschreckte.
Gleichzeitig pfiff etwas haarscharf an seinem Gesicht vorbei — er fuhr unwillkürlich zurück — und dann, schneller, als er sich über seine Vermutung klar werden konnte, hinein in das Feld!
Aber da schnellte schon einer hoch und mit der Geschwindigkeit der Furcht davon — immer durch die Äcker — in die hohen Ährenfelder hinein — so schnell konnte der verdutzte Doktor gar nicht nachkommen — —
Er musste es sich halblaut vorsagen, damit er’s glaubte und begriff:
Man hatte auf ihn geschossen.
Und der, welcher den Anschlag verübt, war kein anderer gewesen, als der Diener aus dem Landhäuschen, der der fremden Dame aus dem Wagen geholfen hatte . . .
Ein frevlerischer, verbrecherischer Anschlag mitten im Frieden, im Angesicht einer Stadt!
Ich werde der Polizei Mitteilung machen, dachte er im Weiterschreiten. Oder noch besser: Ich wende mich sofort an das deutsche Konsulat.
Warum schoss denn der Kerl auf mich? Warum?
„Wir müssen die Pläne einfach haben“, tönte es da wieder in seinem Ohr.
Das hatte er gehört. Und deshalb . . .
Wirklich deshalb?
Deswegen hatte man versucht, ihn aus dem Wege zu räumen? Dachte man, er hätte mehr gehört? Und durfte man von ihm Gefahr erwarten?
Etwa — weil er Deutscher war?
Er hatte den Kerl ganz deutlich erkannt, konnte ihn also mit ruhigem Gewissen anzeigen.
Aber was würde dann geschehen? Die Polizei würde eine Untersuchung einleiten. Die belgische Polizei — pah! Er musste lachen. Seit einiger Zeit war man nicht eben gut auf die Deutschen zu sprechen. Beliebt waren sie in Belgien nie gewesen. Bei den unteren Schichten nicht, weil man mit Frankreich sympathisierte und in den Deutschen einen ewig drohenden Feind sah.
In den oberen Kreisen spielten kommerzielle Gründe mit; man sah es — ähnlich, wie in der Schweiz — nicht gerne, dass der Außenhandel teilweise in deutschen Händen lag. Gar in Antwerpen! Da saßen lauter deutsche Großkaufleute, die den Engländern den Rang abgelaufen hatten.
Scholz kannte die Verhältnisse nur zu gut. Er versprach sich von dem widerwilligen. Eingreifen der Polizei nicht viel. Denn er ahnte, dass der Verbrecher Gönner hatte, die Macht besaßen.
War denn die Polizei nicht längst auf das geheimnisvolle Gartenhaus aufmerksam geworden?
Drückte sie nicht vielleicht ein Auge zu? Duldete am Ende ungesetzliche Handlungen, die mit zu einer geheimen Organisation gehörten, die das Tageslicht zu scheuen und doch den Schutz der Regierung zu genießen hatte . . .
Da konnte auch der Konsul nicht viel ausrichten. Nein, Dr. Scholz fasste einen anderen Plan. Der Angriff auf sein Leben erschien ihm plötzlich ganz unwichtig. Seine Person und seine Interessen traten in den Hintergrund angesichts eines Verdachtes, der von ihm Besitz ergriffen hatte.
Er beschloss, die Augen offen zu halten und auf eigene Faust zu handeln. Vielleicht konnte er seinem Vaterlande einen großen Dienst erweisen. Angesichts dieser Möglichkeit mussten alle persönlichen Interessen schweigen. — Jetzt bog er wieder nach der breiten Landstraße ab, die nach Löwen hineinläuft.
Eine Hupe ließ ihn umblicken. Und auf den ersten Blick erkannte er das Auto, welches vor dem kleinen Hause gehalten hatte.
Das Coupé war jetzt offen. Aber von der Dame, die darinnen saß und ihn im Vorbeifahren musterte, sah er nur eine Wolke weißer Schleier und große Brillengläser. Fast gespenstisch sah sie aus.
Wie er noch stand und ihr nachstarrte, flog etwas das aussah wie eine weiße Rose, auf die staubige Straße. Er eilte hinzu. Es war ein Taschentuch aus feinem Batist, dem ein diskretes Parfüm entströmte. In einer der spitzen und gezierten Ecken war eine gräfliche Krone eingestickt, darunter die Initialen „M. v. S.“ Ratlos stand er da — vor einem neuen Rätsel.
Drittes Kapitel.
Der Sohn des Archivrates Rambaud war noch nicht zu Hause. Aber Dr. Scholz lernte inzwischen Madame Rambaud kennen. Sie war eine elegante Vierzigerin mit lebhaften Manieren und ergriff sogleich die Führung der Unterhaltung. Sie sprach ein fließendes, reines Französisch, ohne jeden Dialekt, so daß ihr Gast nicht wenig verwundert war, zu hören, sie sei Südfranzösin.
„Ich habe mich aber vollkommen naturalisiert“, setzte sie hinzu, „und darf sagen, ich bin nicht weniger überzeugte Belgierin wie meine Tochter, die hier geboren ist und ihr Vaterland mit ganzer Hingabe liebt. Haben Sie ihren Namen noch nicht in den Zeitungen gelesen? Sie schreibt viel für die Gazette de Liège und für den Patriote in Brüssel . . .“
„Mademoiselle Rambaud . . . lassen Sie mich nachdenken.“
„Yvonne Rambaud . . .“
„Ah ja, jetzl erinnere ich mich. Yvonne Rambaud — schreibt sie nicht sehr viel über die Hebung der belgischen Landwirtschaft, die sie gegenüber der industriellen Entwicklung ganz besonders von der Regierung begünstigt sehen möchte?“
„Ja, mein Herr! Ich sehe, Sie haben die Aufsätze mit Interesse gelesen.“
„Einige davon. Aber ich muß gestehen, daß mich manches zum Widerspruch reizte. Denn es unterliegt keinem Zweifel, daß die Hauptbedeutung Belgiens auf industriellem und handelspolitischem Gebiete liegt.
Beachten Sie: Der belgische Handelsumsatz beträgt ein Drittel des deutschen, die Bevölkerung aber nur ein Neuntel. Das sind doch Erfolge, die für sich selber sprechen!“ Ich muß Ihnen darauf die Antwort schuldig bleiben“, erwiderte Madame Rambaud, und setzte lächelnd hinzu: „Ich, müssen Sie wissen, stamme noch aus der alten Zeit. Ich habe nicht, wie meine Tochter, auf der Universität in Lüttich studiert. Mein Reich ist die Küche und meine Interessen liegen im Hause.“
„Womit Sie das eigentliche Reich der Frau beherrschen“, sagte Dr. Scholz mit einer leichten Verneigung. „Die Artikel ihrer Tochter sind jedenfalls mehr von der Liebe zum Bauernstand als von praktischen Kenntnissen beeinflußt.“
Er sagte das, nicht nur, weil es seine Überzeugung war, sondern auch, weil Yvonne Rambaud noch ein anderes Steckenpferd hatte: die Polemik gegen Deutschland.
Diese kam immer wieder in ihren Artikeln zum Durchbruch, und dieser Haß war ebensowenig durch Tatsachen begründet, wie ihre seltsame Auffassung über Belgiens Wirtschaftspolitik. Es war einfach eine persönliche Gefühlspolitik, die Yvonne Rambaud in den Blättern betrieb, die ihr aus Gott weiß welchem Grunde ihre Spalten öffneten. Dr. Scholz sah wieder einmal seine Überzeugung bestätigt, daß Frauen nicht geeignet seien, sich in Tagesfragen zu mischen. Er hielt nicht viel von den „studierten Frauen“, vielleicht nur deshalb, weil die Vorstellung einer intellektuell völlig gleichberechtigten Frau seinem ausgesprochenen Männlichkeitsgefühl widersprach.
Als sich die Türe öffnete und er flüchtig eine hohe, weibliche Erscheinung sah, dachte er an die deutsche Erzieherin. Eine unbeschreibliche Unruhe ergriff ihn, aber sofort wich diese Empfindung einem Gefühl des Staunens, mit Bewunderung gemischt, vielleicht auch mit angenehmer Enttäuschung, als die etwa zwanzigjährige junge Dame eintrat und Madame Rambaud sie ihrem Gaste sogleich vorstellte:
„Meine Tochter Yvonne . . . Herr Dr. Scholz . . .“
Aufstehend flüsterte sie Yvonne zu: „Ein bedeutender Mensch“ — und laut sagte sie: „Ich bitte dich, mein Kind, unseren lieben Gast zu unterhalten, ich will nur schnell einmal nachsehen, ob der Tisch in Ordnung ist.“
Fast gleichzeitig trat auch der Archivrat ein. Er wechselte mit seinem Gast einige höfliche Phrasen und dieser antwortete zerstreut; denn nie im Leben vorher hatte eine Frau eine solche Wirkung auf ihn ausgeübt wie Yvonne, die ihn mit dem Augenblick ihres Erscheinens vollständig in ihren Bann genommen hatte.
Sie war von bezaubernder Schönheit.
Mehr Frau in ihrem Äußeren als Mädchen hatte sie etwas Überlegenes, wozu die hohe schlanke Figur noch beitrug. Ein kleiner, kräftig gezeichneter Mund, den das weiche runde Kinn wieder vollendet frauenhaft machte, die hochgeschwungenen Brauen verrieten einen festen Willen, die Nase war gerade, edel, die Flügel bebten, wenn sie sprach, wie in verhaltener Leidenschaft. Die mandelförmig geschnittenen Augen verliehen ihr fast etwas Orientalisches, aber die Pupillen hatten nichts von dem weichen, verträumten Schmelz einer Slavin. Sie waren klar und groß, voll Feuer und Kraft, und ohne weiteres mußte sich Dr. Scholz gestehen, daß eine ungewöhnliche Intelligenz aus ihnen sprach — eine Intelligenz allerdings, die leicht von jener lauernden Leidenschaftlichkeit beherrscht wurde, die das ganze Antlitz ausdrückte, sogar die widerspenstigen kastanienbraunen Haare, die die Stirne in zwei Flügeln rahmten.
„Sie erinnern mich an ein Gemälde“, sagte er leise, nachdem er ein paar belanglose Worte mit ihr gewechselt hatte. „Im Antwerpener Museum hängt ein Bild von Jordaens: ,Wie die Alten sungen, so pfeifen die Jungen‘. . .“
Sie unterbrach ihn mit einem herzhaften Lachen, in dem ein voller, weiblicher Ton mitklang, der ihn erbeben ließ:
„Nun wollen Sie mich wohl gar mit der Dame im Mittelstück des Bildes vergleichen . . .“
„Sie nahmen mir das Kompliment —vorweg, mein Fräulein!“
„Nun, mein Herr, ich bin gewohnt, daß man mir Schmeichelhaftes sagt, aber ich muß gestehen, Sie wählen dafür eine originelle Form. Denken Sie nicht, ich fühlte mich nun verpflichtet, die Schmeichelei mit gleicher Münze zurückzugeben! Ich finde aber, daß Sie das Aussehen eines Gelehrten haben, wie ich ihn mir vorstelle: Kein altersschwacher Bücherwurm, sondern ein kluger Mensch voll frischer Männlichkeit, der mit dem Verständnis der Jugend aus dem Vollen schöpfen kann.“
Er lächelte, diesmal wirklich verwirrt:
„Sie machen mich verlegen. Meine Verdienste sind bisher so kleine . . .“
„O, treiben Sie keine konventionelle Politik der Bescheidenheit. Ich pflege mich bei meinem Vater stets vorher über die Gäste zu erkundigten, die ich bei Tisch sehen werde, und Ihr Name ist mir aus mehreren archäologischen Zeitschriften nicht mehr unbekannt.“
„Wirklich? Sie haben meine Essays gelesen?“
„Sicherlich viele davon. Und ich freue mich aufrichtig, mich wieder einmal mit einem Manne unterhalten zu können, der etwas zu sagen weiß. Wir sind mithin Kameraden, Herr Dr. Scholz, und jedwedes Kompliment ist von jetzt an zwischen uns verpönt — wollen Sie mir das auf Handschlag versprechen?“
Sie reichte ihm eine schmale, gepflegte, kräftig geformte Hand. Er schlug mit Herzlichkeit ein.
„Also Kameraden, — obwohl — ich Deutscher bin?“
Sie lachte belustigt.
„Ich beiße Sie deswegen nicht, Doktor. Ja, ich gestehe, ich hasse eine bestimmte Art non Deutschen, aber das sind Preußen. Und zwischen Deutschen und Preußen besteht ein gewaltiger Unterschied . . .“
„Wohl nur in der Diktion.“
„Nein, überhaupt. Unter Preußen verstehe ich die Potsdamer Wachtparade, wie man in Europa die militärischen Maschinen des Königs Friedrich, den die Preußen den Großen nennen, getauft hat. Ich meine also das preußische Militär, diese Sklaven des Drills, diese Offiziere, deren soldatische Anmaßung die ganze Welt unterwerfen möchte. Das ‚Volk der Dichter und Denker‘ hasse ich nicht, denn ich weiß sehr wohl, daß die Intelligenz in Deutschland sich in einem steten, erbitterten Kampfe mit dieser rohen Diktatur der Gewalt befindet, die sich in allen Regierungs- und Verwaltungsgebieten behauptet.“
Er hatte mehrmals den Kopf geschüttelt.
„Wie sehr verkennen Sie Deutschland, mein Fräulein, und wie oberflächlich urteilt das Ausland über das herrliche Ringen zwischen einer ungehemmt und schrankenlos vorwärtsstrebenden intellektuellen Jugend und dem fundamentalen Gesetz der deutschen Ordnung! Gerade in diesem Ringen der Parteien drückt sich kein Konflikt aus, wie sie glauben, sondern es ist der Ausdruck einer uneingedämmten Kraft, eines Überschusses an Kräften, die dieses Land stets und in alle Ewigkeit einzusetzen hat.“
„Sie sympathisieren also mit dem militärischen Drill?“
„Dieser militärische Drill ist von der höchsten Geisteskraft durchflutet, mein Fräulein, was schon daraus hervorgeht, daß fast alle Vertreter des Handels, der Intelligenz und der Kunst als Reserveoffiziere dem Heere angehören.“
Sie zuckte die Achseln.
„Sie wollen nichts auf Ihr Vaterland kommen lassen. Ich achte diesen Standpunkt, denn sonst leugnen gerade die Deutschen ihre Nationalität im Auslande gerne ab. Im Herzen denken Sie ja doch anders.“ Und lachend setzte sie hinzu: „Sie als preußischer Unteroffizier — nein, wissen Sie, dagegen sträubt sich meine gesunde Vorstellung.“
Die Hausfrau bat zu Tisch. Eben traten auch Leutnant Rambaud ein, und — wahrhaftig, dachte Dr. Scholz, er hat die Frechheit! — und stellte seinen Freund vor:
„Marquis Julien de Soubise . . .“
Wie ganz anders war Yvonne gegen diesen neuen Gast als gegen Scholz! Vollendete Dame, beinahe herablassend, ließ sie kaum eine oberflächliche Unterhaltung zwischen sich und dem Marquis, der ihr Tischnachbar war, aufkommen:
Neben der Dame des Hauses hatte die Erzieherin Platz genommen. Yvonne schien zu glauben, Dr. Scholz habe sie noch nicht gesehen oder gesprochen, denn sie wandte sich zu ihm:
„Ein Fräulein von Sandern, unbedeutend und harmlos, ich glaube, Mama hat sie nur engagiert, weil sie adelig ist.“
Von diesem Augenblick an war der Doktor schweigsam und verstimmt. Denn Elsa von Sanderns Augen hatten eben auf ihm geruht, als Yvonne diese taktlose und häßliche Bemerkung machte, mit der sie gleichzeitig verriet, daß sie die Deutsche haßte.
Aber je kühler der Doktor war, desto mehr unterhielt sich Yvonne gerade mit ihm, zum Ärger des Grafen, der schon bei der Vorstellung dem Deutschen eine Antipathie zu erkennen gegeben hatte.
Jetzt warf er ihm von Zeit zu Zeit einen forschenden Blick zu, in dem sich nur allzudeutlich der Haß spiegelte, den die Bevorzugung, die ihm die Tochter des Hauses zukommen ließ, mit jeder Minute steigerte.
Als er zu Eugen hinüberblickte, machte dieser eine sonderbare Handbewegung, etwa als wollte er sagen: Nur Geduld! Diesen lästigen Ausländer wollen wir schon noch kalt stellen!
Es erging dem Marquis wie dem Deutschen: Er war gefesselt durch die majestätische Schönheit Yvonnes, während diese ihn links liegen ließ.
Der Doktor sah mit einem Gefühl der Beschämung zu seiner deutschen Landsmännin hinüber. Er erinnerte sich der Vorgänge vom verflossenen Morgen und daß ihn eigentlich gerade der Liebreiz des jungen wieder hierhergezogen hatte.
Und nun konnte er in einem Augenblick so völlig auf sie vergessen!
Am liebsten hätte er ihr Abbitte geleistet — mit den Augen wenigstens — hätte ihr gezeigt, daß er sich auch mit ihr unterhalten wollte, denn es interessierte ihn so vieles aus ihrem Leben — aber sie hielt die Augen auf ihren Teller gesenkt.
Kam es nur ihr so vor, oder lag über ihr der Schimmer einer Hilflosigkeit die ihn rührte und bedrückte zugleich? Manchmal warf sie einen scheuen Blick zu dem Leutnant hinüber — nein, dachte der Deutsche, Liebe drückt dieser Blick nicht aus, und der finstere überlegene Ausdruck, mit dem Eugen Rambaud seine Braut zu mustern pflegt, erinnert mehr an Gewalt als an Zärtlichkeit.
Sie sind verlobt — und sie wechseln bei Tisch kein Wort zusammen. Madame Rambaud ist von konventioneller Höflichkeit zu ihr, und die Bemerkung Yvonnes —
Seltsam, seltsam, dachte er für sich. Die Verlobung scheint geheim gehalten zu werden, wenigstens wissen offenbar weder der Vater, noch die Mutter, noch die Schwester davon. Vielleicht hatte Elsa von Sandern bloß in der ersten Verwirrung ihn eingeweiht und war darum von dem Leutnant nachher zur Rede gestellt worden . . .
Das war alles so merkwürdig und unnatürlich in diesem Hause. Yvonne zog ihn wieder ins Gespräch.
Sie erzählte ihm, daß. sie in London erzogen sei.
„England ist wunderschön, und die englische Nation verehre ich. Kennen Sie London?“
Er mußte verneinen. In Italien war er schon gewesen und in Holland und in Polen . . .
„Russisch Polen?“
„Ja. Ich habe dort einen Bruder, in Kielce. Der baut russische Bahnen und ist mit einer Polin verheiratet.“
„Wie interessant! Er kommt nie mehr nach Deutschland?“
„Vorläufig wohl nicht; denn er ist sehr glücklich verheiratet. Freilich, durch jeden seiner Briefe klingt die Sehnsucht nach der deutschen Heimat, nach den deutschen Eichen.“
„O, ich kann mir nicht vorstellen, daß der Deutsche im Auslande so sehr Heimweh hat. In London leben so viele Deutsche, die sich ganz als Engländer fühlen, und erst in Amerika . . .“
„Zugegeben! Lassen Sie aber einmal das Vaterland nach all denen rufen, die jetzt mit ausländischen Mänteln prunken, dann sollen Sie sehen, wie diese Mäntel fliegen und der deutsche Panzer sichtbar wird!“
„Wir wollen es abwarten, Herr Dr. Scholz. Nach meinen Informationen wird es ja nicht mehr allzulange dauern, bis die eisernen Würfel fallen. Sir Grey zum Beispiel, ein Freund der Familie, in der ich in London lebte, äußerte sich erst vor kurzem noch sehr pessimistisch über Österreich.“
„Deutschland, mein Fräulein, will den Frieden. Wenn aber einmal ein frecher Nachbar wagen sollte, an unsere heiligsten Güter zu tasten, dann, ja dann würde das Volk im Sturme aufstehen und dann würde in Europa wieder ein Lied gesungen werden von dem deutschen Zorn!“
Er hatte sich in Hitze geredet. Seine letzten Worte waren von allen verstanden worden.
Es war eine Pause in der Unterhaltung eingetreten, die Madame Rambaud benutzte, die Tafel aufzuheben.
Dr. Scholz fühlte einen Moment das Peinliche der Situation. Er war ärgerlich über sich selbst, daß er sich nicht mehr im Zügel gehabt. Aber da traf ihn ein Blick Elsa von Sanderns, ein so warmer, herzlicher, dankbarer Blick, daß er sogleich die Gelegenheit benützte, zu ihr zu treten:
„Ich fühle, daß. Sie so denken wie ich, gnädiges Fräulein!“
„Oh! Sie haben mir aus der Seele geredet! Ich hasse diese Menschen hier! O, wie ich sie hasse!“
„Sie hassen? Können Sie denn hassen?“
Sie schlug die Augen auf. Ein Feuer loderte in ihnen.
„Wenn Sie wüßten — wenn Sie wüßten, was man mir hier angetan hat, wie man mich demütigt und was man mir noch antut.“
„Wie, mein liebes gnädiges Fräulein, man behandelt Sie schlecht?“
„Nein, das ist es nicht. Ich kann es Ihnen jetzt nicht sagen. Nur warnen möchte ich Sie. Nehmen Sie sich in acht!“
Er zuckte die Achseln — aber da fiel ihm sein Erlebnis auf der Landstraße ein. Er nickte ihr dankbar zu. Sie zog sich zurück, mit einem verlorenen Lächeln auf den Lippen, das ihm ins Herz schnitt.
Was war ihr? Konnte er ihr denn nicht helfen? Er wollte es doch — aber nun mußte er sich nach Yvonne umsehen!
Sie unterhielt sich mit ihrem Bruder und dem Grafen.
Der Archivrat zog ihn ins Gespräch.
Zwischen Yvonne und den beiden Männern fand eine erregte Auseinandersetzung in der Fensternische statt. Der Doktor konnte es bemerken, ohne doch ein Wort von dem zu erhaschen, was gesprochen wurde.
„Und ich wiederhole dir, daß es ein deutscher Spion ist“, sagte der Bruder eindringlich.
„Nein, ich mache diese Sucht, die ich in England schon hinreichend kennen gelernt habe, nicht mit“, erwiderte Yvonne, aber der Klang ihrer Stimme war nicht mehr fest.
„Sie wollen nicht glauben, daß Deutschland alle Welt mit seinen Kundschaftern überschwemmt?“ warf der Marquis ein. „Ah — in Frankreich ziehen sie umher als Leierkastenmänner, arbeiten in den Steinbrüchen, schleichen sich in unsere Bureaus, ja sogar die Legionen ihrer dienenden Frauen haben sie mobil gemacht! Jeses zweite Kindermädchen, jede Bonne in Paris ist eine Spionin!“
„Ammenmärchen!“
„Wir haben Beweise!“
„Auch daß Dr. Scholz ein verkappter Spion ist?“
„Das wissen wir aus seinem Benehmen — ja, wenn wir Beweise hätten!“
„Er ist doch so ganz in deinem Bann, liebe Schwester, daß es dir nicht schwer fallen kann, ihn auszuholen“, sagte Eugen. „Er wird Frauen gegenüber genau so tölpelhaft sein wie alle Deutschen.“
„Sie sind Hunde, diese Prussiens!“ setzte der Marquis hinzu.
Sie lehnte sein zudringliches Lächeln mit einem kühlen Blick ab.
„Ich kann mich nicht dazu hergeben, Polizeidienste zu übernehmen“, sagte sie, zu dem Bruder gewandt. „Wenn ich aber im Laufe weiterer Unterhaltungen mit Dr. Scholz die Überzeugung gewinnen sollte, daß er ein Spion ist, werde ich nicht zögern, die Beweise dafür der Polizei zu übergeben.“
Der Marquis nickte. befriedigt. Er beugte sich über Yvonnes Hand mit einigen 5chmeichelworten, die sie mit kalter Herablassung entgegennahm.
„Er darf nicht nach Deutschland zurück“, sagte Eugen entschlossen zu seinem Freunde. „Sie hätten dort nicht die geringsten Chancen mehr!“
„Das ist wahr. Wie weit sind Sie mit der Deutschen?“