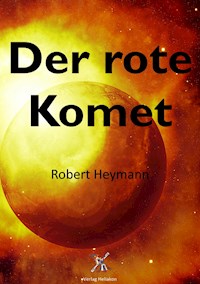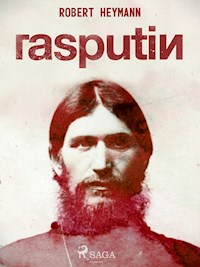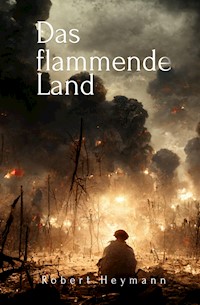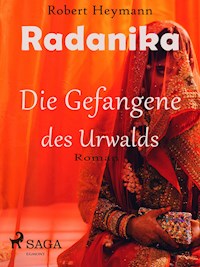Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Heymann verfolgt in beiden Teilbänden die Sittengeschichte der sexuellen Hörigkeit durch die Jahrhunderte und versucht durch zahlreiche Beispiele und Überlegungen seine (durchaus dem damaligen Zeitgeist entsprechende) ¬These von einem naturgegebenen Hörigkeitsverhältnis der Frau gegenüber dem Mann zu untermauern. Der mit vielen teils amüsanten, teils pikanten, teils regelrecht absurden Anekdoten gepfefferte sowie reich und geschmackvoll bebilderte Band ist ein Muss für den Liebhaber opulenter Erotika aus dem frühen 20. Jahrhundert. Allen kultur- und soziologiehistorisch Interessierten bietet er darüber hinaus eine Fundgrube von geschlechtsgeschichtlichen Stereotypen, wie sie die Gesellschaft über Jahrhunderte dominiert haben, und eröffnet dadurch einen vielsagenden und unverstellten Einblick in das weite Kreise prägende männliche Denken und den chauvinistisch-männlichen Blick auf die Frau vor rund hundert Jahren.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 326
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Robert Heymann
Die hörige frau
Sittengeschichte der Erotomanie
Saga
Die hörige Frau
German
© 1931 Robert Heymann
Alle Rechte der Ebookausgabe: © 2016 SAGA Egmont, an imprint of Lindhardt og Ringhof A/S Copenhagen
All rights reserved
ISBN: 9788711503744
1. Ebook-Auflage, 2016
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für andere als persönliche Nutzung ist nur nach Absprache mit Lindhardt und Ringhof und Autors nicht gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com – a part of Egmont, www.egmont.com
Einführung
Der Begriff „Hörigkeit“, auf die Frau angewandt, könnte irreführend sein, wenn wir nicht in einem Zeitalter leben würden, in dem die normale Hörigkeit der Frau, ihre Unterwerfung unter den Willen und die libido des Mannes, als unnatürlich angesprochen wird — obgleich sie eben doch der natürliche Zustand ist, mögen auch noch so viele Stimmen gegen diese einfache Tatsache eifern.
Schon im Jahre 1908 hat Dr. Georg Groddeck bei Hirzel in Leipzig ein Buch erscheinen lassen, Vorträge, die der Autor als Aufsätze teilweise in der „Zukunft“ veröffentlicht hat. Dieser kluge Nervenarzt hat vor fast 25 Jahren sehr genau vorausgesehen, was uns die „Antihörigkeitsbewegung“ oder „Emanzipation“ der Frau bescheren würde. Der Frau — und dem Manne.
„Man überhört die Mahnung der Natur jetzt in den Feministenkreisen geflissentlich. Das wird nicht helfen. An einem gewissen Punkt wird und muß die Frauenbewegung stillstehen. Es handelt sich da gar nicht etwa um rein körperliche Zustände, obwohl die allein genügen, um die Leistungsfähigkeit der Frau zu vermindern. Die Frau, selbst die gesündeste (und die erst recht), ist zu bestimmten Zeiten stets mehr oder weniger intellektuell unzurechnungsfähig. Ihr Wesen gerät dann mit unentrinnbarer Notwendigkeit in einen vollständigen Aufruhr, der an die Zeit der Entwicklung vom Kind zum Mädchen erinnert, sie wird gewissermaßen jedesmal wieder ein Mädchen mit mädchenhaften Ideen, kommt unter den Druck einer Gewalt, von der sie beherrscht wird, statt sie zu beherrschen. Die Frau ist im allerhöchsten Grade abhängig von ihrem Frausein und niemals, niemals wird sie das überwinden. Niemals wird sie deshalb auch nach außen leisten können, was der Mann leistet. Diesem Teil der Frauenfrage steht der Mann sehr ruhig gegenüber.“ (Wohlverstanden: 1908! Heute steht der Mann der Entwicklung der Frau ganz im Gegenteil sehr beunruhigt gegenüber!)
„Die Frau bleibt Dilettant im Schaffen. Sie ist zu anderen Dingen bestimmt!“
Die Natur hat wunderbar gearbeitet, um die Frau vor einem Abwenden von ihrer Bestimmung zu bewahren, um sie von dem Tätigkeitsfeld des Mannes zurückzuhalten, ihr jede schöpferische Tätigkeit unmöglich zu machen. Nicht genug, daß sie das Weib schwächer schuf, nicht genug, daß sie die Frau mit wiederkehrender Regelmäßigkeit daran erinnert, daß sie im Dienste des Geschlechts steht, wie sie auch zum Wahrzeichen dieses Verfallenseins an die Geschlechtlichkeit der Frau die Brüste gab, die sie zu allen schweren Arbeiten unfähig machen, nicht genug damit: sie gestaltete den Charakter, das Wesen der Frau so, daß sie auch nicht imstande ist, geistige Probleme zu lösen.
*
Wenn wir das natürliche Hörigkeitsverhältnis der Frau gut heißen, ein Verhältnis, das durch den Stand der jeweiligen Kultur ganz von selbst reguliert wird, so ist damit selbstverständlich nicht gesagt, daß Hörigkeit gleichbedeutend mit Sklaverei sein soll. Jedes Volk ist das wert, was es an seinen Frauen achtet. Aber es ist ein Irrtum, nein, eine bewußte Irreführung unerfahrener und urteilsloser junger Menschen zu behaupten, die Achtung vor der Frau müßte immer bedingt von dem Grade ihrer sozialen Stellung abhängen. Die Frau hat ihre Bestimmung. Achtet sie diese, erwirkt sie von selbst die Achtung auf eine Stellung, die zwar nicht den Ansprüchen der modernen Feministen entspricht, wohl aber der naturgewollten Entwicklung, die historisch begründet ist. Will sie über ihren Beruf als Geliebte, Frau und Mutter hinauswachsen (das Industriezeitalter, die sozialen Verschiebungen entschuldigen die Irrtümer der Frau, rechtfertigen sie aber deshalb nicht) — will das Weib also herrschen, indem es sich dem Manne gleichstellt, so erleidet es das Schicksal der Frauen des spätrömischen Reiches. Wenig geachtet, sich selber fremd, gesetzlos und übermütig geht es unter in Haltlosigkeit und Sinnentaumel, den Mann, den Staat mit sich reißend in das Chaos.
Wenn ich also hier von naturgewollter Hörigkeit spreche, so meine ich jenen Grad der Abhängigkeit, die die Natur dem Weibe mit auf den Lebensweg gegeben hat. Alle modernen Eiferer werden weder die Menstruation der Frau, noch die Tatsache hinwegleugnen können, daß der Geschlechtsverkehr den Mann nur zum Vater, die Frau aber zur Mutter machen „kann“. Den Vater trifft soziale Verantwortung. Die Mutter trägt ihr Kind, gebärt es und bleibt ihm zeitlebens verbunden. Die Nabelschnur, die die Schere der Hebamme durchschneidet, ist gleichwohl unzerreißbar.
Betrachten wir einmal in großen Zügen die Stellung des Weibes in der Vergangenheit bei Natur- und Kulturvölkern.
Historische Begründung der weiblichen Hörigkeit
Nach I. I. Bachofen („Das Mutterrecht“) soll es in Urzeiten eine Art „Weiberherrschaft“ gegeben haben, eine Gynäkokratie, vielleicht hervorgegangen aus dem Mutterrecht. Aber diese Hypothese läßt sich nicht beweisen. Daß da und dort bei einzelnen Völkern Abarten von der Regel der Weiberhörigkeit vorkommen, beweist natürlich nichts gegen die unwiderlegliche Tatsache, daß das Weib, nach einem Zustand des Hetärentums, vielleicht sogar unter dem Kommunismus der Liebe, mit dem Hervortreten kultureller Seßhaftigkeit in Hörigkeit geriet, resp. in diesem Zustand verblieben ist, der mehr oder weniger gemildert wurde durch den Reichtum oder die Armut der betreffenden Völker.
Die Frau wird die „Verwalterin der aufgehäuften Schätze, sie bestimmt Maß und Art der Verwendung, sie wird verantwortlich für die Pflege der Familie auf der Grundlage des Ernteertrages.
Wollen wir uns über die Stellung der Frau bei primitiven Völkern ein Urteil bilden, so müssen wir das Maß der Arbeit abwägen, das der Frau aufgebürdet wird.“ — „Dort, wo dieser Anteil im Vergleich zu der Arbeitsleistung des Mannes ein besonders großer ist, können wir auf eine Unterdrückung des Weibes schließen,“ urteilen Ploß und Bartels.
„Aber wir können uns auch nicht wundern, daß überall da, wo auch die Männer den schwer zu erlangenden Lebensunterhalt durch anstrengende Tätigkeit erwerben müssen, dem weiblichen Geschlecht ebenfalls kein müßiges Leben beschieden sein kann. So ist es seine Aufgabe fast überall, das Wasser herbeizuschaffen, die Speisen zu bereiten und die Kleidungsstücke herzustellen. Bei manchen Völkern müssen die Frauen sich auch an der Jagd und am Fischfang beteiligen, und bei einer gewissen Anzahl von Stämmen liegt ihnen sogar der Ackerbau ob. Diese letzteren sind es besonders, die dem weiblichen Geschlecht nur eine untergeordnete Stellung zuerkennen wollen. Das ist aber nur für den einen Fall gültig, wo die Männer überhaupt keinen Anteil an dem Ackerbau nehmen.
Das Weib ist Eigentum des Mannes geworden. Er kauft es, verkauft es, vertauscht es. Am weitesten geht die Gewalt des Mannes auf den Fidschi-Inseln, wo beim gemeinen Volk die Weiber nicht allein Handelsartikel sind, sondern von ihren Männern umgebracht und gefressen werden, ohne daß dies gestraft oder gerächt wird. Nicht selten gehen die Weiber des Vaters an den Sohn über. Nur das Weib, nicht der Mann, kann strafbaren Ehebruch treiben.“
Oft ist das Weib nicht mehr als ein Stück Vieh, wie auf einzelnen Inseln der Südsee. Forscher haben berichtet, daß die Kannibalen Weiber regelrecht mästen, um sie zu verspeisen. So hat R. Thurnwald einen Fall berichtet, der zu einer Strafexpedition geführt hat.
„Es handelte sich um ein Buka-Weib, das an einen Nissan-Mann verheiratet war. Der Mann war vor 10 Monaten gestorben. Das Weib war zunächst bei dem Häuptling des Dorfes ihres Mannes verblieben. Nach etwa drei Monaten holte sie der Häuptling Salin aus Malés zu sich. Monate hielt sie sich bei Salin auf, führte dessen Wirtschaft und unterhielt mit ihm regelmäßig geschlechtlichen Verkehr. Da Salin dem Häuptling Somsom aus Bangalu bei Siar zur Lieferung von Menschenfleisch verpflichtet war, wurde schon drei Monate vor Schlachtung des Weibes (Karas, Buka-Name oder Huenot, Nissan-Name) abgemacht, daß Salin sie zur Schlachtung auffüttern sollte. Nun mietete Somsom, der das Fleisch bekommen sollte, den Schlächter in der Person des Häuptlings Mogan aus Torohabau. Er bezahlte ihn mit einem Schwein, 2 Bündeln Pfeile (zu je 16 Stück), 5 Armringen und einem Messer. An dem verabredeten Tag erschien nun Somsom mit seinen Leufen und Mogan mit den Seinigen auf Salins Platz. Jetzt sträubte sich zunächst Salin, die Karas herauszugeben. Sie scheint beim geschlechtlichen Verkehr die Lüste des alten Salin zu reizen verstanden zu haben, außerdem erwartete Salin von ihr nach 3—4 Monaten ein Kind. Er wünschte deshalb, daß Somsom sich noch gedulde. Dieser alte Menschenfresser wollte aber nichts davon wissen und verlangte sein Opfer. Der Überzahl vermochte Salin nicht standzuhalten, und so gab er schließlich doch die Karas heraus und half bei ihrer Schlachtung dadurch, daß er sie festhielt.
Vorher war sie wie ein Schwein an Händen und Füßen gebunden und aus der Hütte Salins herausgetragen worden. Der erste Streich wurde von Mogan schräg über die Brust gegen die Bauchhöhle zu geführt, dann durchschnitt ihr einer von Somsoms Leuten, Sinai, mit einem Messer die Kehle, ein anderer, Nataweng, schoß ihr einen Pfeil in die Seite und dieser erst machte ihrem Leben ein Ende.
Das hatte sich am Nachmittag zugetragen. Man schleppte nun die Leiche nach dem Strand, verlud sie in ein Kanu und ruderte nach Somsoms Dorf. Dort wurde sie bei Mondschein in des Häuptlings Haus gebracht, und die ganze Familie schlief die Nacht über in demselben Raum.
Am nächsten Morgen schaffte man die Leiche auf eine der üblichen Feuerstätten aus Korallenkalk und röstete sie dort an, wie man es mit Schweinen tut. Hierauf erst schritt man zur Zerstückelung der Leiche, zur ‚Kilué‘, der Fleischverteilung ...“
Was schon Cook über die Sitten gewisser Südseestämme berichtete, gilt noch heute. Die Weiber und Mädchen schwimmen den herannahenden Schiffen entgegen, um sich zum sinnlichen Genuß anzubieten, und die Männer, die mit ihnen kommen, finden nichts Anstößiges in dieser Hingebung. Dann empfangen die Weiber, wie Korvettenkäpitän Werner auf der „Ariadne“ 1878 beobachten konnte, von ihren Männern Aufträge, was sie als Lohn für ihre Gefälligkeit von Bord mitbringen oder wohl gar entwenden sollen.
Ihren Lendenschurz, damit er nicht naß werde, halten sie beim Schwimmen an einem Stabe befestigt über dem Wasser, und jede beeilt sich, die erste an Bord zu sein. Denn sowie die Mannschaft sich mit Schönheiten versehen hat, werden die Überzähligen zurückgewiesen und müssen unter dem Hohngelächter ihrer Gefährtinnen heimschwimmen. An Bord aber wird die Szene häßlich, denn dort bricht bald die rohe Ausschweifung aus. Eigennutz ist übrigens die alleinige Triebfeder dieser Prostitution.
„Das Los der Frauen ist im allgemeinen kein glückliches. Erhandelt, bilden sie den meist ausschließlich arbeitenden Teil der Bevölkerung, wogegen der Mann zu Ratsversammlungen geht, beim Biertopf sitzt, in den Krieg zieht, Jagd und Fischfang treibt, im übrigen aber faulenzt und sich von seinem weiblichen Personal bedienen läßt. Auch hier findet Teilung der Arbeit statt, allein in höchst verschiedener Weise, je nach der kulturellen Phase, in welche die Entwicklung des Volkes gelangt ist. Nur bei einigen Stämmen, z. B. den Funke, Schilluk, Nuer und Baru, hilft auch der Mann beim Feldbau und auf der Viehweide“ (Ploß).
Die Marolong, ein Betschuanen-Stamm, kaufen ebenfalls ihre Frauen mit 5 Stück Vieh. Auf die Jungfrauschaft legt der Marolong großen Wert. Sieht er sich betrogen, so kann er die Braut zurücksenden und sein Vieh zurückverlangen, ebenso im Falle die Frau unfruchtbar ist. Verführer müssen logischerweise dem Vater Entschädigung zahlen. Geschlechtlicher Verkehr mit Europäern wurde ehemals mit dem Tode bestraft.
Bei den Aschanti steht nur dem Häuptling das Recht zu, seine Frau zu verkaufen. Das Weib der Denka ist die Sklavin des Mannes, und vom Erbrecht ist sie ausgeschlossen. Sie geht mit dem ganzen Nachlaß in den Besitz des Erben ihres Gatten über.
Die nomadisierenden Araber der Sahara betrachten das Weib als die Sklavin des Mannes. Sie trägt Wasser und Feuerungsmaterial herbei, mahlt Gerste, melkt die Kamele und Schafe und webt die Stoffe.
Bei den meisten nordasiatischen und afrikanischen Völkerschaften ist das Weib wenig mehr als eine Sklavin. Da sie in engster Abhängigkeit von den niedersten Leidenschaften des Mannes steht, ist ihr Anteil an dem Leben dementsprechend. Natürlich wird auf diese Art die Frau, die mehr Instrument als Wesen ist, manchmal weniger kostbar als das Haustier, schnell in Verbindung mit den ökonomischen Interessen des Mannes und ergo mit dem Handel gebracht. So gut aber der Wilde das Vieh stiehlt, so gut stahl er auch die Frauen, und in der Folge entstand der Raubhandel, der eine ganz eigentümliche Auffassung von Recht und Sitte zeitigte, und als dessen Ausläufer die eigentliche Kaufehe mit privilegierten Formen erst zu betrachten ist. Sie führte endlich zu dem naivsten Prinzip der Sklaverei, zur Leibeigenschaft.
Bei den Afghanen war früher ein Mädchen (nach Elphinstone) 60 Rupien wert. Man zahlte mit ihnen Strafen! Zwölf Mädchen für einen Mord, sechs „Stück“ für Verstümmelung eines Gegners — usw. Noch unter der Regierung des in Berlin gefeierten Amanullah geriet eine deutsche Frau in eine entsetzliche Lage. Sie heiratete einen Afghanen, und als dieser starb, wurde sie (1929!) automatisch die „Gattin“ des Bruders. Die Ausreise wurde ihr verweigert. Sie war Sklavin geworden!
Dem Koreaner ist die Frau entweder Werkzeug des Vergnügens oder der Arbeit, niemals aber eine ebenbürtige Genossin. Sie darf keinen Namen führen. Sie ist einfach die „Frau“ des Mannes, namenlos.
Die Mohammedaner hatten bis zur Herrschaft Kemal Paschas unumschränktes Recht über ihre Frauen. Diese betrachteten ihre Stellung als Allahs Wunsch und ließen sich von dem Manne mißhandeln, „mit Füßen treten und zuletzt durch die drei Talaks wegjagen, ohne laut zu murren“.
Das ist nun freilich anders geworden. Die Frauen dürfen ohne Schleier gehen und studieren. Die Monogamie ist gesetzlich eingeführt, aber nicht die Regel. Kemal erließ 1931 noch ein scharfes Gesetz, das sich gegen die Polygamie wandte, die nachweisbar noch immer in zahlreichen Teilen der Türkei herrschte (und herrscht!).
Das Gesetz vom Jahre 1923 hatte nur äußerlich eine starke Abnahme der Vielehen mit sich gebracht, denn dieses Gesetz verbot bekanntlich jedem türkischen Staatsangehörigen, mehr als eine Frau legitim sein Eigen zu nennen.
Es war aber ein offenes Geheimnis, daß zahlreiche Türken aus persönlichen und vielleicht auch aus sozialen Gründen bei ihrem alten „Frauenbetrieb“ blieben.
Mit Hilfe einiger technisch-juristischer Tricks gelang es ihnen in der Mehrzahl der Fälle, sich mehrere Frauen legal zu sichern und durch Bestechung der Zivilstandesbeamten auch die amtlichen Papiere zu diesem Zwecke zu bekommen.
Der Anlaß zum Eingreifen Kemal Paschas waren die Reklamationen, die von zahlreichen Europäern, vor allem Engländern und Engländerinnen, an ihn gerichtet worden sind.
Man staunt über die Heuchelei dieser „zivilisierten“ Nationen, die eine Million Armenier durch die Türken abschlachten ließ, zusah, daß man hunderttausende armenischer Frauen und Kinder vergewaltigte, tierisch — nein, menschlich! — zu Tode marterte, ohne mehr zu tun, als in den Zeitungen da und dort zur „Menschlichkeit“ zu mahnen. Man staunt über die Heuchelei Englands, die die Draga Maschin, Serbiens letzte Königin, wie ein Vieh abschlachten ließ, ohne mehr zu tun, als einige papierene Proteste nach Serbien zu senden. Man staunt über die Entrüstung, die die „Zivilisation“ sofort ergreift, wenn es sich um die Sittlichkeit (des Andern) handelt!
Hindu-Frauen dürfen ohne Erlaubnis des Familienvaters das Haus nicht verlassen. In Gegenwart der Schwiegermutter dürfen sie mit ihrem Manne nicht sprechen. Während der Mahlzeiten kauern sie auf der Erde und warten, bis die Männer sich erheben. Den alten Chinesen hatte Confucius befohlen: Mann und Frau bewohnen getrennte Räume. Sie dürfen nichts gemeinsam haben. Confucius forderte ausdrücklich die Hörigkeit der Frau.
Bei den Chinesen ist der zwangsweise Verkauf von Frauen etwas Alltägliches, und oft genug befassen sich die nächsten Angehörigen des Opfers mit dem Verbrechen. Im Jahre 1881 schrieb der Generalgouverneur der beiden Kiangs in Schanghai:
„Aus jedem Distrikt der Provinzen meiner Verwaltung sind mir in der letzten Zeit Bittschriften des Inhalts zugegangen, daß Witwen entführt oder durch Gewalt und Zwang wider ihren Willen zur Wiederverehelichung veranlaßt wurden ... Es geschehe auch, daß der Schwiegervater eine Beischläferin fälschlich beschuldigt, mit andern unerlaubten Umgang gehabt zu haben, und die Schwiegereltern und der Mann selbst sie gewaltsam zu unsittlichen Zwecken zum Verkauf bringen ... Von allen widerlichen und empörenden Handlungen ist diese sicherlich die schlimmste ...“
„Strafbar ist“ — heißt es dann in einer Verfügung des Gouverneurs:
„Die Entführung von Frauen und Mädchen oder der Versuch derselben.
Der durch den beabsichtigten zwangsweisen Verkauf von Witwen, Beischläferinnen und Mädchen zu unsittlichen Zwecken herbeigeführte Selbstmord derselben.
Der Verkauf von Witwen und Beischläferinnen durch die Schwiegerväter ...“
Die Strafen, die für diese Verbrechen festgesetzt sind, sind Tod durch Enthauptung oder Erdrosselung. Übrigens nimmt es der Staat mit der Erkenntnis, daß diese Behandlung der Frauen „die schlimmste aller widerlichen und empörenden Handlungen“ sei, nicht allzu genau. Er deportiert die weiblichen Angehörigen politischer Verbrecher meist nach dem Süden des Reiches, um einen schwunghaften Handel mit ihnen zu treiben, von dem er selbst nicht weniger profitiert als die dortigen zahlreichen Bordelle. Der Preis einer solchen Unglücklichen schwankt zwischen 50 und 100 Dollar. Ob diese Maßregeln geeignet sind, die politischen Verbrecher zu Patrioten zu erziehen, möge eine offene Frage bleiben.
Betrachten wir aber das Land des Fortschritts, das Land, in dem die Zivilisation in den letzten Jahrzehnten ihre größten Triumphe gefeiert — Amerika, und zwar die Vereinigten Staaten, in denen jener unerhörte wirtschaftliche Aufschwung zu verzeichnen ist. Sie ernähren eine ungeheure Zahl von Mädchenhändlern, Kupplerinnen, Bordellinhaberinnen mit allen ihren Trabanten, deren Namen und Würden in jedem Strafgesetzbuch figurieren. Die Bordelle in New York, Chicago und San Francisco beherbergen Mädchen aus allen Ländern der Erde, am wenigsten — Amerikanerinnen. Die meisten Insassinnen dieser Häuser sind gewerbsmäßige Dirnen, die sich freiwillig aufnehmen ließen. Allein diese Freudenhäuser schließen neben diesen Mädchen unzählige Opfer in sich ein, die durch List und Gewalt aus ihrer Heimat über den Ozean geschleppt und hier der Schande preisgegeben werden. Die Art und Weise, wie die Unglücklichen gefangen werden, ist schon so oft erörtert worden, daß es wohl unnötig ist, diesem Punkt eine längere Auseinandersetzung zu widmen. Eine Annonce in der Zeitung, in der ein Zimmermädchen, eine Köchin, Gouvernante oder Gesellschafterin zu sehr hohem Gehalt für das Ausland gesucht wird, ein Verhältnis mit einem eleganten Mann, der das Opfer nötigenfalls auch heiratet, um es erst in einem andern Weltteil, wenn es völlig in seiner Gewalt ist, erkennen zu lassen, daß es die Beute eines Sklavenhändlers geworden — das sind die gewöhnlichsten Mittel, deren sich die Mädchenhändler bedienen. Einmal im Ausland, ist den Mädchen, infolge ihrer Unkenntnis der Sprache, eine Verständigung mit den Mitreisenden, die den Opfern eventuell die Augen öffnen könnten, erschwert, ja unmöglich gemacht.
M. v. Brandt („Sittenbilder aus China“) schreibt charakteristisch: „Der Zweck der chinesischen Ehe ist ausschließlich die Erziehung eines männlichen Nachkommen, der bei dem Tode des Vaters die Waschung des Leichnams desselben vornehmen kann.“ Die Heirat vollzieht sich als Handel. Von den Nebenweibern wird dies als selbstverständlich zugestanden. Dagegen will man in China nichts davon wissen, daß auch die „rechte“ Frau „gekauft würde“. Die Beischläferin allein wird „gekauft“. Der Preis, der für sie bezahlt wird, heißt „Körperpreis“. Das Geld, das für die Frau gegeben wird, heißt jedoch „Verlobungsgeschenk“. Diese Logik, die wohl ein Wort — aber keine Begriffsänderung mit sich bringt, ist wenig einleuchtend. Was unser Autor über die Beziehungen zwischen Mann und Frau schreibt, trägt auch keineswegs dazu bei, die Ansicht zu erwecken, als vollziehe sich die Ehe in China unter irgendwelchen sittlichen Auspizien. Um die Ehe zu vermeiden, werden die Mädchen Nonnen oder begehen Selbstmord. „Der Begriff, die Frau als Gefährtin des Mannes,“ heißt es in den „Chinese characteristics“, „fehlt in China fast vollständig, und solange die Gesellschaft dort in ihrer jetzigen Form bleibt, kann sie es auch nie werden. Eine junge Frau hat in der Familie, in die sie eben eingetreten ist, sichtbare Beziehungen zu niemandem weniger als zu ihrem Manne. Er würde sich schämen, mit ihr sprechend gesehen zu werden, und es scheint, als wenn beide in der Beziehung wirklich nicht oft Veranlassung haben, sich zu schämen. In den seltenen Fällen, in denen ein junges Paar soviel gesunden Verstand hat, um zu versuchen, miteinander bekannt zu werden, und den Anschein erweckt, als wenn es seine Gedanken austauscht, bildet es den Gegenstand des Spottes für die ganze Familie und ein unlösbares Rätsel für alle Mitglieder derselben.“
An diese Stelle gehört noch die „Totenehe“. Eine Witwe darf oder soll in China nicht mehr heiraten. Denn sie ist und bleibt die Gattin des Toten. Geschieht es aber doch — was höchst selten passiert —, daß eine Witwe aus guter Familie sich wieder verehelicht, so tritt an sie der Wunsch heran, für den Toten eine andere Gattin zu finden, damit der Platz derselben auf der Familienbegräbnisstätte und im Ahnensaal nicht unausgefüllt bleibe. Für Geld versteht sich dann wohl auch die Tochter einer armen Familie zu einer solchen Ehe, die als völlig rechtmäßig angesehen wird. — In einzelnen Teilen Rußlands herrscht der regelrechte Frauenraub. Im übrigen besteht im allgemeinen der Frauenkauf. Die unsittliche Form der Ehe hat auch Tolstoi veranlaßt, die noch viel unsittlichere „Kreuzersonate“ zu schreiben. Denn ein Volksphilosoph, der die Ehe an sich, also den Geschlechtsaustausch, als eine Unsittlichkeit bezeichnet, ist aus dem Rahmen des Naturbegriffes ausgetreten und verdient darum schon bekämpft zu werden, weil die zivilisierte Welt begierig solche Grundsätze aufschnappt, die, je weiter sie sich von aller Natürlichkeit entfernen, um so ungefährlicher dem Gebäude ihrer Moral sind, weil niemand sich zu ihnen bekehren wird.
Bei den slawischen Völkern überhaupt besteht Frauenkauf oderraub, besonders noch in Montenegro. Doch schreibt das montenegrinische Recht (§ 10): „Folgt ein Mädchen dem ledigen Manne freiwillig ohne Vorwissen der Eltern, so kann man ihr nichts anhaben, da sie die Liebe selbst verband.“
Kaibara Ekken schreibt über die Japanerin: „Eine Frau soll stets ängstlich darauf bedacht sein, auf sich selbst streng zu achten. Sie stehe morgens früh auf und gehe abends spät zu Bett. Sie schlafe nicht am Tage und besorge die Angelegenheit im Hause. Sie soll emsig weben, nähen, Hanffäden drehen und spinnen. Auch darf sie nicht viel Tee, Sake und andere Dinge trinken. Theater und Gesang, Vortrag von Theaterstücken und dergleichen lose Dinge soll sie nicht anhören und ansehen. Zu den Shinto- und Buddah-Tempeln und überhaupt nach allen Orten, wo viele Leute zusammenströmen, soll sie, wenn sie nicht in den Vierzigern ist, nicht oft hingehen.“
In Ägypten äußert sich die Ehe, wie Herodot berichtet, meist in monogamer Form: „In Ägypten nimmt der Priester nur eine Frau. Jeder andere, soviel er will.“ (Hist. Bibel, 1, 80.) Es scheint aber, daß die Freiheit wenig beansprucht wurde, denn auch Gustav Klein berichtet in seiner „Allgemeinen Kulturgeschichte“: „Die Ehe war sehr heilig, und die Stellung der Frau eine würdige.“ Ebers setzt hinzu: „Wenn es wahr ist, daß man die Höhe der Kultur eines Volkes nach der mehr oder minder günstigen Stellung, welche es den Frauen anweist, beweisen darf, so läuft die ägyptische der Kultur aller andern Gesellschaften den Rang ab.“ Verschiedene Gesetze weisen auf die Hochschätzung der ägyptischen Frauen hin. Wer eine Frau mit Gewalt ver- oder entführt, wurde entmannt. Keuscher noch als es je die christlichen Regeln den Mönchen vorschrieb, lebten die ägyptischen Priester. Man kannte auch weibliche Klöster, so das Kollegium der heiligen Jungfrauen am Ammonstempel zu Theben.
Bei der Verehrung der Frau im alten Ägypten ist es natürlich interessant, wie das Volk die Ehe auffaßte. Hören wir, was Ploß in „Natur und Völkerkunde“ darüber schreibt: „Im alten Ägypten konnte ein Mann ein Mädchen zu seiner ‚Genossin‘ machen. Dies war eine Art Probeehe, welche ein Jahr lang dauern durfte. Nach Ablauf dieser Zeit konnte die Genossin wieder entlassen werden.“ — Diese Sitte, die uns geradezu unverständlich ist und gewiß unsittlich erscheint, konnte also nichts an der hohen ästhetischen Auffassung vom Weibe ändern, im Gegenteil, die sexuelle Freiheit und jeder Mangel an Heuchelei befestigten diese Hochschätzung. Von der heiligen Prostitution der Babylonierinnen wurde die Keuschheit der Frau in der Ehe niemals berührt, wie Herodot ausdrücklich bemerkt. — Über die Ehe bei den Indern sagt Ratzel (Völkerkunde): „In den Vedas zeigen sich die Inder als ein Volk von reinen Sitten und kräftigem Geist.“ Es scheint, daß auch bei ihnen Monogamie Gesetz war, und die hohe sittliche Auffassung vom Wesen der Frau stimmt damit überein. Das schwerste Verbrechen war die gewaltsame Entführung und Schändung einer Frau, ein Verbrechen, für das man keine Entschuldigung kannte, das nur durch den Tod geahndet werden konnte.
Wie man aber das Wesen der Ehe auffaßte, beweist folgende brahmanische Sentenz: „Ist die Schuld (Kinderzeugung) bezahlt, so soll der Mensch sich aus der Welt zurückziehen. Denn vom sinnlichen Leben erlöst zu werden, ist immer ein Glück.“ Die Ehe war also eine Pflicht, keine ideale Natureinrichtung, und die Kirche machte dem Staate die Konzession, sie als temporäre Notwendigkeit zu bezeichnen. Was aber vom sittlichen Standpunkt aus bei den Indern nicht genügend hervorgehoben werden kann, ist, daß sie die Ehe als Kaufgeschäft nicht zuließen. Frauenkauf, überhaupt Mitgiftzahlung, war verboten, und Arrhian berichtet ausdrücklich, daß in Indien die Heiraten geschlossen wurden, ohne daß etwas gegeben oder genommen wurde. Damit beweisen die alten Inder die Erkenntnis von der Unsittlichkeit, die in dieser Art der Eheschließung liegt, die stets zu materiellen Rücksichten bei Eingehung eines Bündnisses führt, zu dessen sittlichem Gedeihen die seelische und körperliche Übereinstimmung allein Pflicht und Notwendigkeit ist. Allein der alte indische Staat war andererseits weit davon entfernt, die Ehe als etwas anderes als eine die Wohlfahrt der Gesamtheit, nicht der einzelnen, fördernde Institution zu betrachten. Dies geht schon daraus hervor, daß er Abtreibung der Leibesfrucht den schwersten Verbrechen gleichstellte. Immerhin war die brahmanische Periode eine Zeit relativer Sittlichkeit, die dem Buddhismus nicht genügte. Seine Askese führte zur Reaktion und Entartung, bis wir an der Grenze des Mittelalters ein ausschweifendes Volk finden, bei dem die Prostitution in vollem Schwunge ist.
*
Die sittliche Auffassung der Frau in Griechenland ist durch die üppige Blüte der Prostitution charakterisiert. Der Staat, der die Notwendigkeit der Ehe für den Bestand rasch genug erkannt hatte, schuf sie mit allem gesetzlichen Beiwerk ausgestattet, indes der Instinkt des Einzelnen nach der freien Ausübung des Liebesgenusses verlangte. So entstand jener Zwitterzustand, den eine zweitausendjährige Kultur nicht beseitigte, sondern ihn verschärfte. Die Ehefrau war ein notwendiges Übel. Man kaufte sie, d. h. man tauschte seinen gesellschaftlichen Rang gegen ihre Mitgift ein und erfüllte seine Pflicht gegen den Staat, indem man mit der Sklavin der herrschenden Sittenanschauung Kinder zeugte. Von dem Schlafgemach der Ehefrau begab man sich zu den Hetären.
So war auch die Erziehung der Jungfrau nur für ihren späteren Beruf berechnet, und dieselbe Abgeschlossenheit und Freudlosigkeit ihres Daseins erwartete sie nach der Eheschließung. Wer wollte ehrlicherweise bestreiten, daß dieser Zustand einem Handel gleichkommt, der nur reale Zwecke verfolgt und alle ideellen Anforderungen gering schätzt?
Etwas besser war die soziale Stellung der Römerin, nicht weil die Römer sittlicher dachten, sondern weil sie praktischer waren. Dieses Volk war so sehr von dem einheitlichen Staatsgedanken durchdrungen, daß es in der Mutter die Gegenwart und die Zukunft des Gemeinwesens erblickte, und seine Ehrerbietung gegen die Frau war nichts weiter als Dankbarkeit gegen die Erzeugerin von Bürgern, in deren Qualität und Quantität das Schicksal Roms begründet war. Auch die Form der Eheschließung war nur auf den Vorteil des kaufenden Teiles berechnet und daher unsittlich. Das junge Mädchen, das mit vollendetem 12. oder 13. Jahre für ehereif befunden wurde, ward nun einem Mann übergeben, den es kaum vorher gekannt hatte. Die Jungfrau wurde nie um ihre Wünsche befragt. Die Familien schlossen gegenseitig die Ehen ihrer Kinder. Liebe und persönliche Zuneigung blieben außer Betracht. Dieser Handel zeitigte so lange keine schlimmen Folgen, als die Männer, oder besser, die Gesellschaft durch die grausamsten Gesetze jede freie Sinnenäußerung unterdrücken mußten. Mit der Zeit, da die Gesetze ihre Kraft verloren, brach auch die geknebelte Freiheit der Leidenschaften in einer Weise durch, die viel weniger die Sittenlosigkeit ihres Zeitalters, als die der vorhergehenden bewies.
„Häufig genug gab es Weiber wie Fulvia, die, statt sich um das Hauswesen zu bekümmern, über die Mächtigsten herrschen wollten, um durch diese zu regieren. Unter solchen Umständen nahm die Ehelosigkeit immer mehr und mehr überhand.
Überhaupt bildete diese Zeit im alten Rom ein Bild tiefster sittlicher Fäulnis, wie sie etwa nur das 17. und das 18. Jahrhundert der modernen Zeit aufzuweisen hat. Unerlaubte Verhältnisse waren selbst in den höchsten Kreisen etwas so Häufiges, daß man kaum noch davon redete. Der Sammelplatz der vornehmen Welt wurden die Bäder von Bajae und Puteoli, wo man alle die daheim durch die Sitte noch immer gebotenen Fesseln abwarf, und wo bei Tanz, Spiel und Völlerei jeder Art die Römer sich einer ausgesuchten Genußsucht hingaben. So nahm jene ungeheure Sittenlosigkeit überhand, wie sie in solchem Grad und Umfang die Welt kaum je wieder gesehen. Die Emanzipation der Weiber war in den höheren Kreisen ausgesprochen, und das einzige Lebensziel derselben war der Genuß.
Schließlich wurde in späteren Zeiten der Verkehr der Frauen außer dem Hause ein fast unbeschränkter. Der Zirkus, das Theater, das Amphitheater standen ihnen offen. Die Folge dieser Zustände war die verbreitetste, tiefste Zerrüttung des häuslichen Lebens. Leichtfertige Ehescheidungen waren an der Tagesordnung.“
*
Die alten Franken hatten, entsprechend den Sittenanschauungen der Gallier, eine große Hochschätzung vor der freigeborenen Frau. Diese konnte für eine Prostitution nie in Betracht kommen. Dagegen hielten sie Sklavinnen, mit denen die „Herren“ einen schwunghaften Handel trieben. Die Ehre der freien Frau war nach jeder Richtung hin geschützt. Schon das Zerraufen der Haarfrisur einer Frau wurde mit schweren Strafen geahndet. Die Entführung einer Frau wurde mit dem Tode bestraft. Ein Sklave, der die Sklavin eines Herrn entführte, zahlte diesem nach dem damaligen Recht einhundertundzwanzig Denare. War er dazu nicht imstande, so erhielt er ebensoviel Rutenstreiche. Freigeborene Frauen, die sich freiwillig prostituierten, wurden meist aus dem Stamm oder später aus der Stadt ausgestoßen, erhielten wohl auch noch eine Anzahl Stockstreiche.
In jener schon mehr und mehr zivilisierten Zeit bis auf Karl den Großen hatten die meisten Edelleute mehrere Konkubinen, die gewöhnlich Sklavinnen waren und gekauft wurden. Doch war die Stellung dieser Nebenfrauen eine ziemlich erträgliche, besser als die der Haremsfrauen des Sultans, wenngleich die Einordnung der fränkischen Konkubinen in eine Art Frauenhaus eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Gefangenhalten in den Harems aufwies.
Wie der Mädchenhandel in der Periode Karls des Großen, die unter dem Einfluß des erstarkenden Christentums und seiner immer kämpfenden Priester mehr und mehr die Einzelehe in Geltung brachte, geblüht hat, beweist ein Erlaß besagten Kaisers gegen die Kuppelei, in dem unter anderm vorgeschrieben wird, daß Priester keine Frauen aufnehmen sollen. In jener Zeit übernahm jene Kategorie von Kaufleuten, die am meisten mit den Edelleuten in Berührung kamen, den Handel mit Frauen, nämlich die Pferdehändler, die das ganze Mittelalter hindurch als quasi privilegierte Frauenhändler auftreten.
Voreheliche Hingabe war unter den Frankenkönigen ein strafbares Verbrechen, dessen jeder Mann eine Frau bezichtigen durfte. Nur mußte er seine Klage damit beweisen, daß er sich entweder einem Gottesgericht oder einem Zweikampf unterwarf.
Weinhold, Freybe und Felix Dahn haben über die Stellung des deutschen Weibes geschrieben. Die Frau war ein untergeordnetes, unselbständiges Geschöpf, denn nach altem Recht konnte der Geschlechtsvormund, Vater oder Gatte „die Frau wie des Lebens so der Freiheit berauben, sie in die Knechtschaft verkaufen, um ihren Vermögenswert zu realisieren“. Langsam schwand das Recht, die Frau in die Knechtschaft zu verkaufen.
„Die Ehe, wie sie sich in den altfranzösischen Epen behandelt findet, wird selten aus aufrichtiger Liebe geschlossen. Die Frau wünscht die Ehe, weil sie von ihr eine Besserung ihres schutz- und rechtlosen Zustandes erhofft. Der Mann (meist unter Beirat seiner Verwandtschaft und Freunde) ehelicht, um den Einfluß und Reichtum der eigenen Sippe zu heben. Die Verlobung erfolgt feierlich vor Zeugen, auch wohl an geheiligter Stätte. Zu nahe Verwandtschaftsgrade sind ein Ehehindernis. Besondere Hochzeitsgebräuche finden sich nicht erwähnt. Die Feierlichkeit dauert manchmal auch acht Tage. Das Paar empfängt priesterlichen Segen.“
Zur Zeit der Minnesänger bot die Frau dem Manne zuerst den Gruß. In seinem vaterländischen Hochgesang „Deutschlands Ehre“ bittet Walther von der Vogelweide die Frauen um keinen andern Sängerlohn, „als daß sie mich grüßen schöne“. Zur Begrüßung, zum Empfang, zum Abschied erhalten die Männer als höchste Ehre von den Frauen den Kuß, aber mit strenger Unterscheidung des Ranges. „Mit minniglichen Tugenden“, heißt es im Nibelungenlied von Crimhilden, „grüßte sie Siegfrieden.“ „Ihr ward erlaubt zu küssen den weidlichen Mann“ und „in Züchten viel Verneigen hat man gesehen an und minnigliches Küssen von Frauen wohlgetan.“
Nach den englischen Gesetzen wurden verheiratete Frauen nicht nur als Eigentum der Männer angesehen, sondern auch als Kinder, die keinen Willen hatten, oder als Sklavinnen, die ihren Willen dem Willen des Herrn unterwerfen mußten. Ein Engländer, der seiner Frau überdrüssig war, konnte sie öffentlich wie ein Stück Vieh verkaufen. Wobei freilich stillschweigend vorausgesetzt wurde, daß die Frau damit zufrieden war, sich verkaufen zu lassen. Es kamen in jener Zeit nicht wenig solche Fälle vor, von welchen wir nur anführen: Ein Herzog kaufte die Frau eines Kutschers, in Worcester kaufte ein Schuster die Frau eines Taglöhners, die an einem Strick um den Hals auf den Markt geführt und gegen fünf Pfund Sterling ihrem Käufer übergeben wurde. Die englischen Gesetze erkannten so wenig einen eigenen Willen verheirateter Frauen an, daß sie bei gemeinschaftlichen Verbrechen von Eheleuten nur allein den Mann, nicht aber die Frau straften und auch den Mann für die Schulden und kleineren Vergehen der Frau haften ließen.
In Alt-England gab der Vater seiner Tochter bei ihrer Verehelichung nicht allein keine Mitgift, er erhielt vielmehr von dem Bewerber einen Kaufschilling bezahlt. „Die Kaufehe“, schreibt Eugen Dühren in seinem „Geschlechtsleben in England“, „hat sich in Britannien bis zum 19. Jahrhundert erhalten. In den ersten Dezennien desselben kamen Frauenverkäufe noch relativ häufig vor. — In einem Artikel in: „All the year round“ vom 20. Dezember 1884 wurden über 20 Fälle in den letzten Jahren mit Namen und allen Einzelheiten betreffs der zwischen 25 Guineen und einem halben Peit Bier oder einem Penny und einem Mittagsmahl wechselnden Preis für eine Frau aufgezählt. Sehr häufig kam die Kaufehe im 18. Jahrhundert, besonders gegen Ende desselben und zu Anfang des 19. Jahrhunderts vor.“
Die betreffende Frau wurde gewöhnlich auf dem sogenannten Haymarkt verschachert. Der Käufer hatte das Recht, sie als Gattin — gleichbedeutend mit Sklavin — zu betrachten und zu behandeln. Heute, sollte man meinen, ist dergleichen wohl nicht mehr möglich. Und doch kam — im Jahre 1904! — ein derartiger Fall vor den Untersuchungsrichter im Londoner Bezirk West-Ham. Die „Zeit“ in Wien berichtete darüber in einem Londoner Brief. Anna Gibson, ein schmuckes Weib von 28 Jahren, fühlte sich bei ihrem Manne, dem sie im Jahre 1895 angetraut war, nicht glücklich. Sie verließ ihn daher und vermietete sich bei einem Metzger namens Thomas Gosford, den ihre Reize so bestrickten, daß er ihr einen Heiratsantrag machte. Als sie ihm mitteilte, daß sie bereits die Besitzerin eines Ehemannes sei, erwiderte er: „Das schadet nichts. Ich werde zu ihm gehen und ihm 25 Pfund Sterling für dich bieten, und wenn er damit einverstanden ist, werde ich sie ihm geben.“ Gesagt, getan. Gibson nahm das Anerbieten an, und der Handel wurde geschlossen. Im holden Monat Mai erschien das liebende Paar auf dem Standesamt zu Stratford, und Frau Gibson wurde fortan Frau Gosford. Aber durch einen Zufall kam die Sache heraus, und Frau Gibson-Gosford und ihr Käufer Thomas Gosford wurden vor den Untersuchungsrichter geladen. Sie gestanden alles ein, und der Richter verfügte, daß ihnen wegen des Vergehens der Doppelehe der Prozeß gemacht werden sollte.
Der Fall würde nicht besonders bemerkenswert sein, wenn nicht eben gleichzeitig der Umstand zu verzeichnen wäre, daß Mißachtung des Weibes, seine Behandlung als Ware in den ungebildeten Volkskreisen Englands nicht so selten ist. Allerdings hat die Unsitte in den letzten Jahrzehnten bedeutend nachgelassen, aber Sheffield zum Beispiel ist immer noch übel berufen wegen des häufig dort vorkommenden Verkaufes von Frauen, und auch im Osten Londons, wo Verkommenheit neben Armut herrscht, ist gar manches Eheweib um eine Quart Bier an einen andern Mann abgetreten worden. An die Öffentlichkeit kommen solche Verkaufsgeschäfte gewöhnlich nur dann, wenn irgendwelche Umstände zu einer gerichtlichen Verfolgung führen.
Ein öffentlicher Verkauf wurde noch im Jahre 1806 auf dem Marktplatz in Hull vollzogen. Der beschränkte Volksverstand hatte jedenfalls die kirchliche Auffassung, daß die Frau des Mannes Hab und Gut ist, zu wörtlich genommen und daraus das Recht für den Ehemann abgeleitet, dieses Stück Hab und Gut verkaufen zu dürfen. Das ist freilich eine Begriffsverwirrung der seltsamsten Art.
*
Wir müssen an dieser Stelle einer Frau gedenken, die ein Beweis dafür ist, daß selbst die bevorzugteste Stellung ein Weib nicht vor der Gemeinheit des Mannes und vor der Dummheit ihrer Zeit retten kann, wenn nicht die von Männern gemachten Gesetze sie vor einem Schicksal bewahren, das die Gemahlin Georgs IV. von England betroffen hat.
Es ist vielleicht das dunkelste Schicksal einer hörigen Frau der Vergangenheit, denn diese Hörige war eine Königin, und ihre Peiniger waren Männer, die die höchste Bildung genossen hatten.
Folgendes ist — wörtlich — die Anklage, die einer der moralisch verkommensten Herrscher, einer der ekelhaftesten Kreaturen männlichen Geschlechts gegen eine unglückliche und anständige Frau — seine Frau — erhoben hat. Es ist unnötig, diese Anklage zu widerlegen. Ihr Ton, ihre Detaillierung zeigen die Niedrigkeit des Charakters dessen, der anklagt — und die Dummheit eines Zeitalters, in dem die Tugend ebenso englisches Nationaleigentum war wie heute.
Eine königliche Bordellkomödie
Am 21. August 1820 erhob der Attorney-General im Hause der Lords folgende Anklage des Königs gegen die Königin Karoline:
„Wie bekannt, reiste die Königin im Jahre 1814 aus England fort. Am 9. Oktober desselben Jahres kam sie in Mailand an, wo sie als Kurier einen gewissen Bartolomeo Bergami in ihre Dienste nahm, der damals gerade dienstlos, früher aber als Kammerdiener bei dem General Pino gewesen war. Es war in den ersten vierzehn Tagen des Aufenthaltes der Königin in Mailand, als sie den Bergami in ihre Dienste nahm. Bereits am 8. November kam die Königin in Neapel an, und folglich war damals Bergami höchstens drei Wochen im Dienste von Ihro Majestät. Wer könnte aber wohl glauben, daß in einer so kurzen Zeit sich schon ein vertrautes Verhältnis zwischen einer Person von so hohem Range und einem Domestiken anknüpfen konnte! Und dennoch läßt es sich durch Zeugen beweisen, daß der ehebrecherische Umgang der Königin mit dem Bergami bereits am Abend des 9. November seinen Anfang nahm. Schon am Tage ihrer Ankunft in Neapel hatte die Königin befohlen, daß der Knabe William Austin, ihr Adoptivsohn, nicht mehr wie bisher in ihrem Zimmer schlafen sollte. Am Abend des 9. November bemerkte eine der Kammerfrauen der Königin, daß diese bei ihrer Rückkehr aus der Oper ganz ungewöhnlich bewegt war. Unfern des Schlafkabinetts hatte sie ein anderes Kabinett, welches mit dem ihrigen in direkter Verbindung stand, einrichten und ein Bett hineinsetzen lassen. Man glaubte, dieses Gemach sei für William Austin bestimmt. Aber keineswegs, Bergami erhielt es. Die Kammerfrau, welche wie gewöhnlich, Ihro Majestät bedienen wollte, wurde zu ihrem großen Erstaunen abgewiesen, verwunderte sich aber noch mehr, als sie am andern Morgen sah, wie das Bett der Königin ungebraucht war, während das von Bergami aufs unverkennbarste zeigte, daß es zwei Personen zum Lager gedient hatte.
Dieser einzige Umstand würde schon vor einem Geschworenengericht den Ehebruch außer Zweifel stellen. Allein es ist meine Pflicht, die weiteren Umstände dieses unsittlichen Lebenswandels in ein noch näheres Licht zu setzen. Obschon Bergami noch immer bei der Tafel die Dienste eines Domestiken verrichtete und auf der Reise die eines Kuriers, so bemerkten doch die andern