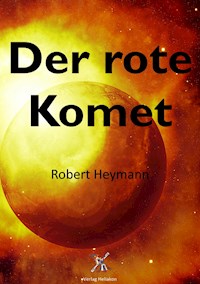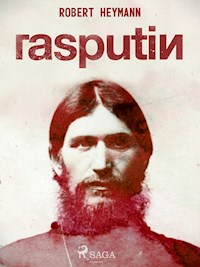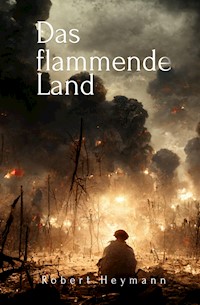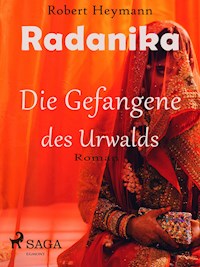Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Erste Weltkrieg tobt. Noch sind die USA nicht in den Krieg eingetreten, aber überall im Land herrscht eine deutschenfeindliche Stimmung. Journalist Harry Smith erhält von Marc Ellison, dem Chefredakteur des "Herald", einen besonderen Auftrag: "Die Germans wollen in der Union eine Revolution machen und dann landen, Neuyork erobern und Amerika in eine deutsche Provinz verwandeln! Und nun reisen Sie nach Deutschland, bringen Sie Beweise, daß die Deutschen die Union erobern wollen." Seine abenteuerliche Reise bringt Harry Smith zuerst nach Deutschland und dann über die Schweiz nach Marokko und Ägypten. Aber das sind nur einige der zahlreichen Schauplätze dieses handlungs- und personenreichen Kriegsromans. "Das Lied der Sphinxe" bildet nach "Gesegnete Waffen" und "Der Zug nach dem Morgenlande" die dritte Fortsetzung des Romans "Das flammende Land", und der Leser begegnet zahlreichen Figuren wieder, die ihm aus den vorangegangenen Bänden vertraut sind. Als fünfter Band folgt "Der Fluch der Welt".-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 394
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Robert Heymann
Das Lied der Sphinxe
Roman
4. Rand der modernen Kulturromane.
3. Fortsetzung des Romans „Das flammende Land“
Saga
Das Lied der Sphinxe
© 1916 Robert Heymann
Alle Rechte der Ebookausgabe: © 2016 SAGA Egmont, an imprint of Lindhardt og Ringhof A/S Copenhagen
All rights reserved
ISBN: 9788711503577
1. Ebook-Auflage, 2017
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für andere als persönliche Nutzung ist nur nach Absprache mit Lindhardt und Ringhof und Autors nicht gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com – a part of Egmont, www.egmont.com
Der weissbärtige Marc Ellison rieb sich das tadellos rasierte Kinn, streifte die Hemdärmel hoch und liess sie wieder herab, steckte die Holzpfeife vom rechten in den linken Mundwinkel und schlug endlich mit der flachen Hand derart auf den Korrekturabzug der Zeitung, dass der Sekretär an der klappernden Underwood in die Höhe fuhr.
„Mr. Ellison?“
„Klingeln Sie mal. Ich möchte Harry Smith sprechen.“
Der Sekretär klingelte. Das Telephon meldete sich. Der Sekretär rief nach der Redaktion hinauf: „Mr. Harry Smith möchte zu Mr. Ellison kommen.“ Da es offenbar mehrere Smiths in der Redaktion des „Harald“ gab und man den Namen Harry oben nicht gleich verstand, setzte der Sekretär, der alle Intimitäten des Betriebes kannte, erläuternd hinzu: „Der schöne Smith ... Well ... der Kanonensmith.“
Mr. Ellison kramte die letzte Ausgabe der World vor und legte den Kopf nachdenklich auf die Seite. Der Lärm des Broadway drang nur sehr gedämpft in das siebente Stockwerk des Wolkenkratzers.
Harry Smith sauste mit dem Fahrstuhl vom zehnten Stock herunter. Er war ein hübscher Junge mit breiten Schultern, einem sporttrainierten Körper und einem Paar steingrauer Augen.
Marc Ellison sah den Journalisten schweigend an mit dem Ausdruck eines Menschen, der sich eine Sache schnell noch einmal überlegt.
„Good Morning, Mr. Ellison.“
„Morning. Waren Sie schon in Europa, Smith?“
„No, Mr. Ellison.“
„Do you speak german?“
„Well, Mr. Ellison.“
„Sie können morgen nach Schweden reisen!“
„Well, Mr. Ellison.“
„Ich schreibe Ihnen einen Scheck auf tausend Dollars. Fürs erste. Sie sollen nach Europa reisen. Ich will einmal in das Gesindel da bei uns reinpfeffern. Entweder sind die Deutschamerikaner Schweinehunde, oder die Engländer bringen die Pest über die Union. Eins muss bewiesen werden. Hier ist das nicht herauszubekommen. Also der Mann, der vor vier Monaten in der Fifthe Avenue eingebrochen und John Clifford angeschossen hatte, hat jetzt aus dem Zuchthause heraus ein Geständnis gemacht: er will ein Mitglied der deutschen Verschwörung sein. Die ‚World‘ schreibt, ein Dr. Ritter, der in seinem Boardinghouse seit vier Monaten die Zeche schuldig ist, habe bekannt, gleichfalls ein deutscher Verschwörer zu sein. Er hat der ‚Oliver‘, die vor drei Wochen mit englischen Kanonen aus Neuyork auslaufen wollte, eins versetzt. Ich glaube, er hat eine Sache in die Dampfröhren gesteckt. Und das Attentat auf den Sekretär vom Präsident Wilson ist auch von einem deutschen Verschwörer verübt worden, der nur zum Schein die Brillantnadel gestohlen hat. Ich lasse übrigens Mr. Gould fragen, warum er die Nachrichten nicht im ‚Herald‘ hat? Die ‚World‘ bringt das in breiten dicken Lettern. Die ‚World‘ macht Geld mit so einer Sensation.“
„Well“, sagte Harry Smith und steckte sich die Havanna an, die ihm der Chef gereicht hatte. „Mr. Gould hat gesagt, das sei Bluff. Wenn die Deutschamerikaner eine Verschwörung gegen die Union inszenieren, dann werden sie nicht mit alten Dampfröhren und Busennadeln Diebstähle beginnen. ‚Der Schwindel stinkt auf Meilen‘, hat Gould gesagt und er stinkt doppelt, weil die ‚World‘ die Nachrichten aus dem ‚Providence Journal‘ abdruckt, das wird von Spring-Rice, dem englischen Botschafter in Neuyork, bezahlt und von englischen Agenturen besorgt.“
Marc Ellison nickte.
„Gould hat eine Deutsche zur Frau. Er ist trotzdem nicht auf den Kopf gefallen. Mrs. Gould sollte aber weniger an dem ‚Herald‘ mitredigieren. Wir müssen business machen, Mr. Smith, und nicht Idealismus verzapfen.“
„Aber auch nicht Blödsinn, Mr. Ellison.“
„No. Das ist nicht smart. Aber mit deutschen Redensarten kann man hierzulande keinen Dollar verdienen. Die Deutschen haben eine Verschwörung angezettelt, und die Deutschamerikaner sind die Werkzeuge. Die Germans wollen in der Union eine Revolution machen und dann landen, Neuyork erobern und Amerika in eine deutsche Provinz verwandeln! Und wenn die bisherigen Beweise nur Bluffs der Engländer sind, dann steht eben fest, dass wir Amerikaner zu dumm sind, bessere Beweise zu finden. Das ist meine Überzeugung, Mr. Smith. Und nun reisen Sie nach Deutschland, bringen Sie Beweise, dass die Deutschen die Union erobern wollen. Schreiben Sie meinetwegen, die Deutschen seien tüchtige Kerle. Sind sie. Schreiben Sie, sie haben die besten Kanonen, die längsten Soldaten und einen genialen Generalstab und einen famosen Kaiser. Well. Haben sie. Aber schreiben Sie, dass die Deutschen die United States erobern wollen. Und bringen Sie Beweise. Dann kann die ‚World‘ nach Texas rutschen, und wir haben eine Million Auflage. Ich zahle gut, das wissen Sie, Mr. Smith. Und noch eins. Sie müssen nicht gleich von Deutschland wieder heimkommen. Sie müssen Beweise bringen. Sie reisen von Deutschland nach Afrika, Marokko. Das ist ein schönes Land. Ich bin dort in meiner Jugend als Kohlenschipper gewesen. Reisen Sie nach Marokko und Algier und Ägypten. Beweisen Sie, dass die Deutschen Marokko erobern wollen. Marokko und Algerien und Tunis und Ägypten. Vielleicht will ein deutscher Prinz König von Nordafrika werden? Beweisen Sie, Mr. Smith. Von Afrika gehen Sie nach Argentinien. Hören Sie, was man dort denkt, nicht was man sagt. Beweisen Sie, dass die Deutschen Argentinien vom Weltmarkt abschliessen wollen. Beweisen Sie, Mr. Smith, hier ist der Scheck.“
Harry Smith nahm den Scheck, klopfte die Zigarre ab und warf, so im Weggehen, noch schnell ein:
„Wenn aber die Deutschen gar nicht so famose Kerle sind, Mr. Ellison? Wenn sie Amerika gar nicht erobern wollen? Und wenn sie überhaupt nicht smart sind?“
„Dann beweisen Sie, dass es für Amerika besser ist, Baumwolle zu verkaufen als Schiesszeug. Dann schreien wir sechs Wochen lang: Wilson verkauft uns an die Engländer. Wilson bricht uns das Genick. Wir müssen unsere Baumwolle los werden. Wir sind berufen, den europäischen Frieden zu machen. Interwieven Sie Ford in Kopenhagen, Mr. Smith. Auf alle Fälle beweisen Sie! Entweder sind die Deutschen hier Aufwiegler, dann müssen wir der Justiz die Augen öffnen. Oder sie sind gute Kerle, hier wie überm Teich, dann muss Wilson Frieden machen. Dann wollen wir unsere Baumwolle los sein. Dann brauchen wir uns auch nicht an die Engländer anzuschliessen. Dann brauchen wir auch keine neuen Soldaten, die Wilson haben möchte. Also, Mr. Smith, beweisen Sie. Und fragen Sie mal in Deutschland nach, ob man wirklich siebenundzwanzig Millionen bei uns für Stimmung gegen England ausgegeben hat. Die Millionen sollten uns einen Krieg mit Mexiko einbrocken. Wenn auch das Staatsdepartement sagt, es sei nichts an den Millionen. Es ist doch etwas daran. Woher haben die Deutschen bloss das viele business? Schauen Sie sich mal um, Mr. Smith, wenn Sie in Deutschland sind, woher die Leute so viel Geld haben. Beweisen Sie. Pleasant journey!“
Ein Händedruck. Mr. Smith ging. Marc Ellison vertiefte sich in den giftsprühenden Artikel eines Baltimorer Blattes. Die Leute in Baltimor wären am liebsten schon morgen gegen Deutschland gezogen. Marc Ellison las: „Auch Emmy Destinn sagt, Deutschland sei ein Land voll bewaffneter Sklaven..“
Marc Ellison steckte die Pfeife wieder in den anderen Mundwinkel und machte: „Ham — die Destinn. Deutschland war für sie und andere god’s own country — eine Insel der Seligen ... jetzt spucken sie darauf ...“ und er las weiter: „Kapitän Ruser hielt einen Vortrag, in dem ...
Ooouuu ... Ruser“, sagte Marc Ellison für sich. „Ruser ... that’s a gentleman.“
Harry Smith fuhr in die Redaktion hinauf, sagte seinen Freunden: „Ich reisen zu die Germans“, und ging in sein Boardinghouse, um noch zu lunchen.
Bei der Table d’hote erzählte er, dass er auf ein paar Monate nach Deutschland und dann nach Afrika gehe. Sein Chef halte die Deutschen für Verschwörer. Sie wollten Amerika erobern. Harry Smith schüttelte sich vor Lachen.
„Das ist das böse Gewissen“, sagte er. „Ich kenne mehr Leute, die so etwas fürchten. Meines Vaters Fabrik liefert monatlich für eine Million Dollars Waffen nach England und Russland. Mit diesen Waffen werden die Deutschen totgeschossen. Das macht auf die Dauer schlimme Nächte. Ein reines Gewissen fabriziert keine Schiesswaffen, wenn es weiss, dass damit Europa in ein Blutmeer verwandelt wird. Darum, und weil ich nicht auch Schiesswaffen machen wollte, habe ich mich mit Harry Smith senior überworfen und bin Journalist geworden. Ich habe keine Angst vor den Deutschen.“
Ein älterer Herr machte eine Pause im Kauen. Er war Einkäufer für ein grosses amerikanisches Schuhgeschäft.
„Sie sind noch sehr jung, Mr. Smith. Darum sind Sie Idealist. Wenn wir nicht die Waffen liefern würden, machten die Japs das Geschäft. Lieber machen wir es.“
„Und wenn die Japs nicht wären, würden wir dann keine Waffen liefern?“ fragte Harry.
„Oh, dear“, lachte der Kaufmann. „Ein Sprichwort sagt: Jeder für sich, und der Teufel hole den letzten. Sollen wir, wenn der Krieg aus ist, die letzten sein?“
„Warum schreien wir dann, dass sich die Germans nicht vom Teufel holen lassen wollen?“ ereiferte sich Harry, der im Grunde gar kein besonderer Deutschenfreund war, und dem die Leute über dem Teich im Grunde ganz gleichgültig blieben. Aber er war jung und hatte ehrliche Ansichten. Wenn einer beim Boxen unerlaubte Griffe machte, dann war der in Harrys Augen erledigt. Und die Amerikaner machten bei der allgemeinen Boxerei schlechte Griffe. „Die Zeitungen schreien, die Hessen hätten gegen Amerika gefochten. Aber sie schreiben nicht, dass uns im Bürgerkrieg fünfzehn deutsche Regimenter geholfen haben. Und sie sagen kein Wort vom General Steuben und von Karl Schurz und den andern. Die Amerikaner sollten endlich aufhören, die Deutschen zu beschimpfen, denn wenn diese nicht wären, dann könnten wir nicht jeden Tag beten: ‚Lieber Gott, erhalte den Krieg. Denn wir machen die besten Geschäfte!‘“
„Das ist aber doch eine tolle Sache“, warf Mr. Bookmaker ein. „Sie reden wie ein Deutscher. Wir verdienen gar nicht so viel.“
„So?“ lachte Harry. „Mein Vater ist Mitaktionär der Hyatt Rosser Bearing Company in Harrison. Sie wissen ... in Neujersey. Die liefern für die Engländer und Franzosen. Sind Sie orientiert, was die Company Dividende zahlt? 1400 Prozent. Die Aktie ist von 50 auf 850 Dollars gestiegen.“
„Gut“, sagte Mr. Bookmaker. „Freuen Sie sich, wenn Sie solche Aktien haben.“
„Und die Aktien der Behlehelm Steel Gesellschaft, die einen Marktwert von vierundeinerhalben Million Dollars hatten, ist auf 52 Millionen Dollars gestiegen. Und so bei allen Gesellschaften, die für den Krieg liefern. Im Zentrum aber sitzt Mr. Morgan und spinnt seine Netze. Er mästet den Krieg. Und dann baut er Kirchen!“
„Hallo!“ sagte Bookmaker mit Nachdruck. „Sie reden wie ein Anarchist. Sind Sie Deutschamerikaner?“
„Meine Vorfahren wanderten vor neun Generationen ein, und mein Vater macht Kriegsgeschäfte, Mr. Bookmaker. Seien Sie beruhigt, ich bin an den 27 Millionen, die die Deutschen für ihre Propaganda ausgegeben haben sollen, unbeteiligt. Ich rede auch, ohne dass die Dollars in meine Taschen fliessen, gegen den Unsinn und gegen schlechte Tendenzen!“
„Die U-Boote und die Zeps sind gute Tendenzen“, erwiderte Bookmaker unter allgemeiner Beifallsbezeigung. „No, Mr. Smith! Die Deutschen sind Räuber!“
Darauf Harry Smith:
„Mr. Bookmaker, das ist ein Unsinn.“
„Doch, Mr. Smith. Die Deutschen sind Mörder.“
„Und die Engländer?“
„Die Engländer kämpfen für die Gerechtigkeit.“
„Auch in Ägypten?“
„Ägypten ist ein Land ohne Kultur!“
„Beweis, Mr. Bookmaker!“
Aber Mr. Bookmaker wusste nur etwas von Niggern zu erzählen, und die ganze Tischrunde stimmte ihm bei. Denn dass die Ägypter auch nur Niggers seien, das stünde wohl fest, und die Niggers seien unreine Tiere, aber keine Menschen. Es sei lächerlich, für die Niggers zu kämpfen. Aber wenn eine Nation Frauen und Kinder ertränke — — Da wurde Harry Smith die Sache zu bunt. Er erklärte, es sei lächerlich, sich aufzuregen, wie andere Leute ihren Streit schlichteten, wenn man den Feinden dieser Leute das Messer in die Hand drücke. Und wenn Amerika seine Landsleute auf armierten Schiffen fahren lasse ... na, und so weiter, was aber der Tafelrunde nicht einleuchten wollte, besonders dem ehrenwerten Mr. Bookmaker nicht, der den ganzen Tag auf der Strasse umherlümmelte und Gott mochte wissen woher seine Gelder bezog. Vielleicht aus seiner Bummeltätigkeit am Hafen und seinen intimen Bekanntschaften unter den Dockarbeitern. Er wusste immer genau, welche Waren die Schiffe geladen hatten. Das ging Harry Smith durch den Kopf, denn er wurde plötzlich grob und nannte Mr. Bookmaker einen Heuchler. Der sagte, Harry Smith sei ein deutsch gefärbter Greenhorn. Da boxte Harry Smith dem Mr. Bookmaker drei Backenzähne ein, dann fuhr er nach Europa.
Harry Smith sah sich Deutschland ganz genau an. Er fand, es sei eine besondere Sache um den preussischen Militarismus. Dieser war nicht Harrys Geschmack, aber er bewunderte das System. Die Deutschen sind famose Kerle, dachte er, die denken nicht daran, nach Amerika zu fahren, und Wilson ist blind gegen die Japs, weil die Germans nervös machen.
Harry schrieb also nach vier Wochen an Marc Ellison: es sei das einzig richtige, Amerika verkaufe seine Baumwolle, denn die Engländer würden nie mit Deutschland fertig, und es sei eine Lüge, dass das Land keine Rohmaterialien habe und die Maschinen stillständen. Das Guggenheimer Syndikat in Chile, das bekanntlich eines der grössten Kupferbergwerke der Welt habe, lasse in Deutschland während des Krieges seine Maschinen bauen. Das sei ein Elfmillionenauftrag. Und die deutsche Ozon G. m. b. H. baue eben jetzt die Madrider Brunnen um, und die Rumänen liessen sich aus Deutschland ein paar Dutzend Lokomotiven kommen. Auf der Germaniawerft in Kiel lägen halbfertige Schiffe für Holland, und deutsche Ingenieure seien nach Rotterdam und Amsterdam gegangen, um dort weiterzubauen. Und wenn erst der Krieg zu Ende sei, dann würde die Produktion Deutschlands aufs neue einsetzen. Marc Ellison solle sich nur einmal vorstellen, was die Türkei für Deutschland dann bedeute. Mesopotamien! Syrien! Feldbahnen! Maschinen! Und die Volkswirtschaft sei auch während des Krieges auf der Höhe. Die Banken hätten das volle Vertrauen des Publikums. Es kämen verhältnismässig weniger Konkurse vor als in Amerika — kurz und gut, die Deutschen ständen famos, und der Michel werde wohl mit dem Daumen auf Ägypten drücken. Wenn erst die dicke Berta am Suezkanal eingegraben sei und auf die Schiffe im Kanal schiesse, dann sei der für die Engländer unpassierbar, und wenn dann in Indien der Tanz losginge, dann müssten die Engländer um Afrika herumfahren. In dem Falle wäre aber time mehr als money — kurz und gut, es sei an der Zeit, dass Amerika seine Baumwolle verkaufe und Wilson den Mund halte, denn die Deutschen wollten mit Amerika Handel treiben, nicht aber Neuyork erobern. Er, Harry, habe davon mit deutschen Offizieren gesprochen, und die seien vor Lachen beinahe gestorben. Er sei sehr beleidigt gewesen, dass man die Amerikaner mit ihren Ideen nicht mehr ernst nähme, aber daran seien nur die Engländer schuld. Amerika solle Baumwolle schicken und Frieden machen, denn es sähe ganz so aus, als ob die Engländer zuletzt kämen und der Teufel sie schon am Kragen hätte ... Er, Harry Smith, bedauere zwar persönlich, dass die Deutschen jetzt so mächtig würden, denn seine Freunde seien sie trotz allem nicht, aber sie seien einfach smart, und er müsse die Kirche seinem Dorf lassen und der Wahrheit die Ehre geben. Und so weiter.
Marc Ellison würde diesen Brief sicher mit sechs druckschwärzeschwangeren Überschriften versehen und das Signal zu einer wütenden Pressfehde gegeben haben, womit er business gemacht hätte, denn es gab Leute genug, die Frieden haben wollten. Aber der schöne Brief Harrys kam nie nach Neuyork, weil die Engländer, die für die Gerechtigkeit streiten, die deutsche Post auf offener See kaperten und durch ihren Zensor säubern liessen. Harrys Brief befand sich aber nicht unter den gesäuberten Briefen, und Marc Ellison fand, dass die Zinsen seiner tausend Dollars auf sich warten liessen.
Harry Smith reiste indessen wohlgemut weiter nach Afrika.
Der Weg führte ihn durch die Schweiz. Von da wollte er weiter über Lyon nach Marseille.
Er hatte Empfehlungen an zwei Berner Familien. Bei der einen blieb er zu Abend. Man hatte Gäste. Mit dem raschen Auffassungsvermögen, das ihm gegeben war, durchschaute er das System der Kaste, das hier an Stelle der gesellschaftlichen Privilegien getreten war. Die Patrizier sind abgeschlossener als die deutschen Adligen, und an Stelle des persönlichen Regiments ist Ihre Majestät „die Masse“ getreten. Wie wenig passen die engen Seelen in den historischen Rahmen der einzigartigen Stadt, die sich versteinert hat in ihrer Vergangenheit: Wie ein trotziger Eindringling steht der Bundespalast, trotzig, in breiter Machtfülle, der Alpenkette des Berner Oberlandes gegenüber.
Die Rede drehte sich natürlich um den Krieg. Der amerikanische Berichterstatter war bald in eine heftige Auseinandersetzung mit einem Baseler Millionär verwickelt, der dem „heiber Dütschen“ den Teufel an den Hals wünschte; und als sich gar ein Lausanner Journalist in die Unterhaltung mischte, da kam der Amerikaner gar nicht mehr zu Wort.
„Die Deutschen,“ sagte der Lausanner, dessen Adern an der Stirne schon beim Klang des Wortes schwollen, „die Deutschen sind Barbaren, bêtes! Sie kommen von dort? Sie wollen widersprechen? O mon Dieu! Kommen Sie einmal nach Genf! Überhaupt in die welsche Schweiz! Man wird Ihnen erzählen von den Greueln dieser Deutschen! Je vous demande pardon — Sie sind enttäuscht, mais — wir kennen die Wahrheit —“
Endlich kam Harry Smith zu Worte.
„Sind Sie Zeuge eines jener Verbrechen gewesen, deren man Deutschland beschuldigt?“
„O non ... mais non — ich bin Neutraler — aber — on raconte — tout le monde raconte — die Deutschen sind Barbaren — oh, monsieur, in Genf ist eine Anstalt, darinnen befinden sich dreihundert belgische Jungfrauen, die —“
Das Gespräch wurde unterbrochen. Der Amerikaner erhob sich. Er war nicht überzeugt, aber beeinflusst. Er fand, dass es schwer war, für Deutschland zu sein, da die ganze Welt dagegen war. Er zog sich bald unauffällig zurück. Aus dem Wortschwall des Lausanner tönte ihm noch nach — le Kaiser — oh, le Kaiser — messieurs —“
Die Stimme des Sprechers überschlug sich. Harry Smith verabschiedete sich. Am nächsten Tage fuhr er weiter.
Die Reise ging nach Lyon.
Er fand die Stadt in grosser Aufregung und hatte das Glück, Zeuge des Empfangs zu werden, den König Nikita auf französischem Boden fand. Harry hatte unterwegs gelesen, Montenegro habe Frieden mit Österreich-Ungarn geschlossen. Der schlaue Nikita hatte rechtzeitig das sinkende Schiff des Vierverbandes am Balkan verlassen und die Standarte des italienischen Schwiegersohnes in berufenere Hände abgegeben. Harry machte also grosse Augen, als er die Freundschaft bemerkte, die man dem flüchtigen Könige entgegenbrachte, und mit noch grösseren Augen las er die Erklärungen des montenegrinischen Generalkonsuls, es seien mit Österreich niemals Friedensverhandlungen eingeleitet worden, Nikita dementierte seine Minister, die montenegrinische Regierung dementierte Nikita, die Österreicher dementierten beides zusammen, und hissten ihre Fahnen in Skutari. Harry Smith schrieb an Marc Ellison, es habe den Anschein, als sei Nikita von Frankreich mit offenen Armen aufgenommen worden. Diese Umarmung sei leidenschaftlich und werde wohl sehr, sehr lange dauern. Harry suchte eine Gelegenheit, von König Nikita empfangen zu werden. Der flüchtige Herrscher tat dem Amerikaner um so lieber den Gefallen, als er die Welt von seinen Leiden wissen lassen wollte. Denn er wünschte nicht, dass man immer wieder an seine Rechenkunststücke erinnerte und hinter der Operette von Lyon den abgekarteten Bluff des besten Maklers vom Balkan vermutete. Der König erzählte dem Amerikaner sehr ausführlich von den Fliegerangriffen auf Cetinje. Die königliche Familie hatte manche Stunde bei Kerzenlicht im Keller des Schlosses verbracht, während Prinz Peter den Lowcen verteidigte. Schliesslich musste die Familie fliehen. Der König kam gerade noch bis Skutari. Da dort die Flieger der Österreicher ihm gefährlich wurden, ritt er nach San Giovanni di Medua, begleitet von acht Gardisten — in ähnlicher Verfassung wie vor ihm der Karageorgewitsch von Serbien. In einem Unterseeboot ging die gefahrvolle Reise nach Italien und dann weiter nach Lyon ... „und schreiben Sie, ich habe nie den Frieden gewollt. Montenegro habe sich bis auf das letzte Gewehr verteidigt. Aber wir hatten keine Lebensmittel mehr. Wir wurden von der ganzen Welt im Stich gelassen. Und was soll werden? Wir haben 100 Millionen Schulden und nichts als Papiergeld. Aber die gerechte Sache wird siegen. Montenegro kann und darf nicht untergehen. Die Balkanfrage ist noch lange nicht entschieden ...“
So und ähnlich sprach König Nikita. Harry Smith dachte, dass diese Reden dasselbe besagten wie alle die offiziösen und amtlichen Kundgebungen, mit denen die Welt überschwemmt wurde. Aber auch diesen Bericht erhielt Marc Ellison nicht, denn die französische Zensur erstreckte sich nach dem Prinzip der Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit auch auf den König von Montenegro, und die Regierung fand, dass Nikita mehr sagte, als der Sache des Vierverbandes zuträglich war. Und da man augenblicklich mit Washington ganz besonders vorsichtig verkehren musste, so strich die Zensur den schönen Artikel von „Lyon“ bis „entschieden“ und fragte bei Harry Smith an, ob er noch Wert darauf lege, ihn abzuschicken. Harry Smith rächte sich durch einen Artikel über die geheimen Verhandlungen zwischen dem montenegrinischen Ministerpräsidenten und der Pariser Regierung, sowie den italienischen Vertretern. Er machte sich über die Reise Briands nach Rom lustig, denn man sprach in Lyon offen von der Missstimmung in Italien. Viktor Emanuel sollte tief entmutigt sein durch den bisherigen Gang der Ereignisse. Die französischen und italienischen Zeitungen schlugen sich in wütenden Pressefehden, die Pariser waren ungehalten über die Engländer, die Engländer tadelten die Russen.
Diesen Bericht übergab Harry dem amerikanischen Konsul, in der Hoffnung, dass Marc Elliot nun endlich wieder von seinem Korrespondenten höre. Der amerikanische Konsul aber war ein guter Freund des ehemaligen Münchener amerikanischen Generalkonsuls und wusste, dass Präsident Wilson mit Leuten, die gegen den Vierverband stänkerten, kurzen Prozess machte. Er lehnte daher die Übersendung des Berichtes Harry Smiths ab, und dieser sandte nun den Brief kurzerhand mit einem holländischen Dampfer nach Amerika. Aber der Holländer hatte das Missgeschick, von einem englischen Kriegsschiff durchsucht zu werden, und da die Engländer für sich die Freiheit der Meere in Anspruch nahmen, so eigneten sie sich auch die neutrale Post an, und Harrys Bericht kam wieder nicht in Marc Ellisons Hände. Hingegen war in dem Boardinghouse, in dem Harry zuletzt gewohnt, ein Brief aus Deutschland angelangt, und als Marc Ellison anfrug, erhielt er den Bescheid, dass Harry wohl in Deutschland angekommen, dort aber vielleicht verschollen sei.
Mr. Bookmaker nahm sich sogleich des mysteriösen Falles an und beschloss, ihn zu verfolgen.
Inzwischen reiste Harry Smith weiter nach Marseille.
Kurz vor der Abfahrt des Zuges bekam der Amerikaner Gesellschaft. In sein Coupé stiegen ein französischer Kapitän und zwei Zivilisten. Der eine von den letzteren war Franzose ... schmächtige Figur, rasche, temperamentvolle Bewegungen, lebhafte Augen, schwarzer Spitzbart. Der andere, ein Englishman, hatte einen schmalen Kopf. Das Gesicht war von kühler Regelmässigkeit. Keine Linie, keine Falte störte die Symmetrie der Züge. Alles war klar, sicher, zielbewusst. Nur um den Mund störte ein brutaler Einschlag. Die grauen Augen blickten so ruhig, dass sie beinahe starr wirkten. Ihr Blick senkte sich schwer und bezwingend auf den, den sie forschend trafen. Das Haar dieses mit ausgesucht einfacher Eleganz gekleideten Reisenden war an den Schläfen ergraut. Es war schwer, sein Alter zu beurteilen. Es konnte zwischen vierzig und Ende fünfzig geschätzt werden.
Die Franzosen grüssten freundlich. Der andere lüftete ein wenig die Mütze. Harry verhielt sich schweigsam. Der Engländer verwickelte den Kapitän in ein Gespräch. Der antwortete verbindlich, aber ohne besondere Liebenswürdigkeit. Kapitän de Reynier reiste nach Marokko und Algerien. Er sah übermüdet aus. Trotz der tadellosen Uniform sah man ihm an, dass er mit dem Kriege ernste Bekanntschaft gemacht hatte.
Und in der Tat war die Lebensgeschichte des Marquis keine gewöhnliche. Von glühendem Patriotismus erfüllt, liess er sich gleich bei Ausbruch des Krieges an die Front senden. Er machte die unglücklichen Septembertage mit. Er lag den Deutschen Monate um Monate in Schützengräben gegenüber.
Allmählich lernte der Kapitän das ganze Unglück seines Landes kennen. Er begriff, dass die Phrasenhaftigkeit der unfähigen Regierung Frankreich immer mehr einem Abgrund entgegensiss. In den heissen Kämpfen in der Champagne lernte er die Uneinigkeit kennen, die die französischen Generale nutzlos die besten Soldaten opfern liess. Reynier machte die Bluttage von Bagatelle mit, General de Ville wollte die verbrauchte Truppe schonen, Duchesne verlangte, dass man sie opfere. Der Kapitän hatte französischen Landsturm unter sich. Er sah die braven Männer fallen, um die Witwen und Waisen ihr halbes Leben vertrauern würden. Er sah sie nutzlos fallen. Erbitterung und Mutlosigkeit ergriffen allmählich den tapferen Offizier. Er schrieb nach Hause an seine geliebte Gattin Eugenie:
„Wir sind stets blind, wir Franzosen! Wie wäre es doch viel besser gewesen, unsere äussere Politik zu ändern und ihr eine andere Richtung zu geben, als die auf das englisch-russische Bündnis.
Montag, den 30. August. Man spricht von den Deutschen wie von Verbrechern, von Wesen ohne Sittlichkeit, die die Verträge ungestraft vergewaltigen. Wir sind ihnen ganz gleich, und wenn es in unserm Interesse gewesen wäre, den Frieden zu brechen, so hätten wir es ohne Skrupel getan, und zwar mit schönen Entschuldigungen und einleuchtenden Gründen.
Oh! Und dann ist man müde, in grossen Buchstaben immer wieder diese „sicheren Zeichen“, „sicheren Vorläufer“ eines deutschen Niederbrechens oder eines grossen Sieges der Verbündeten oder des Friedens zu lesen. Schon seit elf Monaten liest man das; alle Tage ein neues Anzeichen, und nichts trifft ein. Sprechen wir lieber weniger und handeln wir dafür mehr. Machen wir nicht so viel Schwätzereien von Bundestreue, von Liebe und Nächstenliebe, beschäftigen wir uns lieber zuerst mit dem Wohle Frankreichs. Sehen wir lieber in überlegter und praktischer Weise mehr in die Zukunft. Wie Deutschland uns doch so gut in der Kriegführung unterrichtet. Werden wir daraus Lehren ziehen? Haben wir bereits aus den zehn Monaten erzwungener Lehrzeit Nutzen gezogen? Aber da ist nichts zu machen, das liegt im französischen Charakter. Wir werden uns nie ändern.“
Es war dem Kapitän Bedürfnis, sich gegen irgend jemanden auszusprechen. So tat er es in den Briefen an seine Gattin in Paris, die er abgöttisch liebte.
Madame Eugenie de Reynier lernte um diese Zeit einen englischen Offizier kennen. Sein überlegenes, brutales Wesen, die Eleganz seines Auftretens betörten sie. Sie wurde seine Freundin, wie so viele andere Pariserinnen, die ihre Ehre nie an einen boche, wohl aber an die glorreichen Verbündeten jenseits des Kanals wegwarfen. Sie zeigte dem Major den Brief ihres Gatten.
„Der Kapitän ist ein Feigling“, antwortete dieser und gab den Brief an die französische Kommandantur weiter. Der Kapitän wurde beobachtet und in die vordersten Linien geschickt. In der grossen Septemberoffensive schlug er sich wie ein Löwe und wurde schwer verwundet. Man sandte ihn nach Paris. Er war den Engländern schon vom Kriegsschauplatz her nicht hold. Er verfluchte dieses blutschänderische Bündnis mit den Angelsachsen. Bald kam er hinter die Geheimnisse seiner Frau, als auch der Major auf Urlaub von der Front nach Paris zurückkehrte. In einer verhängnisvollen Stunde schoss der Kapitän auf den „Verbündeten“. Zum Glück verwundete er ihn nur leicht. Der Kommandant von Paris liess die Sache niederschlagen. Der Engländer kam wieder an die Front, Madame Eugenie begleitete ihn nach dort. Kapitän de Reynier wurde strafversetzt zur Legion. Er hatte dort seine Karriere begonnen. Nun musste er sie da vielleicht beenden, während sein Vaterland den letzten, heissen Kampf gegen den Feind führte.
Die Erinnerungen liessen ihn kein entgegenkommendes Wort gegen den unbekannten Engländer finden. Umso angeregter plauderte sein Begleiter, der Vertreter des „Matin“:
„Denken Sie ... als ich abreiste, wurde Paris von einem Zeppelin bombardiert! Diese verfluchten boches!
Mon dieu! Ich befand mich gerade in der Metropolitain. Welche Katastrophe! Ein Tunnel wird vollkommen aufgerissen! Wie ein Taifun geht uns allen ein Luftzug ins Gesicht. Ein Donnerrollen folgt. Aufschlag auf Aufschlag, Explosion auf Explosion. Wie wahnsinnig stürmen wir alle die Aufgangstreppen empor. Ich erinnere mich noch, einen Baum gesehen zu haben, der, wie vom Blitz in zwei Teile gespalten, auf dem Dache eines Hauses lag. Ein anderes Haus war in der Mitte durchschlagen. In einem Esszimmer lagen drei Tote. Ambulanzwagen drängen sich durch die Menge. Auf die fünfstöckigen Häuser fallen neue Bomben. Dabei sah man gar nicht, woher sie fielen. Ein grauer Nebelschleier lag über Paris. In wenig Minuten entlud sich ein Orkan von Feuer, Eisen und Rauch über der Stadt. Die Bomben heulten, grollten Die Fenster spien zersplittertes Glas. Ein Haus wird in der Mitte auseinandergerissen. Feuerwehrleute arbeiten im Scheine von Fackeln. Ganz Paris ist pechdunkel ...“
Der Engländer hörte mit hochgezogenen Brauen zu. Dann erwiderte er, es erginge England nicht besser. Die Deutschen hätten diesmal gleich die ganze Insel mit Bomben belegt. Wehrlose, offene Städte. Freilich seien mehrere Bombenfabriken schwer beschädigt. „Sie haben es auf unsere Industrie abgesehen. Aber wir bauen jetzt in Amerika ein Riesenkampfluftschiff. Einen Luftdreadnought. Die Curtiss Aviation Works in Buffalo haben das Ding in Arbeit. Aktionsradius 1000 Kilometer. Die Deutschen mögen sich vorsehen ...“
Der bewegliche Franzose stiess einen Fluch durch die Zähne.
„Les Allemands, oh, les Allemands!“ In dem Ton lag abgrundtiefer Hass. Dieser Ausruf drückte alles aus, was dieses irregeleitete und von einer förmlichen Psychose ergriffene Volk über die Deutschen dachte. In diesem Tonfall spiegelten sich die verwerflichen und unbegreiflichen Vorstellungen von einer Rasse von Werwölfen und Kulturlosen ... Nach einer kleinen Pause fuhr er fort, die Stimme dämpfend und einen misstrauischen Blick auf den unbekannten Mitreisenden werfend:
„Ich bin Mitarbeiter des französischen Ministeriums des Äussern an der Presskampagne. Ich leite die Kriegsdrucksachenzentrale. Wir geben Bücher und Broschüren in vierzehn verschiedenen Sprachen heraus. Wir verbreiten die Schandtaten der boches in allen Sprachen und in allen Ländern der Welt. Unsere Erfolge sind viel, viel grösser, als die Deutschen ahnen. Sie sind eindrucksvoller als ihre Zeppelinangriffe ...“
Das Gespräch verstummte eine Weile.
„Sie sind Neutraler, mein Herr?“ fragte der Kapitän plötzlich und unvermittelt den Mitreisenden.
„Amerikaner.“
„Deutsch-Amerikaner?“
„Amerikaner. Immerhin — ein wenig deutsches Blut fliesst von langer Ahnenreihe her auch in meinen Adern.“
Smith lächelte bei diesen Worten verbindlich: „Harry Smith aus Saginaw in Michigan.“
„Ah, ah“, machte der Kapitän und verneigte sich mehrmals. „Eugen de Reynier, Kapitän beim ersten Regiment der Fremdenlegion.“
Der Engländer wandte dem Kapitän den Kopf zu. Smith sah den Offizier halb verwundert, halb interessiert an. Die Fremdenlegion! Smith hatte nichts Erbauliches davon gehört. Der Engländer warf nun eine Frage dazwischen und stellte sich vor: „Mein Name ist Bradley. Ich korrespondiere für die „Times“.
Der französische Zivilist stieg an der nächsten Station aus. Harry Smith freute sich, in dem Engländer einen Kollegen gefunden zu haben.
„Ich bin in Europa, um für ein amerikanisches Blatt die Wahrheit der deutschen Interessen zu erforschen“, sagte er.
„Ein Blatt deutscher Sprache?“
„Nein. Aber ich arbeite auch viel für deutsche Blätter in Amerika.“
„Und welches sind die Ergebnisse Ihrer Erforschungsreise?“
„Die besten. Die Deutschen haben eine gewaltige Höhe der Zivilisation erreicht. Ich denke, dieser Krieg wäre zu vermeiden gewesen, denn die deutschen Interessen erforderten ihn nicht.“
Der Engländer lächelte überlegen.
„Sie dürfen nicht vergessen, Mr. Smith, dass mit der Produktion, die in Deutschland freilich eine schwindelnde Höhe erreicht hat, auch die Ansprüche auf Absatz gewachsen sind. England beherrscht ein Viertel der Erde. Es hat die denkbar günstigsten Plätze der Welt in seinen Händen, und abgesehen von seiner Ausfuhr ist die Einfuhr von Obst, Getreide, Diamanten, Gold und Baumwolle beinahe unbegrenzt. Wir beherrschen den Markt der ganzen Welt, und deshalb ...“
„Deshalb, meinen Sie, musste es zwischen England und Deutschland, rein handelspolitischer Interessen wegen zur Entscheidung kommen?“
„Yes.“
Der Amerikaner merkte, dass das Gespräch in ein gefährliches Fahrwasser steuerte, aber er liess nicht locker. Der Hochmut des Angelsachsen und die lauernde Schweigsamkeit des Franzosen reizten ihn, seine Anschauung nicht zu unterdrücken.
„Man neigt allmählich in Amerika der Auffassung zu, dass die deutsche Armee unbesiegbar sei —“
„Was nützt die Armee? Sie ist eingeschlossen. Österreich ist auf die Dauer nicht stark genug, Galizien gegen die neue Offensive Russlands zu decken. Czernowitz soll doch schon wieder in russischen Händen sein. England hat mühelos fast alle deutschen Kolonien genommen. Wir werden aus Saloniki eine unüberwindbare Festung machen. Wir zwingen Griechenland, uns zu folgen. Der Balkankrieg beginnt erst, Mr. Smith — übrigens Sie reisen nach Marokko, nicht wahr?“
„Allerdings ...“
„Nun, gestehen Sie es doch ganz offen. Sie vertreten eine amerikanische Waffenfabrik oder haben irgendeine geheime Mission?“
Die durchdringenden grauen Augen hielten den Blick des Amerikaners fest. Smith musste unwillkürlich lächeln. Ein klassisches Beispiel für die Gespensterseherei der Engländer! Mit leisem Spott entgegnete er:
„Mr. Bradley, Sie überschätzen meine Fähigkeiten, und wie es scheint die Ehrlichkeit eines Amerikaners, der übrigens, jetzt will ich es bekennen, noch deutsches Blut in den Adern hat. Übrigens haben in Marokko doch nur die Franzosen, aber nicht die Engländer Interessen —“
„Meinen Sie?“
„Sicherlich. Wenn ich aber wirklich in einer geheimen Mission nach Marokko ginge, so würden Sie mich mit dieser sehr durchsichtigen Taktik nicht vor ein Kriegsgericht bringen. Ich versichere Sie aber, dass ich nur als Journalist nach Marokko gehe. Und Sie, Mr. Bradley?“
Der Engländer zog kaum merklich die Brauen hoch.
„Ich? Ich reise nach Tanger, besuche vielleicht Algerien.“
„Ah! Das werde ich mir später ansehen. Ich gehe zunächst nach Fez.“
Das Gespräch verstummte. Der Franzose und der Engländer unterhielten sich leise.
Smith hörte nicht weiter hin, denn er war aufgestanden und sah durch das Fenster auf die Landschaft.
Der vermeintliche Gegner brachte den Kapitän dem Engländer sofort näher.
Das Rattern der Räder verschlang die leise geführte Unterhaltung zwischen beiden. Sie beschäftigten sich mit ihrem Reisebegleiter.
Der Kapitän sagte: „Es wird gut sein, wenn man ihn im Auge behält.“
Darauf Bradley: „Ich bitte Sie, Kapitän: Ein Deutsch-Amerikaner in Marokko — man müsste ein Kind sein, um nicht zu begreifen, dass er bestimmte Interessen vertritt!“
„Natürlich. Die ganze Welt ist von diesen Emissären verseucht.“
Bradley nickte, beugte sich an das Ohr des Kapitäns. „Man wird ihn rechtzeitig unschädlich machen. Benachrichtigen Sie die Behörden in Tunis. In Tanger nehme ich ihn auf mich. Schlimmstenfalls — damned — ein Spion, da wird man keine grossen Umstände machen. Es gibt eine amerikanische Protestnote — allright — wir pfeifen darauf.“
Der Kapitän lachte. Der Engländer trat auf den Gang hinaus. Er war erregt.
„Der käme mir gerade gelegen,“ murmelte er, „jetzt, wo alles so gut steht. Man wird mir den Kerl doch nicht auf den Hals gehetzt haben? Käme ihm teuer zu stehen.“
Sie langten bei Dämmerung in Marseille an. Da sie Aufenthalt hatten, so willigte Smith gerne ein, sich von seinem Reisebegleiter die Stadt zeigen zu lassen. Als sie den Bahnhof verliessen, begegneten ihnen einige Leute, die von französischen Soldaten eskortiert wurden.
Branken wandte sich fragend an den Kapitän, der die Leute mit besonderem Interesse musterte.
„Sind das Deserteure oder ähnliches, Herr Kapitän?“
„Nein, Legionäre.“
„Warum werden sie von Soldaten eskortiert? Sind diese Leute schon vereidigt?“
„Es sind Zivilgefangene, die einen Vertrag unterschrieben haben. Kommen nun nach St. Jean. Von dort werden sie nach dem Fort Therèse in Algier eingeschifft.“
Die neuen Rekruten der Fremdenlegion machten einen traurigen, hilflosen Eindruck. Smith wollte einen von ihnen anrufen, aber der begleitende Sergeant trieb die Rekruten schnell vorwärts. Der Kapitän glaubte, dem Amerikaner eine Erklärung geben zu müssen:
„Sie melden sich alle freiwillig. Frankreich hat keine Ursache, solche Soldaten für seine Kolonien zurückzuweisen.“
Der Engländer lenkte das Gespräch ab. Sie schlenderten durch Marseille. Smith war müde, die drei Reisenden gingen deshalb in ein Restaurant. Als sie am Kai entlangschritten, versank die Sonne.
Eine Welle von Orange ging über den Horizont hin — eine Untiefe öffnete sich am Himmel, und nun floss ein Strom von Gold und tiefem Purpur über das Meer. Die Sonne sank in die Flut: und es war, als vernehme man das Zischen des heiligen Feuers, das dem Balle entgegenströmte, als die schwarzen Tinten der See ihn tiefer und tiefer zu sich hinabzogen. So starb der Tag. Eine Decke von tiefem Lila zog sich über das Firmament.
Sie standen am nördlichen Eingang des alten Hafens. Als Smith den trunkenen Blick wandte, da fiel sein Auge auf das Fort Saint Jean, das den Hafen gemeinsam mit dem Fort Saint Nikolas und einer dritten Festung verteidigt. Von einem Hügel grüsste gespenstisch die Kirche Notre Dame de la Garde herab.
Beim Anblick der gewaltigen Mauern von St. Jean fasste den Amerikaner ein Grauen, er wusste nicht, warum. Sein Blick hing an den grauen, massigen Steinen, die 40 Meter hoch aus dem Meere emporwuchsen zu einer mittelalterlichen Zwingburg.
„Der letzte Aufenthalt der Fremdenlegionäre in Europa“, erklärte ihm der Kapitän und betrachtete ihn misstrauisch von der Seite. Smith verabschiedete sich bald von seinen Reisegefährten, nachdem er mit ihnen soupiert hatte. Bradley hatte mehrmals versucht, das Gespräch auf die deutschen Militärverhältnisse zu bringen, und der Kapitän hatte einen grossen Vortrag über den wirtschaftlichen Zusammenbruch der Zentralmächte gehalten. Er zeigte sich miserabel informiert, aber der Amerikaner hatte keine Lust, ihn vom Gegenteil zu überzeugen.
Er schützte für den nächsten Tag Besorgungen vor und nahm gleich längeren Abschied. Dem Kapitän versprach er, ihn, wenn es die Zeit gestattete, in Sidi Bel Abbés zu besuchen, wo er in Garnison stand. Und mit dem Engländer verabredete er eine Zusammenkunft in Tanger.
„Ich werde Sie dort dem Sultan vorstellen“, versprach ihm dieser. „Sie werden unvergessliche Eindrücke mit nach Hause nehmen.“
Smith versprach, unbedingt zu kommen. Als er gegangen war, sassen die beiden Freunde noch lange zusammen. Und am nächsten Morgen meldete sich Reynier bei dem Stadtkommandanten. Die Folge der Unterredung zwischen den beiden Offizieren war, dass eine Depesche an den französischen Militärgouverneur von Fez abging.
Harry Smith war seit drei Tagen in Fez. Er hatte sich um billiges Geld ein Pferd erworben und streifte die Umgebung ab, als er gegen Abend über die steinerne Brücke, die den Sebu überquert, zurückkam. Erschrocken riss er sein Pferd zurück. Mehr als dreissig Köpfe von Marokkanern waren auf grosse Spiesse gesteckt und zierten eines der Eingangstore in die Stadt.
Die halbverwesten Köpfe machten einen schrecklichen Eindruck. Smith, der bisher noch keinen Blick in die Geheimnisse dieses Landes hatte werfen können, war so verblüfft, dass er nicht einmal das Traben eines Pferdes hörte, das im Galopp herankam.
Im Reitsitz sass eine Dame. Sie drückte den Tropenhelm fester in das Haar und betrachtete erstaunt den Europäer, während sie das Tier in langsame Gangart brachte.
Nun hielt sie knapp an seiner Seite.
Er blickte sie an, riss sein Pferd zurück und grüsste.
„Verzeihen Sie, meine Dame, dass ich sie nicht früher bemerkte. Ich versperre Ihnen den Weg!“
Sie schüttelte lächelnd den Kopf. Ihre stahlklaren Augen aber ruhten durchdringend auf seinen Zügen.
„Sie entsetzen sich über diese Trophäen, mein Herr?“ fragte sie in reinem Französisch.
„Ja — ich muss gestehen ... diese barbarische Justiz ist mir noch überraschend.“
„Sie werden sich daran gewöhnen, wenn Sie länger hier im Lande sind. Diese Herrschaften —“ sie wies mit der Reitgerte nach den Köpfen auf den Spiessen — „haben sich gegen den Sultan empört. Es sind Beduinenführer — sehen Sie, dieser mit dem schwarzen Bart und der Narbe auf dem linken Ohr — das ist Ben Moussa gewesen, einer der Getreuen Rais Ulis, des Räubers.“
„Wie? Sie kannten diese Leute?“
Sie nickte.
Ihre grausame Ruhe verursachte ihm ein Gefühl des Unbehagens. Er warf ihr einen scheuen Blick zu. Sie war jung, wenn auch die Sicherheit, mit der sie sich gab, sie älter erscheinen liess. Aber die warme Stimme berührte ihn so sympathisch, dass er die augenblickliche ablehnende Empfindung rasch vergass. Sie beobachtete ihn mit Interesse.
„Wir haben wohl den gleichen Weg, Madame?“
„Allerdings ... Ich will zurück nach Fez ...“
„Sie wohnen dort — und ich habe Sie noch gar nicht bemerkt!“
„Mon dieu — ich bin erst vor kurzem angekommen!“
Sie bediente sich des Französischen so fliessend, dass Smith sie für eine geborene Französin hielt. Er fragte:
„Sie kommen aus Frankreich?“
Dir Tiere gingen im Schritt nebeneinander. Sie zögerte einige Sekunden mit der Antwort, während ihr Blick forschend und kalt das Gesicht ihres Begleiters streifte. Dieser bemerkte es nicht, denn sie machte sich am Gebiss des Pferdes zu schaffen, während sie sich über die Mähne beugte.
„Ich bin Französin, war zuletzt in Konstantinopel, bin dort ausgewiesen worden und reise jetzt. Ich reise immer.“
Er sah sie erstaunt an. Und mit der Freiheit seiner Jugend fragte er unvermittelt:
„Gewiss sind Sie die Gattin eines der hier tätigen Diplomaten oder gehören wenigstens zum diplomatischen Korps.“
Sie lachte belustigt.
„Ja und nein — und doch nicht! Ich reise ganz allein!“
„Das wagen Sie?“
„Warum nicht? Der Mut ist Sache der Gewohnheit. Ich habe mich schon sehr früh an Selbständigkeit gewöhnen müssen. Für eine Französin ist allerdings meine persönliche Freiheit ungewöhnlich. Sie sind Amerikaner?“
„O — das wissen Sie — so ohne weiteres?“
„Natürlich“, lachte sie belustigt.
Er hielt sein Pferd zurück.
„Sie kennen mich?“
„Durchaus nicht. Ich habe nur gelernt, mit offenen Augen durch die Welt zu gehen. Man lernt schnell taxieren. Gewiss — man kann einen Hochstapler aus Mexiko mit einem spanischen Granden und einen amerikanischen Bierbrauer mit einem englischen Diplomaten verwechseln — vorausgesetzt, dass man sie nicht reden hört — aber den Amerikaner und den Deutschen erkennt man auf den ersten Blick.
Ein Mann, der nicht viel mit Pferden zu tun hatte, reitet anders. Sie reiten wie ein Offizier, nicht etwa wie ein Cowboy oder wie ein Texasjak.“
Sie lachten beide.
„Stehen Sie hier im Dienst?“ fragte sie weiter.
„Nein, wie käme ich dazu?“
„Nun, ich dachte.“
„Ich stehe dem allen fern.“
„Sie sind also zu Ihrem Vergnügen in Marokko?“
„Ich bin Zeitungskorrespondent.“
Wieder traf ihn ein rascher Blick. Sie ritten jetzt durch die „heilige“ Stadt Fez. In den engen, krummen und winkligen Gassen lag der Schmutz umher, dass die Pferde manchmal stolperten. Räudige Hunde gruben gierig in dem Abfall, nackte Kinder balgten sich vor den Häusern und dann und wann begegnete den Reitern ein Araber zu Pferde. Kamele mit ihren Treibern, ein Minster auf einem dicken Esel, Gefangene, die ihre Ketten klirrend nachschleiften, Soldaten, deren lumpige Uniform in Verbindung mit einem krummen Dolch sie als Mitglieder der „Armee“ des Sultans kennzeichneten.
Etliche von diesen „Gardisten“ mühten sich ab, eine Armstrong-Geschützröhre durch den Schmutz zu zerren, dazwischen drängten sich alte, verlumpte und unverschleierte Weiber bettelnd an die Europäer heran, und abschreckend hässliche Araber mit zerfetzten Stirnbinden mussten erst durch die Pferde beiseite gedrängt werden, ehe sie die Strasse freigaben.
Smith ritt mit seiner Begleiterin staunenden Auges durch diese Gassen. Der Lärm, das Geschrei um sie her machte eine Unterhaltung unmöglich. Man merkte, dass Krieg war oder jedenfalls geführt werden sollte, denn immer wieder tauchten Soldaten auf, und zwischen den Lücken der halbverfallenen Mauern gähnten alte Geschütze, die allerdings mehr Kuriosität als Waffen in ernstem Sinne bildeten. Einzig die viereckigen, kanzelartigen Minaretts und die Moscheen waren in gutem Zustande. Die Häuser waren halb zerfallen und starrten von Elend und Schmutz. Ein Pilger sass mitten auf der Strasse und leierte das muhammedanische Glaubensbekenntnis herunter: „le Mah il Allah ...“
Die offenkundige Neugierde, das Staunen, das sich in den Zügen des Amerikaners prägte und den Neuling verriet, schien das Misstrauen der Dame beseitigt zu haben. Sie beobachtete mit lauerndem Lächeln einen Eingeborenen in weissseidener Hose und gestickter roter Jacke, den gleichfalls roten Tarbusch mit Troddeln auf dem Wollhaar. Er folgte ihnen in einiger Entfernung.
„Sehen Sie den Mann?“ fragte sie. „Das ist ein Offizier des Maghzen.“
„Ich bin ihm schon mehrmals begegnet“, erwiderte Smith. „Er treibt sich immer in der Nähe meines Hotels herum.“
In diesem Augenblick winkte die Dame dem Offizier, der eben herübersah. Sofort veränderte er seine bisher scheinbar gleichgültige Haltung und lief herbei.
„Ist’s möglich?“ sagte er in einem schrecklichen Deutsch, mit einem drolligen Berliner Einschlag, „Sie, Madame?“
„Ja, ich bin’s. Ich habe Sie sofort erkannt, Achmed Bey, obgleich Sie sich seit Ihrem Aufenthalt in der Berliner Militärakademie einigermassen verändert haben!“
Sie blickte auf seine Uniform. Aber der Marokkaner geriet nicht in Verlegenheit. Mit einem höflichen: „Muhammed ben Aissa, Kommandeur der Leibgarde“, wandte er sich an den Amerikaner, der mit einer Verbeugung antwortete und sich gleichfalls vorstellte, dann fuhr jener fort: „Zwischen der Schumannstrasse in Berlin und Fez liegt eine Welt. Ich bin berufen, zusammen mit den Franzosen, die Armee des Maghzen zu reorganisieren. Das ist eine Lebensaufgabe, über der man verzweifeln könnte. Da ich aber an die Zukunft meines marokkanischen Vaterlandes glaube ...“
„Unter französischem Protektorat?“ fragte die Dame schnell.
Muhammed ben Aissa zuckte, mit einem langen, forschenden Blick auf sie, die Achseln.
Sie lachte.
„Ich verstehe. Erst wird die Armee reorganisiert und eine solide Basis geschaffen, dann werden die Franzosen, die dem Sultan von Marokko gegen Bu Hamara und Genossen haben halten helfen, mit ihren eigenen Waffen geschlagen. Glauben Sie im Ernst, Muhammed ben Aissa — zum Heile Marokkos? Wird nicht eine andere Macht Frankreich ablösen?“
„Deutschland nicht!“ erwiderte der Marokkaner mit einem lauernden Blick auf den Amerikaner.
Dieser sah seine Begleiterin fragend an. Sie aber blickte in unbestimmte Fernen.
„Deutschland“, antwortete sie, ohne jemanden anzusehen mit einem verträumten Blick ... „Sie vergessen England — qui vivra verra — doch auf ein andermal! — ich sehe Sie doch übermorgen zum Tee bei mir?“
„Gerne, Madame, statten Sie dann auch der Kaserne der Haraba, der Leibgarde, einen Besuch ab?“
„Verlassen Sie sich darauf, lieber Kaid — Salem aleikum! Apropos — noch ein Wort — Wollen Sie über unsere Begegnung schweigen?“
„Sie wünschen es?“
„Ich verlange es.“
Der Kommandeur der marokkanischen Garde machte eine vollendet weltmännische Verneigung.
Sie lachte hellauf und winkte ihm mit der Gerte. Der Amerikaner wusste nicht, ob er in einem Märchenland weilte. Diese Gegensätze ... es war wie in einer Operette, gar, als seine rätselhafte Begleiterin nun sagte:
„Man hat Ihnen die politische Polizei auf den Hals gehetzt, ich habe es schon gemerkt. Haben Sie sich denn verdächtig gemacht?“
„Verdächtig! Als ob ich etwas im Schilde führte! Was geht mich Marokko an!“
„Aber Muhammed ben Aissa hält Sie für einen deutschen Unterhändler ... Vielleicht hat Sie jemand denunziert ... hatten Sie französische Reisegesellschaft?“
„Nein — das heisst, bis Marseille — da reisten ein französischer Kapitän und ein englischer Journalist mit mir — ein Herr de Reynier und Mr. — einen Augenblick — Mr. Bradley. Aber was ist Ihnen?“
Sie hatte für einen Moment ihre Sicherheit eingebüsst. Ihre Augen wurden dunkel, eine fahle Blässe glitt über ihre Wangen.
„Nichts, Mr. Smith — rien de tout ... doch ich verstehe nun ...“ Sie sah einige Sekunden zu Boden. „Haben Sie heute abend etwas vor?“
„Nein, gnädige Frau.“
„Wollen Sie mir Gesellschaft leisten?“
„Ich wüsste nicht, was mir grösseres Vergnügen bereiten könnte.“
„Dann holen Sie mich um Sieben ab. Ich wohne beim englischen Botschafter. Fragen Sie sich durch. Sie müssen vor einem Torwege, an dessen linker Seite Sie eine mit Eisen beschlagene Tür bemerken, haltmachen. Klopfen Sie. Sie werden den Dragoman Dolmetscher kennenlernen; ein sehr netter Herr. Und dann besuchen wir die Vorstellung einer Casije, einer einheimischen Tänzerin. Seien Sie pünktlich!“
Sie reichte ihm die Hand. Er führte sie an seine Lippen. Ihre Augen tauchten für einen Augenblick ineinander. Er fühlte, wie ihm das Blut zu Kopfe stieg. Sie gab ihrem Pferde die Sporen und jagte weg.
Gesenkten Hauptes, ein Opfer der widersprechendsten Empfindungen und Gedanken, kehrte der Amerikaner in sein Hotel zurück.
Der junge Leutnant hatte die Liebe kaum kennengelernt. Ausser dem Flirt war sie ihm fremd geblieben.
Die moderne Blasiertheit verachtete er, ungesundes Schwärmertum erregte seinen Spott. Um so tiefer trug er die Sehnsucht nach der Frau in sich verschlossen. Er hatte grosse, starke Ansichten von der Liebe.
Denn Harry Smith besass einst eine Mutter, die früher nicht nur schön gewesen war, sondern auch sich ihren Idealismus bewahrt hatte. Diese Mutter hatte mühelos die Achtung vor dem weiblichen Geschlecht in Harrys Seele gepflanzt. Seine weitgehenden gesellschaftlichen Beziehungen hatten es mit sich gebracht, dass er schon vielen Frauen begegnet war, Mädchen, die ihre berechnenden Wünsche um den zwar nicht reichen, aber begabten und aussichtsvollen Jüngling gesponnen hatten.
Er war kühl an allen vorübergegangen. Um so mehr beschäftigte er sich jetzt mit der seltsamen Frau, die er auf so aussergewöhnliche Weise kennengelernt hatte. Geheimnisse umgaben sie. Die mysteriöse Umgebung erhöhte den Reiz ihrer Erscheinung.
Sie war schön.