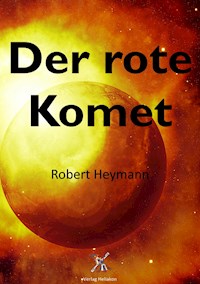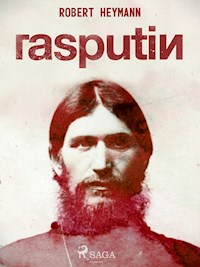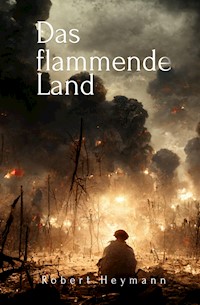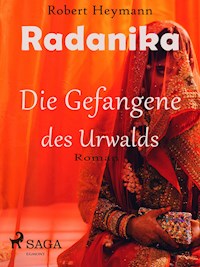Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Deutschland im Ersten Weltkrieg. Die Baronin von Salm stattet der Frau Geheimrat Scholz einen Besuch ab. Ein bitteres Leid plagt die Baronin: Seit Kriegsausbruch hat sie nichts mehr von ihrem Sohn gehört, den sie irgendwo in Sibirien verschollen glaubt. Doch tatsächlich sitzt Maximilian von Salm auf einem polnischen Gut gefangen und ist dort nur noch am Leben, weil der Pole Boris von Kareszynski sich für ihn eingesetzt hat. Zwischen beiden entwickelt sich eine ambivalente Freundschaft, die jedoch ein brutales Ende nimmt, als Boris bei Eintreffen der Deutschen ermordet wird. Schweren Herzens folgt Maximilian seiner soldatischen Pflicht, die ihn weiter nach Osten ruft ... Heymanns packender Kriegsroman lässt ein umfassendes Panorama des Ersten Weltkriegs entstehen, dessen Stationen über Deutschland und Polen bis nach Russland, Konstantinopel und Bagdad führen. – "Der Zug nach dem Morgenlande" bildet nach "Gesegnete Waffen" die zweite Fortsetzung des Romans "Das flammende Land". Als vierter und fünfter Band folgen "Das Lied der Sphinxe" und "Der Fluch der Welt".-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 385
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Robert Heymann
Der Zug nach dem Morgenlande
1. bis 7. Tausend
Saga
Der Zug nach dem Morgenlande
German
© 1916 Robert Heymann
Alle Rechte der Ebookausgabe: © 2016 SAGA Egmont, an imprint of Lindhardt og Ringhof A/S Copenhagen
All rights reserved
ISBN: 9788711503553
1. Ebook-Auflage, 2016
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für andere als persönliche Nutzung ist nur nach Absprache mit Lindhardt und Ringhof und Autors nicht gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com – a part of Egmont, www.egmont.com
Frau Geheimrat Scholz hielt die schmale Visitenkarte unschlüssig in der schlanken, von blassblauen Adern durchzogenen Hand.
Ihr mildes Antlitz mit den feinen Falten war vom Schimmer der Frühlingssonne überflutet, die den Garten vor dem Hause durchspann.
In ihren gütigen Augen mit dem ergreifenden Ausdruck heiss erkämpften Ergebens in das dunkle Schicksal dieser Zeit glitt ein leises Lächeln aus tiefem Grunde an die Oberfläche.
„Freifrau Ite von Salm.“
Ja, ja, nickte die alte Dame vor sich hin.
Die klugen Augen blickten das wartende Dienstmädchen einige Sekunden nachdenklich an.
„Sagen Sie der Frau Baronin, ich würde mich sehr freuen, sie bei mir zu sehen. Und meinen Söhnen wird es eine besondere Ehre sein ...“
Das Mädchen ging. Die Frau Geheimrat setzte sich in den alten Lehnsessel, in dem schon ihr seliger Gatte so manche Stunde seines arbeitsreichen Lebens versonnen hatte, und wartete auf die Teestunde. Ihr Blick glitt durch die offene Türe in das Nebenzimmer, wo alles schon bereit gesetzt war. Den Tisch bedeckte ein blütenweisses Tuch. Zwei schlanke Vasen trugen Rosen und Veilchen. Und eine lange Reihe von Tassen rahmte sich um das Teegebäck.
So schön ist es nicht wie in vergangenen Zeiten, dachte die Frau Geheimrat. Was hatte sie manchmal für kleine Leckerbissen von ihrem Hof- und Leibbäcker an der Ecke erhalten! Aber die Zeit forderte Sparsamkeit. Und wenn sie bedachte, dass die Welt an allen Ecken und Enden in Flammen stand, dann empfand Frau Scholz den tiefen Frieden ihrer Vorstadtvilla als ein Geschenk ihres gütigen Schöpfers, für das sie ihm gar nicht genug danken konnte.
Unwillkürlich hob sich ihr Auge zu dem Bilde des ernsten Mannes mit dem dunklen Vollbart. Zu einer Zeit, wo man noch nichts von „Star“ preisen wusste hatte ein jetzt längst berühmter Maler den Geheimrat in Öl gemalt. Da war es der Frau Geheimrätin stille Zuflucht, ihr geheimes Glück, hier unter dem Bilde zu sitzen und im Geiste Zwiesprache zu halten mit dem, dessen reiches Leben sie so viele Jahre in Freud und Leid geteilt hatte. Dann sagte sie wohl manchmal zu dem stummen Manne: Siehst du, wie recht ich getan hatte, wenn ich den ungebärdigen Hans nicht immer so rauh anfasste, wie du es manchmal in deutscher Strenge wünschtest. Und wie stolz darfst du nun auf deine Jungens sein! Ach, hättest du ihre Frauen noch sehen dürfen! Hätte ich nur dies noch als letzte Gnade von dem Allmächtigen erbitten dürfen —
Nur dies: Dass du den Franz noch einmal hättest in die Arme schliessen dürfen, der damals gegen deinen Willen vom Gymnasium zur Realschule überging, um Ingenieur zu werden. Instinktiv fühlte der Junge die neue Zeit voraus, die Zeit des höchsten Triumphes der Technik. Du wolltest, er sollte gleich dir Beamter werden. Sollte die Tradition unseres Hauses fortpflanzen. Was für Kämpfe musste ich damals durchhalten, lieber Alter, als ich dem Jungen den Rücken deckte! Unsere Vorfahren sind ja alle im Lande geblieben und in Amt und Würden gestorben. Unser Franz aber wollte ins Weite! Seine Augen leuchteten, wenn von fernen Ländern die Rede war, und wie oft redete er sich in Hitze, der Junge, wenn er seine fabelhaften Zukunftspläne entwickelte, die in jugendlicher Grenzlosigkeit irgendwo in den Kordillieren in einem phantastischen Brückenbauprojekt gipfelten. Dann schütteltest du wohl den Kopf, Alter, und sagtest: „In dem Jungen steckt Zigeunerblut. Weiss Gott, wo er das her hat. Das ist kein rechter Deutscher!“
Hättest du geahnt, dass dieses Zigeunerblut so echt deutsches Blut war. Dass dieses Deutschland seine Fahnen in die fernsten Erdteile entsenden würde. Die Geschichte hat ja oft genug bewiesen, lieber Mann, dass der Zug ins Weite ein deutscher ist. Nun steht der Junge seit vielen Monaten als Reserveoffizier im Felde, ist Hauptmann und eilt von Westen nach Osten und von Ost nach West in wilden, abenteuerlichen Fahrten, immer zur Seite der Pflicht. Hat sich seine Frau Sonja aus dem schlachtenumtosten Polen geholt, die treueste Gattin und liebreizendste Mutter. Ach, hättest du den Freundeskreis noch gesehen, der jetzt meine alten Tage verschönt. Die Männer im feldgrauen Kleid, die von den Karpathen gegen die Russen vorgebrochen sind wie eine heilige Schar der Zukunft. Hättest du Else, die Tapfere, noch umarmen dürfen! Ach, du Treuer, wie hätten deine Augen geleuchtet über diesem deutschen Blut! Wie hat Else sich eingesetzt im Zeichen des Roten Kreuzes für alle. Wie hat sie gelitten um den Einen, der schliesslich ihr Gatte wurde und Vater ihres Kindes ist, das sie unter dem Herzen trägt. Dein Hans! — — —
Hier umflorten sich die grauen Augen der alten Geheimrätin. Verstohlen rückte die Hand an dem Spitzenhäubchen.
Lieber Alter! Wie hast du manchmal auf den wilden Jungen gescholten! Wie bitter konntest du damals werden, als er beinahe das concilium abeundi bekam, weil er einer Froschverbindung seine junge, überschäumende Sehnsucht nach dem grossen, starken Leben geweiht hatte! Wie musste ich manchmal mit meiner stillen Kraft vermittelnd eingreifen, dass kein Riss zwischen der gärenden Jugend und deiner konservativen Lebensanschauung eintrat. Und auch der wilde Hans machte trotz allem seine Examina und wurde ein guter Sohn. Und wurde ein stiller Mann. Und blieb ein Deutscher! Und zog mit den Ersten unter dem Rauschen deutscher Siegesfahnen in welsche Lande ein. Focht um dein und unser Vaterland, lieber Alter, mit deutschem Heldensinn, bis — ach, lieber Gott, nimmer will ich an die Stunde denken, da ihn sein junges, stolzes, lebenprangendes Weib über die Schwelle führte.
Vom Schlachtfeld weg hierher.
Blind!
Lieber, lieber Alter, konnten deine Söhne mehr tun für das Land, das unser Vaterland ist? Sie sind doch deiner Frau Söhne geworden und sind mir nachgeraten, wenn du auch manchmal meintest, sie schlügen aus der Art.
Die neue Zeit schuf neue Menschen. Grössere Helden aber hatte keine Epoche der Vergangenheit.
Leise wischte sich die alte Rätin mit dem Taschentuch über die Augen. Ja, ja, Alter, du gibst mir Recht. Viel Leid hat der Krieg in dieses unser stilles Haus getragen. Aber es ist Leid in Ehren.
Die Gedanken der Rätin wandten sich wieder dem Einen zu: Dem Blinden.
Da unterbrach ein rasches Trippeln im Korridor ihr Sinnen. Ein dunkler Lockenkopf erschien zwischen der Türspalte:
„dzién dobzy! Guten Morgen. Grossmutti — träumst du wieder?“
Die Züge der Rätin wurden glatt und hell. Die Sonne schien in ihre Augen, dass sie sie geblendet einige Sekunden schliessen musste.
Franz und Sonjas Kind!
Ihr ureigenstes Blut — und doch polnische Rasse! Das kleine Ding, das da hereinwirbelte und mit kätzchenartiger Geschmeidigkeit sein Köpfchen liebkosend im Schosse der Grossmutter barg, war ganz und gar ein Kind der Mutter. Die grossen, mandelförmigen Augen waren schwarz und tief, die Lippen stolz und verlangend zugleich aufgeworfen, die Brauen hochmütig gewölbt.
Die Hand der Rätin strich über den schwarzen Scheitel.
„Du musst noch im Garten spielen, Kleines.“
„Kommt Mama nicht bald?“
„Sie kann nicht mehr lange ausbleiben.“
„Und Papa?“
„Papa? Bete für ihn, mein Kleines. Dein Papa marschiert zwischen den deutschen Sturmkolonnen gegen Warschau. Bete für ihn, so oft du allein bist und dem lieben Gott dich nahe fühlst.“
Die grossen Augen des Kindes hoben sich zu der alten Frau empor. Es lag die frühe Reife des fremden Volkes in dem suchenden Blick.
„Grossmutter, ich bete für Papa, so viel ich kann. Und ich weiss auch, dass Papa wiederkommt. Bald, Grossmutter.“
„Dann weisst du mehr als ich, mein Kind. Wer sagt dir das?“
„Gott.“
„Kind, Kind, das darf man nicht sagen. Gott spricht nicht durch die Seele eines kleinen Mädchens.“
Da war es, als streife ein Hauch des ewig Rätselhaften und ewig Unendlichen durch das stille Zimmer, als das kleine polnische Mädchen seine Augen gross aufschlug, Augen, in denen die Geheimnisse der Unschuld wie Sterne in einem See zitterten:
„Warum nicht, Grossmutter? Ich habe immer den lieben Gott bei mir. Warum soll er mir nicht sagen, wann Papa kommt?“
Die Rätin schlug die Augen nieder und schwieg. Das Kind kuschelte sich zu ihren Füssen hin. Da meldete das Mädchen die Frau Baronin von Salm, und scheu flüchtete die Kleine.
Die Rätin griff nach ihrem Stock. Wenn sie aufstand, brauchte sie eine Stütze.
Im Türrahmen blieb eine hohe Frauengestalt zögernd stehen. Nur einen Moment. Aber die Rätin fasste doch mit ihren Sinnen das Bild in sich auf: Die Vierzigjährige ging aufrecht, schlank und stolz. Ihr Scheitel war blond, die Augen hell und blau. Nur der Mund — ein junger Mund noch, trug schmerzliche Züge. Hier versteckte sich das herbe Leid, das diese trutzige Frau keinem zeigen wollte.
Denn sie fürchtete sich vor dem Mitleid.
„Sie werden sehr erstaunt sein, Frau Geheimrat, dass ich ...“
Die Rätin liess sie nicht aussprechen.
„Kommen Sie, Frau Baronin, und setzen Sie sich in meinen Lehnstuhl. So. Und lassen Sie sich wieder einmal in die Augen sehen. So wie damals ...“
Nun sassen sich die beiden Frauen gegenüber. Und dachten beide an dasselbe.
Dass sie seit zehn Jahren Nachbarn waren. Dass Freiherr Bodo von Salm auf Markenstein ein Menschenalter hindurch durch denselben Flur gegangen war wie der Geheimrat. Dass sie sich täglich steif gegrüsst hatten: Der Oberstleutnant, der schliesslich General geworden war, und der Rat. Der Erstere kurz verbindlich, der letztere beinahe devot.
Und dass die junge Frau Baronin von Salm sich von einem schönen Tage an geweigert hatte, die Frau Rat Scholz noch zu kennen, weil die alte Dame sie nicht zuerst gegrüsst hatte. Sie, die Jüngere. Aber: Freifrau von Salm auf Markenstein, Exzellenz. Und wie sich das gespannte Verhältnis fortgepflanzt hatte, bis einmal der junge Salm, der dieselbe Schule besuchte wie Franz, etwas von Bürgerpack geäussert hatte.
Die Rätin dachte in dem Augenblick nicht ohne Bitternis an jenen Sturm im Wasserglase. Franz hatte dem jungen Baron die Mappe an den Kopf geworfen. Der hatte wieder geschlagen. Franz hatte ihn schliesslich untergekriegt. Mit einem Loch im Kopf war der Junge von drüben heimgekommen. Es gab einen sehr offiziellen Besuch des Herrn Generals. Und Franz bekam von seinem Vater über den Sonntag Hausarrest. Nie hatte die Mutter den Jungen bis dahin über den Vater murren hören. Damals lehnte er sich auf ...
Sie vermittelte.
Aber die Familie der Salm und die Scholzens kannten sich nicht mehr. Der Tod ging erst nach vis-à-vis. Man holte den General zum letzten Appell.
Die Augen seiner Witwe blieben tränenleer und blau. Ihr Junge ging ins Ausland.
Dann holte man den Geheimrat ins letzte Amt.
Und weiter gingen die Frauen aneinander vor über, die von Markenstein und die vom Bürgerpack.
Der Krieg kam.
Zwischen den beiden Frauen fiel kein Wort davon. Nur durch das Mädchen erfuhr die Rätin, dass der junge Salm nicht im Heer stünde. Kein Mensch wisse, was aus dem geworden sei.
Und nur in den Zeitungen verfolgte die von Salm die Schicksale der beiden jungen Männer von vis-à-vis.
„Sie denken an damals,“ ergriff die Generalin jetzt das Wort. „Ich bin gekommen, Frau Geheimrat, um — abzubitten.“
Schnell ergriff die alte Frau die Hand der noch so jungen schönen Gefährtin.
„Nicht das, Exzellenz ...“
„Nein, sagen Sie Frau von Salm zu mir, bitte.“
„Nun denn, Frau Baronin, das sind tote Zeiten. Davon wollen wir nicht sprechen. Plaudern wir von den neuen Zeiten, die so inhaltsreich geworden sind, dass man eigentlich auf die Vergangenheit gar nicht mehr zurückkommen kann.“
Die blauen Augen der Baronin dankten mit einem Aufleuchten.
„Ich bin über die Schicksale Ihrer Söhne immer auf dem Laufenden geblieben, Frau Rat. Sie dürfen Gott danken. Sie haben Heldensöhne.“
„Sie haben treu und tapfer ihre Pflicht getan, Frau Baronin. Ja, das darf ich frei gestehen. Und nun denken Sie nicht, ich sei neugierig. Ich habe Ihren Sohn von früher Jugend an gekannt. Wo ist er?“
Die Augen der Generalin wurden seltsam gross. Das Blau in ihnen versteinerte sich förmlich. Hilflos gingen die Pupillen hin und her; die Lippen öffneten sich mit einem leisen Seufzer ...
Erschrocken und voll innigen Mitleids sah die Rätin den verhaltenen Jammer.
Ehe sie etwas sagen konnte, brach er mit elementarer Wucht aus der gepressten Brust der einsamen Frau. Sie neigte sich plötzlich vor, ihre Lippen bebten, ein heftiges Schluchzen erschütterte den ganzen Körper.
Vergeblich versuchte sie, den so lange unterdrückten Schmerz auch jetzt zurückzuhalten. Unaufhaltsam schüttelte er die unglückliche Frau, und es dauerte lange Zeit, bis sie endlich die Worte hervorbrachte:
„Seit Kriegsausbruch — kein Wort mehr — vermisst — verschollen — verloren — Sibirien — aber wohl schon lange tot —“
Und nun sie ihr Herz erleichtert hatte, nun die Last von ihrer Brust gewichen war, strömten die Tränen aus ihren Augen, die ersten Tränen, die die Augen eines Zeugen schauen durften, und der ungeheuerliche Schmerz entlud sich in dem erschütternden Bekenntnis:
„Seien Sie mir nicht böse — verachten Sie mich nicht — der Krieg — ich musste mich einmal an einer mitfühlenden Brust ausweinen — liebe, gute Frau Rätin — nur einmal — lassen Sie mich weinen.“
Die gütige alte Frau legte ihre Hand um die Schultern der Generalin.
„Weinen Sie! Weinen Sie sich aus, liebe Baronin. Es wird besser werden. Und dann — dann will ich Ihnen zum Troste sagen — mag der Trost auch schwach sein —: Es sind hunderte wieder auferstanden, die das Gerücht schon begraben hatte. Behalten Sie nur recht fest den starken Glauben, dass Ihr Sohn noch lebt — dann werden Sie vielleicht doch —“
Die Rätin brach im halben Satze ab.
Im wilden Schmerze schüttelte die Andere das Haupt.
„Er kommt nie wieder. Er kommt nie wieder. Ich will es ja glauben und ich hoffe Tag und Nacht und jede Stunde. Aber seit zehn Monaten habe ich kein Lebenszeichen mehr von ihm erhalten ... seit zehn Monaten ... und jeden Tag habe ich darauf gewartet, jeden Tag habe ich gehofft — und jede Nacht habe ich um meinen blonden Jungen gebetet ...“
„Woher bekamen Sie die letzte Nachricht?“
„Aus einem Gute bei Warschau. Dort war er zuletzt als Maschinenbauer. Doch auch die Verbindung mit dem alten Herrn von Karczynski ist unterbrochen. Und er hätte doch geschrieben, wenn er gekonnt hätte. Ach, mein Junge hätte geschrieben!“
Was sollte die Rätin zum Troste darauf antworten? Es bestand ja wirklich, wenn sich die Dinge so verhielten, so gut wie keine Hoffnung mehr, dass die Baronin ihren Jungen wiedersehen würde. Der lag wohl längst in fremder Erde, er mit Hunderttausenden, die sich zum Opfer hatten darbringen müssen in diesem blutigsten aller Völkerkriege ...
Es klingelte. Sonja kehrte zurück. Jubelnd hing das Kind an ihrem Arm. Sie hatte sich von all den Aufregungen erholt, die ihr im Verlaufe dieses Krieges beschieden waren. Wahrlich, viel lag hinter ihr. Vor dem Kriege von dem Gouverneur von Kielce verfolgt, teils mit unwürdigen Liebesanträgen, teils mit der Verhaftung wegen Teilnahme an grosspolnischer Verschwörung, hatte sie zusehen müssen, wie man ihr den Gatten gepeitscht, bis die einrückenden preussischen Bataillone sie und den Geliebten aus höchster Not erretteten.
Die Sturmflut der Kämpfe hatten den Gatten als deutschen Reserveoffizier hierhin und dorthin geschleudert. Die Russen kamen wieder nach Kielce. Sie floh mit einer Proviantkolonne, verbarg sich in Lodz, wurde von den einrückenden Russen aufgestöbert und entkam mit knapper Not dem Pogrom.
Nun lebte sie bei der gütigen Schwiegermutter, im Herzen des unbesiegbaren Reiches, sicher und gehegt, und doch in täglicher Seelennot um den fernen Mann, von dem nur spärliche Feldpostbriefe Kunde gaben.
Seit zwei Wochen fehlte jede Nachricht von ihm. Ihr erstes Wort war, nachdem sie die fremde Dame kurz begrüsst hatte:
„Mutter, hast du einen Brief von ihm?“
„Nein, mein Kind. Franz hat noch nicht geschrieben. Aber der heutige Heeresbericht vom grossen Hauptquartier verkündet neues, unaufhaltsames Vorrücken in Galizien ...“
Sonja hörte die letzten Worte kaum. Wer durfte sie schelten, dass Freude und Genugtuung über den Siegeszug der Deutschen und Österreicher, die von den Karpathen nach endlosen Winterkämpfen vorstürmten und die Russen vor sich hertrieben, verstummten in der ewig nagenden Sorge um den Einen, der doch ihre eigenste Heimat war?
Die Baronin lenkte die junge Polin mit ein paar Trostesworten ab. Bald waren die Frauen in traulichem Gespräch. Frau Scholz ging ins Nebenzimmer, um nochmals nach dem Rechten zu sehen. Durch die halb offene Türe lauschte sie auf das Gespräch. Und ihre Gedanken wanderten zurück und wanderten voraus. Und wieder stand sie im Geiste vor dem Bildnis in dem Wohnzimmer.
„Hättest du das gedacht, Alter? Hättest du dir jemals träumen lassen, dass die stolze Freifrau den Weg herüber zum Bürgerpack finden würde? Das hat der männermordende Krieg getan ...“
Bald schrillte die Klingel immer häufiger. Die Gäste, die das Leben da draussen, das weitab von der Rätin Heim vorbeiflutete, in geklärtem Abglanz zu ihr trugen, mehrten sich. Man plauderte so gerne bei einer Tasse Tee.
Die Türe ging auf, und eine hohe, schlanke Frau, der selbst die schlichte Tracht in ihrer geschmackvollen Gewähltheit, die sich fernab von den albernen Modeirrungen der Tauentzienstrasse im Berliner W.-viertel hielt, trat langsam ein.
Der Baronin war es, als sähe sie auf eine Bühne, und irgend eine künstlerische Hand stellte ein ergreifendes Bild. Ja, sie konnte die Tränen nicht zurückhalten, als diese schöne Frau, die mit kommender Mutterwürde begnadet war, sorgsam einen aufrechten Mann ins Zimmer schob. Er trug feldgraue Uniform. War Hauptmann. Seine Schultern waren gerade und breit, der Kopf stand stolz auf einem starken Nacken. Seine Haare, über dem rechten Auge gescheitelt, waren weiss. Der frühe Schnee leuchtete seltsam zu der unverbrauchten Frische der Züge.
Doch wie er den ersten Schritt ins Zimmer tat, da beherrschte eine kindliche Unbeholfenheit seine Erscheinung. Er streckte die rechte Hand aus und tastete zum Türrahmen. Die linke suchte ... und als sie jetzt den Arm der tapferen Frau erfasst hatte, glitt ein seliges Lächeln der Sicherheit über die Züge des Hauptmanns.
Er war blind.
Wo ehedem die sonnigen blauen Augen in die Welt gesehen, da lagen tiefe Schatten. Die Frau, die den Hauptmann seit einem Jahrzehnt schon kannte, die ihn als Knaben mit ihrem Jungen hatte spielen sehen, erblickte ihn jetzt so.
Sie hätte aufschluchzen mögen. Denn in dem Augenblick war der blinde Hauptmann und der verschollene blonde Junge eines. Keine Schranke trennte sie. Die Vorstellung schweisste zwei Begriffe zu einem Lebendigen zusammen, das sich in dem blinden Hauptmann verkörperte ...
Und ohne ein Wort, ohne Übergang eilte die Baronin auf Hauptmann Hans Scholz zu und küsste seine rechte Hand.
Er fühlte weiche Frauenlippen und zog schnell die Hand zurück. Jähe Röte flog über die wettergebräunten Züge, und fragend wandten sich die dunklen Augenhöhlen zu der Frau an seiner Seite.
Die Baronin umarmte die junge Gattin. Staunend lauschte der Hauptmann auf die Stimme der Generalin, die längst entschwundene Bilder in ihm weckte ...
Else klärte ihn auf. Er konnte nicht genug fragen, setzte sich neben die Baronin und erörterte alle Möglichkeiten, die doch noch für ein Auftauchen des Verschollenen sprachen.
„Wo haben Sie zuletzt gefochten?“ fragte die Baronin schliesslich schüchtern.
„Auf der Höhe von Notre Dame de Lorette ... eine Granate nahm fast meinen ganzen Zug, mit dem ich einen Patrouillengang unternommen. Mich kostete sie das Augenlicht ...“
„Deutschlands Zukunft wird Sie entschädigen,“ stammelte die Generalin verwirrt.
„Mein Unglück ist nicht so gross, wie Sie denken,“ lächelte der Hauptmann. „Sie meinen, ich sehe nicht? Ich sehe alles. Ich sehe durch die Augen meiner lieben Frau. Und seitdem weiss ich erst, dass meine Augen eigentlich immer recht kurzsichtig waren. So viel Schönheit sehe ich durch diese Frauenaugen ...“
„Ach, Hans, sei still,“ warf die junge Frau errötend dazwischen. Da stürmte Sonjas Kind herein, den Arm voll Blumen.
„Mutti, Grossmutti, die hat mir eben ein Feldgrauer geschenkt. Er kommt gleich —“ und wie sie jetzt den Hauptmann erblickte, der ihr jeden Abend vor dem Schlafengehen die schönsten Märchen erzählte, und den sie ganz besonders in ihr Herz geschlossen hat, da eilt sie auf diesen zu:
„Onkel, lieber Onkel Hans — schau nur — die herrlichen Blumen!“
Sie streut sie ihm in den Schoss. Auf seinen feldgrauen Beinen liegen sie nun in junger Farbenpracht: Rote und blaue und grüne Blätter.
Ein Erschrecken geht durch alle Herzen. Sonja zieht die Kleine beiseite.
„Kind! Weisst du denn nicht, dass Onkel Hans die Blumen nicht sehen kann? Du hast ihm weh getan!“
In des blinden Hauptmanns Zügen ist das Lächeln erloschen. Seine Hand gleitet über die samtenen Blütenkelche. Und wie suchend erhebt er die toten Augen zu seiner Frau. Da ist schon das Kind an seiner Seite:
„Onkel, hab ich dir wirklich weh getan? Nein — du bist ja so klug! Du hast schon so viele böse Hexen bezaubert und hast mit Riesen gekämpft und schöne Feen aus dem Morgenland haben dir Schätze in deinen Schoss gelegt. Du kannst gar nicht böse sein. Sieh her, Onkel Hans! Das ist eine rote Rose. Schau, wie sie sich halb öffnet, wie der Tau von ihren Blättern perlt. Küsse sie, Onkel Hans!“
Der feldgraue Hauptmann neigt den Kopf und küsst die rote Lebensblume. Seligkeit liegt in seinen Zügen. Und der liebliche Kindermund presst seine Lippen auf die Stelle, die der blinde Onkel geküsst hat.
Der sagt leise zu der Generalin:
„Glauben Sie, dass man mit eigenen Augen so schauen kann?“
Ein Gast kommt. Die Stimme lässt den Hauptmann aufstehen:
„Mutter, ich habe einen guten Freund geladen. Viktor Oberländer von den Fliegern. Seine Frau hat ihn hierherbegleitet.“
„Ich habe in deinem Tagebuch von ihm gelesen,“ erwidert die Rätin. Sofort erinnerte sie sich: Das ist jener Flieger, der die Gattin eines Artilleriehauptmanns geliebt hatte, und den der Hauptmann Hans Scholz vom Verderben rettete, indem er rechtzeitig die kleine Pflegerin Anny, die sich leise in das Herz des Fliegers geschlichen hatte, nach dem Argonnerwalde rief. Und eine Ehe wurde dadurch vor Verfall und Schande bewahrt.
Frisch, jung, braun trat der Flieger ein.
„Der hat mir die Blumen geschenkt!“ jauchzte die Kleine. Der blinde Hauptmann und der schlanke, starke Oberleutnant fassen sich bei den Händen.
„Sie sind vollkommen wiederhergestellt?“ frägt Scholz.
„Vollkommen. Meine kleine Frau hat’s geschafft!“
Die kleine Frau hält sich schüchtern rückwärts. Aber Else, unter deren Leitung sie so lange Zeit in einem Feldlazarett im Westen die Verwundeten gepflegt hatte, zieht sie an den Händen zur Tafel.
„Immer noch das gleiche grosse Kind!“ lacht die Hauptmannsfrau. „Nun lassen Sie sich mal ansehen, wie Sie aussehen als Frau Oberleutnant, kleine Anny!“
Sie haben sich ja auch so lange nicht gesehen. Und Anny, die von der Katastrophe von Notre Dame de Lorette natürlich durch Briefe erfahren hat, wirft einen schüchternen, fragenden Blick auf den Hauptmann. Und dann, ganz unvermittelt, schlingt sie die Arme um die Hauptmannsfrau!
„Ach Else ... Frau Else ... sagen Sie du zu mir!“
Die Frauen umarmen sich.
„Ännchen, Kleines ... wir wollen Schwestern sein!“ sagt Else und küsst die liebliche Frau auf die roten Lippen.
Oberleutnant Oberländer frägt:
„Nun sagen Sie mal, Herr Kamerad, erzählen Sie: Was machen Sie jetzt in Berlin mit Ihrer lieben schönen Gattin?“
Der Hauptmann erwidert:
„Das fragen mich so viele. Auch Sie denken nun Was kann der Hauptmann nun noch wett sein ohne Licht? St.! Lassen Sie mich ausreden. Ich habe gegen jedes Mitleid, das ich nicht ausstehen kann und gar nicht verdiene, zwei feine Trümpfe. Erstens lebe ich und geniesse ich alle Schönheiten der Welt durch meine Frau — und zweitens bin ich hier in Berlin vom Kriegsministerium angestellt — als Lehrer!“
Er lacht vergnügt. Und lauscht mit allen Sinnen auf den überraschenden Eindruck dieser Verkündung.
Die Überraschung bleibt nicht aus.
„Als Lehrer?“ frägt der Oberleutnant. „Aber Herr Kamerad —“ er wirft einen fragenden Blick auf Frau Else. Die Hauptmannsgattin nickt.
Der blinde Hauptmann fährt fort:
„Das Kriegsministerium hat eine Einrichtung geschaffen, die uns so recht als „Barbaren“ kennzeichnet. Es hat dafür Sorge getragen, dass unsere Verwundeten während ihres Aufenthaltes in Berlin alle Museen und Galerien unter sachkundiger Leitung kennen lernen. Der Segen des Geistes ruht auf dieser Verfügung. Sie glauben nicht, Herr Kamerad, wie unsere braven Feldgrauen auf solchen Wanderungen mit heiliger Inbrunst lernen, schauen, geniessen. Manch einer kehrt mit einem ganz anderen Blick ins Feld zurück, als er hierherkam, und den Verzweifelnden giesst die Wissenschaft und die Schönheit der Kunst erhabenen Trost ins einsame Herz. Man muss natürlich jeden einzelnen Hörenden nach seiner Art erfassen ...“
„Ich verstehe noch nicht ...“
„Nun, bin ich durch meinen Zivilberuf als Archivkundiger und Geschichtsforscher nicht als Erster zu solcher Leitung geeignet? Sie vergessen, dass ich nicht nur Hauptmann, sondern auch noch Doktor der Philosophie bin. Vor Kriegsausbruch schickte mich ja meine Regierung nach Belgien, um Archive zu studieren, und dabei lernte ich meine tapfere Gattin kennen. Doch um bei unserem Thema zu bleiben: Ich bin angestellt, unsere Verwundeten durch die Galerien und Museen zu führen und ihnen dabei sachkundige, populäre Vorträge zu halten. Da ich jeden Gegenstand aus der Erinnerung kenne, so fällt mir das leicht. Im übrigen führt mich meine Gattin, und es bedarf nur eines kleinen Hinweises von ihr, damit ich sofort im Bilde bin ...“
Er lachte, als keine Antwort kam.
„Das war mein zweiter Trumpf, lieber Herr Kamerad! Nun sagen Sie selber, ob es Zweck hat, an mich Mitleid zu verschwenden.“ Der Oberleutnant drückte dem Hauptmann nur die Hand.
„Mitleid? Ich fühle nur Hochschätzung. Und — ich beneide Sie!“
Da wandte sich der Hauptmann zu seiner Gattin:
„Hörst du, Else? Er beneidet mich. Bist du nun vollkommen glücklich?“
Sie neigte sich zu ihm und ergriff seine Hand. Das Gespräch verstummte. Das Schweigen heiliger Erkenntnis von ungesprochenen Dingen lag über dem Raum. Die Gottesseele gab jedem zu denken.
Die Rätin schenkte den Tee ein. Das Mädchen reichte Gebäck umher. Als es klingelte, stellte es schnell das Körbchen weg und eilte hinaus.
„Eine Depesche,“ sagte das pausbäckige ostpreussische Mädel, das in den Russenstürmen Eltern und Heimat verloren hatte, mit vor Erregung zitternder Stimme.
„An wen?“ fragte die Rätin leise.
„Frau Sonja Scholz.“
Sonja griff nach dem kleinen Stückchen verklebten Papieres.
Ihre blasse Hand zauderte, es zu öffnen. Niemand trieb Sie zur Eile an. Alle Augen hafteten an ihrer Hand.
Denn beides konnte der Inhalt sein:
Der Tod konnte sich dunkelblasig aus dem Papier erheben und seine schwarzen Schleier über die Herzen werfen. Oder lähmender Schreck über ein noch ungewisses Schicksal konnte aus den taumelnden Zeilen kriechen. Oder jauchzende Freude konnte goldene Blumen in die Luft schleudern und die Herzen berauschen.
Mit einer nervösen Geste, auf alles gefasst, riss Sonja den Umschlag auf.
Sie las ... und die Worte perlten halblaut von ihren Lippen:
„Stehen vor Przemysl. Bin gesund. Ich küsse dich und alle Lieben. Franz.“
Mit einem tiefen Lächeln blickte sich Frau Sonja um. Dann griff die Hand ans Herz, und leise glitt sie auf den Stuhl zurück.
„Er lebt!“
Herrgott über den Himmeln, du bist nie heisser angebetet worden als mit diesen zwei Wörtchen:
„Er lebt.“
Zwei Wochen später lief der Feldpostbrief des Hauptmanns Franz Scholz ein.
„Hurra! Prezemysl ist gefallen. Das wisst Ihr schon, nicht wahr? Wir marschieren weiter. Schwere Kämpfe liegen hinter uns. Die zweite österreichisch-ungarische Armee hat die Festung den Russen wieder abgenommen, diesmal, Gott möge es geben, für immer. In einem Siegesmarsch fegten wir durch die Hochebenen vor den Karpathen, von denen wir die Russen in übermächtigem Ringen seit dem ersten Mai heruntergeworfen hatten. Mein hoher Führer Mackensen dringt unaufhaltsam weiter. Wir sichern der Wiener Landwehrdivision den Vormarsch gegen Lemberg. Das k. k. Infanterieregiment Nr. 34 Wilhelm I. hat die Tête. In ein paar Wochen muss Lemberg in unseren Händen sein — und dann geht es weiter. Unaufhaltsam werden wir die neue Offensive durch Galizien tragen, bis der letzte Fleck Boden des verbündeten Landes von den Feinden geräumt ist. Und dann — was dann kommen wird?
Wird Russland zur Erkenntnis gelangen, dass wir unbesiegbar sind? Wird uns Kämpfern endlich die Friedensstunde schlagen, werden wir wieder die Glocken des Doms in Berlin in festlichem Geläute vernehmen? Wer weiss es? Wir sind trotz aller Strapazen guten Mutes. Sicher hast du mir mehrmals geschrieben, liebste Frau, aber die Feldpost erreicht uns nicht. Wir drängen im Sturmschritt vorwärts, da können die Bagagen nicht mehr Schritt halten. Und doch sehne ich mich so sehr noch einem lieben Wort, Sonja. Es ist der einzige Lichtblick in diesem Labyrinth von Kämpfen, Ruhelosigkeit und Schrecken ...
Ihr könnt Euch in Berlin keine Vorstellung mehr machen von dem, was wir jetzt erleben. Der Krieg tritt in sein grausamstes Stadium.
Vor uns her flieben die Russen und sengen und brennen. Tote Dörfer, vergewaltigte Städte säumen unseren Siegesweg. Während ich dies schreibe, marschiere ich auf der Strasse nach Lemberg. Vor uns rattern deutscher Train und österreichische Batterien. Wir bilden augenblicklich die Nachhut. Die Erde ist zerrissen von Granaten. Ungezählte Wunden trägt der zerfetzte Leib, der noch grausam umwunden ist von russischen Stacheldrahtzäunen, die gleichfalls von den stürmenden Bataillonen in die Erde getreten sind und sich eingefressen haben in den unglücklichen Boden. An Schützengräben gehts vorüber. Die Russen haben sich wohnlich eingerichtet, niedere Dächer grüssen uns, die durch Balken gestützt werden. Der Boden bewahrt die düsteren Zeugen tragischer Stunden: Karabiner und Gewehrkolben, Postkarten, Papiere, Uniformfetzen, und auf all diesen Gegenständen die düstere Tinte, mit der die Geschichte dieser Wochen geschrieben wurde: Blut.
Überall Blut! Der Fuss stösst auf kleine Flaschen. Es sind Handbomben. Vor einem Trichter liegt ein toter russischer Offizier. In der starren Faust hält er wie zum Salut den blutbefleckten Degen ... und dann kommen Felder mit blauen; nickenden Kornblumen. Die Sonne scheint darüber, die Lerchen jubilieren, und man denkt, Gott habe das Füllhorn des Friedens über die Erde gestreut ... bis plötzlich eine tote Hand aus der Erde wächst, eine tote, starre Hand, die Fläche nach der Heimat gerichtet, als wollte sie über Länder und Zeiten weggreifen ... die Hand eines schlecht verscharrten Toten. Und dann liegen sie zuhauf ... Russen und Deutsche ... Pioniere graben Gräber, Zimmerleute schnitzen Kreuze ... und das Auge wandert verwundert hinter der Lerche her, die höher und höher steigt, dem blauen Himmel entgegen.
Die Kornblumen nicken.
Durch die Felder wandelt deine liebe Gestalt im weissen Kleide. Dein Schleier weht im Winde. Du bist die Liebe und meine Hoffnung. An dich denke ich Tag und Nacht und Nacht und Tag.
Die Bilder verschwinden. Wir marschieren. Tag und Nacht und Nacht und Tag. Immer hinter den Russen her.
Wir marschieren ...“
Sonja eilte mit dem Briefe zu Hans Scholz. Sie lasen ihn immer wieder gemeinsam: Hans, Else, Sonja. Sie riefen die Mutter und die Baronin. Um die Mittagsstunde kam ein Gast Frau von Salms, den sie ohne Umstände herüberführte zu Ihren neuen Freunden: „Major von Gumbinskj“.
Ein alter Haudegen, der das linke, podagragekrümmte Bein nachschleppte. In den grossen, steingrauen Augen zuckte dann und wann ein verräterisches Feuer.
Herr von Gumbinskj hatte den Brief kaum gelesen, da humpelte er nach der Diele und entnahm seinem Paletot einen umfangreichen Pack Papiere.
„Seien Sie ihm nicht böse, wenn er Sie jetzt ein wenig langweilt,“ sagte Frau von Salm. „Er reitet ein Steckenpferd, von dem ihm wohl nichts mehr wird herunterbringen können — und es ist eine so begreifliche, entschuldbare Marotte.“
Der Major strich seinen pechschwarzen Schnurrbart und breitete ohne Umstände auf dem Tisch eine Landkarte von Galizien aus. Dann holte er aus einer kleinen Messingbüchse Nadeln mit bunten Köpfen und begann, die deutschen, österreichischen und russischen Stellungen auf der Landkarte zu markieren. Mit einer Schnelligkeit und Sicherheit, dass die Frauen nicht wenig erstaunt waren.
„Ich beschäftige mich Tag und Nacht mit dem Krieg,“ erklärte der Major. „Besonders nachts, wenn ich nicht schlafen kann. Mir ist es nicht vergönnt gewesen, mitzumarschieren. Und dabei bin ich preussischer Major. Fühle mich pudelwohl. Nur das Bein ... ja ...“ er warf einen verzweifelten Blick auf die junge Generalin, als erwarte er von ihr die Bestätigung der fatalen Tatsache, die immer wieder als traurige Entschuldigung heraufbeschworen wurde, dass der Major nicht ins Feld konnte ... „das Bein, meine Damen. Ich schäme mich vor meinem toten Vater, der bei Vionville gefallen ist. Aber der Kommandeur der Schlesier, bei denen ich einmal gestanden bin, hat mich ausgelacht, als ich mitwollte. Ich habe keine Ruhe mehr. Marschiere also auf der Karte mit. Schlechter Ersatz das, aber immerhin ...“
Er brach wieder mit einem hilflosen Lächeln ab. Die Generalin kam ihm zu Hilfe.
„Sie haben Ihre Pflicht Zeit Ihres Lebens getan, Herr Major. Würde mein Gatte noch leben, der leberleidend war, er wäre auch zum Zusehen verurteilt. Trösten Sie sich mit dem Schicksal so vieler Anderer, Major. Nicht jeder kann bis zum letzten Atemzuge dem König dienen.“
Er war schon so mit seiner Karte beschäftigt, dass er die Worte der Baronin überhörte. Oder er tat nur so, als vernehme er sie nicht, um nicht zeigen zu müssen, wie wohl sie ihm taten.
Mit Feuereifer vertiefte er sich in die Stellungen der Armeen.
„Sehen Sie — den Anmarsch und weiteren stürmischen Vormarsch der Deutschen können die Russen einfach nicht mehr aufhalten. Dass es auf Warschau zugeht, unterliegt keinem Zweifel mehr, eben so wenig, dass der Feind die polnische Hauptstadt nicht wird halten können. Das sage ich. Wir haben im Laufe des Juni bis jetzt — ich habe mitgezählt, meine Damen! — dem östlichen Feinde etwa fünfundzwanzigtausend Gefangene abgenommen, ein halbes Dutzend Geschütze und wohl ein halbes hundert Maschinengewehre. Der Gegner steht uns östlich der Guila-Lipa in stark verschanzter Stellung gegenüber. Er tut natürlich alles, um den Boden gegen die Truppen unseres Linsingen zu halten. Und ich sage Ihnen voraus, dass keine paar Tage mehr vergehen, dann ist diese Feldstellung über den Haufen gerannt. Und dann? Oh, ich kann Ihnen seine Rückzugsstrassen genau anzeigen. Dann wird er fluchtartig aus der Gegend von Marjambol zurückgehen, und Linsingen wird ihm auf den Fersen bleiben und ihm gegen die Zlota-Lipa treiben. Das wird einen gewaltigen Druck auf die gesamten feindlichen Stellungen ausüben, die sich von Marajow-Miasto bis nördlich Przemyslani hinziehen. Inzwischen fragen alle: Wo bleibt unser Hindenburg? Wir werden eine grosse Uberraschung erleben. Wissen Sie, was Hindenburg vorbereitet? Eine grosse, gewaltige Offensive im Norden, durch die die ganze russische Front aufgerollt werden wird, Östlich von Lemberg kämpfen die Österreicher. Sie werden diesmal die Russen werfen. Alles spricht dafür. Und Mackensen? Mackensen säubert das Land zwischen Bug und Weichsel. Nichts wird ihn aufhalten. Bald werden die Russen an die Weichsel gedrückt sein. Die Stellungen westlich davon sind schon erschüttert. Die gewaltige Offensive unserer Truppen wird nicht einen Tag zum Stehen kommen. Alle Teile arbeiten programmässig zusammen. Es ist ein erhebendes Gefühl, das als Militär zu verfolgen.
Im Westen müssen wir unsere Stellungen halten. Dass die Franzosen eines schönen Tages einen grossen Durchbruchsversuch mit Hilfe der Engländer und ihrer ungezählten Scharen Farbiger unternehmen werden, ist sicher. Dass unsere stählerne Mauer auch der fürchterlichsten Probe standhalten wird, unterliegt für mich keinem Zweifel. Ich bin sicher, in den Argonnen wird es auch bald blutige Tage geben. Die Stellung des Feindes westlich von Four de Paris erfordert eine Regulierung unserer Linie. Sie wird vorbereitet. Die Truppen des preussischen Kronprinzen werden sich ein neues Ruhmesblatt in den eisernen Kranz dieses Kriegsjahres flechten. Bei Souchez steht eine zerschossene, bis zur Unkenntlichkeit verstümmelte Zuckerfabrik. Wenn diese Zuckerfabrik einmal wieder fest in französischen Händen ist und bleibt, dann haben die Feinde einen Sieg zu verzeichnen. Einen Sieg, der sie einen Kilometer weiter gebracht hat. Aber so oft sie auch diese Zuckerfabrik nehmen, ebenso oft jagen die Deutschen ihnen diesen Trümmerhaufen wieder ab. Diese Zuckerfabrik hat für mich etwas Symbolisches. Man müsste einmal ein eigenes Werk darüber schreiben. Auf den Masshöhen stehen wir unerschüttert wie seit Wochen. Und was vollends die Italiener betrifft — sie haben einiges Land, das die Österreicher freiwillig aus strategischen Gründen räumten, besetzt. Aber alle Anstürme gegen das Doberdo-Plateau haben die verbündeten Truppen abgewiesen, und an dem Görzer Brückenkopf rennen sie sich nicht nur diesmal die Köpfe ein. Dort wird nach meinen Berechnungen noch viel Blut fliessen, denn die Italiener möchten Görz um jeden Preis nehmen, um ein greifbares Resultat zu haben. Cadorna will siegen, die Regierung treibt ihn, dem Volk eine Trophäe zu Füssen legen zu können, diesem ruhmgierigen, irregeführten Volk, das allmählich mit Entsetzen sieht, was aus dem Marathonlauf nach Triest geworden ist. — Ja, meine Damen, so stehen wir ...“
Seine Zuhörerinnen waren ihm mit grösster Aufmerksamkeit gefolgt. Es war interessant, sich von ihm in die Geheimnisse dieser Fortschritte einweihen zu lassen. Er beherrschte die gegenseitigen Stellungen mit virtuoser Geschicklichkeit, er kannte jedes Siegesdatum, er wusste auf Monate zurück die einzelnen Stellungen wieder festzulegen.
Aber nun kam er auf seine besondere Liebhaberei: Er verlor sich in phantastischem Vorhersagen. Er wurde immer erregter. — Er nahm Warschau ein. Er rückte mit drei deutschen Armees nach Russland. Er sah Bulgarien an deutscher Seite. Er wusste, auf welchem Wege die Bulgaren in Serbien einfallen würden. Er sah eine neue österreichische Armee gegen das unbesiegte Bergland vorrücken. Er eroberte mit seinen Fähnchen ganz Serbien, er sah eine starke deutsche Armee drohend vor den Grenzen Rumäniens stehen, die Wankelmütigen mit eiserner Faust vor einem Bündnis mit Russland warnend. Er erblickte schon Griechenland in dem allgemeinen Ringen, er sah das alte Hellas verwüstet, er drang mit deutschen Heeren siegreich bis nach Konstantinopel, er sah die deutschen Fahnen vor Ägypten — nein, auf dieser atemlosen Laufbahn vermochten ihm die Zuhörerinnen nicht mehr zu folgen. Sie nahmen seine Darlegungen, in denen viel Logik steckte, für beinahe frevlerisches Spiel mit schier undenkbaren Möglichkeiten, und sie wurden auch nicht wärmer, als der Major nun einzelne Ereignisse des Krieges fachmännisch erläuterte.
Er steckte immer fieberhafter die kleinen Nadeln auf. Nun holte er noch winzige Fähnlein von verschiedenen Farben hervor und markierte vor Przemysl Kavallerie, Artillerie und Infanterie.
„Ich werde Ihnen die Schlacht vor Przemysl vorführen, meine Damen. Ich hätte allerdings die Aufstellung der einzelnen Truppenteile etwas anders bewerkstelligt. Sehen Sie: Wenn zum Beispiel die Deutschen ...“
Hans Scholz hatte Else schon längst ein Zeichen gegeben, ihn hinauszuführen. Er lächelte nachsichtig über die Kriegswütigkeit des Majors und winkte Sonja. Die Baronin und die Rätin blieb allein zurück. Frau Scholz hatte wirkliches Interesse für die geschickten und sachkundigen Ausführungen des Majors. Das hatte der sofort gemerkt, und nun liess er in seinen Vorträgen auch nicht mehr locker. Die junge Generalin opferte sich. Gumbinskj war ein alter Freund des Generals gewesen. Obgleich beide im militärischen Range ziemlich weit von einander entfernt waren, hatten sie sich gut verstanden, denn die Freundschaft datierte noch aus der Heimat der beiden. Sie waren Schlesier. Und stundenlang konnte der Major von den Schönheiten Schlesiens erzählen. Dann rauchte der General seine Pfeife, der Junge kauerte zu seinen Füssen, und die Generalin lauschte gerne auf die temperamentvollen Geschichten des Mannes, der ungefähr in ihrem Alter stand. War er zu Besuch, so verflogen die Stunden. Es kam wohl vor, dass der Freund die Augen etwas länger auf die Gastgeberin gerichtet hielt, als tunlich war. Dass er tief in diese dunklen Sterne blickte. Und die junge Frau, die den um vieles älteren Gatten nach dem Wunsche der Eltern geheiratet hatte, empfand wohl einmal eine geheime Sehnsucht ... vielleicht nicht einmal nach dem jugendlichen Offizier, sondern nach dem Leben da draussen, das er verkörperte ...
Das war nun lange her. Die Generalin suchte ihren verschollenen Sohn, und Major Gumbinskj steckte Kriegskarten ab.
Sie lächelte leise in sich hinein, als sie sich so über die Karte neigte und die Worte des Offiziers an ihrem Ohr vorüberglitten ...
Verstohlen winkte sie dem Hauptmann und den beiden Frauen durch das Fenster nach. Sie durchschritten den Garten und gingen auf die Strasse. Dort nahmen sie ein Automobil, um den Oberleutnant Oberländer zu besuchen.
Der sollte in ein paar Tagen an die Front nach Galizien. Und Else hatte es Anny zugesagt, dass sie noch einmal mit ihrem Gatten vorüberkommen würde.
Oberländer wohnte in der Potsdamerstrasse. Durch das Menschengewühl leuchteten in brennenden Farben die Blumen, die an allen Ecken feilgeboten wurden. Grosse rote Plakate an den Litfasssäulen riefen die Landsturmmänner, die nie eine Waffe getragen hatten, vom 36. bis zum 46. Jahre zur Musterung.
„Das gibt wieder Millionen Soldaten,“ sagte Frau Sonja. „Wie viele Frauen müssen nun wieder in Bälde den Sohn oder den Gatten hergeben!“
„Es war ursprünglich geplant, den Berliner ungedienten Landsturm über 36 Jahre nicht mehr einzuberufen,“ warf der Hauptmann ein, der zugehört hatte. „Allein die drohende Haltung Italiens zwingt Deutschland, alle Reserven mobil zu machen.“
Sie waren am Ziel. Anny, die das Automobil hatte vorfahren hören, eilte ihnen bis an die Treppe entgegen.
Das junge Ehepaar bewohnte drei Räume. Das Wohnzimmer war warm und farbenreich eingerichtet. In langhalsigen Vasen nickten Blumen. Die Sonne spielte über das Eisbärenfell.
Ein junger Mann von etwa sechsundzwanzig Jahren stand in der Mitte des Zimmers. Die Frauen kannten ihn nicht. Else betrachtete ihn etwas befremdet. Er hatte einen bronzefarbenen Teint und dunkle, unruhige Augen. Das reiche, blauschwarze Haar fiel in einer schweren Welle über das rechte Auge. Um die leicht gekräuselten Lippen spielte ein Lächeln.
„Herr Doktor Bogdanoff,“ stellte Anny vor. Der Hauptmann, der den Tritt des Mannes vernommen und den Freund an seiner Stelle vermutet hatte, liess die schon zum Gruss erhobene Hand sinken und verneigte sich steif.
Frau Sonja warf einen Blick nach dem offenen Flügel. Die Noten entstammten einem bulgarischen Lied.
Die Polin hatte ein Vorurteil gegen alle Leute aus dem Balkan. Else sah Frau Anny, nur Sekunden, durchdringend an. Anny hielt den Blick ruhig aus. Doch zitierte eine leise Verlegenheit durch ihre Stimme, als sie sagte:
„Herr Doktor Bogdanoff unterrichtet mich in der bulgarischen Sprache ... und da spielte er mir eben ein bulgarisches Volkslied vor ... aber setzt Euch doch. Ich will das Lied wiederholen. Herr Doktor, wollen Sie mich begleiten?“
Sie sprach hastig und nervös, wie es sonst nicht ihre Art war. Weshalb blickte sie mehrmals verstohlen nach dem Nebenzimmer?
„Wo ist dein Mann?“ fragte Else, während sie ablegte und dem Gatten in einen bequemen Sessel half. Hans Scholz bat, ihm das Lied vorzuspielen. Er verwickelte den Bulgaren sogleich in ein Gespräch über den Balkan.
„Mein Mann ist nach dem Kriegsministerium gefahren. Ich glaube, er wird bald befördert werden. Er sprach so geheimnisvoll ... vielleicht wird er die Führung eines Geschwaders bekommen.“
Sie setzte sich an das Klavier.
Doktor Bogdanoff wehrte sich gegen die Befürchtung des Hauptmanns, dass es der Entente gelingen würde, einen neuen Balkanblock zu gründen.
„In Griechenland liegt natürlich viel Zündstoff, und die Politik des ententefreundlichen Venizelos ist eine Gefahr für den ganzen Balkan. Aber Rumänien wird sich keinesfalls durch die Schreier vom Schlage des Take Jonescu und Filipescu beirren lassen. Was vollends Bulgarien betrifft — denken Sie im Ernste, Bulgarien wird die verräterische Politik Serbiens vergessen? Bulgarien wartet ab — Bulgarien ist schlagfertig. Möglich, dass nicht vorauszusehende Niederlagen der Zentralmächte mein Vaterland zwingen würden, sich auf Seiten der Alliierten zu stellen. Aber ich glaube das nicht! Deutschland wird siegen ... und der Krieg, der im Balkan begonnen wurde, wird im Balkan in seine entscheidende Phase treten. Dann wird Bulgariens Schwert aus der Scheide fliegen ...“
„Kommen Sie, Herr Doktor,“ sagte Anny ungeduldig.
Er trat ans Klavier. Else musste sich gestehen, dass Boris Bogdanoff ein hervorragender Pianist war. Übte er die Kunst nur zu seinem Vergnügen, so war sie doppelt schätzenswert. Ehe sie sichs versah, war sie ebenso in seinem Banne wie Anny, die verzaubert zuhörte, um dann mit ihrer glockenhellen Stimme einzusetzen:
Ein Jüngling reitet in Weiten,
Er jagt nach flüchtigem Glück.
Die Vila sieht ihn reiten
Und locket ihn zurück.
„Du bist zum Glück erkoren,
Die Sonne ist dir hold.
Du bist im Mond geboren,
Getauft mit Sternengold.“
Auf weissem Wolkenpferde
Die Vila sanft entschwebt,
Wo zwischen Himmel und Erde
Ihr Märchenland sich hebt.
Drei Tore seh’n in die Fernen:
Das eine ist Sonnenschein.
Das andere Gold von den Sternen,
Das dritte aus Edelgestein.
Sie ruft ihren jungen Helden
— Der trägt das Kampfeskleid —
Zu ihren Sternenzelten
In die Unsterblichkeit ...a)
Der Hauptmann klatschte begeistert Beifall. Wieder warf Anny einen verstohlenen Blick nach dem Nebenzimmer.
Doktor Bogdanoff küsste galant die Hand Elses, die sie ihm in der ersten Aufwallung entgegenstreckte.
„Musik und Wiedergabe sind gleich schön,“ sagte sie in ihrer einfachen Art. Nur Frau Sonja blieb zurückhaltend. Bogdanoff sprach begeistert von dem bulgarischen Volkslied. Bald kam er auf den deutschen Volkston zu sprechen und bewies, dass er ein ausgezeichneter Kenner der deutschen Kultur war.
„Ich bin Attaché bei der bulgarischen Gesandtschaft, gnädige Frau, und als solcher habe ich mich bemüht, in die wunderbaren Geheimnisse des deutschen Liedes und der deutschen Kunst einzudringen. Gebe Gott, dass ich nie gezwungen werde, gegen diese Nation, die ich so heiss liebe, zu kämpfen.“
„Sind Sie Offizier?“ fragte Sonja.
„Unteroffizier der Reserve, meine Dame. Im gewöhnlichen Leben Jurist.“
„Schade, dass Ihr nicht etwas früher gekommen seid,“ warf Anny dazwischen. „Wir hatten Besuch. Eine sehr interessante schwedische Dame, die für Aftonbladet und verschiedene neutrale Blätter schreibt. In der Hauptsache durchreist sie Deutschland, um die amerikanische Presse zu unseren Gunsten zu bearbeiten und die Wahrheit über unser Land in Amerika zu verbreiten. Sie gedenkt später Vorträge drüben zu halten.“
„Viel auf einmal,“ sagte der Hauptmann. „Schade, dass Sie uns die interessante Dame nicht vorstellten.“
„Ich habe die Ehre gehabt, sie bei der gnädigen Frau und dem Herrn Oberleutnant einzuführen,“ warf Bogdanoff ein. „Sie ist in der Tat eine sehr interessante Erscheinung.“
Da trat der Oberleutnant ein, und das Gespräch nahm sogleich eine andere Wendung.
„Ich habe der gnädigen Frau Gesellschaft geleistet,“ sagte der Bulgare nach der ersten Begrüssung. „Doch nun will ich mich empfehlen.“
Kaum schloss sich die Türe hinter ihm, da wandte sich der Flieger mit einer nervösen Geste an seine Frau:
„War Bogdanoff schon lange hier?“
„Zwei Stunden etwa, Viktor. Erst unterrichtete er mich, dann spielte er einige Lieder. Übrigens war Frau van Veeren hier ... sie ging, als Herr Hauptmann Scholz und seine Damen kamen.“
Oberländer nickte befriedigt.
„Was sagen Sie zu Frau van Veeren? Wir müssten mehr solche Neutrale ins Land bekommen. Aber was viel wichtiger ist: Ich komme morgen schon ins Feld!“
„Viktor!“ rief die junge Frau und klammerte sich an ihn. „Viktor! Morgen — und das sagst du so hin, als ob das nicht wieder eine Trennung von Wochen, ach, Monaten bedeuten würde?“
Viktor Oberländer lächelte zerstreut und drückte einen schnellen Kuss auf Annys Hand. Else sah ernst zu Boden.
Was war das für eine sonderbare Geschichte mit dieser Frau van Veeren? Der Oberleutnant nahm an, sie müssten ihr begegnet sein. Aber das war doch nicht der Fall! Hier entstand ein Konflikt — Else fühlte ihn, ohne sich Rechenschaft geben zu können, wo eigentlich der Mittelpunkt war ...