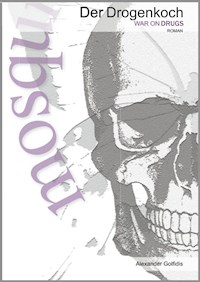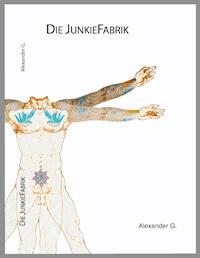
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Wie schon das Buch "Der Heroin Schuster", orientiert sich auch das Buch "Die JunkieFabrik" an der Lebensgeschichte des Autors. Eigentlich nicht der klügste Einfall, zwei biografische Bücher über ein und dieselbe Drogenabhängigkeit zu schreiben. Trotzdem ließ den Autor eine Frage nicht los: Wie viel Mitschuld trägt unsere Gesellschaft am entstehen einer Drogenkarriere? Das Buch ist seine Antwort darauf. Um jedoch nichts frei erfinden zu müssen, ist es größtenteils biografisch. Zum Inhalt: Das Buch soll dem Leser eine Art "Draufsicht" in das Leben eines Drogenabhängigen vermitteln. Wie bei einem Foto, das alle Dinge eines Geschehens festhält und nicht nur die Abschnitte zeigt, die von Medien gerne, in Hinblick auf Drogenabhängige, der Öffentlichkeit präsentiert werden. Es befasst sich nicht mit richtig oder falsch – es will zeigen und soll helfen zu verstehen. Und für diejenigen die einen Weg suchen, soll es eine Hilfe sein. Es wird kritisch die Rolle unserer konsumorientierten, aber sinnentleerten Leistungsgesellschaft hinterfragt, die Nikotin- und Alkoholkonsum nicht nur billigt, sondern auch zig Milliarden daran verdient - obwohl daran die meisten Menschen zugrunde gehen. Während gegen Konsumenten illegaler Drogen eine wahre Hetzjagd betrieben wird – ungeachtet der Tatsache, dass im Ranking internationaler Studien, Alkohol und Tabak unter den zehn schädlichsten Drogen zu finden sind.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 303
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Alexander Golfidis
Die JunkieFabrik
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Impressum neobooks
Kapitel 1
Vorwort
Dieses Buch ist entlang den Eckdaten, der authentischen Geschichte des Autors geschrieben. Es beschreibt seine über 15 Jahre dauernde Drogenabhängigkeit und führt den Leser schonungslos in den Abgrund der Sucht – beginnend in der wohlbehütenden Atmosphäre einer bürgerlichen Einfamilienhaussiedlung ...
Der Autor hat in diesem Buch versucht, dem Leser eine Art „Draufsicht“ in das Leben eines Drogenabhängigen zu vermitteln – wie bei einem Foto, das alle Dinge eines Geschehens festhält und nicht nur die Abschnitte zeigt, die von den Medien gerne in Hinblick auf Drogenabhängige der Öffentlichkeit präsentiert werden.
Dieses Buch befasst sich nicht mit richtig oder falsch – es will zeigen und es soll helfen zu verstehen. Und für diejenigen die einen Weg suchen, soll es eine Hilfe sein.
Dennoch wird in diesem Buch kritisch die Rolle unserer konsumorientierten, aber sinnentleerten Leistungs-gesellschaft hinterfragt, die Nikotin- und Alkoholkonsum nicht nur billigt, sondern auch Milliarden daran verdient (obwohl daran die meisten Menschen zugrunde gehen), während sie gegen die Konsumenten illegaler Drogen eine wahre Hetzjagd betreibt – ungeachtet der Tatsache, dass im Ranking internationaler Studien, Alkohol und Tabak unter den zehn schädlichsten Drogen zu finden sind.
Kapitel 2
Es war ein warmer Tag im Mai. Sascha lag in der Wiese vor seinem Haus und sah in den strahlend blauen Himmel. Im satten Gras um ihn herum erblühten Gänseblümchen und dazwischen lugte ockergelb der Löwenzahn hervor, wie blitzende weiße und gelbe ins Gras geworfene Perlen. Am Horizont, weit oben, sah er einen Vogel seine Kreise ziehen. Sascha musste die Augen fest zusammenkneifen, als er sich langsam in der Weite wie ein Punkt am Himmel verlor.
Der Garten war von einer grünen Hecke umgeben und davor schlängelte sich eine kleine Straße entlang, an der sich links und rechts ähnliche Häuser befanden – die alle gleich aussahen. Es war eine Einfamilienhaussiedlung.
Obwohl es sich bei Neuaubing um den Vorstadtbezirk einer Großstadt handelte, lebten die Bewohner dort wie in einem Dorf. Aus Instinkt alles ablehnend was nicht bürgerlich war, wussten sie wenig von der weiten Welt dahinter und waren der Ansicht, ihr Stadtviertel wäre der Mittelpunkt der Welt. Sie lebten wie unter einer Dunstglocke. Ihr Denken war flach und einfach. Trafen sich die Bewohner in ihren Vorgärten, beim Friseur oder beim Bäcker, stimmten sie über das Wetter an, tratschten über die Nachbarn oder sie gaben ihre Ansichten weiter: »Dies und das gehört sich so«, »Der Mensch muss klein sein«, und »Arbeit ist der Welt Lohn.«
In dieser Umgebung lebte Sascha mit seinen Eltern. Doch nun wollten sich die Eltern scheiden lassen und der Vater war bereits ausgezogen – aber das passierte sowieso in jeder dritten Ehe.
Saschawar ein schmächtiger Junge, geradezu dürr, ein Windhauch hätte ihn forttragen können. Besonders die Beine waren dünn wie Grashalme. Was er zunächst beim Fußballspielen zu spüren bekam – wenn die Kinder am Sportplatz ihre Mannschaften zusammenstellten und die »Profis« nach und nach ihre Lieblingsspieler aufriefen, war er immer unter den letzten derer, die gewählt wurden.
Sascha empfand das als Gemeinheit, doch er wusste auch, dass er nicht so schnell laufen konnte wie die anderen. Und Tore schießen … davon war er weit entfernt. Insgeheim gefiel ihm das Fußballspielen gar nicht. Doch dies behielt er für sich, denn für die anderen Kinder war Fußball das Größte.
Offensichtlich hatte er nichts anderes, um in der Welt der Größeren, Schnelleren und Stärkeren mitzuhalten, außer, dass er ein wenig frech war …
Manchmal provozierte Sascha größere Kinder. Sobald sie an seinem Gartentor vorbeiliefen, rief er ihnen hinterher: »Hau bloß ab, du blöde Sau, du!«.
Doch mit Mut konnte man weder Fußballspiele gewinnen noch Stärkere besiegen oder vor anderen davonrennen.
So wurde Sascha, der reichlich Fantasie besaß, ein wenig zum Tagträumer. Er träumte sich die Dinge einfach schön: Wo er schwach war, träumte er sich stark – wo es wenige gab, die ihn bewunderten, träumte er von vielen, die ihn bewunderten. Alles, was er nicht konnte, aber gern gekonnt hätte, war in seinen Träumen möglich. Oft saß er in der Schule und blickte nach vorne Richtung Tafel wie die anderen Kinder auch, doch in Wirklichkeit war er ganz in seine Träume vertieft.
Einmal träumte er sich einen Traum sogar so schön, dass er nicht mehr zu unterscheiden vermochte, was Traum und was Wirklichkeit war.
Ein Nachbarsjunge hatte Sascha erzählt, dass er ein Flugzeug bauen wollte … und Sascha hatte in seinen Gedanken das Flugzeug weiter entworfen und fertig gebaut: Aus Kisten und Brettern hatte er den Rumpf gezimmert. Das Untergestell bestand aus einem alten ausgedienten Kettcar. Die Tragflächen waren aus Spannplatten, je eine oben und eine unten, wie bei einem Doppeldecker. Und der Motor stammte von einem Rasenmäher.
Nun besaßen der Nachbarsjunge und Sascha ein eigenes Flugzeug. Es wartete in der Garage seines Freundes, bis beide von der Schule nach Hause kamen. Dann würden sie endlich losfliegen und über den Wolken schweben können. Sascha freute sich so sehr, dass er seine Lieblingslehrerin, Frau Walter, in sein Geheimnis einweihte und ihr von dem Flugzeug erzählte. Doch statt sich mit ihm zu freuen, bezeichnete Frau Walter ihn als Lügner. Er wollte ihr noch erklären, dass es doch in der Garage stand, dieses Flugzeug, und beteuerte unter Tränen: »Es ist in der Garage … ganz ehrlich … wir haben es dort zusammengebaut … und es fliegt richtig.« Doch Frau Walter schenkte ihm kein Gehör, sie glaubte ihm kein Wort und behauptete, er würde Lügen erzählen …
Manchmal träumte Sascha davon, ein Rockstar zu sein. Zwei Straßen weiter von seinem Zuhause gab es eine große Wiese und dort gab er in seinen Träumereien Open-Air-Konzerte. Er war ein richtiger Rockstar mit langen Haaren, die wild im Wind flatterten. Sascha hatte eine E-Gitarre umgehängt, dazu trug er ein ärmelloses Glitzer T-Shirt und seine Beine steckten in knallengen schwarzen Lederjeans. Die Wiese war mit tausenden Zuschauern gesäumt und alle jubelten ihm begeistert zu.
Saschas hatte einen Lieblingstraum, den er immer wieder vor sich hinträumte. Er war ein gefährlicher Rocker. Einer, vor dem alle zitterten. Eine feindliche Rockerbande hatte seine Mitschülerin Claudia Pusselt entführt. Sascha war heimlich in sie verliebt.
Er stellte sich den Rockern in den Weg und kämpfte. Mit ein paar gezielten Schlägen hatte er schnell die Anführer ausgeschaltet und den Rest der Bande in die Flucht geschlagen. Dann trug er Claudia Pusselt auf seinen Armen zu sich nach Hause. Sie war nackt. Die Feinde hatten ihr schon die Kleider entrissen, und er war gerade noch rechtzeitig hinzu gekommen, um Schlimmeres zu verhindern. Vorsichtig legte er sie in seinem Zimmer auf den Tisch und untersuchte ihre Wunden. Dies war Saschas Lieblingstraum …
Aber Sascha war nicht nur ein Träumer, auf der anderen Seite war er ein aufgeweckter Junge mit vielen Begabungen und in manchen Dingen sogar nahezu genial. So hatte er schon mit neun Jahren damit begonnen, eigenständig Radio- und Fernsehgeräte zu reparieren. Seine Kommode glich einem Ersatzteilschrank mit vielen Kabeln, Röhren, Transistoren und Sicherungen, welche, sobald man die Schranktüre öffnete, in einem bunten Durcheinander herausflogen.
Es war zwar so, dass jedes Mal, wenn er die Geräte wieder zusammenschraubte, Schräubchen und andere Kleinteile übrigblieben, aber dennoch funktionierten sie einwandfrei. Auch ein paar Stromschläge hatte er schon abbekommen und nicht nur einmal hatte er dabei mehr Glück als Verstand gehabt.
Als Sascha zehn Jahre alt war, zog er in den Keller. Dort hatte er sein Reich mit mehreren Alarmanlagen gesichert. Wollte man zum Beispiel im Erdgeschoss durch die alte niedere Rundbogentüre, hinter der sich die Kellertreppe befand, hatte Sascha über ein Seilzugsystem am unteren Ende der Treppe eine Puppe an einem Galgen befestigt. Jedes Mal, wenn jemand nun die Türe öffnete, fuhr die Puppe gespenstisch in die Höhe. Dabei hatte sie einen Strick um den Hals gebunden, an dem sie über eine Hebelwirkung nach oben gezerrt wurde. Zur besonderen Abschreckung der nicht willkommenen Besucher war sie mit blutunterlaufenen Augen geschminkt und hatte ein Messer in der Brust stecken.
Hatte man die erste Hürde hinter sich gebracht und war die Treppe nach unten gelangt, stand man auf der zweiten Alarmanlage. Unter dem Teppich befand sich ein Kontaktblech, welches in einem Bogen über einen Draht angeordnet war. Sobald jemand darauf stieg, leuchtete in Saschas Zimmer eine rote Warnlampe auf. Die dritte Alarmanlage befand sich direkt vor Saschas Kellerzimmer unter dem Fußabstreifer. Wieder ein Kontaktblech. Trat jemand darauf, ging in Saschas Zimmer das Radio in voller Lautstärke an, dabei führte ein Kabel zu einem Lautsprecher, welcher direkt vor der Tür in Kopfhöhe in einem Regal versteckt war. Dieser brüllte dem ungebetenen Gast dann vollgas in die Ohren …
Außerdem war Sascha manchmal ein richtiges Früchtchen. So hatte er einmal die batteriebetriebene Puppe seiner großen Schwester, die selbstständig gehen konnte, von der Hausecke in den Kellerschacht laufen lassen. Vorher hatte er das Schachtgitter zur Seite geschoben, sodass die Puppe beim Erreichen des Schachts in den Abgrund fiel und sich beim Sturz den Kopf abbrach, was er wiederum nicht beabsichtigt hatte.
An einem anderen Tag hatte Sascha aus einem alten Blecheimer, einem weißen Laken und zwei zusammengebundenen Bohnenstangen ein Gespenst gebastelt, welches oben an der Bohnenstange in fünf Meter Höhe vor dem Fenster seiner Oma hin und her schwebte. Die Oma bewohnte im selben Haus das obere Stockwerk. Über eine lange Schnur, die Sascha über zwei Hausecken geleitet hatte, bewegte er heimlich das Gespenst, während er ganz unschuldig im Blickkontakt mit dem Rest seiner Familie im Garten saß. Das Gespenst wippte indessen vor dem Fenster seiner Oma wild hin und her.
Als einmal im Sommer ein Graben für die Kanalisation durch den Garten gezogen wurde, eröffnete Sascha dort eine Rennstrecke für das Meerschweinchen seiner Schwester. Er setzte es in den Graben und spritzte ihm mit dem Gartenschlauch hinterher. Das arme Tier rannte auf der Flucht vor dem Wasser wie der Teufel den Graben auf und ab. Stunden später lag es tot darin und Sascha beerdigte es heimlich. Erst als die Schwester nach tagelangem Bitten und unter tausend Schwüren beteuert hatte, dass sie nichts davon zu Hause erzählen wolle, führte sie Sascha zu dem Grab des Meerschweinchens, welches sich außerhalb des Gartens neben einer Telefonzelle in einem Gebüsch befand. Durch einen schmalen Eingang konnte man durch das Geäst zu einer kleinen Lichtung kriechen. Mit Zweigen hatte er dort ein Kreuz zusammen geknotet. Während er seiner Schwester nicht verriet, wieso das Meerschweinchen im Grab gelandet war, hatten beide noch einmal andächtig Abschied genommen und Blumen auf das Grab gelegt. Saschas offizielle Version lautete, das Meerschweinchen habe einen Herzinfarkt gehabt. Was vermutlich auch stimmte.
Kapitel 3
Die neue Schule
Als Sascha von der Volksschule zur Hauptschule wechseln sollte, begann für ihn ein Albtraum und seine Kindheit nahm ein jähes Ende. Die Hauptschule lag im Hochhausgebiet - und dort gab es Gangs. Sascha hatte schon öfter durch das fremde Viertel gemusst. Zur Kirche und auch zur alten Schule hatte der Weg ein Stück weit durch das Neubauviertel geführt. Meistens hatte er eine sichere Strecke am unteren Rand des Viertels gewählt, aber an manchen Tagen, wenn er zu viel Angst hatte, machte er einen ganz großen Bogen darum und lief sicher die Hauptstraße entlang.
Alle mieden das Hochhausviertel, sogar die Erwachsenen. Sie sagten, es hätte einen schlechten Ruf.
In der Vergangenheit hatte Sascha schon schlechte Erfahrungen in diesem Viertel gemacht: Einmal, als er zum Kommunionsunterricht zu spät dran war, hatte er den Weg durch das andere Viertel abgekürzt. Er war mit dem Rad unterwegs. Am Spielplatz hingen ein paar Jugendliche herum und einer rief ihm nach: »Hey du, komm mal her.« Sascha hatte zwar Angst, aber er war kein Feigling und so fuhr er die paar Meter, die er schon an ihnen vorüber war, wieder mit dem Fahrrad zurück. »Wer is’n des?«, rief einer der Jungs, die sich um ihn herum aufstellten. Zwei der Jungs waren beinahe einen Kopf größer wie Sascha und bestimmt ein oder zwei Jahre älter. Der dritte Junge war in Saschas Alter. Er hatte die Rolle des Rädelsführers übernommen und es war ihm anzusehen, wie sicher er sich mit seinen größeren Freunden fühlte. »Der hat ja Mädchensandalen an«, spottete er. Sascha hatte keine Ahnung, dass er Mädchensandalen anhaben sollte. Er hatte die Sandalen zwar von seiner Schwester geerbt, aber dass es sich demzufolge um Mädchensandalen handeln musste, war ihm nicht klar gewesen. »Das sind keine Mädchensandalen«, gab er trotzig zurück. Undschon schubste ihn einer von seinem Fahrrad herunter. »Jetzt gibt’s Ponches«, hörte er eine Stimme hinter sich und da boxte ihm der etwa gleichaltrige Junge von der Seite ins Gesicht. Sascha wirbelte herum und warf ihn zu Boden. Blitzschnell hatte er ihn überrumpelt und saß auf ihm drauf, so dass dieser nicht mehr zuschlagen konnte. Damit hatte der Gleichaltrige gar nicht gerechnet. Doch dann zogen ihn die beiden Größeren von hinten herunter, und jeder von ihnen kniete sich auf einen von Saschas Armen, sodass er sich nicht mehr wehren konnte. Und der Junge, den er eigentlich schon besiegt hatte, drehte ihm solange die Nasenspitze, bis sie rot und lila leuchtete. Als sie endlich mit ihm fertig waren, ließen sie ihm noch die Luft aus dem Reifen und Sascha musste sein Rad schieben. Seine Jacke war zerrissen, die Fahrradreifen waren platt und aus Saschas Augen rannen unaufhaltsam Tränen. Er hatte so eine Stinkwut. Es war so ungerecht!
Und nun sollte Sascha dort, in dem Neubauviertel, zur Schule gehen. Er war zwar mutig, aber er war kein Schläger – immer wenn er zuschlagen wollte, hatte er eine Hemmung in sich verspürt und seine Schläge wurden wie von Watte abgebremst. Er konnte einfach niemandem wehtun.
Sascha stand alleine da. Und so träumte er sich Rache, er wollte auch zu einer Gang gehören, zu einer Rockergang und dann sollten sie alle vor ihm zittern. So wie in seinen Träumen!
Am ersten Tag in der neuen Schule war Sascha von der gewaltträchtigen Atmosphäre so verängstigt, dass er sich in die Hosen machte. Am Schuleingang hatten zwei größere Schüler einen kleineren blutig geschlagen. Einer hatte den Jungen von hinten festgehalten, der andere hatte davor gestanden und wie beim Fußballspielen mit seinen Füßen auf ihn eingetreten.
Sascha hatte sich an ihnen vorbeigestohlen und war dann so angstvoll in seinem Klassenzimmer gesessen, dass er sich nicht zu fragen traute, ob er auf die Toilette dürfe. Eisern hatte er es verdrückt. Als der Mittagsgong ertönte, war er aus der Schule gestürmt und gerade, als er durch den Haupteingang kam, konnte er es nicht mehr halten. Ein nasser Fleck prangte pfannkuchengroß vorne mitten auf seiner Hose. Sascha hielt die Schultasche davor und rannte, als wäre der Teufel hinter ihm her, den ganzen weiten Weg bis nach Hause.
Den Tag darauf bot sich ihm ein ähnliches Bild. Er hörte lautes Geschrei, als er von dem Teerweg in den mit grauem Schiefer gepflasterten Vorhof zur Schule bog. Kaum war er um die Ecke, sah er in einem Halbkreis angeordnet etwa acht Mädchen, die um eine liegende Gestalt herumstanden.
Nachdem er noch ein paar Schritte näher heran war, sah er, dass es sich um einen schmächtigen Jungen handelte, der sich Zuflucht suchend am Boden wie ein Igel zusammengerollt hielt. Doch sein eigener Körper bot ihm wenig Schutz. Die Mädchen traten mit ihren Füßen nach ihm. Gemeine, fiese Stöckelschuhe hieben in seinen Leib. Die Anführerin, ein hässliches Mädchen mit einer wild abstehenden Frisur, vielen Pickeln im Gesicht und einem knallrot geschminkten Mund, zog ihn an den Haaren hoch und fuhr ihm mit ihren lila lackierten Fingernägeln quer über das Gesicht. Blut lief über seine Wange und tropfte auf die Pflastersteine. Dann kreischte sie ihm noch eine Drohung ins Ohr: »Nächstes Mal kommst du nicht so leicht davon!« Mit einem kräftigen Schubs stieß sie ihn wieder zu Boden. Noch einmal trat eine jede zu, endlich ließen sie von ihm ab. Der Schulgong war ertönt.
Zurück auf den Pflastersteinen blieb ein Junge, der zitterte und wimmerte wie ein zu Tode erschrockenes Tier. Es war ein Siebtklässler, Sascha sollte ihn später noch kennenlernen.
Diese Schule war die Hölle: Im Pausenhof und in der Vorhalle standen immer wieder solche Grüppchen zusammen, die auf Schwächere losgingen. Der Toilettengang zwischen den Schulstunden wurde zum Spießrutenlauf: Jedes Mal blieb offen, ob man wieder heil zurück ins Klassenzimmer fand, oder ob man in die Arme der Acht- oder Neuntklässler lief, die sich einen Spaß daraus machten, jüngere Mitschüler mit dem Kopf in die Toilettenschüssel zu tauchen. Gewalt, Schläge und Erpressung waren an der Tagesordnung.
Selbst die Lehrer hatten es nicht leicht: Lehrer wurden aus dem Fenster gehängt, geohrfeigt, oder, wenn ihnen so nicht beizukommen war, wurden auf dem Lehrerparkplatz ihre Autos beschädigt.
Doch mit der Zeit arrangierte sich Sascha mit der Situation. Er hatte sich mit Marcel angefreundet. Marcel war ein kräftiger, drahtiger Junge und drückte neben ihm die Schulbank.
Marcels ganzer Körper schien nur aus Muskeln zu bestehen – er war sogar so stark, dass er es gar nicht nötig hatte, sich gegen Schwächere zu wenden. Marcel konnte es mit jedem aufnehmen, denn obendrein hatte er auch Mut.
Eigentlich trumpfte Marcel überall dort, wo Sascha nichts zu bieten hatte. Im Sport war er immer unter den Ersten. Er hatte viele Freunde. Und er war sogar der Kopf einer Jungenbande.
In seinem Viertel hatte Sascha früher auch Freunde gehabt. Helmut, Robin und Karl wohnten alle in seiner Straße.
Sie waren gute Freunde gewesen, die täglich miteinander spielten. Im Winter, wenn tiefer Schnee in den Straßen und Gärten lag, zogen sie mit ihren Schlitten zu einem nahegelegenen Hügel und donnerten in halsbrecherischer Fahrt hinunter. Im Sommer fuhren sie mit ihren Rädern raus vor die Stadt zu einem Baggersee zum Baden. Manchmal hatten sie auf dem Weg zum See, an einer Brücke haltgemacht. Dort hatten sie am Geländer um die Wette gepisst. Sieger war, wer am weitesten kam. Karl hatte den stärksten Strahl, er lag immer um einen Meter in Führung.
… Und so etwas machten doch nur wirklich gute Freunde miteinander.
Doch seit Sascha in die neue Schule gewechselt war und nun zu seinen Freunden Marcel aus dem Hochhausviertel gehörte, hatten die Eltern von Helmut, Karl und Robin ihren Kindern verboten mit ihm zu spielen, sie hatten ihnen erzählt, Sascha sei jetzt ein »Rocker«.
Die Freundschaft zwischen Sascha und Marcel wurde schnell enger, innerhalb kürzester Zeit waren die beiden beste Freunde. Außerdem hatte Sascha etwas, womit von Marcels Freunden niemand aufwarten konnte. Er hatte ein eigenes Haus mit Garten.
Von nun an spielten die beiden oft auf der Wiese vor Saschas Haus – sie wetteiferten im Bogenschießen mit selbst geschnitzten Pfeil und Bogen, oder kletterten auf den Obstbäumen umher, die sich ebenfalls im Garten befanden. Und manchmal ging Sascha auch mit Marcel rüber ins andere Viertel. Nachdem dort alle mitbekommen hatten, dass Sascha nun Marcels neuer Freund war, war auch er dort willkommen. Sascha stand unter Marcels Obhut, wie unter einem unsichtbaren Schutzschild.
So kam es, dass sich nach und nach ein Wandel vollzog: Erst war Sascha noch brav zur Schule gegangen, hatte um acht im Bett gelegen und kannte die Krimis aus dem Abendprogramm nur vom Hörensagen, während die anderen Mitschüler und Freunde damit prahlten, dass sie länger aufbleiben durften und was sie alles für Serien gesehen hatten. Sonntags war er sogar des Öfteren in der Kirche gewesen und nur der Umstand, dass ihm regelmäßig vom Weihrauch schlecht wurde, hatte ihn von dieser Pflicht befreit.
Doch nun vollzog sich zeitgleich mit dem Eintreten der Pubertät eine Änderung, die sich bald über alle Bereiche seines Lebens ausweitete.
In Saschas näherem Umfeld gab es keine erwachsenen Vorbilder, an denen er sich orientieren wollte: Da war ein entfernter Onkel, der sich selbst für den Größten hielt, alles besser wusste und darüber hinaus ständig über andere am schimpfen war. Er trug Tag für Tag denselben blauen Arbeitskittel, in dem ordentlich in der Brusttasche ein Phasenprüfer und ein kleiner Meterstab steckte. Im Ganzen hatte der Onkel keine einzige Eigenschaft, die Sascha als toll oder nachahmenswert empfunden hätte. Dann gab es noch den Vater eines Freundes, der ständig besoffen auf der Couch vor dem Fernsehapparat saß. Ein weiterer Onkel, ein Lustgreis mit Hitlerbärtchen und streng gezogenem Scheitel, der fortwährend versuchte die kleinen pfirsichgroßen Brüste von Saschas pubertierenden Schwestern zu berühren, taugte ebenfalls nicht als Vorbild.
»Hier hast du nen Zehner«, sagte der Onkel übermäßig laut und reichte Sascha einen Geldschein, während die Schwestern mit nach unten zeigenden Mundwinkeln zu Sascha starrten.
»Deine Schwestern kriegen nichts, die waren nicht nett zu mir«, betonte der Onkel mit dem Hitlerbärtchen, damit sich Saschas Schwestern ärgern sollten. Sie hatten sich nicht von ihm betatschen lassen und gingen deshalb nun leer aus.
Von weiblichen Vorbildern hielt Sascha auch nichts – schließlich waren Frauen als Vorbilder für einen Jungen, mehr als untauglich.
Wenn sich Sascha mit seinen Fragen an die Erwachsenen wandte, »Warum muss man zur Schule gehen? Warum muss man arbeiten?«, hörte er jedes Mal die gleichen altgedienten Antworten. »Weil man es so macht! Weil sich das so gehört!«
Ihm kam es so vor, als würden sie nur das weiter geben, was sie selbst einmal gehört hatten. Doch weil sich die Erwachsenen über ihre Arbeit und über ihr Leben ständig beschwerten und dennoch immer wieder das Gleiche taten, zweifelte Sascha daran, dass dies der richtige Weg sei.
Es war ihm, als wollten sie ihn klein machen, gering halten, ihn nicht das große Leben, die Freiheit leben lassen. Vielmehr wollten sie Sascha zu dem machen, was sie selbst waren. Zu einem Gefangenen. Sie wollten das, was sie sich selbst nicht zutrauten, auch keinem Anderen zugestehen. Er sollte sich ihr Lebensmodell überstülpen: Sie waren gut gekleidet, hatten jedoch keinen individuellen Stil; sie waren klug, hatten aber keine eigenen Ideen; sie besaßen Talent, wussten es jedoch nicht zu nutzen; sie hatten Herz, dachten jedoch vordergründig immer nur an sich. Kurzum, sie waren wie alle: Massenware, gewöhnlich – keine Piraten, keine Eroberer, keine Entdecker. Die Erwachsenen waren wie Klone, die sich zwar in Aussehen und Größe unterschieden, jedoch ansonsten kein eigenständiges Denken besaßen – sie waren süchtig an öffentlichen Meinungen. Und diesen Stempel wollte sich Sascha nicht aufdrücken lassen.
Am meisten hasste es Sascha jedoch, wenn seine Verwandten zu Besuch kamen. Dann gab es schon Tage vorher Stress. Es wurde aufgeräumt, die Böden gewischt und das Haus auf Hochglanz getrimmt. Kurz vor der Ankunft der Verwandtschaft wurden dann noch die Kinder herausgeputzt. Die Haare der Schwestern wurden gekämmt, bis es Tränen gab. Steife unbequeme Sonntagskleidung musste angezogen werden und dann sollten die Kinder als Aushängeschild für eine tolle Familie einen guten Eindruck machen. Sascha stand dann etwas abseits und beobachtete die Erwachsenen. Er durchleuchtete sie wie mit einem Röntgenapparat. Er registrierte jede Lüge, jedes falsche Lächeln, jedes sich Hervorheben wollen, und er verabscheute das alles zutiefst. Während sie beieinanderstanden und sich gegenseitig oberflächliche Dinge erzählten, die sie nicht berührten, und sich wechselseitig anlogen, wie toll es ihnen ginge und wie weit sie im Leben gekommen waren – stand Sascha daneben und hasste sie dafür.
In dieser Zeit musste Sascha für den Schwimmunterricht ein Stadtviertel weiter zum nahegelegenen Schwimmbad fahren. Es war ein kalter Novembermorgen gegen 6:50 Uhr mitten im Berufsverkehr. Der S-Bahnhof wimmelte von Menschen. Als der Zug einfuhr, hatte sich Sascha einen Weg durch die Menschenmassen gebahnt und war im Zugabteil nach hinten gestiegen, um einen der freien Sitzplätze zu erhalten. Dies war der Vorteil, wenn man so dünn war wie Sascha, konnte man sich leicht hindurchschlängeln. Doch leider waren die hinteren Plätze schon belegt, so griff er nach oben in die Haltestange, damit er nicht durch den Zug geworfen wurde, sobald dieser anfuhr.
Während der Fahrt sah sich Sascha die Gesichter der Mitfahrenden genauer an. Eng an eng standen die Menschen gedrängt nebeneinander. Wie Gefangene, fremdbestimmt und unterwürfig standen sie da. Nichtssagende Gesichter mit satten Tränensäcken. Es waren sehr traurige Gesichter, dicke und dünne, kurze und lange – bei manchen hatte sich der Trübsinn in verbissene, zornige Mienen verwandelt, in denen hineingeworfene Münder versucht waren, falsches Lächeln anzudeuten. Andere wirkten abwesend in weit fernen Ländern, wieder andere standen krumm, mit gesenktem Kopf, als würden sie sich vor Schlägen ducken. An manchen haftete der Geruch von Alkohol und Nikotin und das Unglück schien ihnen aus den leidenden, mit Falten übersäten Gesichtern zu triefen. Alle hatten leere und ausgebrannte Augen und niemand hatte ein Lachen im Gesicht. Sie liefen den ganzen Tag unsinnig in ihrem Leben hin und her, doch ihre Rastlosigkeit ergab keinen Sinn – denn es bereitete ihrem Herzen keine Freude.
In einem undurchsichtigen, verworrenen Gedankengang kam Sascha das Wort »Schafe« in den Sinn …
Als er an diesem Tag nach Hause kam, sagte er zu seiner Mutter: »Die Menschen sind wie Schafe … Du brauchst bloß am Morgen in die S-Bahn kucken und du siehst Schafe.«
Die Mutter erwiderte empört:
»Die Menschen sind doch keine Schafe.«
»Doch nur Schafe«, antwortete Sascha.
Alle sprangen sofort in die Bresche, sobald jemand die Gesellschaft anging, dabei war ihnen nicht klar, dass sie selbst zu den Verdummten gehörten. Sie fühlten sich manipuliert und überfordert, der Sache nicht gewachsen, und sie hatten das Gefühl, dass ihnen ihr Leben vermiest wurde. Und es stimmte.
Die Menschen hatten ein System erschaffen, in dem sie sich gegenseitig ausnahmen, bis ihnen die Luft ausging. Und das nannten sie Kapitalismus. Obendrein hatten sie in der Politik ein System, in dem die ganze Zeit lautstark geredet wurde, und sie einem dabei so viele Lügen erzählten, bis die Allgemeinheit alles zu fressen begann, was ihnen erzählt worden war. Das nannte man Demokratie.
Die Erwachsenen gingen in die Arbeit, kamen nach Hause und beschwerten sich darüber. Am nächsten Tag gingen sie wieder hin. Sie waren wie fremdbestimmt. Blökend und einander Parolen zurufend, liefen sie alle in eine Richtung. Sie folgten einem Schilderwald – hier lang – dort lang – da lang – hier nicht lang – und diese Schildersprache riefen sie sich gegenseitig zu, während sie versucht waren, mit der Herde mitzuhalten. Eigennutz und Kleinherzigkeit saßen manchen auf den Schultern und flüsterten anspornend in die Ohren »lauf schneller, lauf schneller, dannbekommst du mehr«, was etliche noch eifriger werden ließ.
Doch sie liefen wie die Blinden – mit jedem Schritt, den sie vorankamen, gerieten sie mehr und mehr in die Mühlen und Abhängigkeiten.
Wie ehemals die Menschen ihr Herz für Glanz und Glorie dreingaben, reichten sie es nun für Qualifikation und Besitz, aber sie hinterfragten nicht. Niemals.
Die Maschinerie zermanschte sie und spie sie dann wieder aus – mit aufgesetzten, grotesken Masken der Anständigkeit.
Sie hatten nicht verstanden, dass sie einstmals eigenständige Lebewesen waren. Sie identifizierten sich mit der Masse und je mehr sie das taten, umso stärker stutzten sie sich zurecht. Bis hin zur Unkenntlichkeit.
Schließlich hatten sie sich, in dem Wahn, angepasst zu sein, das letzte Stück Persönlichkeit herausgebügelt, das sie ausgemacht hatte.
Nun quakten sie den ewigen Singsang ihres individuellen Fortschritts, mit der inhärenten Angst, jemand könne ihr Weltbild mit nur einem Furz in tausend Stücke zerschlagen.
Halbtot, krank und siech vom Arbeiten, Fernsehen und Zeitunglesen gab es am Ende für die, die es geschafft hatten, Rente, Altenheime, Pflegeheime und Gehwägelchen.
Und für die anderen gab es schon vorher Tüten voll Arzneien gegen die blumenkohlartigen, kranken Gewächse, die aus ihren Körpern wucherten, und die anderen Erkrankungen, die sie sich in ihrem Stress zugezogen hatten.
Sascha hatte keine Worte für das, was er sah, wenn er in die Gesichter der Erwachsenen blickte, es war nur ein Gefühl, das ihn überkam: Das Gefühl von Lug und Trug, ein Falschsein was ihnen tief zugrunde lag. Eine ewig kreisende Sinnlosigkeit, die ihr Dasein ausmachte, das eine einzige Lüge war.
Sascha wusste nur eines: So wollte er nicht werden.
Kapitel 4
Die Hai-Bande
Ganz anders hingegen waren Saschas neue Freunde aus dem Hochhausviertel. Sie entsprachen nicht dieser »Norm«, sie waren in der Gegend als »Rocker« verschrien, es waren jugendliche Aufsässige, die machten, was sie für richtig hielten.
Eines Tages nahm sich Sascha aus Mamas Nähzeug eine Nadel, wickelte einen Faden darum und tauchte die Nadel in die Tusche, welche aus dem Nachlass seines Onkels stammte (er war technischer Zeichner gewesen). Dann stach er sich seine erste Tätowierung in den Arm.
Bald war er nicht mehr wieder zu erkennen – er hatte sich ein Messer und die »Dreipunktetätowierung« auf den Arm gepikst. Die drei Punkte standen nach der Neuaubinger Auslegung, für schwul, pervers und arbeitsscheu.
Wobei Sascha als Dreizehnjähriger, der gerade aus der Autospielphase kam, sich über schwul oder pervers noch nie richtig Gedanken gemacht hatte – einzig, was arbeitsscheu hieß, da hatte er eine Vorstellung.
Dann hatte er sich ein Herz mit den Buchstaben »S« und »P«, die wiederum für schwul und pervers standen, und zwei Schwerter mit Fahnenberankung tätowiert. Später kam noch ein Hai, das neue Gang-Zeichen hinzu. Ins Ohr hatte er sich drei Löcher gestochen, wo nun zwei goldene Kreuze und ein Ring hingen.
In wenigen Tagen war aus Sascha ein Anderer geworden.
Wenn er nachts durch das Hochhausviertel lief – was er nun lieber tat, als in die Schule zu gehen – bekam er direkt vor sich selbst Angst. In der Dunkelheit hallten seine Schritte wegen der mit Hufeisen beschlagenen Cowboystiefel von den Plattenbauten zurück, sodass er bei jedem Schritt selbst erschrocken zusammenfuhr.
Er trug eine schwarze Lederjacke, die im Licht der Straßenlaterne matt glänzte, und im Ohr glitzerten die goldenen Kreuze. In der Tasche befand sich ein abgerissener Mercedes-Stern, den man als Wurfgeschoss oder Schlagring verwenden konnte.
Nun wusste er, dass er anders war! Sobald er an der Bushaltestelle ankam, um eine Station ins nächste Viertel zu fahren, und dort zu viele »Normalos« herumstanden, die auf den Bus warteten, wechselte er die Straßenseite und ging erst wieder rüber, wenn der Bus einfuhr. Mit denen hatte er nichts gemeinsam, außerdem konnte man so eventuelle Verfolger abschütteln. Die Polizei hatte nämlich bald sein Anderssein erkannt und sich an seine Fersen geheftet …
Nun war Sascha der Junge mit den gefährlichen Adleraugen – denn wer nicht stark war, musste wenigstens gefährlich dreinschauen können. Was Sascha ausreichend vor dem Spiegel geübt hatte …
So kam es, dass Sascha, wie man so schön sagt, auf die schiefe Bahn geriet.
Es fing damit an, dass sich die neuen Freunde jetzt auch nachts trafen und tagsüber deswegen die Schule schwänzten.
Während sich nun die Klassenkameraden in der Schule befanden und für den Abschluss büffelten, trafen sich die Freunde meist bei Harry, dessen Eltern beide zur Arbeit waren. Anstatt zur Schule gingen sie dann zum Klauen in den nahen Lebensmittelmarkt und besorgten sich dort Zigaretten, Schnaps, Chips, Süßigkeiten und hin und wieder CDs.
Da passierte es einmal, dass es Franzi, einen Jungen aus Saschas Clique, mit einer Anzeige wegen Diebstahl erwischte. Franzi, ein schlaksiger Junge mit Wuschelkopf, hatte sich nicht wie Sascha je links und rechts nur eine Schachtel Zigaretten in die Socken getan, sondern Franzi hatte sich pro Bein sechs Schachteln Zigaretten in die Strümpfe gestopft und diese dabei so überdehnt, dass die Zigarettenschachteln genau an der Kasse, wie bei einem Zaubertrick, mit einem Knall auf dem Boden landeten. Nun lagen sie in dem schmalen Durchgang zwischen den Kassen um Franzis Füße verstreut. Die Kassiererin beugte sich über die Kasse und betrachtete das Malheur. »Wo kommen die denn her?« fragte sie verblüfft, als sie die sechs Schachteln Zigaretten am Boden sah. Franzi stand indessen entgeistert da und es schien, als hätte ihn die Situation so überrascht, dass er auf der Stelle eingefroren war. Er brachte keinen Mucks hervor. In seinem anderen Strumpf steckten weitere sechs Schachteln. Der Kaufhauschef kam hinzu und die Polizei wurde gerufen, während Sascha mit klopfenden Herzen erst hinter einem Regal verschwand und dann aber bei einer anderen Kasse unbehelligt durchschlüpfte. Als er nach draußen kam, wurde er schon von den anderen der Clique erwartet.
»Wo ist Franzi«, fragte Harry, ein Junge mit einem fiesen Ausdruck in den Augen.
»Sie haben ihn erwischt«, antwortete Sascha, der fast am ganzen Leib zitterte.
»Scheiße, ich hab ihm doch gesagt, dass er aufpassen soll«, fiel Harry ins Wort.
»Es musste schiefgehen, er hatte zwölf Zigarettenschachteln in den Socken stecken«, entgegnete Sascha.
Ein ehrfürchtiges Raunen ging durch die Runde. Dann bog ein Polizeiwagen zum Supermarkt ein und hielt vor dem Personaleingang. Die Jungs verkrümelten sich hinter einer Hausecke und sahen, als der Polizeiwagen wieder abfuhr, Franzis Wuschelkopf im Rückfenster des Polizeiautos.
Nach ihren Diebeszügen saßen die Freunde vorwiegend bei Harry, rauchten Zigaretten, tranken Alkohol und schauten Filme oder hörten Musik. So laut, dass oft die Nachbarn vor Harrys Türe standen und sich über die verkommene Jugend von heute ausließen.
Gegen Abend zogen sie dann durch ihr Stadtviertel, das sie auch »Chicago-West« nannten.
Waren sie im Besitz von Geld, saßen sie in den umliegenden Kneipen, hatten sie keines machten sie anderen Blödsinn. So ließen sie sich hin und wieder in Tiefgaragen einsperren: Einer aus der Bande schlich heimlich einem Auto folgend in die Tiefgarage und öffnete dann seinen Kumpels die Seitentüre. Dann klauten sie Mercedes-Sterne – wovon Sascha schon einen bis zur Hälfte gefüllten Schuhkarton besaß; was zur Folge hatte, dass in seinem Viertel bald kein einziger Mercedes mehr mit einem Stern aufwarten konnte. Manchmal stahlen sie auch Mopeds, einmal sogar ein Motorrad, eine 1000er Kawasaki, mit der sie dann abwechselnd einen Feldweg am Stadtrand entlang donnerten, bis der Tank leer war. Doch das war ein seltenes Highlight.
In der Regel machten sie sich an den Zigarettenautomaten im Viertel zu schaffen. Dabei hatten sie verschiedene Techniken, wobei aber bisher nur das Stechen funktioniert hatte.
Sascha ging meistens mit Marcel auf Diebestour. Vorher wollten sie noch Peter abholen. Sascha drückte die Klingel an dem schmutzig gelben Hochhaus, wo Peter wohnte. Es war elf Uhr nachts. Der Lautsprecher der Sprechanlage ging an:
»Wer is'n da?«
»Wir sind's, Sascha und Marcel, kommst du runter?« »Ich hab kein Geld.«
»Wir wollen nicht in die Kneipe.«
»Moment, ich bin gleich unten.«
»Ich geh noch runter«, rief Peter zu seinem Vater, der zu dieser Zeit regelmäßig besoffen vor dem Fernseher hing:
»Du … wiiillst doch nicht noch rauuus?«, lallte der Vater, während Peter ihm noch einen verachtenden Blick zuwarf und dann nach unten eilte.
Sascha und Marcel saßen auf der Steintreppe vor dem Hauseingang und Peter lehnte sich ans Geländer.
»Hi, was machen wir denn?« fragte Peter die beiden. »Wir wollten den Automaten um ein paar Zigaretten bitten«, grinste Sascha.
»Vorne am Gößweinsteinplatz«, sagte Marcel, und die Jungs spazierten los.
Sie gingen durch das Hochhausviertel und wechselten an einem Fußübergang in die Einfamilienhaussiedlung. Die Aufsesserstraße lag ruhig und einsam im Licht der Straßenlaternen.
»Soll ich Schmiere stehen?«, flüsterte Peter.
»Ja, bleib hier an der Ecke und pass gut auf, dass niemand kommt«, sagte Marcel mit leise gehaltener Stimme.
Sascha und Marcel gingen ein paar Schritte weiter zu dem Zigarettenautomaten, der inmitten einer Hecke am Gartenzaun befestigt war.
»Hast du das Feuerzeug?« flüsterte Sascha. »Moment«, murmelte Marcel.
Marcel kramte ein Feuer aus seiner Hose. Dann zog er die Zigarettenlade hervor und hielt sie fest, damit sie nicht wieder zurückschnappte. Mit der anderen Hand leuchtete er Sascha mit dem Feuer. Sascha holte eine Stricknadel aus seiner Jacke und ritzte damit die Packung auf, die zu einem Drittel im Spalt sichtbar wurde. Dann versuchte er eine Zigarette herauszuziehen. Nach ein paar Minuten hatte Sascha neun Zigaretten herausgefischt. Danach wechselten sie zur nächsten Schublade. Plötzlich hüpfte Marcel im Dreieck und schüttelte wie wild seine Hand. Er hatte sich die Finger am Feuerzeug verbrannt. »Mach mal schneller«, schimpfte Marcel. »Mein Daumen ist schon ganz schwarz.«
Kaum waren sie wieder am Zigarettenfischen, schlug Peter Alarm.
»Shhhht … shhhht … shhhht«, presste er durch die Zähne.
Ein Mann kam mit zügigen Schritten die Straße entlang. Die drei Jungs wechselten schnell die Straßenseite und warteten, bis der Fußgänger um die Ecke in einem Wirtshaus verschwand.
Dann machten sie sich erneut an die Arbeit. Als sie fertig waren, hatten sie etwa siebzig Zigaretten erbeutet – Marcels Daumen war schwarz wie Teer und vier Feuerzeuge waren kaputt gegangen. Während der Rest der Zigaretten zerfleddert im Automaten hing.
Davor hatten sie es schon mit anderen Methoden versucht. Einmal, in der Zeit um Sylvester, mit selbst gebastelten Bomben, die zwar die Zigarettenautomaten restlos demolierten, aber weder die Zigaretten, geschweige denn die Geldkassette freigegeben hatten. Die Automaten hingen nur verbeult und ausgebrannt an den Gartenzäunen und hinterließen einen trostlosen Anblick. Ein andermal hatten sie petroleumgetränkte Lappen in die Schubladen der Automaten gestopft und angezündet, was zwar alle Zigaretten zerstörte, aber ansonsten nichts einbrachte. Außer, dass im ganzen Viertel kein einziger Zigarettenautomat mehr zu benutzen war.