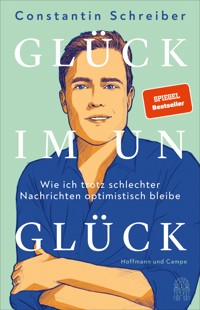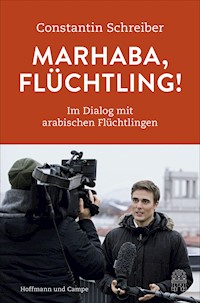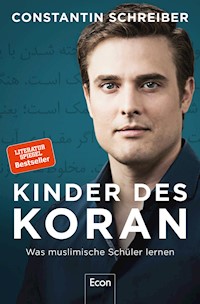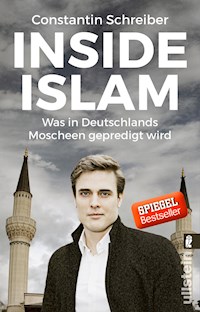9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HOFFMANN UND CAMPE VERLAG GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Land am Abgrund. Eine Gesellschaft zwischen Hoffnung und Hass. Und eine muslimische Frau auf dem Weg zur Macht. Deutschland in ungefähr dreißig Jahren, kurz vor der nächsten Bundestagswahl. Die aussichtsreichste Kandidatin für den Posten an der Regierungsspitze ist Sabah Hussein. Feministin, Muslimin, Einwandererin, Mitglied der Ökologischen Partei. Aber nicht alle wollen sie gewinnen sehen und arbeiten mit allen Mitteln daran, Sabah Husseins Wahl zu vereiteln, während die Gesellschaft immer weiter auseinander bricht. Der Bestsellerautor, Grimme-Preisträger und Tagesschau-Sprecher Constantin Schreiber legt nach seinen erfolgreichen Sachbüchern mit Die Kandidatin einen rasanten und dramatischen Roman vor, nach dessen Lektüre man anders in die Zukunft schaut.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Constantin Schreiber
Die Kandidatin
Roman
Hoffmann und Campe
1
»Wollt ihr absolute Diversität?«, schreit ein junger Mann mit Vielfaltsmerkmal ins Megaphon.
»Ja!«, skandiert die Menge, klatscht und jubelt. »Ja!« Die Demonstrierenden lassen Ballons in Regenbogenfarben in Form eines D steigen. D wie »Diversity«. Alle großen linken Gruppierungen sind vertreten, Antirassismusaktivisten, Kapitalismusgegner, Migrantenorganisationen, Klimaschützer. In ihren Gesichtern stehen Zeichen von Wut und Anspannung, von jahrelangem Kampf. Auf der anderen Seite der Absperrung wettern die Gegner.
»Stoppt die feindliche Übernahme unseres Landes!«, ruft dort ein alter weißer Mann ins Mikrophon. Hinter ihm recken weiße Männer und Frauen Fäuste in die Luft oder halten Plakate hoch. Auf manchen steht »Für meine Heimat«, andere zeigen Bilder von Frauen mit Hijab, mit dicker roter Farbe durchgestrichen. Die Rechten schreien zornerfüllt. Alles, was sie hassen, ist direkt vor ihnen.
Wie zwei Kampfhunde an der Leine, bellend und fletschend und gerade so zurückgehalten, dass sie sich nicht zerfleischen, stehen sich links und rechts vor der Zentrale der Ökologischen Partei gegenüber. Es ist der Tag der Entscheidung. Nur noch wenige Minuten bis 18 Uhr, bis ihr Deutschland vielleicht ein anderes sein wird. Bis Sabah Hussein als erste Muslima zur neuen Bundeskanzlerin gewählt sein wird – oder auch nicht.
An vielen Orten in Deutschland ist die Gewalt bereits eskaliert. »Wo ist die Polizei?«, klagt eine verängstigte ältere Frau in einem Video, das in den sozialen Kanälen tausendfach geteilt wird, während hinter ihr ein Mob zu sehen ist, der Feuer legt, Autos zerstört, weiße Passanten verprügelt. »Fuck white privilege!«, schreien die Protestierenden. Man muss annehmen, dass die Polizei die Chaoten und Schlägertrupps unbehelligt walten lässt. Weil sie offen rechts ist, wurde die Polizei vielerorts durch andere Strukturen ersetzt.
Die rechten Extremisten wüten. Sie nennen sich Heimatkämpfer, vermummte, bullige Gestalten, die es vor allem auf Journalisten und Redaktionsgebäude abgesehen haben. Am Mittag halten plötzlich drei schwarze Vans vor dem Redaktionshaus der Pfote, einem bekannten linken Presseorgan. Binnen Minuten stürmen voll vermummte Extremisten das Gebäude, legen Feuer, schlagen Journalisten zusammen. Kurz darauf posten die Heimatkämpfer Bilder von am Boden liegenden blutüberströmten Journalisten und zertrümmerten Redaktionsräumen. Einige Pfote-Mitarbeiter können sich im Konferenzraum verbarrikadieren, kauern unter Tischen und schicken über Twitter und Instagram Hilferufe nach draußen. Die Antifakämpfer und die muslimische Schariabrigade kündigen an, zur Unterstützung zu kommen und die Heimatkämpfer zu vertreiben.
Überall Gewalt, Eskalation und Hass.
Es ist 17:50 Uhr. Im Netz und auf den Bildschirmen sind Liveaufnahmen geschaltet, die Kameras auf den Balkon der Parteizentrale der ÖP in Berlin gerichtet, auf den sie gleich hinaustreten wird. Sabah Hussein wird eine Ansprache halten an dieses so gespaltene Deutschland.
Sie selbst ist Sinnbild dieser Spaltung, einer Polarisierung, die keine Kompromisse zulässt. Entweder ist man für Sabah Hussein und für all das, wofür sie steht, Weltoffenheit, Diversität, Antikapitalismus, Feminismus, Antirassismus. Oder man ist dagegen. Welche Worte der Versöhnung kann sie finden, welche Taten ankündigen, um den Hass zu lindern? Wie nur kann sie es bewerkstelligen, sie, deren Aufstieg auch erst möglich geworden ist durch den Hass, die Spaltung, die Polarisierung?
Wie auch immer die Wahl ausgeht, wenn sie auf den Balkon tritt, werden die Massen toben und aufeinander losgehen. Und so steht für viele über all dem Lärm, den Parolen und der Gewalt an diesem Tag eine einzige Frage:
Wie konnte es so weit kommen?
2
Drei Monate zuvor
Sabah Hussein sitzt in einem Dienstwagen der Staatskanzlei. Die Hände hat sie auf das schwarze Leder gelegt, die kühle Glätte des Leders beruhigt sie. Die Fingernägel sind grellrot lackiert. Lidstrich, Lippenstift, alles perfekt. Sabah ist vor kurzem vierundvierzig geworden, aber sie sieht jünger aus. Sie achtet genau auf ihr Gewicht und darauf, was sie isst. Wegen des Glaubens trinkt sie keinen Alkohol. Jeden zweiten Morgen geht sie joggen oder macht Yoga, bevor sie das Tagesprogramm beginnt. Disziplin ist ihr wichtig. Sie verkauft ihre Politik auch durch ihr Auftreten. Vielleicht sogar vor allem durch ihr Auftreten.
Als »Kleopatra der deutschen Politik« bezeichnete sie ein Journalist einmal – und spielte dabei wohl auf ihre orientalische Erscheinung an, auf ihre Nase und auf die modischen Röcke, Schuhe und Kleider, die stets sitzen. Und die sie noch auffälliger machen, als sie ohnehin ist.
Überhaupt geht es immer vor allem darum, dass sie da ist. Die Frau, die Migrantin, die Muslima. Ihre Präsenz ist Programm. Verheißung für die einen, Provokation für die anderen. Symbol für eine weltoffene Gesellschaft, weil sie von ganz unten kometenhaft nach ganz oben kam. Und Symbol für Deutschlands kulturelle Übernahme, weil sie als Muslima allen anderen vorgezogen wurde. Um Inhalte musste sie sich lange nicht kümmern. Sie selbst war Inhalt genug. Selbst jetzt, als Kanzlerkandidatin, beschäftigt sich die Öffentlichkeit weniger mit dem, was sie sagt, als vielmehr damit, dass sie im Rampenlicht steht. Und mit der Frage: Darf sie, die Muslima, da sein, wo sie ist, und sich dahin bewegen, wo sie noch hinwill? Oder darf sie das nicht?
Im Rückspiegel treffen sich ihr Blick und der des Fahrers. Es ist nur flüchtig, und sie sprechen kein Wort, sie fühlt seine ablehnende Haltung. Sie wendet sich ab und schaut aus dem Fenster, sieht die Stadt an sich vorbeiziehen.
Dresden. Nirgendwo fühlt sich die Kanzlerkandidatin der Ökologischen Partei fremder als in Sachsen. Hier gehört sie nicht hin. Der spießige, rückwärtsgewandte Landstrich mit seinen kleinbürgerlichen Wohnzeilen. Die Enge der Platten passt zur Enge im Denken. Sie fahren durch Dresden-Friedrichstadt, vorbei an der Yenidze. Das ehemalige Fabrikgebäude ist einer Moschee nachempfunden und fällt auf in dieser so deutschen Umgebung. Heute ist es ein Bürokomplex.
»Gleich sind wir da«, sagt Jette.
Jette ist Sabahs wichtigste Mitarbeiterin, ihre Büroleiterin. Die Frauen schauen sich einen Moment an, bevor die Kanzlerkandidatin mit dem Kopf nickt und Jette wieder auf ihr Handy blickt. Seit fünf Jahren sind sie das Powerduo der deutschen Politik. Sabah ist der Star und Jette die Managerin. Ein Erfolgsteam, zuerst belächelt und inzwischen gefürchtet. Vor allem jetzt, da sie so kurz davorstehen, ins Kanzleramt einzuziehen.
Sabah weiß, dass sie ohne Jette nie so weit gekommen wäre. Sie suchte von Anfang an jemanden, dem sie voll und ganz vertrauen konnte. Es musste eine Frau sein, so viel stand fest. Jettes Direktheit gefiel ihr. Manch einer würde sie für unhöflich halten, weil sie sich nichts macht aus Small Talk und übertriebener Freundlichkeit. Schnell zum Punkt kommen. Zielstrebig und effizient. Das ist Jette.
Wie zwei Freundinnen reden Sabah und Jette miteinander, und doch sind sie distanziert. Sabah soll es recht sein, sie mag es nicht, wenn jemand sie zu gut kennt. Genau wie Jette. Obwohl sie sich fast jeden Tag sehen und ständig telefonieren oder Nachrichten austauschen, weiß Sabah wenig über Jettes Leben vor ihrer gemeinsamen Zeit. Auch hat sie keine Vorstellung davon, was Jette macht, wenn sie nicht arbeitet. Sport wahrscheinlich, zumindest wirkt sie so. Sie hat eine durchtrainierte, schlanke Figur. Und offenbar interessiert sie sich auch für Mode, wie Sabah.
Konkurrenzgefühle kommen – was Äußerlichkeiten angeht – bei Sabah nicht auf. Sie hält sich für die attraktivere Frau. Jettes Nase ist etwas zu groß, und ihre glatten, schulterlangen blonden Haare sind zu durchschnittlich, zu normal, während Sabahs Frisuren immer bestechend auffällig sind. Sie trägt die Haare mal hochgesteckt, mal in Wellen gelegt, mal zur Mähne geföhnt.
Die Limousine fährt am Neumarkt vor. Sabah steigt aus, die Absätze ihrer High Heels klackern auf dem Kopfsteinpflaster. Sie zieht den knöchellangen Rock zurecht und blickt gespannt in die Menge.
»Wir sind das Volk!«, rufen die Menschen auf dem Platz vor der Frauenkirche. Fünftausend Demonstranten seien gekommen, sagt die Polizei, zehntausend, sagen die Veranstalter. Der Platz ist umringt von Polizisten. Die Bewegung der regelmäßig stattfindenden »Islam? Nein danke«-Demo gibt es schon seit über einem Jahr, aber seitdem bekannt geworden ist, dass Sabah Hussein aussichtsreiche Kandidatin für das Amt der Bundeskanzlerin ist, findet sie immer mehr Anhänger und wächst rasant. Angeführt wird der Aufmarsch von einer Truppe aus Nationalisten, Europagegnern und Islamhassern. Dresden ist als Deutschlands braunes Biotop verschrien, wo sich die rechten Ränder des Landes öffentlichkeitswirksam versammeln und grölen.
Sabah geht auf die Demonstranten zu. Die Menschen machen ihr Platz, vielleicht weil sie nicht mit ihr reden wollen, vielleicht weil sie die Kamerateams sehen. Neben dem Haupteingang zur Frauenkirche skandiert die Menge: »Deutschland, Deutschland!«
Sabah ruft: »Ich bin auch Deutschland!«
Das Gegröle verstummt. Die Demonstranten schauen sie wutentbrannt an. Sabah fragt ruhig: »Was haben Sie denn gegen Menschen wie mich?« Aufruhr, Tumult. »Verpiss dich, du Islamnutte«, schreit einer ihr ins Gesicht. »Scheiß Lügenpresse!«, grölt einer dem Kamerateam hinter ihr zu. Mehrere Männer recken Fäuste in die Luft, die Gesichter dunkelrot vor Zorn.
Sabah schreckt zurück. Ein Personenschützer schiebt sich vor sie. Die Stimmung droht gefährlich zu werden. »Abbruch, sofort!«, ruft der Mann. Die Kanzlerkandidatin wird umringt von Sicherheitskräften. Sie eskortieren Sabah zurück zum Auto. Flink schlüpft sie in den Wagen, und einer der Männer schlägt die Tür hinter ihr zu.
»Die Szene ist toll! Wie der dich beleidigt!«
Jette hat alles mit dem Handy aufgezeichnet. Sie schaut sich das Video noch einmal an, schneidet es rasch zurecht. Sie lädt es auf Sabahs offizielle Accounts hoch und kommentiert: »Ich bin traumatisiert. Man hat mich angeschrien, attackiert, angegriffen. Aber: Ich gebe nicht auf, für eine offene und gerechte Gesellschaft zu kämpfen!« Dazu notiert sie die Hashtags #Deutschland #Dresden #Frauenkirche #Islam #Rassismus #Solidarität #ToxischeMännlichkeit und #migrantsunderattack.
Dann geht alles sehr schnell. Wie erwartet, berichten alle großen Online-Nachrichtenseiten – Globus, Echo, Bote – innerhalb einer Stunde über Sabahs Auftritt in Dresden. »Nazis greifen künftige Kanzlerin an.« Und »Brauner Mob attackiert Deutschlands muslimische Kanzlerkandidatin!« #Dresden und #Frauenkirche trenden in den sozialen Netzwerken, außerdem #Rassismus und #IchbinmitSabah.
Jettes Telefon klingelt. »Es ist Rania«, sagt sie. Nach zwei Minuten legt sie auf. »Sie macht nächsten Donnerstag eine Sendung zu Rechtsextremismus. Sie will dich dabeihaben. Der Arbeitstitel ist ›Wutbürger:innen gegen die Friedensreligion des Islam‹. Sabah, es könnte nicht besser laufen!«
Auch Sabah ist klar: Das ist gut. In der Politik zählt Aufmerksamkeit. Sie halten vor dem Hotel Taschenbergpalais, ein Fünfsternehaus in renovierter barocker Pracht. Früher nannte man den Bau wegen seiner orientalischen Einrichtung »Türkisches Palais«. Zu sehen ist davon nichts mehr. Im Innenhof lassen sie den Abend ausklingen. Jette trinkt Weißwein, Sabah Bionade. In der Ferne hören sie die Menge grölen.
»Necdum positus metus aut redierat plebi spes«, sagt Jette.
»Du weißt, ich hasse es, wenn du mit deinem Latein angibst.«
»Und noch nicht legte sich die Furcht, oder schöpfte das Volk wieder Hoffnung. Es ist ein Zitat aus Tacitus’ Beschreibung des Brandes von Rom. Unbehelligt saß Kaiser Nero in seinem Palast, von fern hörte er die Menschen schreien.«
»Aber das ist doch etwas ganz anderes.«
»Das Schreien in der Ferne? Zornige, verzweifelte Menschen ohne Hoffnung? Das ist immer gefährlich.«
»Jette, wir leben im einundzwanzigsten Jahrhundert. In Deutschland. Wer kann uns schon wirklich etwas wollen?«
Jette machen der Hass und die Ablehnung mehr zu schaffen als Sabah. »Nero kam am Ende um. Durch die Flammen, die er entfacht hatte.«
»Aber Nero war der Böse, und wir sind die Guten«, sagt Sabah und nimmt einen Schluck Bionade.
3
Zwei Tage nach Dresden sitzt Sabah Hussein am Schreibtisch ihres Büros im Innenministerium in Berlin-Mitte. Der schlichte funktionale Bau wurde 2014 fertiggestellt. Das Brandenburger Tor, die Spree, das Kanzleramt, alles ist nur wenige hundert Meter entfernt, und wenn Sabah aus dem Fenster schaut, breitet sich vor ihr das grüne Meer des Tiergartens aus. Selbst wenn sie am Schreibtisch sitzt, kann sie über die mächtigen Baumwipfel der grünen Lunge der Hauptstadt blicken.
Ihre Partei hat vor zwei Jahren durchgesetzt, dass viele Freiflächen in der Innenstadt zu Parks und Grünflächen umfunktioniert wurden. Sabah gefiel das, weil sie diese Weite von früher nicht kannte. In einem Flüchtlingslager aufgewachsen, hat sie später immer in dicht besiedelten Stadtteilen gelebt, in kleinen engen Wohnungen. Der Tierpark ist für sie ein Symbol für das andere Leben, das sie jetzt führt. Oft läuft sie vor der Arbeit auf den Schotterwegen durch den weitläufigen Park, hält ab und an inne und schaut nach oben in die dichten Blätter, während die aufgehende Sonne Lichtblitze auf ihr Gesicht wirft. Die Weite, die Stille, das Grün. Sie weiß, warum Grün die Farbe des Islam ist. Der Prophet soll sich am liebsten in grünen Gewändern gezeigt haben. Grün ist Leben, ist Frieden, ist Hoffnung. Sie kann es jedes Mal spüren, wenn sie laufen geht.
Ihr Büro ist groß und hell. Der schlichte Schreibtisch sieht so aufgeräumt aus, dass man meinen könnte, er sei bloße Dekoration. Vor der Fensterfront steht eine u-förmige hellbraune Couch, davor ein etwas aus der Zeit gefallener Glastisch. Ordnung ist für Sabah wichtig. »Da bin ich deutscher als deutsch«, sagte sie einmal in einem Interview.
Sabah lehnt sich in dem dunklen Ledersessel zurück und öffnet das Paket, das die Mutter ihr am Vortag mitgab. Sie hat ein altes Foto rahmen lassen, das die Tochter gemeinsam mit dem Vater zeigt. Als kleines Kind im Flüchtlingslager. Beide strahlen. Sie waren fröhlich, trotz der Armut und der Unsicherheit, in der sie lebten. Heute wäre Sabahs Vater achtundsiebzig Jahre alt geworden. Was wäre der Vater stolz auf seine Tochter. Was sie alles erreicht hat, wer sie geworden ist! Ach, wenn er sie nur sehen könnte!
Sabah spürt Wehmut in sich aufsteigen. Sie packt das Bild aus dem Seidenpapier und stellt es zu den anderen Fotos von den Menschen, die ihr wichtig sind und die sie zu der Person machten, die sie heute ist. Ein golden gerahmtes Bild der Eltern steht da. Wie jung ihr Vater darauf aussieht! Vor der Flucht hatte er in der nordsyrischen Hafenstadt Latakia einen kleinen Laden besessen, von dem er später immer erzählte. Latakia mit seinen Stränden und den grünen Hügeln im östlichen Hinterland. Sabah kennt Latakia nur aus den Erzählungen ihrer Eltern und von den wenigen Bildern, die sie retten und mitnehmen konnten. Und die sie ihr zeigten, die vielen Jahre, die sie zusammen im Flüchtlingslager verbrachten. Im Sommer, wenn es an der syrischen Küste heiß und schwül war, fuhr die Familie mit Freunden in die nahen Berge, nach Slinfah. Dort war es angenehm mild, und klares, kühles Wasser rauschte in kleinen Bächen ins Tal hinab, so erzählte es ihr Vater. Oder sie machten einen Ausflug auf die kleine Insel Aruad vor der Küste, wo man die Fischer beobachten konnte, wie sie früh am Morgen mit ihrem Fang vom weiten Meer zurückkehrten. Ihre Mutter erzählte einmal, am meisten vermisse sie die frischen Pistazien. Man holte sie in riesigen Säcken, rot-grüne Früchte, die man Schicht für Schicht schälen musste, um zum herrlichen Kern zu gelangen.
Ihre Eltern wären gerne in der Heimat geblieben. Aber hatten sie denn eine andere Wahl, als sie zu verlassen? Zuerst war der Krieg weit weg, im Osten des Landes und im Süden. Während woanders Menschen im Bombenhagel starben, lag die Jugend in Latakia am Strand oder traf sich abends an der Corniche, wo es an kleinen Verkaufsständen gegarte Maiskolben gab und man sich auf die Motorhauben der parkenden Autos setzte und Späße machte. Dann kam der Krieg näher. Zuerst bemerkten sie es an den Militärfahrzeugen mit schwerem Geschütz, die durch die Straßen fuhren. Später überflogen die ersten Kampfflieger die Stadt. Dann fielen die Bomben.
Sabah stellt das Bild ihrer Eltern zurück an seinen Platz und lässt die Gedanken schweifen. Vielleicht ist es der Geburtstag des Vaters, jedenfalls denkt sie sonst nur ungern an die Vergangenheit.
Ein kleineres Foto auf ihrem Schreibtisch zeigt einen freundlich lächelnden Mann mit Vollbart. Es ist Muhammad Abd al-Malik, der Imam der al-Dunja-Moschee in Berlin-Neukölln. Als junger Mann kandidierte er in Tunesien für die islamische al-Nahda und kam später als Imam nach Deutschland. Als Sabah ein junges Mädchen war, hat er ihr Halt gegeben. Halt, den ihr die Familie nicht geben konnte, nicht weil die Eltern es nicht gewollt hätten und nicht liebevoll oder besorgt genug um ihre Tochter waren, sondern weil sie kaum Zeit hatten und sich darum kümmern mussten, mit einfachsten Jobs genug Geld für ihre Familie nach Hause zu bringen. Auch verstanden sie die Welt um sich herum kaum, wie hätten sie diese denn ihren Kindern erklären und die Zerrissenheit, die Sabah in Deutschland spürte, lindern können? Zum Beispiel, wenn sie ihren Eltern erzählte, wie sie zum Schwimmunterricht musste und die Lehrer erwarteten, dass sie sich fast nackt zeigte? Die Eltern erzogen sie im Sinne ihrer Religion, sagten ihr, dass sich Mädchen bedecken sollten, und waren froh, als sie sich entschied, den Hijab zu tragen. Erst später begriff sie, dass die Eltern genauso zerrissen waren wie sie. Sie wollten ankommen, dazugehören, alles richtig machen, aber sie wollten doch auch ein gottgefälliges Leben führen!
Muhammad Abd al-Malik hatte Antworten, die sie sonst nirgendwo bekam. Er war nur fünfzehn Jahre älter als sie und darum näher dran an ihrem Leben und den Sorgen und Fragen, die sie hatte. Als sie vom Schwimmunterricht erzählte und ihn fragte, was sie tun solle, machte er ihr klar, dass sie im Recht sei. Eine Muslima dürfe sich nicht den entehrenden Blicken von Jungen und Männern ausliefern.
»Vertrau mir«, sagte er. »Ich regle das.«
Er schrieb einen Brief an die Schule, er forderte, dass Sabah aus Rücksicht auf ihre religiösen Gefühle im Burkini schwimmen dürfe. Die Schule war skeptisch. Abd al-Malik schickte den Brief an die Medien und setzte die Schule unter Druck. Muslimische Verbände, Antidiskriminierungsstellen und die ÖP liefen Sturm, weil ein Mädchen in seiner Religionsfreiheit eingeschränkt wurde, und bald durfte Sabah im Burkini am Schwimmunterricht teilnehmen.
Jeden Freitag ging Sabah mit ihrem Vater und ihren Brüdern in die al-Dunja-Moschee. Er setzte sich mit den Söhnen in den großen Hauptraum, während sie die Predigt auf dem Bildschirm im Frauenbereich mitverfolgte. Später ging sie mit den Schulfreundinnen in die Moschee. Abd al-Maliks Predigten waren konservativ, aber nicht radikal. Er sprach von Keuschheit, Gottesfurcht und Glaubensstärke, er betonte, dass Muslime ein starkes Band bilden müssten, um sich gegen Andersgläubige zu behaupten. Er wies auch darauf hin, dass sich Muslime von den christlichen Feiertagen möglichst fernhalten sollten. Aber nie rief er zu Gewalt auf, und er erklärte regelmäßig, was Dschihad wirklich bedeute. Nämlich nicht, die Ungläubigen zu töten, sondern sie mit Argumenten auf den richtigen Weg zu bringen.
Er wurde zu einem ihrer wichtigsten Berater. Als sie in der Politik anfing, als sie immer stärker getragen und gefördert wurde von Frauennetzwerken und Feministinnen, da ging ihr ein Hadith immer wieder durch den Kopf: »Ein Volk, das seine Angelegenheiten einer Frau anvertraut, wird nie Erfolg haben.« So soll es der Prophet gesagt haben! Sabah fragte sich, was das für sie und ihre Vorhaben bedeutete, für sie, eine gottesfürchtige Frau, die ehrgeizig war und eine Welt voller Möglichkeiten vor sich sah.
An einem Freitag, nachdem die Männer den Gebetsraum verlassen hatten, suchte sie das Gespräch mit Muhammad Abd al-Malik. »Imam«, sagte sie, »ich bin unsicher. Handle ich gegen Gottes Ordnung?«
Sie setzten sich auf zwei Stühle an der einen Seite des großen Gebetsraums nahe dem Eingang. Abd al-Malik sah sie an. Sie war nicht mehr das kleine Mädchen, das mit der Familie zum Gebet herkam, sondern eine attraktive Frau, in westlicher Kleidung. Abd al-Malik schlug den Koran auf und las ihr eine Sure vor: »Siehe, dort fand ich eine Frau, die Königin über sie ist. Von allen Dingen wurde ihr gegeben, und sie besitzt einen großartigen Thron.«
»Du kennst die Geschichte, Schwester«, sagte er. »Es ist die Geschichte von Bilkis, der Königin von Saba. Ich erzähle sie dir. Als König Suleiman von Bilkis und ihrem unvergleichlichen Thron hörte, schrieb er ihr einen Brief und forderte sie auf, den Islam anzunehmen und zu ihm zu kommen. Das stürzte Bilkis in ein Dilemma. Der Brief stammte von einem mächtigen Mann, der ihr Land versklaven könnte, wenn sie sich nicht fügte. Aber sie wollte sich auch keinem falschen Propheten unterwerfen. Sie machte sich auf den Weg. Suleiman befahl währenddessen einem Dschinn, Bilkis’ Thron zu holen und ihn so zu verändern, dass Bilkis ihn nicht wiedererkennen konnte. Die Gelehrten sind sich bis heute nicht einig, warum Suleiman das wollte. Als Bilkis bei ihrer Ankunft gefragt wurde, ob der Thron der ihre sei, sagte sie: ›Es sieht so aus, als könnte er es sein.‹ Dann fügt sie hinzu, sie sei als jemand gekommen, der sich Gott bereits unterworfen habe. Bis heute sehen die Gelehrten in Bilkis eine Frau von höchster Intelligenz.«
»Was heißt das für mich?«, fragte Sabah.
»Dass du alles werden kannst, solange du dich Gott unterwirfst.«
Die Worte hallten lange in ihr nach. Sich Gott zu unterwerfen, ist für jeden Muslim und für jede Muslima selbstverständlich. Aber das Gleichnis von Bilkis bedeutete auch noch etwas anderes. Dass Allah alles Handeln bestimmte, auch das politische. Dass sie sich nicht nur als Privatperson Gott unterwarf, sondern immer und überall. Dass Gottes Gesetze über allem standen. Seine Ordnung, seine Regeln. Und das war in Deutschland noch nicht der Fall. Welcher Muslim konnte das Freitagsgebet schon so verrichten, wie er es tun sollte? Das passte immer noch nicht zusammen mit den Arbeitszeiten. Unternehmen ignorierten Gottes Gebote! Wie schwer war es doch, halal zu essen, wenn man unterwegs war! Und dann die sexuelle Freizügigkeit, ein Werk des Schaitan, des Teufels.
Nach Tagen des Nachdenkens war klar: Sie würde sich dafür einsetzen, dass Deutschland auch das Land der Muslime würde, die hier lebten. Damit sie nach ihren Regeln leben konnten. Und sie dachte an die Ökologische Partei, die ihr Anliegen, im Burkini am Schwimmunterricht teilzunehmen, verstand und sie dabei unterstützte. Diese Partei konnte etwas bewirken! Sie setzte sich mit ihren Zielen und ihrem Programm auseinander. Ja, die ÖP müsste die Partei sein, mit der sie das verwirklichen könnte. Sabah hatte ihre Richtschnur gefunden, dank Imam Muhammad Abd al-Malik.
Und dann ist da noch ein Foto von Gerhard Reuter. Es zeigt Sabah und den Bundesinnenminister gemeinsam an Sabahs erstem Arbeitstag im Ministerium, an dem Tag, der ihr Leben verändert hat. Sie sieht Reuter fast täglich, aber seine Bedeutung für sie ist riesig. Er hat ihr geholfen, in kurzer Zeit so weit zu kommen. Sabah kann sich noch genau an den Abend erinnern. Sie saß auf einem Podium zum Thema »Vielfalt konkret«. Sie war eine junge Beamtin, gerade fertig mit der Uni und erst wenige Monate im Job. Eigentlich sollte verhandelt werden, wie gut die deutsche Verwaltung Vielfalt förderte, aber der Moderator interessierte sich vor allem für ihre Kindheit im Flüchtlingslager, für ihre Erfahrung mit Rassismus, für ihre strukturelle Benachteiligung als Frau. Nie zuvor hatte man sie so eingehend dazu befragt, schon gar nicht vor Publikum. Es dauerte etwas, bis sie sich freigesprochen hatte. Bis sie selbstbewusster wurde.
Sabah muss Eindruck gemacht haben auf Gerhard Reuter. Drei Tage später rief er sie an und bot ihr einen Job an. Als stellvertretender Vorsitzender der ÖP und als Bundesinnenminister schuf er für sie den Posten der Sonderbeauftragten für öffentliche Dialoge. Sabah wusste, dass das ihre große Chance war, und nach zwei Wochen bezog sie das Büro mit dem Blick über das grüne Meer des Berliner Tiergartens.
Sonderbeauftragte für öffentliche Dialoge. So wunderbar wolkig der Titel, so wenig definiert war das, was sie tun sollte. Aber das ließ ihr große Freiheiten und die Möglichkeit, sich in fast jede Debatte einzumischen. Reuter ist wie ein Vater für Sabah, er behandelt sie, als wäre sie seine Tochter. Nicht nur ist er einer der einflussreichsten Politiker Deutschlands, altgedient, bestens vernetzt, hoch anerkannt, er steht auch unter Druck. Denn es drängen immer mehr Frauen und Migranten an die Macht. Weiße Männer, zumal in der ÖP, haben einen schweren Stand. Die älteren werden ersetzt, die jüngeren haben kaum Aussicht auf eine Karriere, weil sie nicht vielfältig sind. Reuter konnte sich bisher halten, weil er schon früh massiv auf Vielfalt setzte und die anderen alten weißen Männer längst weggelobt oder einfach verabschiedet hatte. Gerhard Reuter und Sabah telefonieren regelmäßig, und er braucht ihren Rat, wenn es darum geht, wie er auf Islamdebatten reagieren soll, was er nach islamistischen Vorfällen schreiben und sagen kann. Der Glanz des Integrationswunders färbt auch auf ihn ab.
Es klopft, Anna Soll steht in der Tür. Sabah schaut auf.
»Ich bin ein paar Minuten zu spät«, sagt Anna Soll, leitende Politikreporterin im Hauptstadtbüro des Globus, »entschuldige.« Die Frauen kennen sich gut. Ganz selbstverständlich legt Anna die Handtasche auf der Couch ab.
»Natürlich«, sagt Sabah und geht auf Anna zu. »Ich freue mich, dass du da bist.« Sie begrüßen sich mit Wangenküssen. Anna ist auch manchmal privat zu Gast bei Sabah, wenn diese bei sich zu Hause einen Salon hält, wie sie es nennt. Sie kocht für befreundete Journalistinnen und bietet einen geschützten und entspannten Rahmen für angeregte politische und kulturelle Gesprächsrunden.
Nach dem erfolgreichen Video von Dresden hat die Reporterin vorgeschlagen, ein Interview für die Globus-Website aufzunehmen. Anna war in der Presseabteilung der Ökologischen Partei Volontärin und danach ein paar Jahre im Abgeordnetenbüro der ÖP in Brüssel tätig gewesen, bevor sie zum linksliberalen Globus wechselte, dem auflagenstärksten wöchentlichen Nachrichtenmagazin des Landes. Sie schreibt über Rechtsextremismus, Nachhaltigkeit und Feminismus und setzt sich auch in der Redaktion für diese Themen ein. Sie ist in der Leitungsgruppe Diversität aktiv und stolz auf ihr Engagement. Sie zeigt ihre Überzeugungen auch, indem sie sich an die zeitgemäßen nichtbinären, feministischen und antirassistischen Stilvorstellungen hält. Sie trägt den weiten einfarbigen Genderkaftan, der jegliche Körperformen neutral verhüllt und bereits von zahlreichen progressiven Frauen und Männern und Diversen ganz selbstverständlich getragen wird. Nur die Rechten hetzen, der Kaftan ähnele dem einteiligen Männergewand in muslimischen Ländern. Anna hat ihr Haar geschlechtsneutral stoppelkurz geschnitten, und ihre Füße stecken in den von gendersensiblen Experten empfohlenen Unisexboots »Birkendocs«. Die schlichten schwarzen Schuhe mit der orangen Plateausohle sind eine erfolgreiche Kooperation von Birkenstock und Dr. Martens.
»Im Interview sieze ich dich wie immer, einverstanden?«
»Klar«, sagt Sabah.
»Bereit?«
»Schieß los.«
»Frau Hussein, Sie sind Sonderbeauftragte für öffentliche Dialoge und nun auch die aussichtsreiche Kanzlerkandidatin der ÖP. Frau, Muslima, Migrantin. Eine solche Kanzlerkandidatin hat es noch nie gegeben. Wie fühlt es sich an, die sprichwörtliche bunte Hündin zu sein?«
»Das ist nichts Neues. Das ist so, seit ich nach Deutschland gekommen bin.«
»Wann ist Ihnen zum ersten Mal bewusst geworden, dass Sie und Ihre Familie wegen Ihrer Herkunft diskriminiert werden?«
»Es gab nicht das eine Ereignis. Es war vielmehr so, dass ich mich als kleines Mädchen in Deutschland gewundert habe, warum weiße Menschen teure Autos fahren, schicke Klamotten tragen und in großen Häusern wohnen. Und wir nicht.«
Anna nickt vielsagend.
»Das habe ich nicht verstanden, bis mir klar wurde: Es liegt daran, dass wir nicht als diesem Land zugehörig akzeptiert wurden. Dass wir arm gehalten wurden und unter dem Rassismus und der Ausbeutung zu leiden hatten, die die Weißen vor Jahrhunderten reich gemacht haben. Und dass diese Ungleichheit sich bis heute fortsetzt.«
Jetzt kommt auch Jette dazu. Sie ist bei Interviews wenn möglich immer dabei. Mal gibt sie Sabah durch eine Geste zu verstehen, besser nichts zu sagen oder nur eine Floskel. Mal greift sie direkt ein und lenkt das Gespräch bei heiklen Fragen in eine unverfängliche Richtung. Bei Anna und dem Globus hat Sabah allerdings nichts zu befürchten.
»Sie engagieren sich gegen Antisemitismus. Woher kommt Ihre Überzeugung?«
»Ich weiß, was es bedeutet, ausgegrenzt zu sein und verfolgt. Im Netz findet eine Treibjagd auf mich statt. Morddrohungen stehen an der Tagesordnung. Die Angst, das Gefühl, nicht sicher zu sein, das ist wie damals, als hier nicht die muslimischen, sondern vor allem die jüdischen Bürger:innen verfolgt wurden.«
»Welcher Hass schlägt Ihnen entgegen seit Ihrer Kandidatur?«
»Der Hass ist extrem, aber das ist er schon so lange, wie ich auf der politischen Bühne stehe. Durch die Kandidatur hat sich die Anzahl an Hasszuschriften einfach deutlich erhöht.«
»Warum ist das so?«
»Wir sehen immer wieder, wie tief verwurzelt Rassismus und Islamophobie in unserer Gesellschaft sind. Wir arbeiten seit einigen Jahren gezielt dagegen an. Aber es verändert sich nur langsam etwas, und bei manchen hält sich der Hass hartnäckig.«
»Wie gehen Sie damit um?«
»Es spornt mich an weiterzumachen. Es zeigt mir, dass wir noch viel Arbeit vor uns haben, unsere Gesellschaft so zu verändern, dass Menschen, egal welcher Herkunft, Religion oder Hautfarbe, vorurteils- und diskriminierungsfrei hier leben können.«
»Wie wollen Sie etwas verändern?«