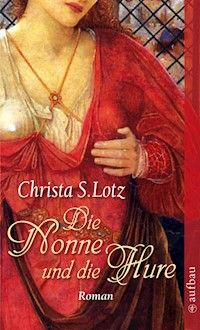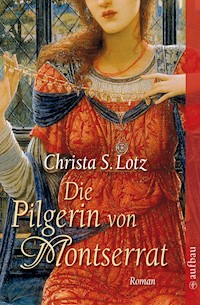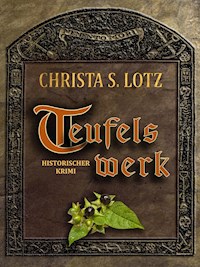8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Fluch der Liebe. Man schreibt das Jahr 1634. Noch ist der Schwarzwald von den Wirren des Dreißigjährigen Krieges verschont geblieben. Doch im September ziehen plündernde Truppen des Kaisers durchs Land. Sie verwüsten die kleine Stadt Calw, wo die junge Elisabeth mit ihrer Familie lebt. Zusammen mit ihrer Schwester Agnes wird Elisabeth von Jakob, einem Musketier, entdeckt, der ihnen zur Flucht in die Wälder verhilft. Elisabeth verliebt sich in ihn, doch ihr Weg führt sie nach Baden-Baden. Sie wird die Leibköchin des Kardinals Thomas Weltlin. Bald schon ahnt sie, dass der Kardinal sich in sie verliebt hat. Wenig später ziehen die Truppen des Kaisers heran und belagern das Schloss. Nach einem Gemetzel entdeckt Elisabeth den schwerverwundeten Jakob und pflegt ihn heimlich in einem Gartenhaus. Ständig ist sie in Gefahr, von ihrer Schwester, dem Kardinal oder den Bediensteten entdeckt zu werden. Als Jakob wieder gesund ist, kehrt er zum kaiserlichen Tross zurück. Elisabeth tut alles dafür, einen Weg zu ihm zu finden, und gerät dabei selber in Lebensgefahr ... Ein opulenter historischer Roman über eine Köchin und ihre unmögliche Liebe.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 590
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
CHRISTA S. LOTZ
DIEKÖCHINUND DERKARDINAL
Roman
Impressum
ISBN 978-3-8412-0593-3
Aufbau Digital,
veröffentlicht im Aufbau Verlag, Berlin, Juni 2013
© Aufbau Verlag GmbH & Co. KG, Berlin
Die Originalausgabe erschien 2013 bei Aufbau Taschenbuch, einer Marke der Aufbau Verlag GmbH & Co. KG
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jegliche Vervielfältigung und Verwertung ist nur mit Zustimmung des Verlages zulässig. Das gilt insbesondere für Übersetzungen, die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen sowie für das öffentliche Zugänglichmachen z.B. über das Internet.
Umschlaggestaltung Mediabureau Di Stefano, Berlin unter Verwendung eines Gemäldes von Dosso Dossi/Bridgeman Library
Konvertierung: le-tex publishing services GmbH, www.le-tex.de
www.aufbau-verlag.de
Inhaltsübersicht
Cover
Impressum
1. BUCH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2. BUCH
10
11
12
13
14
15
16
17
3. BUCH
18
19
20
21
22
23
24
25
26
4. BUCH
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Nachwort
Informationen zum Buch
Informationen zur Autorin
1. BUCH
(September 1634 – November 1634)Flucht
1.
Eine Trompete wurde zum Angriff geblasen, gefolgt von einem dumpfen Trommeln. Elisabeth lief zum Fenster und schaute hinaus. Der Marktplatz lag friedlich in der Morgensonne, der Brunnen plätscherte, allerlei Volk war unterwegs.
Noch einmal ertönte das Trompetensignal, das Trommeln wurde heftiger. Und dann kamen sie von überallher, ein Wald aus Piken, von jeder Gasse und aus jedem Winkel. Nein, sagte sie sich, das kann nicht sein, das ist nur ein Alptraum. Die kaiserlichen Soldaten waren da, sie fielen über Männer, Frauen und Kinder her, stachen mit ihren Piken auf sie ein, Blut spritzte, markerschütternde Schreie ertönten. Die Söldner schleppten Geschirr, Möbel und Bettzeug aus den Häusern, legten Feuer und drohten den Bewohnern, ihnen die Därme herauszureißen, wenn sie die Verstecke ihrer Wertsachen nicht verrieten. Und dann hatten die Soldaten Elisabeth am Fenster entdeckt. Sie rannten zur Tür, stießen sie auf und polterten die Treppe herauf. Elisabeths Herz klopfte wie ein Hammer gegen die Rippen. Wo sollte sie sich verstecken? Was würden sie mit ihr anstellen? Die Tür flog mit einem Krachen auf, eine Horde von Männern drängte herein. Elisabeth stand wie fest gewurzelt, konnte sich nicht rühren. Der vorderste Mann, mit einem wilden Bartgestrüpp vor dem Mund, hob seine Pike, von der Blut herabtropfte. Vor Elisabeths Augen drehte sich alles. Und dann stach der Soldat zu. Elisabeth spürte einen brennenden Schmerz im Bauch, sie griff dorthin, Blut rann an ihren Händen herab, es roch süß und metallisch. Sie fiel, ihr Körper schlug auf den Boden. Elisabeth riss die Augen auf. Die Männer verschwanden wie in einem Nebel, es wurde still. Sie rieb sich die Augen.
Der Geruch nach Feuer und Blut stand ihr noch in der Nase. Die Schmerzen im Bauch ebbten langsam ab. Elisabeth schlug die Decke zurück, erhob sich von der Strohmatratze, lief zum Fenster und stieß den Laden auf. Kalte Luft strömte herein. Piken und Soldaten waren verschwunden. Die kleine Stadt Calw, von Mauern umschlossen und mit Türmen bewehrt, erwachte zum Leben. Die Sonne war hinter Nebelwolken versteckt, ein Hahn krähte sich die Seele aus dem Leib. Handwerker überquerten den Platz auf dem Weg zur Arbeit. Im Marktbrunnen strömte das Wasser wie eh und je, und aus den Häusern drang das Klappern von Geschirr. Elisabeth rieb sich mit den Fingern über die Stirn, um den bösen Traum zu verscheuchen. Mochte er nur niemals Wirklichkeit werden! Sie holte ein Wollkleid aus der Truhe neben dem Bett, zog es mit ein wenig zittrigen Fingern an und band ihre langen Haare zur Seite. Elisabeth verließ die Kammer und lief die knarrenden Stufen der Treppe hinunter. Aus der Küche hörte sie die Magd mit Töpfen hantieren. Elisabeths Mutter gab Anweisungen für die Tagesarbeit. Elisabeth ging durch den Flur hinaus in den Hinterhof, um sich das Gesicht in der Wassertonne zu waschen. Erfrischt kehrte sie in die Küche zurück und begrüßte Mutter und Magd. Elisabeths Vater, Mesner des protestantischen Städtchens, ihr Bruder Lukas und ihre Schwester Agnes betraten hintereinander die Küche. Zusammen mit Elisabeth und der Mutter ließen sie sich an dem blank gescheuerten Holztisch nieder. Die Magd stellte einen Topf mit Haferbrei auf den Tisch und setzte sich ebenfalls dazu. Der Vater schaute Agnes tadelnd an, als sie zu ihrem Silberlöffel griff. Mit seinem Dreiecksbart und dem Spitzenkragen über der schwarzen Soutane sah er dem Superintendenten der Stadt, Johannes Valentin Andreä, recht ähnlich.
Der Vater senkte den Kopf, faltete die Hände, die anderen taten es ihm nach. Er betete: »O Herr, öffne meine Lippen.
Und mein Mund soll sprechen mein Lob.
Beschütze uns vor allem Übel, das da kommen soll.
Lobet den Herrn.
Der Name des Herrn sei gelobt. Amen.«
»Amen«, wiederholten die anderen, bevor sie sich dem heißen Brei zuwendeten. Eine Weile herrschte Stille, derweil gedämpftes Klappern von Löffeln erklang. Der Vater hatte das Frühmahl beendet und schob seine Schüssel aus bunter Keramik von sich.
»Liebe Familie«, begann er seine tägliche Ansprache. »Wie wir alle wissen, haben die Kaiserlichen die Schlacht bei Nördlingen gewonnen. Ich bin in großer Angst und Sorge um uns alle, denn danach haben sie die Städte Göppingen und Schorndorf eingenommen und befinden sich jetzt in Stuttgart. Sie schonen die Einwohner nicht, sondern foltern und quälen sie, um die Verstecke der Reichtümer aus ihnen herauszupressen. Sie schrecken vor nichts zurück, auch nicht vor Vergewaltigung«, sein Gesicht überzog sich mit einer leichten Röte, »Brandstiftung und Mord. Sie sollen die Stuttgarter Geistlichen bis aufs Blut gequält haben. Jetzt seien sie auf dem Weg nach Tübingen und Herrenberg, hat mir der Stadtvogt gesagt.«
»Um Jesu willen«, sagte seine Frau, die aschfahl geworden war. Elisabeth war es, als röche sie wieder den Brandgeruch.
»Ich habe heute Nacht davon geträumt«, sagte sie mit gepresster Stimme. »Was sollen wir tun, Herr Vater, wie können wir uns schützen?«
»Am besten geben wir ihnen alles, was wir haben«, warf Agnes ein. Alle starrten sie entsetzt an.
»Das wäre eine große Sünde«, erwiderte der Vater. »Denn sie würden es nur versaufen, verfressen und zur Verbreitung ihrer papistischen Lehre verwenden. Wir sollten erst einmal abwarten, was geschieht.«
»Sollen wir warten, bis sie hier einfallen wie ein Schwarm Hornissen und uns alle massakrieren?«, rief die Mutter mit schriller Stimme. »Lasst uns hinauf ins Waldgebirge gehen, zu meiner Schwester in Neuweiler, da wären wir in Sicherheit!«
»Das kommt gar nicht in Frage, Weib!«, knurrte der Vater. Sein Bart zitterte.
»Die haben doch selbst nicht genug zum Leben, und außerdem wäre es feige, unsere Brüder und Schwestern hier im Stich zu lassen.«
»Sie könnten doch mit uns gehen«, warf Elisabeth ein.
»Und dem Feind die Stadt kampflos überlassen?«, fuhr ihr Vater auf. »Unser Haus hergeben, unser ganzes Leben hier?«
»Wir könnten uns doch im Keller oder auf dem Dachboden verstecken«, meinte Lukas.
»Da werden sie uns gewiss bald finden«, gab die Mutter zurück.
»Ich werde gleich zum Superintendenten gehen und mich mit ihm besprechen«, sagte der Vater und erhob sich vom Tisch. »Ihr geht eurem Tagwerk nach, das ist Gottes Wille. Betet und kommt heute Abend in die Kirche, der Superintendent wird uns einiges zu sagen haben.«
»Ach, wären wir doch in Ettlingen oder in Baden«, seufzte die Mutter. »Da würde der Markgraf seine schützende Hand über uns halten.«
»Wir bleiben«, beschied der Vater und war gleich darauf zur Tür hinaus.
»Schade, dass der Superintendent zur Zeit keinen Unterricht für euch drei abhält«, meinte die Mutter.
»Er hat andere Sorgen, hat er gesagt«, erwiderte Elisabeth. »Aber ich kann mich nützlich machen, könnte auf den Markt zum Einkaufen gehen und später kochen.«
»Was willst du denn heute kochen?«, fragte Agnes.
»Ich weiß nicht, ob ich überhaupt etwas herunterbringe«, wandte die Mutter ein.
»Ja!«, ließ sich Elisabeths Bruder Lukas vernehmen. »Ich möchte mal wieder saure Leber haben!«
»Mal schauen, was es auf dem Markt gibt«, sagte Elisabeth. Ihre Mutter händigte ihr einen Korb und einen Lederbeutel mit ein paar Gulden und Kreuzern aus.
»Treib dich aber nicht zu lange in der Stadt herum, wer weiß, was passiert!«, mahnte die Mutter.
»Ich bin groß genug mit meinen achtzehn Jahren!«, fuhr Elisabeth auf.
»Die Jahre schützen dich nicht davor, von Männern belästigt zu werden«, gab die Mutter zurück. Zu Agnes gewandt, fügte sie hinzu: »Und du kannst die Stube fegen und die Wäsche waschen.«
Agnes verzog maulend das Gesicht.
»Warum darf ich nicht auf den Markt gehen? Warum darf immer Elisabeth rausgehen und ich nicht?«
»Weil sie uns das Mittagessen kocht, darum. Außerdem ist sie zwei Jahre älter als du.«
Elisabeth warf sich eine wollene Schecke über, griff nach dem Korb und trat hinaus auf den Platz. Es war immer noch düster und kalt, die Sonne schaffte es nicht, durch den Hochnebel zu dringen. Knechte und Mägde zersägten Buchen- und Tannenholz, das aus den Wäldern gebracht worden war. Hausfrauen mit schwarzen Hauben eilten geschäftig hin und her, um einzukaufen oder Birnen und Äpfel aus ihren Gärten zu holen, die sie einmachen oder für den Winter dörren würden. Elisabeth ging die wenigen Schritte zum Rathaus hinunter. Hier hatten die Bäcker und die Metzger ihre Bänke. Sie verkauften Brot, Dinnete, Mehlfladen mit Speck, Hutzelbrot und Brezeln. Die Metzger priesen Querrippe vom Rind, Schweinefüße, Lammhals, Bries, Leber und Lunge an. In einen Steinguttopf war Schmalz gefüllt, in einen anderen Butter. Elisabeth kaufte eine große Leber vom Rind, ein Töpfchen Schmalz, ein Viertelpfund Speck und Brot. Von einem der Bauern ließ sie sich Äpfel in den Korb füllen. Mit einer Kanne Milch beladen, trat sie den Rückweg zum Elternhaus an. In diesem Augenblick wurde es laut auf dem Platz. Eine Gruppe jüngerer Leute torkelte zum Brunnen und ließ sich an dessen Rand nieder. Sie trugen Pumphosen, Stulpenstiefel, Wämser aus gewalktem Tuch und Federhüte. Mein Gott, das ist ja der Stadtvogt mit seinen Kumpanen, dachte Elisabeth, muss er sich in dieser Zeit betrunken hier herumtreiben? Die Männer stimmten einen Gesang an und drehten sich dazu im Kreis. Als Elisabeth ihren Weg fortsetzen wollte, kam ein Mann zu ihr herüber.
»Darf ich Euch geleiten, schönes Kind?«, fragte er mit schwerer Zunge. Sein Atem roch nach Wein.
»Geleite Er sich lieber selbst zurück auf den Pfad der Tugend!«, gab sie zurück.
Verdutzt blieb der Mann stehen. Er machte einen drohenden Schritt auf sie zu. Dann reckte er den Kopf.
»Potz Stern!«, rief er. »Die Frau ist aber nicht auf den Mund gefallen!«
Elisabeth lief schnell zurück ins Haus ihrer Eltern.
»Was ist? Du bist ja ganz außer Atem«, sagte ihre Mutter, die ihr den Korb und die Kanne aus der Hand nahm.
»Ich musste mich vor einem Trunkenbold retten«, entgegnete Elisabeth, »und ich verstehe nicht, warum sich unser Stadtvogt am helllichten Tag besäuft, anstatt sich um die Geschicke der Stadt zu kümmern.«
»Dem ist es völlig gleichgültig, was aus uns wird«, sagte die Mutter mit einem Seufzer. »Wir müssen uns selber helfen, dann hilft uns Gott.«
Sie stellte Korb und Kanne auf den Küchentisch.
»Nun walte deines Amtes als Köchin«, meinte sie.
Die Mutter zog sich zurück, wahrscheinlich zum Beten. Elisabeth nahm ein Messer, legte die Leber auf ein Brett und begann sie aufzuschneiden. Blut tropfte ihr über die Finger. Sie zögerte einen Augenblick, schnitt dann die Leber in fingerdicke Schnitten, streute Salz und Pfeffer darüber und legte die Scheiben auf den Rost des Ofens. Während sie langsam rösteten, schnitt Elisabeth Speck, den sie zusammen mit Schmalz in einer gusseisernen Pfanne ausließ. Darin briet sie die geschnittenen Äpfel und Grieben. Aus dunklem, in Fleischbrühe eingeweichtem Brot, Mehl, Zimt, Muskatnuss und Essig stellte sie eine dunkle Soße her, gab die Leberstücke in die Pfanne und ließ alles eine halbe Stunde kochen. In der Zwischenzeit brachte sie in einem Topf Wasser zum Sieden und schabte einen Teig aus Eiern, Mehl und Milch hinein. Die Uhr von der nahen Kirche schlug die zwölfte Stunde, der Vater würde bald heimkehren. Agnes und Lukas kamen in die Küche.
»Das riecht aber gut«, sagte Agnes. Sie steckte den Finger in die Soße und leckte ihn ab.
»Warte, bis das Essen auf dem Tisch steht!«, rief Elisabeth und drohte ihr mit dem Zeigefinger. »Mach dich lieber nützlich! Du kannst Schüsseln, Teller und Besteck aufdecken.«
Die Familie versammelte sich um den Tisch. Elisabeth trug die Leber in einer Schüssel auf und goss Äpfel, Schmalz und Grieben darüber. Sie ließ die Teigwaren in einem Seiher abtropfen und gab sie in eine weitere Schüssel. Nach dem Gebet begannen sie zu essen. Der Vater legte Gabel und Löffel beiseite, lobte Elisabeths Kochkunst und berichtete über das, was er im Pfarrhaus erfahren hatte.
»Unser Superintendent Andreä hat sich entschlossen, zusammen mit seiner Frau die Stadt zu verlassen. Er wird nach Neuweiler zum dortigen Pfarrer gehen. Sie nehmen mit, was sie tragen können.«
»Warum schließen wir uns ihnen nicht an?«, fuhr seine Gattin auf.
»Ja, lasst uns fliehen!«, pflichtete Elisabeth ihr bei. »Die Kaiserlichen können jeden Tag eintreffen.«
»Aber nicht nach Neuweiler, nach Baden will ich gehen!«, versetzte Agnes.
»Wir bleiben«, beharrte der Vater. »Uns werden sie verschonen, denn wir haben nicht viele Reichtümer.«
»Und was ist mit den Bildern von Cranach und Dürer, was mit dem Tafelsilber für hohe Feiertage?«, warf die Mutter ein. »Und mit der Truhe voller Goldgulden?«
»Das ist alles wohlverwahrt und versteckt. Auf dem Dachboden.«
»Dann befehle ich uns in Gottes Hand«, sagte die Mutter. Als wäre es ein Zeichen gewesen, ertönte in diesem Augenblick eine Glocke auf dem Marktplatz. Alle sprangen auf und liefen hinaus. Der Büttel des Stadtvogtes hatte sich am Brunnen aufgestellt. Von überall her strömten die Menschen herbei, derweil der Büttel weiter die Glocke schwang. Viele hatten ihre Fenster geöffnet und harrten gespannt der Dinge, die da kommen sollten.
»Eine Nachricht hat unsere Stadt erreicht«, verkündete der Büttel feierlich. Die Feder auf seinem Filzhut wippte bedenklich. »Ein Bote kam geritten und überbrachte die Nachricht, dass die Kaiserlichen Herrenberg geplündert hätten und nun auf dem Weg zu uns seien. Hier gäbe es etwas zu holen, so erzähle man sich im feindlichen Lager.«
Ein Stöhnen ging durch die Menge. Dann kam Bewegung in sie.
»Wo ist denn unser Stadtvogt?«, rief ein Mann. »Warum kommt er nicht selbst und steht uns bei in dieser schweren Stunde?«
»Er lässt sich entschuldigen«, antwortete der Büttel. »Und er lässt euch sagen, dass ihr Ruhe bewahren und in euren Häusern bleiben sollt.«
Vom Fluss her war ein Schuss zu hören.
»Sie kommen!«, kreischte eine Frau. Eine Welle der Angst ergriff die Calwer Bürger.
Kopflos rannten sie in alle Richtungen davon, den Stadttoren zu. Elisabeth wurde von der Menge mitgerissen, sie rannte um ihr Leben. Ob die Stadttore offen waren? Würden sie es schaffen, vor den Augen der Kaiserlichen aus der Stadt hinauszukommen? Wo waren ihre Eltern und ihre Geschwister? Elisabeth konnte sie nirgends entdecken. Gänse stoben laut schnatternd davon, Schweine quiekten und brachten sich vor den rennenden Leuten in Sicherheit. Als sie das äußere Tor erreichten, sah Elisabeth, dass es verschlossen war. Von außen wurde dagegen gehämmert. Um Gottes willen, dachte Elisabeth, lass sie nicht hereinkommen, lass diesen Kelch an uns vorübergehen! Jetzt war das Tor offen, und Männer mit blutverschmierter Kleidung strömten herein. Elisabeth erkannte den Metzger unter ihnen, der ihr am Morgen die Leber verkauft hatte. Ihr fiel ein, dass vor dem Tor der Metzgerplatz lag, wo Rinder, Schweine und Hühner geschlachtet wurden.
»Gott sei Dank habt ihr das Tor geöffnet«, rief einer der Metzger. »Wir fühlen uns nicht mehr sicher da draußen.«
»Wer hat geschossen?«, fragte eine befehlsgewohnte, leicht schwankende Stimme. Elisabeth erkannte den Stadtvogt.
»Es muss einer von Euren Lausbuben gewesen sein«, sagte der Metzger, »die sich nicht entblöden, sich am helllichten Tag auf dem Marktplatz zu besaufen.«
»Das geht Euch nichts an«, versetzte der Stadtvogt. »Geht jetzt wieder in Eure Häuser zurück. Wer gut und rechtschaffen ist, dem wird nichts geschehen.«
Murrend und nur allmählich zerstreute sich die Menge. Elisabeth ging gedankenverloren zum Marktplatz zurück. Im Haus fand sie ihre Familie versammelt.
»Es war blinder Alarm, ich habe es schon gehört«, sagte ihr Vater. »Jetzt lasst uns essen und früh ins Bett gehen.«
Am anderen Nachmittag gegen fünf Uhr wurde eine Trompete geblasen. Elisabeth hörte das Bersten der Stadttore bis in die Stube hinein. Von allen Seiten her drang das Bellen der Falkonette. Die Stadt wurde von den Kaiserlichen mit leichten Geschützen beschossen. Das Herz klopfte Elisabeth bis zum Hals, ihre Beine zitterten. Sie lief zum Fenster und sah wie in ihrem Traum einen Wald aus Piken durch alle Gassen kommen. Ihre Mutter lief wie ein Vögelchen umher, versuchte, etwas zusammenzupacken, um es im letzten Augenblick zu verstecken. Der Vater packte sie am Arm, rief nach seinen Kindern und lief mit ihnen die Stiege zum Dachboden hinauf. In der Eile stolperte Elisabeth, schlug der Länge nach auf die Stiege, rappelte sich wieder auf. Auf dem Dachboden schob der Vater Lukas und seine Frau zu einer Kiste und bedeutete ihnen, hineinzukriechen. Den beiden Mädchen wies er einen Platz in einem großen Schrank an. Drinnen roch es dumpf und modrig. Alte Kleider und Pelze hingen herab, hinter denen sich Agnes und Elisabeth versteckten. Von draußen hörte Elisabeth Schüsse und Schreie, die nichts Menschliches mehr an sich hatten. Der Schweiß brach ihr aus allen Poren. Dicht an sie gedrängt hockte Agnes, die ebenfalls nass von Schweiß war. Durch einen Spalt in der Schranktür konnte Elisabeth einen Streifen Tageslicht sehen, den staubigen Boden und eine Ecke der Truhe, in der ihre Mutter und ihr Bruder um ihr Leben bangten. Die Schreie von draußen wurden immer lauter. Jetzt mussten die Soldaten im Nachbarhaus sein. Elisabeth hörte Flüche, herzzerreißendes Wimmern eines Kindes und dann ein Klatschen, als sei ein menschlicher Körper aus dem Fenster geworfen worden. Sie war halb ohnmächtig, bekam keine Luft mehr. Ein Hustenreiz quälte sie zunehmend. Agnes hatte ihre Arme um sie geschlungen und weinte leise vor sich hin.
»Sei ruhig!«, zischte Elisabeth ihr zu. »Willst du, dass sie uns finden?«
Das Tageslicht machte allmählich der Dämmerung Platz, aber immer noch waren die Schüsse und Schreie von draußen nicht verstummt, nahmen sogar an Heftigkeit zu.
Von den unteren Räumen her hörte Elisabeth ein Poltern, das Krachen von Töpfen und das Splittern zerbrechenden Geschirrs. Das Geräusch von genagelten Stiefeln polterte die Stiege herauf.
»Vater unser, der du bist im Himmel«, betete Elisabeth lautlos in sich hinein. Ihr Hustenreiz wurde stärker. Sie räusperte sich, krampfte ihre Hände ineinander. Hoffentlich hörten es die Männer nicht. Etwas Hartes drückte an Elisabeths Schenkel. Mein Gott, was war denn das? Ihr fiel ein, dass sie vergessen hatte, ihrer Mutter nach einem morgendlichen Einkauf den Geldbeutel zurückzugeben. Sollte sie aus dem Schrank herauskommen und den Söldnern die Goldgulden und Kreuzer anbieten? Aber würden sie deswegen sie und ihre Familie verschonen? Agnes neben ihr zitterte so sehr, dass Elisabeth fürchtete, das Klappern ihrer Zähne könnte sie verraten. Das Geräusch der Stiefel kam näher, es waren viele Stiefel. Die Söldner unterhielten sich laut in einer fremden Sprache, liefen mit ihren Fackeln hin und her, schlugen mit den Schwertern auf Kisten und Truhen. Elisabeth presste sich die Faust vor den Mund, um nicht aufzuschreien. Sie drückte Agnes noch fester an sich, damit ihre Zähne aufhörten zu klappern. Flüche wurden laut, es schepperte und rasselte, dass Elisabeth fürchtete, die Besinnung zu verlieren. Jetzt schienen sie etwas entdeckt zu haben, vielleicht das Kästchen mit Goldgulden, das ihre Mutter in der hintersten Ecke, bedeckt von Tüchern und alten Töpfen, versteckt hatte. Einen Augenblick lang wurde es still im Raum. Dann brachen die Männer in ein Freudengeheul aus. Der Deckel einer anderen Truhe klappte hoch. Mit vor Entsetzen geweiteten Augen hörte Elisabeth ihre Mutter sagen: »Verschont uns, um Christi willen, wir haben nicht mehr als dieses Kästchen mit den Goldgulden!« Lukas weinte. Unverständliches Brüllen folgte.
»Wo sind eure Reichtümer?«, fragte einer mit lauter Stimme. Sie wurde übertönt von den Schreien, die vom Marktplatz und aus den Nachbarhäusern zu ihnen drangen.
»Wir haben nichts mehr, erbarmt Euch«, flehte die Mutter. Wo war nur der Vater geblieben?
»Was ist in dem Schrank?«, wollte die dröhnende Stimme wissen.
»Da sind nur alte Kleider und Pelze drin«, sagte die Mutter. Lukas war inzwischen verstummt. Ein klatschender Laut, ein Stöhnen, noch ein Hieb, ein Gurgeln, dann trat Stille ein. Tritte näherten sich dem Schrank, die Tür wurde aufgerissen. Elisabeth war vollkommen starr. Im Schein der Fackel sah sie, unter den Kleidern hindurch, Stulpenstiefel, die mit Dreck und Blut verkrustet waren. Elisabeth hielt den Atem an.
So sah also der Tod aus. Mit seiner Pike stocherte der Söldner in den Kleidern herum, riss einen Pelzrock von der Stange. Elisabeth spürte einen leichten Stich an der Schulter, von den Kleidern gedämpft. Sie nahm all ihre Kraft zusammen, um nicht aufzuschreien. Die alten Röcke, Wämser und Hosen schienen den Söldner jedoch nicht zu gefallen. Die Stiefel entfernten sich. Die Tür zum Dachboden quietschte, offensichtlich kamen weitere Söldner herein. Elisabeth befahl ihr Leben und das ihrer Familie in Gottes Hand.
»Was macht ihr denn da, seid ihr von allen guten Geistern verlassen?«, rief ein Mann.
»Ihr sollt euch holen, was ihr braucht, zu essen und zu trinken und warme Kleidung für den Winter. Wer hat gesagt, dass ihr die Bewohner quälen und töten sollt?«
Elisabeth schreckte zusammen, ihr wurde eiskalt. Dann stimmte es also, dass ihre Mutter und Lukas tot waren.
»Verschwindet und lasst euch hier nicht mehr blicken!«, rief der Mann. Das Getrappel der genagelten Stiefel entfernte sich. Auch draußen war für einen Augenblick Ruhe eingekehrt. Das Kratzen in Elisabeths Hals wurde unerträglich, sie musste husten. Mit einem Satz war der Mann beim Schrank und sagte: »Wer immer in diesem Schrank versteckt ist, komme heraus, ihm wird kein Leid geschehen.«
Elisabeth dehnte ihre steifen Glieder, drehte sich auf den Bauch und kroch aus dem Schrank. Agnes tat es ihr nach. Ihr Gesicht war kreidebleich. Der Mann leuchtete Elisabeth mit seiner Fackel ins Gesicht. Er hatte lange Haare und war mit einem roten, goldverbrämten Musketierrock und Stiefeln bekleidet. Am Gürtel steckten Degen, Pulverbeutel und Zunderbüchse.
»Ihr müsst fort aus der Stadt«, sagte der Mann. »Hier seid Ihr Eures Lebens nicht mehr sicher.«
»Was ist mit meinen Eltern, mit meinem Bruder?«, fragte Elisabeth mit versagender Stimme.
»Mir wäre es recht, wenn wir aus diesem gottverdammten Loch herauskommen«, ließ sich Agnes mit weinerlicher Stimme vernehmen. »Habe ich nicht gesagt, ich will nach Baden?«
Elisabeth starrte sie entsetzt an. Hatte sie denn kein Herz im Leib?
»Die Söldner haben Eure Eltern und Euren Bruder mitgenommen«, sagte der Musketier. »Aber ich habe ihnen bei Strafe verboten, ihnen etwas anzutun.«
»Und unser Herr Vater?«, wollte Elisabeth wissen.
»Den habe ich nicht gesehen. Jetzt schnell, bevor die Männer es sich noch anders überlegen.«
»Was sind das für Männer, die sich so grausam verhalten?«, fragte Elisabeth hastig.
»Es sind Italiener und Kroaten, die angeworben wurden«, war die Antwort. »Jan van Werth, unser Oberst, ist schon weitergezogen nach Neuenbürg.« Er griff in den Schrank und holte zwei abgegriffene Pelzmäntel heraus.
»Hier. Legt sie Euch um, die Nächte sind schon sehr kalt«, sagte er.
Elisabeth und Agnes folgten dem Söldner, der sie die Stiege hinunter und aus dem Haus führte. Auf dem Marktplatz lagen viele Leichen, einige Stellen waren rot vom Blut.
»Habt Ihr Verwandte, zu denen Ihr gehen könnt?«, fragte der Söldner. In den Gassen fing nun wieder das Schreien und Wehklagen an.
»Eine Tante in Neuweiler«, sagte Agnes.
»Kennt Ihr einen Schlupfwinkel, durch den man die Stadt verlassen kann?«, fragte der Söldner weiter.
»Wenn wir durch den Zwinger gehen, hinten, beim Salzstadel, da gibt es ein Nebentor, vielleicht kommt man da hinaus«, antwortete Elisabeth. Sie liefen durch die Gasse zum Salzstadel. Überall zerstochene Leiber, Sterbende, Verletzte, Blut und der Geruch nach Pulver, Urin und Kot. An einem Feuer saßen Soldaten und brieten ein Ferkel am Spieß.
»He, wohin mit den Dirnen?«, rief einer den Musketier an.
»Sie zeigen mir ein Versteck mit Geld«, antwortete der.
Der Sprecher wollte sich erheben, fiel aber an seinen Platz zurück, weil er zu betrunken war. Elisabeth merkte, dass auch andere den Zwinger entlangliefen, vor allem Frauen und Kinder. Wenn es einen gerechten Gott gibt, dann soll er wenigstens die Frauen und Kinder entkommen lassen, dachte Elisabeth, während sie keuchend weiterlief. Aus dem Augenwinkel bemerkte sie einen Soldaten, der einer Schwangeren den Säbel an die Kehle legte, damit sie ihm die Verstecke von Gold und Silber verriete. Dreh dich nicht um, rief Elisabeth sich selber zu, doch sie hielt einen Augenblick an, um Atem zu schöpfen, und drehte sich um. Der Söldner hatte die Frau zu Boden geworfen, lag über ihr und stieß in sie hinein. Die Feder an seinem Hut wippte, als sei das Ganze ein einziges großes Vergnügen. Sie erreichten den Salzstadel und die Stadtmauer. Jemand hatte eine Strickleiter darüber geworfen. Also gab es einen Ausweg aus dieser Hölle! Agnes begann, die Leiter hinaufzusteigen. Hinter ihnen drängten sich andere, die ebenfalls fliehen wollten. Elisabeth drückte dem Musketier die Hand, die sich warm um die ihre schloss.
»Wie heißt Ihr?«, fragte sie noch.
»Jakob.«
»Ich heiße Elisabeth.«
Ein letzter Blick, und schon musste Elisabeth die Strickleiter hinaufklettern.
»Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder!«, rief der Musketier ihr nach.
»Ich danke Euch für alles«, gab sie zurück. Sie war gleich auf der Mauerzinne. Im Schein der Feuer, die auf dem Platz brannten, bemerkte sie einen kleinen Farn, der aus der Mauer herauswuchs. Das war für sie wie ein Zeichen, dass es Hoffnung gab. Vom Zwinger her näherte sich eine Schar Söldner, die immer schneller wurden. Agnes wurde an einem Seil auf der anderen Seite herabgelassen, Elisabeth folgte. Jetzt hatten die kaiserlichen Söldner die Fliehenden erreicht. Du kannst ihnen nicht helfen, rief Elisabeth sich zu, schau, dass du deine Schwester und dich selber rettest! Vor ihnen lag der Weg, der in den Wald hinaufführte. Andere Gestalten liefen vor ihnen her. Das Gelände war hier so steil, dass Elisabeth tief Luft holen musste. Es ging durch Tannen und Gebüsch, Brombeersträucher und Moospolster hinauf, immer weiter hinauf, es roch faulig nach welkem Laub und Pilzen. Elisabeth schwitzte trotz der nebelfeuchten Kühle. Die Dornen verhakten sich in ihrem Mantel. Immer wieder zerriss die Wolkendecke, um einem blassen Mond Platz zu machen. Dadurch konnten sie wenigstens den Weg erkennen. Agnes folgte ihr dichtauf. Auf einem Fichtenstumpf setzten sie sich hin und hielten eine kurze Rast. Warum nur hatten sie nichts zum Essen und zum Trinken mitgenommen?
»Ich habe Hunger«, klagte Agnes. »Ich will zu meiner Mutter, ich will in mein Bett!«
»Wir kommen bald nach Neuweiler«, tröstete Elisabeth sie. »Dort wirst du zu essen bekommen und ein weiches Bett dazu.«
Mit ihren sechzehn Jahren, zwei Jahre jünger als sie, war Agnes doch noch ein Kind. Hinter ihnen knackte es im Gebüsch. Elisabeth fuhr zusammen. Wurden sie von den Kaiserlichen verfolgt? Immerhin hatten sie sie über die Mauer steigen sehen. Zwei Frauen mit einer Schar von Kindern lösten sich aus dem Dunkel. Gott sei Dank, es waren offensichtlich Flüchtlinge wie sie selbst.
»Hütet euch davor, Fackeln anzuzünden«, sagte die ältere der beiden Frauen.
»Wir haben gar keine«, erwiderte Elisabeth. »Und wenn wir welche hätten, warum sollten wir sie nicht anzünden?«
»Weil wir von den Söldnern verfolgt werden.«
Elisabeth Mut sank. So sehr hatten es die Söldner auf ihre Habseligkeiten abgesehen, dass sie selbst den beschwerlichen Weg in den Schwarzwald nicht scheuten!
»Wohin geht Ihr?«, fragte Elisabeth.
»Nach Neuweiler, zum Superintendenten, der dort bei einem Pfarrer weilt«, antwortete die Frau. Sie blickte die andere Mutter an, und sie zogen weiter. Agnes und Elisabeth standen auf und folgten ihnen, verloren sie aber bald aus den Augen. Bald kamen sie an einem Schafott vorbei, einem erhöhten Podest, dem Blutgerüst, auf dem die Delinquenten mit dem Schwert gerichtet wurden. Schaudernd wandte Elisabeth sich ab, Agnes schien es nicht näher zu berühren. Nach etwa zwei Stunden bergauf und bergab erreichten sie den Weiler Zavelstein. Wie Perlen auf einer Schnur lagen die kleinen Häuser an der einzigen Straße aufgereiht. Die Wolken hatten sich inzwischen verzogen, es war eiskalt, und der Mond beschien die alte Burg am Ende der Straße. Alles war still. Elisabeth zog ein paar gelbe Rüben aus einem Garten und wusch sie notdürftig in einem Brunnen. So hatten ihre Zähne wenigstens etwas zum Beißen. In der Burg brannten noch einige Lichter. Der Weg führte hinab ins Tal, dann wieder ganz hinauf. Manchmal, wenn sie auf einer Straße liefen, hörten sie Reiter kommen und versteckten sich angstvoll im Gebüsch. Über Schmie erreichten sie schließlich das Dorf Neuweiler. Es herrschte eine unheimliche Ruhe. Sie hielten auf die Kirche zu. Aus dem Glockenstuhl des Daches ertönten zwölf Schläge. Vom Pfarrhaus her näherte sich eine Schar dunkel gekleideter Menschen. Keiner sprach ein Wort.
2.
Im Näherkommen erkannte Elisabeth den Superintendenten Andreä, dessen Frau und einige andere Calwer Bürger. Andreä, in seinem Talar mit dem pelzbesetzten Kragen, über den er einen wollenen Umhang geworfen hatte, sprach die beiden an.
»Ihr seid doch Elisabeth und Agnes Weber, Töchter des Mesners von Calw.«
»Ja«, bestätigte Elisabeth. In diesem Augenblick wurde ihr bewusst, welcher ungeheuerlichen Lage sie gerade erst entronnen waren.
»Wir sind, zusammen mit vielen anderen, aus der Stadt geflohen«, sagte sie.
»Es werden immer mehr«, stellte Andreä fest, über ihren Kopf hinweg zum Waldrand blickend. »Was ist mit euren Eltern, eurem Bruder?«
»Sie wurden misshandelt, dann hat uns ein Söldner befreit«, sagte Elisabeth und kämpfte mühsam die Tränen nieder. »Ich weiß nicht, wo sie sich jetzt befinden.«
»Ich hoffe, sie konnten sich retten«, meinte Andreä. »Und ich werde Gott darum bitten, seine Hand über sie zu halten.«
»Haltet euch nicht so lange auf«, beschwor sie ein Mann, der neben Andreä stand.
»Ihr werdet verfolgt, ihr müsst fliehen!«
»Das ist der Maier des Dorfes«, erklärte Andreä. »Er bringt uns zu den Wäldern, durch die wir uns nach Aichelberg und zur Enz durchschlagen wollen. Pfarrer Rebstock hat uns gut mit Essen versorgt.« Er zog sein Felleisen vom Rücken, fasste hinein und gab den Mädchen jeweils ein Stück Brot und Wurst und einen Schluck Wein aus einem Lederbeutel.
»Hier, nimm das Felleisen, ich brauche es nicht mehr.« Er reichte Elisabeth den Rucksack.
»Habt Ihr selbst denn noch genug?«, fragte Elisabeth.
»Wir teilen alles miteinander, es ist ausreichend für alle da«, sagte er.
»Ich danke Euch, Herr Superintendent.«
»Nun müssen wir gehen«, meinte er. Elisabeth und Agnes schlossen sich der kleinen Schar an.
»Was ist mit unserer Tante?«, fragte Elisabeth unterwegs leise den Superintendenten.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!