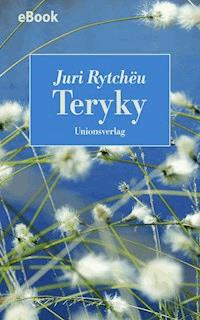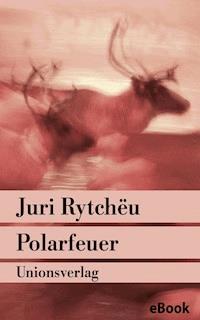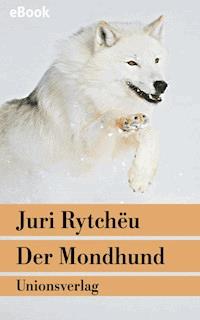9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unionsverlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Aitmatow, Rytchëu, Tschinag: Die drei großen Autoren der asiatischen Steppen und Berge haben sich – jeder auf seine Weise – mit der Realität des Schamanismus in ihren Ländern beschäftigt. Diese Anthologie versammelt aus ihren Werken Szenen von der Arbeit und Wirkung von Schamaninnen und Schamanen, die ihr Leben prägten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 317
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Über dieses Buch
Aitmatow, Rytchëu, Tschinag: Die drei großen Autoren der asiatischen Steppen und Berge haben sich – jeder auf seine Weise – mit der Realität des Schamanismus in ihren Ländern beschäftigt. Diese Anthologie versammelt aus ihren Werken Szenen von der Arbeit und Wirkung von Schamaninnen und Schamanen, die ihr Leben prägten.
Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.
Tschingis Aitmatow (1928–2008) erlangte mit der Erzählung Dshamilja Weltruhm. Er besuchte das Maxim-Gorki-Literaturinstitut in Moskau und war Redakteur einer kirgisischen Literaturzeitschrift. Sein Werk fußt auf den Erzähltraditionen Kirgisiens und verarbeitet die Grundfragen der Zeit.
Zur Webseite von Tschingis Aitmatow.
Juri Rytchëu (1930–2008) wuchs als Sohn eines Jägers in der Siedlung Uëlen auf der Tschuktschenhalbinsel im Nordosten Sibiriens auf und war der erste Schriftsteller dieses nur zwölftausend Menschen zählenden Volkes. Mit seinen Romanen und Erzählungen wurde er zum Zeugen einer bedrohten Kultur.
Zur Webseite von Juri Rytchëu.
Galsan Tschinag, geboren 1943 in der Westmongolei, ist Stammesoberhaupt der turksprachigen Tuwa. Er studierte Germanistik in Leipzig und schreibt viele seiner Werke auf Deutsch. Er lebt in Ulaanbaatar und verbringt die restlichen Monate abwechselnd als Nomade in seiner Sippe und auf Lesereisen.
Zur Webseite von Galsan Tschinag.
Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Taschenbuch, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)
Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.
Tschingis Aitmatow, Juri Rytchëu, Galsan Tschinag
Die Kraft der Schamanen
Anthologie
E-Book-Ausgabe
Unionsverlag
HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.
Impressum
Dieses E-Book enthält als Bonusmaterial im Anhang 5 Dokumente
Zusammengestellt von Lucien Leitess
© by Unionsverlag, Zürich 2024
Alle Rechte vorbehalten
Umschlag: Schamanentrommel, Darstellung der tengristischen Drei-Welten-Kosmologie
Umschlaggestaltung: Martina Heuer
ISBN 978-3-293-30838-1
Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte
Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)
Version vom 26.06.2024, 03:22h
Transpect-Version: ()
DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.
Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.
Unsere Angebote für Sie
Allzeit-Lese-Garantie
Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.
Bonus-Dokumente
Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.
Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert
Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.
Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät
Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:
Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt
E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.
Wir bitten um Ihre Mithilfe
Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.
Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags
Inhaltsverzeichnis
Cover
Über dieses Buch
Titelseite
Impressum
Unsere Angebote für Sie
Inhaltsverzeichnis
DIE KRAFT DER SCHAMANEN
VorbemerkungTschingis AitmatowErinnerung an den WunderdoktorAufbruch und Heimkehr vom MeerJuri RytchëuErinnerung an die HeilerinDie Schule des Schamanen MletkinDie VölkerschauOperation in der JarangaGalsan TschinagErinnerung an Pürwü und den Gesang der GeisterDie Beschwörung des FriedhofsAmbije beim KrankenbesuchWorterklärungenNachweiseMehr über dieses Buch
Über Tschingis Aitmatow
Tschingis Aitmatow: Über mein Leben
Kasat Akmatow: Tschingis Aitmatow bei sich zu Hause
Über Juri Rytchëu
Juri Rytchëu: Der stille Genozid
Eveline Passet: Juri Rytchëu – Literatur aus dem hohen Norden
Leonhard Kossuth: Wo der Globus zur Realität wird
Über Galsan Tschinag
Andere Bücher, die Sie interessieren könnten
Bücher von Tschingis Aitmatow
Bücher von Juri Rytchëu
Bücher von Galsan Tschinag
Zum Thema Schamanismus
Zum Thema Heilkunst
Zum Thema Schenken
Zum Thema Mongolei
Zum Thema Kirgisistan
Zum Thema Asien
Vorbemerkung
Immer wieder haben sich ihre Wege gekreuzt, über Jahre haben sie gegenseitig ihr Werk und Wirken verfolgt – Tschingis Aitmatow, Juri Rytchëu und Galsan Tschinag. Tausende von Kilometern liegen die Schauplätze ihrer Werke auseinander, und doch wurzeln sie – bei allen Unterschieden – gemeinsam in den nomadischen Kulturtraditionen Asiens, in denen der Schamanismus Alltag war.
Der Kirgise Tschingis Aitmatow wuchs auf im verordneten Atheismus der sowjetischen Epoche. Nur hoch im Gebirge, im Sommerlager der Nomaden, begegnete er als kleiner Junge der fortwirkenden Tradition schamanischen Heilens, die der älteren Generation noch eine Selbstverständlichkeit war. Doch durch sein ganzes Werk zieht sich – vielleicht sogar von ihm selbst nie bewusst wahrgenommen – die schamanische Weltwahrnehmung. Davon zeugen seine Faszination für das beschwörende Wort, seine Inspiration durch Märchen und Legenden wie im Auszug aus Der Junge und das Meer. Davon zeugt aber vor allem, dass die »Helden« seines Œuvres keineswegs nur in der Menschenwelt zu Hause sind. Die gehörnte Hirschmutter in Der weiße Dampfer, die Wölfe Akbara und Taschtschajnar, das Pferd Gülsary, der Schneeleopard Dschaa-Bars und viele andere sind als beseelte Wesen, als Gefährten wie als Opfer dem Menschen zur Seite gestellt. Vielleicht hat ihn gerade diese Sensibilität früher als andere hellhörig gemacht für die Gefährdungen des »blauen Planeten« durch Krieg und Umweltzerstörung.
Juri Rytchëu, der große und einzige Epiker der Arktis, hat die äußerlich kleine Welt der Tschuktschen in ihrem ganzen Reichtum für Millionen Leserinnen und Leser weltweit erschlossen. Dieses Volk von etwa fünfzehntausend Personen am äußersten Rand Asiens hält offenbar bedenkenswerte Erfahrungen für die Metropolen bereit. In Rytchëus Romanen kristallisieren sich Schöpfungsgeschichte, Kosmologie, historische Chronik und politische Umwälzungen über Generationen. Wenn er in Der letzte Schamane dem Lebensweg seines Großvaters Mletkin folgt, nimmt er uns mit auf einen Gang durch die Menschheitsgeschichte. Als Junge wird Mletkin auf archaische Weise zum Schamanen erwählt. Als sein Wissensdurst ihn um 1880 zu weiten Reisen durch die USA führt, erlebt er die »moderne Zivilisation« am eigenen Leib in ihrer gedankenlosen Neugier, hinter der eine grausame Hybris steht.
Galsan Tschinags Werk und Wirken führt die schamanische Tradition ins 21. Jahrhundert. Er ist vieles in einem: traditionelles Oberhaupt der Tuwa in der Mongolei, aktiver Schamane und Schriftsteller, der seit der Studienzeit in Leipzig seine Werke meist auf Deutsch schreibt. Die Erinnerungen an seine Lehrmeisterin Pürwü zeigen, wie er inmitten eines Universums geistiger Mächte heranwuchs und wie selbstverständlich die Arbeit des Schamanen darin war. Die beiden Auszüge aus seinem Roman Gold und Staub, die bereits in diesem Jahrtausend spielen, machen demgegenüber beunruhigende Komplexität fühlbar: Zweifel und Selbstzweifel haben in den Schamanen selbst Einzug gehalten. Er weiß um die Brüchigkeit seiner Autorität und die Verletzlichkeit der Verehrung, die er genießt. Er registriert die Anfechtungen, denen er selbst unterworfen ist. Die Geister, die er ruft, kommen oft überraschend und werfen ihn manchmal selbst zu Boden. Und zuletzt muss er erfahren, dass schamanische Arbeit auch darin bestehen kann, den Ärmsten der Armen zu einem staatlichen Krankenschein zu verhelfen.
In Juri Rytchëus Roman Die Reise der Anna Odinzowa erklärt Rinto der Ethnologin aus St. Petersburg, was ein Schamane ist: »Eine Bibliothek, eine Apotheke, ein meteorologischer Dienst, ein Veterinär, ein historisches Archiv und noch vieles, vieles andere in einer Person.« Diese Zusammenstellung will ein Anreiz sein, in den Werken der drei Autoren dieses viele, viele andere zu erfahren.
Tschingis Aitmatow
Erinnerung an den Wunderdoktor
Zu meiner frühen Kindheit gehört vor allem die Erinnerung an meine Großmutter Aimchan. Sie war eine herausragende Persönlichkeit und genoss bei den Menschen ihres Dorfes hohes Ansehen. Offenbar war sie eine weise Frau. Sie hatte meinem Vater vieles beigebracht und war sehr stolz auf ihn. Sie besuchte uns des Öfteren in der Stadt. Sie hatte ihren weißen Turban auf dem Kopf, den Eletschek, den nach unserer nationalen Tradition nur verheiratete Frauen tragen durften. Sie war eine stattliche, anmutige Erscheinung. Der Eletschek stand ihr sehr gut und verlieh ihr etwas Majestätisches. Sie war eine fesselnde, kluge Persönlichkeit, kannte viele Lieder und Märchen. Sie konnte weder lesen noch schreiben. Und doch stand meine ganze Kindheit unter ihrem strahlenden Glanz – dem Glanz einer märchenhaften Welt.
Es war wieder einmal Sommerszeit, ich war fünf, sechs Jahre alt, und man brachte mich zu Großmutter. Wir brachen auf in die Berge – zum sommerlichen Nomadenlager. Wahrscheinlich war das einer der letzten großen Nomadenzüge in unserer Gegend. Das Nomadenleben neigte sich seinem Ende entgegen. Überall breitete sich die sesshafte Lebensweise aus. Neue Siedlungen entstanden, Kolchosen und Sowchosen. Da spielten die Jahreszeiten nicht die gleiche Rolle wie früher. Der Höhepunkt des Nomadenlebens war nämlich jene Saison, bei der die Menschen mit Kind und Kegel, mit Sack und Pack zu neuen Weidegründen fürs Vieh umsiedelten.
Ich erinnere mich lebhaft an diese Zeit, denn sie zog uns Kinder ganz besonders in ihren Bann. Wenn die Bewegung zum Aufbruch einsetzt, geraten alle in eine gehobene, ja erregte Stimmung. Die Jurten werden zusammengetragen. Die Gerätschaften werden auf Kamele, Pferde und Ochsen gepackt. Und danach bricht die ganze Gemeinschaft der Nomaden mit ihren zahlreichen Viehherden aus Steppen und Vorbergen in die Richtung der hohen schneeweißen Bergriesen auf. Sie ziehen über die Pässe hin zum Dshajloo, den sommerlichen Weidegründen im Hochgebirge.
Das Nomadenlager ist ein wohlgeordnetes System, man musste alles vorkehren, damit die Umsiedlung normal ablief und das Leben in den Bergen im Handumdrehen weitergehen konnte. Dort musste alles griffbereit sein, auf der Stelle ausgepackt, ausgebreitet und eingerichtet werden können.
Die Viehzüchter und ihre Angehörigen kommen ja an einen völlig menschenleeren Ort. Die Menschen hätten sich an diesem Platz seit Langem niedergelassen und angesiedelt, wäre dort ein Leben das ganze Jahr über möglich gewesen. Aber das Dshajloo ist nur im Sommer zugänglich. Bis Ende Mai sind die Gebirgspässe unüberwindbar. Da häufen sich noch meterhohe Eis- und Schneemassen. Und ab Ende September, Anfang Oktober setzen wieder die Schneefälle und Schneestürme ein und schließen die Pässe ab, sodass sie erneut unüberwindlich bleiben – bis zum nächsten Mai. Zwei Drittel des Jahres ist dieser Ort im Hochgebirge von allem abgeschlossen, für nichts und niemanden erreichbar. Nicht einmal für wilde Tiere.
In dieser Zone, bei drei- bis viertausend Metern über dem Meeresspiegel, herrscht polares Klima. Bei Dauerfrost und ewigen Schneestürmen kann nichts bestehen, am allerwenigsten der Mensch. Dafür zieht es ihn aber umso heftiger in die Höhe während der kurzen Frist des Sommers, als müsse er diesen Augenblick nutzen.
In der Folklore wird diese Zeit manchmal mit der Jugend verglichen – der blühenden, glücklichen Jugendzeit, die das Alter rasch einholt und beendet.
Der Dshajloo ist märchenhaft und paradiesisch. Blumen und Gräser der Alpen und Hochgebirge sprießen und blühen fantastisch. Helle und klare Bäche und Flüsse strömen von den Gletschern herab. Allerlei Getier und Vögel tummeln sich reichlich in den Bergwäldern. Es gibt Brennholz in Hülle und Fülle. Dieser Flecken Erde schenkt den Menschen die besten Tage des Lebens.
Die Kirgisen schlugen also zur Sommerszeit an diesen Stellen des Hochgebirges ihre Jurten auf. Und mit Beginn des Herbstes räumten sie wieder diesen Platz des Lebens, um in die Täler zurückzukehren. Dabei musste man sehr auf der Hut sein, damit sich der Pass vor der Rückkehr nicht schloss. Solche Fälle waren zwar selten, doch kam es vor, dass Menschen aus weiß Gott welchen Gründen den Zeitpunkt der Rückkehr verpassten und die Steppe nie mehr erreichten. Wenn der Pass verschlossen war, kamen die Menschen um – es gab keinen Ausweg mehr. Wer dort bei Anbruch des Winters zurückbleibt, kommt in den Schneemassen und bei den polaren Frösten um – sogar die Wölfe, die mit den Menschen zurückbleiben. Deshalb waren die Menschen darauf bedacht, die Zeit einzuhalten.
Unser sommerlicher Nomadenzug nahm also seinen Anfang. Großmutter Aimchan ließ mich auf ein Pony steigen. Bis heute erinnere ich mich an das Pferdchen. Ja, man hat ein Kerlchen von fünf, sechs Jahren schon selbst reiten lassen. Für Kinder gab es Sättel, die auf beiden Seiten in Lendenhöhe Schutzleisten hatten, damit das Kind nicht nach links oder nach rechts vom Sattel rutschte. Sie ähnelten gewissermaßen den Kinderstühlen in der Stadt, die auch so gesichert sind, dass die Kleinen am Tisch der Erwachsenen mit Platz nehmen können.
Ich hatte also meinen Sattel und mein Pferdchen und war darauf mächtig stolz. Ich ritt selbstständig im Zug der Nomaden mit. Das Pferdchen gehorchte mir. Man hatte mir kein ungestümes Pony ausgewählt, das Hals über Kopf ausreißt. Ich brauchte keine Angst zu haben. Und so ritt ich an der Seite von Großmutter und den Verwandten. Wir setzten den Herden nach, den Pferden und Schafen. Auf dem Rücken der Kamele schaukelten die Traglasten. Alle zog es zum großen Dshajloo.
Aber welche Vorbereitungen und Mühen kostet dieser Zug über die Pässe, um dort nur zwei Monate zu verbringen, danach zurückzukehren und von Neuem dorthin aufzubrechen. Der Hin- wie der Rückweg ist voller Beschwernisse und Gefahren. Mitunter kommt es dabei zu Naturkatastrophen. Aus heiterem Himmel bricht ein Schneesturm los, oder ein Erdrutsch begräbt Menschen und Tiere unter sich, zerstört Hab und Gut. Ganze Familien mit Kind und Kegel, mit Sack und Pack und all den Jurten sind unterwegs. Diese Zeit ist stets mit vielen Vorahnungen und Empfindungen verbunden.
Die Nacht vor dem Zug zum Gebirgspass hat den Namen Schykama – das ist die Nacht der Sammlung. Der Nomadenstrom nähert sich dem Ort vor der allerletzten Wegstrecke in die Höhe.
Unsere Karawanen versammelten sich dort gegen Abend. Es machte wenig Sinn, die Jurten nur für die eine Nacht zu errichten, deshalb rastete man in Zelten. Lagerfeuer brannten, an denen sich die Menschen wärmten. Am Fuß der Massen aus Eis und Schnee breitete sich ringsum die raue, schöne und majestätische Bergwelt aus. Und man dachte nur das eine: Wie werden wir morgen früh den Gebirgspass erstürmen? Sogar die Herden spürten diesen Augenblick vorweg – üblicherweise laufen die Tiere achtlos nach allen Seiten auseinander, aber hier verharrten sie alle an Ort und Stelle: Kein einziges Tier entfernte sich. Eine Nacht lang standen die Herden in dicht gedrängten Haufen.
Die Alten – Frauen oder Männer – heben an den Lagerfeuern ihren Sprechgesang an. Sie appellieren an die Geister der Berge und Pässe. Sie tragen ihre Beschwörungen vor.
»Nun sind wir am Fuß des Passes angelangt. Alle sind da – unsere Herden, die Familien und die Kinder, der Hausrat und die Jurten. Wir möchten dort hinauf, um das Licht der Welt zu erblicken. Jenseits des Passes liegen die frischen Wiesen und fließen die klaren Flüsse. Wir wollen dort unseren Sommer verbringen.«
Sie flehen zu den Geistern des Gebirgspasses.
»Haltet uns nicht auf, und schüttet keinen Regen über uns aus! Fallt nicht mit Winden über uns her, und verdeckt uns nicht die Sicht mit Wolken oder Nebel! Verschont uns mit dem Unheil der Elemente!«
»Wir schwören euch: Auch wir lieben diesen Himmel, diesen Pass und diese Berge! Beschert unsere Kinder mit Glück! Lasst das Vieh seinen Weg zum Dshajloo gesund beenden! Und behütet unseren Weg zurück ins Winterlager!«
»Lasst alle Nöte hier unten zurück! Schenkt den Tieren, jeder Kuh und jedem Schaf wie jedem Pferd, das Glück, die Wiesen unterm Himmel zu sehen. Und wir möchten die Vögel hören und die Tiere unterm Himmelszelt erblicken! Wir sagen Dank dem Schöpfer Tenir, Dank dir, Tenir, dass es den Weg über den Gebirgspass gibt.«
Was für eine verzauberte Zeit! Auch in späteren Jahren bin ich zum Dshajloo geritten, aber dann war schon alles anders und der Zauber verflogen. Doch nun herrschte noch eine ursprüngliche, romantische Stimmung vor. Und natürlich kam es zu unvergesslichen Begebenheiten …
Die erste hatte damit zu tun, dass mir plötzlich ein Zahn wehtat.
Wir hatten uns bereits auf dem Dshajloo niedergelassen und in verschiedene Ails aufgeteilt. Zwanzig bis dreißig Jurten standen jeweils zusammen. Üblicherweise taten sich die verschiedenen Sippschaften und Klans zusammen. Plötzlich tat mir der Zahn schrecklich weh. Ich hielt mich nicht an die Aufteilung nach Klans, sondern rannte von Jurte zu Jurte. Kein Verwandter, kein Mensch konnte mir helfen. Wer sollte da auch einspringen – Zahnärzte gab es sowieso nicht.
Der Zahn schmerzte Tag und Nacht. War ich zuvor mit den anderen Kindern vom frühen Morgen bis zum Anbruch der Dunkelheit durch die blühenden Wiesen gerannt, so lag ich nun da und wimmerte.
Die Kinder rannten um die Wette und spielten unentwegt. Den Erwachsenen war das recht, sie wollten ja, dass die ganze Kinderschar sich in der reinen Natur und der Höhenluft austobte. Niemand hat uns da je zurechtgewiesen. Über uns wölbte sich ein klarer Himmel. Der Himmel leuchtete, und ein Wasser von besonderer Reinheit umgab uns allenthalben wie die Gräser, die sonst nirgendwo so schön wachsen. Wenn da nur nicht mein Zahn gewesen wäre, der mich furchtbar quälte.
Großmutter machte mir Kompressen mit Kräutern, legte einen erhitzten Stein auf die Stelle. Sie tat, was sie konnte, doch nichts half. Da schickte sie einen Verwandten los, einen Pferdehirten. Er sollte einen bekannten Wunderheiler holen. Wo der sich aufhielt, weiß ich nicht mehr, vielleicht im benachbarten Dshajloo.
Der Pferdehirt ritt weg zum Wunderdoktor. Ein zweites Pferd führte er am Zügel. Heute würde man, brauchte man jemanden, ein Auto hinfahren lassen – aber im Dshajloo, da gibt es bis heute keine Straßen.
Der Zahn tat weiterhin schrecklich weh. Ich weinte und wimmerte und versuchte, mich irgendwie abzulenken.
Endlich brachte man den Wunderdoktor. Er war ein alter Mann, aber noch recht munter und beweglich. Großmutter hatte ihn schon von Weitem erkannt.
»Da kommen sie endlich.« Großmutter freute sich. »Gott wird uns schon helfen und dich erleichtern.« Und sie fügte voller Überzeugung hinzu: »Jetzt werden wir deinen Zahn endlich kurieren!«
Ich war rasch auf den Beinen und hüpfte aus der Jurte. Da sah ich, wie unser Verwandter die Furt am Fluss überquerte. Seitlich hinter ihm ritt der Wunderheiler auf dem Pferd, das man ihm eigens geschickt hatte. Er wurde empfangen, wie sich das gehörte. Ohne Umstände trat er auf mich zu und fragte: »Wo tuts weh?«
Ich heulte sofort und zeigte ihm den Zahn: »Da!«
»Hör auf zu weinen«, sagte er. »Wir kurieren dich auf der Stelle.« Ich glaubte ihm aufs Wort, dachte mir wohl: Wenn er schon hierhergeritten ist, dann muss es ja stimmen, was er sagt. Und wie wir ihn erwartet hatten!
Der Wunderdoktor streichelte mir über den Kopf und wandte sich an Großmutter: »Sorgt dafür, dass alle anderen verschwinden. Lasst mich mit dem Kind allein in der Jurte. Da soll sich der Junge hinsetzen. Ich bedecke ihn dann mit einem Tuch – von oben bis unten.«
Gesagt, getan. Ich sitze unter ihm auf dem Boden und halte den Kopf gesenkt. Er stellt eine Tasse vor mich hin. In die Tasse kommt eine Kerze, die er anzündet. Sie brennt mit kleiner Flamme. Und er fängt an zu sprechen: »Öffne deinen Mund und blicke auf die Kerze!« Er bedeckt mich mit einem Tuch. Es wird dunkel. Nur die kleine Kerze brennt …
Zuvor sah ich noch, wie sich der Wunderheiler eine rituelle Kleidung überzog. Sie bestand aus Bändern, Federn und Lederstreifen, langen und kurzen. Das zottige Gewand war seltsam. In der Hand hielt er einen langen Stock, der ihn weit überragte. An diesem Stock hingen allerlei Eisenstückchen, Lappen und Lederriemen. Zudem hatte sich der Mann eine merkwürdige Mütze über den Kopf gestülpt.
Ich sitze also unter dem Tuch und über der Kerze und bin völlig bedeckt. Er rennt um mich herum, lässt den Stock erklirren, indem er ihn immer wieder auf die Erde stößt. Dabei gibt er völlig unverständliche Töne von sich und spricht fremdartige Wörter vor sich hin …
Damals wusste ich natürlich nicht, dass es ein Schamane war, der mich kurierte. Obwohl man bei uns den Islam als Religion längst angenommen hatte, war das Schamanenwesen, zumindest in rudimentären Formen, noch erhalten geblieben.
Der Schamane umkreiste mich unentwegt. Er schrie seine Verwünschungen und Anrufungen aus sich heraus.
Erstaunlicherweise – niemand wird es mir glauben, aber es war so und nicht anders – tat der Zahn plötzlich nicht mehr weh.
Der Zahn, der mich tagelang ununterbrochen mit rasenden Schmerzen geplagt, den man mit Salz und heißem Wasser gespült, mit Kompressen und anderen Mittelchen behandelt hatte, ließ mich in Ruhe. Von einem Augenblick zum anderen hörte der Zahnschmerz auf.
Er fragt mich: »Tuts noch weh?«
»Nein, nicht mehr«, antworte ich.
»Siehst du! Bleib noch ein wenig sitzen!«
Ich habe gar nichts dagegen und bleibe sitzen.
Er nimmt das Tuch von meinem Kopf. Und was sehen meine Augen?
Er hatte die kleine Porzellanschale mit Wasser unter die Decke gestellt. Als er die Decke von mir nahm, zeigte er auf diese Schale und sprach: »Sieh doch! Lauter kleine Würmer!«
Ich sah sie tatsächlich. Da krümmten sich Würmchen so dünn wie Haare.
Der Wunderdoktor hatte den Zahn beschworen. So war es doch?
Ich habe das nie vergessen und muss immer wieder daran denken. Denn genau so und nicht anders hat es sich abgespielt …
Viele Jahre später fragte ich Zahnärzte, ob solche Würmchen im Zahn eines Menschen vorkämen. »Nein, so etwas gibt es nicht«, wurde mir stets geantwortet. Warum sie aber bei mir wirklich vorkamen, kann ich bis heute nicht erklären.
Der Schamane sagte mir damals: »Schau, sie sind herausgefallen. Alle. Jetzt tut dein Zahn nicht mehr weh!« Hatte er sie herbeigezaubert? Oder war es so gewesen, wie er es mir erklärte? Für mich ein Rätsel bis heute.
Natürlich hatte ich, kaum war das Zahnweh verschwunden, alles sofort wieder vergessen. Meine Spielkameraden kamen herbeigerannt. Wir tollten wieder umher, hüpften und spielten nach Herzenslust. Vor lauter Freude schlachtete Großmutter ein Lamm. Dem Schamanen wurde herzlich gedankt. Er erhielt Geschenke und ritt wieder auf dem Pferd, auf dem er gekommen war, davon.
Warum sich den Kopf über das Rätsel zerbrechen? Die Hauptsache war doch – der Zahn tat nicht mehr weh.
Aufbruch und Heimkehr vom Meer
In einer finsteren, dunstgeschwängerten Nacht tobte entlang der ganzen Ochotskischen Seeküste, an der ganzen Front von Land und Meer, der uralte, unbändige Kampf der zwei Elemente – das Festland trotzte dem Druck des Meeres, das Meer berannte unermüdlich das Land. Tosend, verzweifelt stürmte das Meer im Dunkel immer wieder gegen die Klippen an und zerschellte. Qualvoll stöhnte die steinharte Erde, während sie die Angriffe des Meeres abwehrte.
So liegen sie im Widerstreit seit dem Schöpfungsakt – seit der Tag zum Tag und die Nacht zur Nacht geworden; und so wird es fernerhin sein, alle Tage und alle Nächte, solange es Erde und Wasser gibt, im ewigen Zeitenlauf. Alle Tage und alle Nächte …
Eine neue Nacht verrann. Die Nacht vor der Ausfahrt aufs Meer. In jener Nacht fand er keinen Schlaf. Zum ersten Mal im Leben schlief er nicht, zum ersten Mal litt er an Schlaflosigkeit. Mit allen Fibern sehnte er den Tagesanbruch herbei, damit er hinauskonnte aufs Meer. Auf ein Robbenfell gelagert, spürte er, wie der Boden unter ihm vom Meeresanprall kaum merklich bebte, wie die Wogen in der Bucht donnerten, sich abhetzten. Er fand keinen Schlaf, lauschte hinaus in die Nacht …
Früher war alles ganz anders gewesen. Keiner konnte sich jetzt vorstellen, keiner wusste oder ahnte auch nur, dass die Welt ganz anders aussehen könnte, hätte es vor Urzeiten nicht die Ente Luwr gegeben. Dann stünden nicht Festland gegen Wasser, Wasser gegen Land. Denn am Anfang, am Urbeginn, gab es keine Erde in der Natur – nicht einmal ein Staubkörnchen. Ringsum breitete sich Wasser, nichts als Wasser. Das Wasser war aus sich selbst entstanden, in seinem ewigen Wandelkreis – in schwarzen Abgründen, tiefen Strudeln. Wogen um Wogen rollten da, rollten auseinander, nach allen Richtungen der damals richtungslosen Welt: aus dem Nichts ins Nichts.
Die Ente Luwr aber – ganz recht, die gewöhnliche breitschnäblige Wildente, die bis zum heutigen Tag in Schwärmen zu unseren Häuptern dahinfliegt – irrte dazumal mutterseelenallein über der Welt herum, und nirgends konnte sie ihr Ei ablegen. Weit und breit war nur Wasser – nicht einmal Schilfrohr fand sich, um ein Nest zu flechten.
Die Ente Luwr schrie in der Luft, sie fürchtete, das Ei nicht länger halten zu können, es über dem bodenlosen Abgrund zu verlieren. Wohin sie sich auch wandte, wo immer sie suchte – überall plätscherten unter ihren Flügeln Wellen, erstreckte sich das Große Wasser – Wasser ohne Grenzen, ohne Anfang und ohne Ende. Völlig entkräftet erkannte sie schließlich: Auf der weiten Welt gab es keinen Ort, wo sie ein Nest bauen konnte.
Da ließ sich die Ente Luwr auf dem Wasser nieder, zupfte sich Federn aus der Brust und flocht ein Nest. Und aus diesem schwimmenden Nest wuchs die Erde. Nach und nach weitete sich die Erde, wurde sie von mancherlei Geschöpfen bevölkert. Der Mensch aber tat sich unter allen hervor – er lernte, auf Skiern über Schnee zu laufen, im Boot auf dem Wasser zu fahren. Er begann, Wild zu erlegen und Fische zu fangen, nährte sich so und mehrte sein Geschlecht.
Hätte die Ente Luwr nur geahnt, wie hart das Dasein wurde mit der Entstehung des festen Landes inmitten des reinen Wasserreichs! Kann sich doch, seit es die Erde gibt, das Meer nicht beruhigen; das Meer kämpft gegen das Land und das Land gegen das Meer. Der Mensch aber hat es zuweilen bitter schwer zwischen Land und See, zwischen See und Land. Das Meer liebt ihn nicht, denn er ist mehr der Erde verhaftet … Der Morgen zog herauf. Wieder ging eine Nacht zu Ende, wieder wurde ein Tag geboren. Wie sich das Maul eines Rentieres durch dessen graublaue Atemwolke abzeichnet, so trat aus dem sich lichtenden, hellgrauen Dämmer allmählich der tosende Zusammenprall von Meer und Ufer. Das Meer atmete. Entlang der ganzen brodelnden Frontlinie von Land und Meer ballte sich der kalte Dampf von dahinziehendem Sprühregen, und übers Ufer, so weit es sich auch erstreckte, hallte das Dröhnen der Brandung.
Der Nebel schwand. Lichter und lichter wurde der Morgen. Allmählich traten die Umrisse der Erde hervor, klarte das Meer auf. Vom Nachtwind aufgestört, schäumten am Ufer noch die weiß gekrönten, anlaufenden Wogenreihen, aber tief in der sich verlierenden Ferne besänftigte, beruhigte sich das Meer bereits, bleigrau glänzte dort schwerer Wellengang. Und es zerrissen die Wolken überm Meer, während sie näher zogen zu den Hügeln am Ufer.
Hier, nahe der Bucht des Scheckigen Hundes, ragte auf der hügeligen Halbinsel, die sich schräg ins Meer schnitt, die markanteste Erhebung: ein Fels, der von fern wirklich an einen riesigen, am Meer geschäftig entlanglaufenden scheckigen Hund erinnerte. An den Seiten von allerlei zottigem Gesträuch überwuchert und bis in den heißesten Sommer mit einem Schneefleck – gleich einem großen Schlappohr – auf dem Kopf, dazu noch einem großen weißen Fleck in der Weichengegend, einer schattigen Mulde, war dieser Berg, der Scheckige Hund, von weit her zu sehen, vom Meer und vom Wald.
Von hier aus, von der Bucht des Scheckigen Hundes, legte gegen Morgen, als die Sonne zwei Pappeln hoch stand, ein Niwchen-Kajak ins Meer ab. Im Boot waren drei Jäger und ein Junge. Die beiden jüngeren und kräftigeren Männer ruderten mit vier Rudern. Am Steuerruder saß der Älteste und zog gemächlich an seiner Holzpfeife – ein braungesichtiger, dürrer Alter mit hervorstehendem Adamsapfel, er war runzlig, vor allem der Hals war von tiefen Falten durchfurcht, und entsprechend waren auch die Hände – groß und knotig in den Gelenken, voller Narben und Risse. Grau war er schon. Fast weiß. Deutlich traten aus dem braunen Gesicht die grauen Brauen hervor. Der Alte blinzelte wie gewohnt mit tränenden rötlichen Augen, musste er doch sein Lebtag auf den Wasserspiegel schauen, der die Sonnenstrahlen zurückwirft; und es machte ganz den Eindruck, als steuerte er das Boot blind durch die Bucht. Am anderen Ende des Kajaks, unmittelbar am Bug, hin und wieder zu den Erwachsenen spähend und sich mit größter Mühe still verhaltend, um ja nicht den mürrischen Alten zu verdrießen, hockte wie eine Schnepfe ein schwarzäugiger Junge.
Der Junge war heftig erregt. Vor Spannung blähten sich seine Nasenflügel, und sein Gesicht übersprenkelten Sommersprossen. Das hatte er von der Mutter – wenn die sich sehr freute, traten in ihr Gesicht ebensolche dunkle Pünktchen. Der Junge hatte allen Grund zur Hochstimmung. Diese Ausfahrt ins Meer wurde seinetwegen unternommen – er sollte das Jagdhandwerk erlernen. Deshalb drehte Kirisk wie eine Schnepfe den Kopf hierhin und dorthin und betrachtete alles mit nicht erlahmendem Interesse, voller Ungeduld. Zum ersten Mal in seinem Leben fuhr er zusammen mit richtigen Jägern aufs offene Meer, fuhr er zu einem großen Fang aus in dem großen Kajak der Sippe. Wie gern hätte sich der Junge von seinem Platz erhoben, hätte er die Männer angefeuert, selbst nach den Rudern gegriffen, sich mit Macht hineingelegt, um schneller zu den Inseln zu gelangen, wo die große Seetierjagd stattfinden sollte! Aber derlei kindliche Wünsche mochten ernsthaften Leuten närrisch dünken. Aus Furcht davor versuchte er nach Kräften, sich nicht zu verraten. Ganz gelang ihm dies nicht. Schwer fiel es ihm, sein Glück für sich zu behalten – heiße Röte malte sich unübersehbar auf seinen sonnenverbrannten drallen Wangen. Und aus seinen Augen – strahlenden, klaren, beseelten Jungenaugen – sprachen unverhohlen Freude und Stolz, die sein Herz erfüllten. Vor ihm lag das Meer, vor ihm – die große Jagd!
Der alte Organ verstand ihn. Während er mit zusammengekniffenen Augen übers Meer steuerte, bemerkte er dennoch, wie der Junge vor Ungeduld zappelte. Dem Alten wurden die Augen heiß – ach ja, die Kindheit, die Kindheit –, doch sog er schnell an seiner erlöschenden Pfeife, um ein Schmunzeln in den Winkeln seines eingefallenen Mundes zu unterdrücken. Er durfte nicht lächeln. Der Junge war nicht zum Spaß bei ihnen im Boot. Er sollte das Leben eines Jägers auf See beginnen. Beginnen, um es dereinst irgendwo im Meer zu beenden – so wollte es das Schicksal, denn nichts Schwierigeres und Gefährlicheres gibt es als den Fang zur See. Daran muss man sich von klein auf gewöhnen. Nicht umsonst pflegten die Leute früher zu sagen: »Verstand gibt der Himmel, Geschick erwirbt man schon als Kind!« Und dann sagten sie noch: »Ein schlechter Jäger fällt der Sippe zur Last.« Daraus folgt: Wer als Mann ein guter Ernährer sein will, muss sein Handwerk schon in frühester Jugend erlernen. Nun war die Reihe an Kirisk, war es Zeit, dem Jungen das Nötige beizubringen, ihn seetüchtig zu machen.
Das wussten alle – die gesamte Siedlung, der ganze Clan der Fischfrau am Scheckigen Hund wusste, dass die Männer heute seinetwegen hinausfuhren, um des künftigen Jägers und Ernährers Kirisk willen. So war es Brauch: Wer als Mann geboren ist, muss von klein auf mit dem Meer Freundschaft schließen, damit das Meer ihn kennt und er selbst das Meer achtet. Daher gingen sie in See – Organ, der Clan-Älteste, und die beiden besten Jäger, der Vater des Jungen, Emraijin, und ein Vetter des Vaters, Mylgun; daher kamen sie der hohen Pflicht der Älteren gegenüber den Jüngeren nach, diesmal ihm gegenüber, dem Jungen Kirisk, der von nun an für immer mit dem Meer zu tun haben würde, in Tagen des Erfolgs und des Misserfolgs.
War er, Kirisk, jetzt auch noch ein Junge, ein Milchbart, und blieb noch ungewiss, was je aus ihm würde – wer weiß, ob nicht gerade ihm bestimmt war, Ernährer und Stütze der Sippe zu werden, wenn sie selber als hilflose Greise nicht mehr ihrem Handwerk nachgehen konnten. So musste es sein, so hielt man es von Geschlecht zu Geschlecht, von einem zum anderen. Darauf beruhte das Leben.
Wozu darüber reden! Das denkt man bei sich und spricht davon selten. Daher schenkte dort, am Ufer des Scheckigen Hundes, keiner aus der Sippe der Fischfrau Kirisks erstem Jagdzug besondere Beachtung. Im Gegenteil, seine Stammesgefährten taten, als bemerkten sie gar nicht, wie er mit den erfahrenen Jägern aufs Meer hinausfuhr. Als nähmen sie dieses Vorhaben gar nicht ernst.
Nur die Mutter begleitete ihn, verlor aber ebenfalls kein Wort über die bevorstehende Fahrt und verabschiedete sich schon vor der Bucht. »Na, geh nur in den Wald!«, sagte sie betont laut zu dem Sohn und sah dabei geflissentlich nicht aufs Meer, sondern zum Wald. »Aber nimm nur trockenes Holz, und verlauf dich nicht im Wald!« Mit diesen Worten wollte sie die Spuren verwischen, den Sohn vor den Kinren schützen, den bösen Geistern. Auch den Vater erwähnte die Mutter mit keiner Silbe. Als wäre Emraijin nicht der Vater, und Kirisk ginge nicht mit dem Vater in See, sondern mit Fremden. Die Kinren sollten nicht erfahren, dass Emraijin und Kirisk Vater und Sohn waren. Wenn Väter und Söhne gemeinsam jagen, wüten die bösen Geister. Sie könnten den einen vernichten, um dem anderen Kraft und Willen zu rauben, auf dass er schwüre, nie wieder hinauszufahren aufs Meer, nie mehr den Wald zu betreten. So sind sie, diese tückischen Geister, versäumen keine Gelegenheit, den Menschen zu schaden.
Kirisk selbst hatte keine Angst vor den bösen Kinren, er war ja schon groß. Die Mutter aber fürchtete sie, bangte vor allem um ihn. »Du bist noch klein«, sagte sie. »Dich kann man noch leicht verwirren und töten.« Wie wahr! Wie viel Unheil bringen die bösen Geister über das junge Volk! Schicken Krankheiten und sonstiges Übel, verkrüppeln ein Kind, damit kein Jäger aus ihm wird. Wem nützt aber solch ein Mensch? Daher ist es so wichtig, vor bösen Geistern auf der Hut zu sein, besonders in der Kindheit, solange man noch nicht erwachsen ist. Steht einer erst auf eigenen Beinen, ist er eine Persönlichkeit, dann schrecken ihn auch keine Kinren mehr. Dann bezwingen sie ihn nicht, sie fürchten die Starken.
So nahmen Mutter und Sohn Abschied. Eine Weile noch verharrte die Mutter wortlos – in ihrem Schweigen lagen Angst, Flehen und Hoffnung –, dann ging sie zurück, ging und hatte sich kein einziges Mal nach dem Meer umgesehen, hatte kein Wort über den Vater verloren, als wüsste sie in der Tat nicht, wohin sich Mann und Sohn begaben, obwohl sie selbst die beiden am Abend für die Fahrt gerüstet, ihnen Wegzehrung bereitet hatte – Vorrat für drei Tage; jetzt stellte sie sich ahnungslos, so sehr bangte sie um den Sohn. In ihrer Angst verbarg sie sogar ihre Unruhe, ließ sich vor den bösen Geistern nicht anmerken, wie sehr sie sich insgeheim fürchtete.
Die Mutter war schon vor der Bucht umgekehrt, der Sohn aber stürzte, im Strauchwerk Bogen schlagend, um seine Spur zu verwischen und die unsichtbaren Kinren abzuschütteln, wie die Mutter ihn geheißen – wollte er sie doch an diesem Tag nicht erzürnen –, den weit vorausgegangenen Männern nach.
Rasch hatte er sie eingeholt. Sie gingen gemächlich mit ihrer Last, Gewehren und Fanggerät, auf der Schulter. Voran schritt der Älteste Organ, ihm folgte, auffallend groß gewachsen und kräftig, der breitschultrige, bärtige Emraijin, und hinterdrein stapfte, die Füße einwärts setzend, Mylgun, knorrig, klobig und rund wie ein Holzklotz. Ihre Kleidung, gut eingetragen, war für die Seefahrt aus gegerbten Häuten und Fellen so gefertigt, dass sie warm hielt und keine Nässe durchließ. Verglichen mit den Männern, wirkte Kirisk geradezu schmuck. Die Mutter hatte sich große Mühe gegeben, hatte seit Langem an seiner Seekluft genäht. Die Robbenfellstiefel und die Oberbekleidung hatte sie überdies an den Rändern bestickt. Wozu das auf dem Meer? Aber eine Mutter ist nun einmal eine Mutter.
»Sieh mal an! Wir dachten schon, du kommst nicht mit. Dachten, du wirst an der Hand wieder heimgeführt!«, spöttelte Mylgun, als Kirisk neben ihm auftauchte.
»Wieso? Nie und nimmer! Ich?!« Kirisk verschluckte sich fast vor Kränkung.
»Na, na, verstehst wohl keinen Spaß!«, wies ihn Mylgun zurecht. »Das gewöhn dir schnell ab. Mit wem sollen wir auf See schon sprechen, wenn nicht miteinander? Da, trag lieber was!« Er reichte ihm seine Winchesterbüchse. Dankbar lief der Junge neben ihm her.
Bald hieß es alles verstauen und ablegen.
So ging es fort aufs Meer. Wie anders würde die Rückkehr aussehen, falls sie Glück hatten und reiche Beute heimbrachten! Dann winkten dem Jungen Ehrungen – mit Fug und Recht. Feiern wird man die Heimkehr des jungen Jägers, mit Liedern die Freigebigkeit des Meeres rühmen, in dessen unermesslichen Tiefen sich Fische und anderes Getier mehren, für starke und kühne Jäger bestimmt. Der Fischfrau wird man Lieder darbringen, der Urmutter, dank der die Fischfrau-Sippe die Erde bevölkert. Dann werden die Hohlstammtrommeln unter den Schlägen der Ahornschlegel erdröhnen, und inmitten der Tanzenden wird der Schamane, der Allwissende, mit Erde und Wasser zu reden beginnen, über ihn, Kirisk, den neuen Jäger. Ja, über ihn wird der Schamane mit Erde und Wasser sprechen, er wird sie beschwören und bitten, stets gut zu ihm zu sein, auf dass er zu einem großen Jäger heranwachse, das Glück ihn stets begleite zu Lande und zu Wasser, und es ihm nie an Beute fehle, sie gerecht zu verteilen unter Alt und Jung. Auch wird der weise Schamane Erde und Wasser beschwören und bitten, dass Kirisk Kinder geboren werden und alle am Leben bleiben, damit sich das Geschlecht der Großen Fischfrau mehre und Nachkommen zeuge noch und noch.
Wo schwimmst du, Große Fischfrau? Dein heißer Leib empfängt das Leben, dein heißer Leib hat uns geboren am Meer, dein heißer Leib ist der beste Ort auf Erden. Wo schwimmst du, Große Fischfrau? Deine weißen Brüste gleichen Robbenköpfen, deine weißen Brüste nährten uns am Meer. Wo schwimmst du, Große Fischfrau? Der stärkste Mann wird zu dir schwimmen, auf dass dein Leib schwelle und dein Geschlecht sich mehre auf Erden …
Solche Lieder wird man singen auf dem Fest bei Tanz und Frohsinn. Und noch etwas Wichtiges stand Kirisk an jenem Fest bevor. Der ekstatisch tanzende Schamane wird sein Jägerschicksal einem Stern am Himmel anbefehlen. Hat doch ein jeder Jäger seinen Schutzstern. Welchem Stern er aber sein, Kirisks, Schicksal anvertraut, würde keiner je erfahren. Einzig der Schamane und jener Stern, der unsichtbare Beschützer, werden das wissen. Sonst niemand. Sterne aber gibt es am Himmel ohne Zahl …