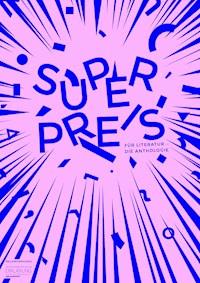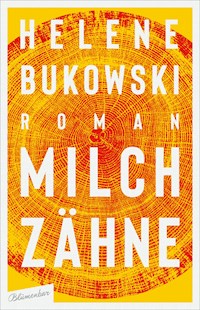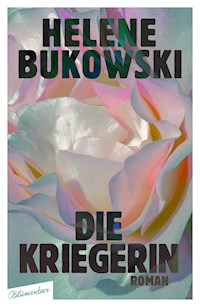
16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Lisbeth und die Kriegerin kennen sich seit der Ausbildung bei der Bundeswehr. Sie haben sich für das Militär entschieden, weil sie einen Körper wollen, der nicht verwundbar ist – als ließe sich der Welt nur mit einem Herzen begegnen, das zur Faust geballt ist. Dabei ist Lisbeth sehr empfindsam: ihre Haut reagiert auf Gefühle und Träume anderer Menschen; schützen kann sie sich nur, indem sie die Distanz wahrt. Als sich ein Feldwebel brutal von Lisbeth nimmt, was er will, schwindet auch diese Sicherheit.
»Die Kriegerin« ist ein Roman über die besondere Freundschaft zweier Frauen, deren oberstes Gebot ist, sich nicht verletzlich zu machen. Helene Bukowski erzählt von den daraus entstehenden Wunden, der Gewalt, ihren Spuren und den Traumata – den erlebten, als auch den vererbten.
»Bukowski verfügt über ein scharfes Sensorium, mit dem sie politisch virulente Themen glasklar erfasst.« Der Tagesspiegel
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 304
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Über das Buch
Als Lisbeth nach ihrem Arbeitstag im Blumengeschäft nach Hause kommt und ihren Mann, ihre Tochter und ein paar Freunde in der Küche sitzen sieht, hält sie es plötzlich nicht mehr aus. Sie dreht um, verlässt die Wohnung, setzt sich ins Auto, fährt an die Ostsee. Dorthin zieht es sie, seit sie als Kind die Sommer mit ihren Eltern in einem Bungalow inmitten der Dünen verbracht hat. Dorthin zieht es sie, seit die Kriegerin ihr während der gemeinsamen Zeit bei der Bundeswehr erzählt hat, dass sie ganz in der Nähe aufgewachsen ist. In diesen Tagen am Strand, an denen sich Lisbeths Leben am Scheidweg befindet, steht die Kriegerin auf einmal vor ihr. Viele Jahre sind vergangen, seitdem sie sich das letzte Mal gesehen haben, aber voneinander angezogen fühlen sie sich noch immer. Aber auch ihre Vergangenheit ruht nicht. Sie sind Frauen, die Gewalt erfahren haben und Gewalt verüben – gegen sich selbst und die Menschen, die ihnen nahe sind. Doch Lisbeth und die Kriegerin sind auch bereit, dagegen anzukämpfen.
Über Helene Bukowski
Helene Bukowski, geboren 1993 in Berlin, lebt heute wieder in ihrer Geburtsstadt. Sie studierte am Literaturinstitut Hildesheim und leitet neben dem Schreiben auch Kurse und Workshops für Kreatives Schreiben. 2019 erschien ihr Debütroman »Milchzähne«, für den sie u. a. für den Mara-Cassens-Preis, den Rauriser Literaturpreis und den Kranichsteiner Literaturförderpreis nominiert war. Der Roman wurde ins Französische und Englische übersetzt und eine Verfilmung ist in Vorbereitung.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlage.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Helene Bukowski
Die Kriegerin
Roman
Übersicht
Cover
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Informationen zum Buch
Newsletter
Motto
Erster Teil — Salzwasser
Zweiter Teil — Schweiss
Dritter Teil — Tränen
Ich danke
Impressum
»Eine Frau bleibt auf Ewigkeit ein Gegenstand«
Finch
»Schmeck mein Blut, Junge Schmeck mein Blut«
Ebow
Erster Teil
Salzwasser
Lisbeth schreckte auf. Die Dunkelheit war so dicht, dass sie nicht wusste, ob sie die Augen geöffnet oder geschlossen hatte. Sie tastete nach dem Nachttisch, fand ihr Handy, hielt es sich vor das Gesicht. Der Bildschirm leuchtete hell, für einen Moment sah Lisbeth nichts. Sie blinzelte. Drei Uhr dreißig. Malik seufzte im Schlaf, drehte sich zu ihr. Zwischen ihnen lag das Kind, atmete ruhig, schlief tief. Lisbeth schlug die Decke zurück, stand auf, schlüpfte in ihre Hausschuhe, zog einen Pullover über, verließ das Zimmer, ging durch den dunklen Flur, schaltete die Lampe in der Küche an. Im Licht begutachtete sie ihre Arme. Die Haut war wund, in den Armbeugen blutverschmiert. Sie überprüfte ihre Fingernägel, pulte Schorf unter ihnen hervor, setzte Wasser auf, füllte Kaffeepulver in eine Tasse.
Im Badezimmerspiegel sah sie, dass sie auch ihren Hals aufgekratzt hatte. Sie duschte kalt, spülte das Blut von ihrem Körper, trocknete sich vorsichtig ab, cremte sich ein, aber ihre Haut hörte nicht auf zu brennen. Zurück in der Küche trank sie den Kaffee, aß eine Scheibe Toast, schlüpfte in ihre fliederfarbene Daunenjacke und verließ die Wohnung.
Sie hatte den Transporter des Blumengeschäfts in einer Seitenstraße geparkt, unter einer Linde, die bereits ihre Blätter verlor. Lisbeth sammelte einige von der Frontscheibe, setzte sich ins Auto, startete den Motor.
Die Straßen waren leer. Sie kam zügig voran. Das Radio hatte sie so leise gestellt, dass sie nicht verstand, worüber gesprochen wurde, nur ein leises Murmeln war zu hören.
Auf dem Großmarkt war noch nicht viel los, der Geruch der Blumen füllte die Halle. Lisbeths Bewegungen wurden ruhiger. Systematisch ging sie alle Stände ab, griff nach den Blüten, überprüfte ihre Stabilität, feilschte, reichte Geld hinüber, unterhielt sich über das Wetter. Nachdem sie alles bekommen hatte, was auf ihrer Liste stand, verstaute sie die Blumen im Transporter und rauchte auf dem Parkplatz eine Zigarette, den Rücken gegen das kühle Metall des Autos gelehnt. Eine Sirene erklang, schnitt durch die Nacht. Lisbeth roch Verbranntes, sah sich um, glaubte für einen Moment, in einem Regen aus Asche zu stehen, blinzelte, sofort war es still. Sie rieb sich über ihre Arme, verstärkte den Druck.
»Verdammt«, fluchte sie und schüttelte ihre Hände aus, widerstand dem Drang, sich zu kratzen, warf die Zigarette fort und stieg ins Auto.
Lisbeth fuhr aus der Stadt hinaus, parkte an einem Kanal, lief durch das hochstehende Unkraut. Blätter und Kletten blieben an ihrer Hose haften. Sie holte ihr Klappmesser aus der Jackentasche, schnitt im Licht ihres Handys Spitzwegerich, Kerbel, Wiesen-Goldhafer, ein paar Schlehenzweige. Langsam ließ der Juckreiz nach. Am Horizont war ein erster Streifen Licht zu sehen.
Als sie zurück in die Stadt fuhr, ging die Sonne auf. Rot glühte sie im Rückspiegel.
Das Blumengeschäft befand sich nahe der Spree. An diesem Tag konnte Lisbeth das Wasser riechen. Sie stellte den Transporter an der Uferkante ab und trug die Blumen und das geschnittene Unkraut zum Laden, verteilte sie dort auf die Emaillekübel, sortierte über Nacht Verwelktes aus, schrieb neue Preise auf die Schilder, sah die Bestellungen durch, arrangierte Töpfe und Pflanzen draußen vor der Tür und fuhr die Markise aus.
Es blieb ein ruhiger Tag. Nur ein paar Menschen kamen in den Laden und kauften Blumen. Lisbeths Hände rochen nach Pistaziengrün, sie hatte mehrere Sträuße mit den Gräsern vom Kanal gebunden und war immer wieder nach draußen in den Hinterhof gegangen, um dort auf einem ausrangierten Stuhl zu sitzen und zu rauchen.
Am Nachmittag rief die Besitzerin des Geschäfts an, gab die Blumenwünsche für die Gestecke einer Hochzeit durch, legte grußlos auf. Lisbeth schrieb eine Liste, fegte die abgeschnittenen Blätter und Stiele zusammen, die sich über den Tag angesammelt hatten und als dichte Schicht den Boden bedeckten, wechselte das Wasser in den Kübeln, heftete Quittungen ab, legte den Schlüssel des Transporters in die Kasse und rauchte eine letzte Zigarette, bevor sie alle Töpfe von draußen wieder nach drinnen räumte, die Markise einfuhr, einen der Sträuße mit den Gräsern und Zweigen vom Kanal in Papier einschlug und sich unter den Arm klemmte.
Um achtzehn Uhr schloss sie die Tür des Blumengeschäfts ab, hielt den Strauß kopfüber. Sie spürte das Gewicht ihrer Hände, die raue Haut, die Schnitte, schob die Finger tief in die Taschen ihrer Daunenjacke und lief unter den schon fast kahlen Platanen hindurch, den Gehsteig entlang, unter ihren Füßen vibrierte die U-Bahn.
In ein paar Wochen würde es dunkel sein, wenn sie das Geschäft am Morgen aufschloss, und es würde dunkel sein, wenn sie es abends verließ.
Ein feiner Nieselregen setzte ein. Lisbeth zog sich die Kapuze ihrer Jacke tief ins Gesicht. Sie spürte die Kälte des Wassers, die Straßenlaternen waren angegangen. In dem orangenen Licht sah der Regen aus wie Schnee. Zu Lisbeths Linken tat sich eine Lücke zwischen den Häusern auf. Hoch standen die Brennnesseln. Lisbeth verließ den Bürgersteig, lief hindurch, kümmerte sich nicht darum, dass die Nässe der Blätter auf ihrer Hose zurückblieb. Im Frühling hatte jemand in die Mitte der Brache Herbstastern gepflanzt. Noch blühten sie. Lisbeth sah sich um. Am Boden zwischen den Blumen kauerte ein weißer Hund. Sie fing an zu schwitzen. In ihrem Kopf verhallte ein Schuss. Sie blinzelte und erkannte, dass es kein Hund war. Eine weiße Plastiktüte hatte sich zwischen den Stielen verfangen. Auf Lisbeths Haut brannte der Schweiß. Sie schob die Ärmel ihrer Daunenjacke nach oben, fuhr über ihre Armbeugen, die Handgelenke, versuchte, nicht die Fingernägel zu benutzen, pulte am Schorf. Dann bückte sie sich nach der Plastiktüte, ging das Beet einmal ab, fand auch noch eine zerknüllte Alufolie, ein leeres Trinkpäckchen und drei Plastikkorken. Sie verließ die Brache, warf alles in einen Mülleimer und lief weiter.
Lisbeth schloss die Haustür auf, stieg die Treppe nach oben, merkte, wie sie immer langsamer wurde. Vor der Wohnungstür blieb sie stehen. Neben der Fußmatte lagen Maliks Turnschuhe, daneben die gelben Gummistiefel des Kindes und noch drei andere Paar Schuhe, die Lisbeth nicht kannte. Sie fühlte ihren Körper schwer werden, in Zeitlupe drehte sie den Schlüssel im Schloss, öffnete die Tür. Die Wohnung war hell erleuchtet. Warme Luft schlug ihr entgegen. Es roch nach Essen. Ein Stimmengewirr kam aus der Küche. Lisbeth hängte ihre Jacke an die Garderobe, ging durch den breiten Flur, stieg über Spielzeug, blieb im Türrahmen zur Küche stehen, hielt den eingeschlagenen Strauß vor der Brust. Malik hantierte am Herd. Drei Freunde von ihm saßen um den ausgezogenen Küchentisch. Sie grüßten Lisbeth. Eden befand sich in ihrer Mitte, mit einem Lätzchen um den Hals. In dem Moment, in dem Eden Lisbeth sah, reckte Eden die speckigen Arme in die Luft und gluckste.
»Da bist du ja«, sagte Malik, drehte sich zu ihr, lächelte sie an. »Wir wollten gerade anfangen.«
Lisbeth hielt den Strauß fester. Vom hellen Licht brannten ihre Augen. Eden streckte noch immer die Arme nach ihr aus, aber sie schaffte es nicht, den Schritt über die Türschwelle zu machen, ganz in den warmen Raum hineinzutreten, sich an den gedeckten Tisch zu setzen, nach einem Weinglas zu greifen, mit den anderen anzustoßen, sich am Gespräch zu beteiligen.
Malik hatte sich wieder den Töpfen zugewandt, öffnete eine Packung Nudeln, entleerte sie in das kochende Wasser. Sein Körper wirkte dabei so leicht, dass er Lisbeth hohl vorkam. Sie schaute zum Tisch, auch das Kind sah mit einem Mal aus, als wäre es aus Pappmaschee.
»Ich habe etwas im Laden vergessen«, murmelte sie, drehte sich um, nahm hastig die Jacke von der Garderobe und verließ die Wohnung. Als sie unten war, hörte sie, wie oben die Tür aufging, hörte, wie Malik nach ihr rief, hörte das Kind weinen, aber sie blieb nicht stehen.
Unten auf der Straße schnappte sie nach Luft. Der Regen war stärker geworden, sie lief durch die Pfützen, ihre Schuhe wurden nass. Lisbeths Auto stand im Halteverbot, sie knüllte den Strafzettel zusammen, setzte sich hinein, hielt das Gesicht in den Blumenstrauß, brüllte, biss zu. Die Dunkelheit schlug hohe Wellen, füllte Lisbeths Lungen, zerdrückte ihre Brust, schmeckte nach Asche. In ihrer Jackentasche vibrierte ihr Handy. Sie holte es heraus. Zwei verpasste Anrufe von Malik. Mechanisch startete Lisbeth den Motor, schaltete den Scheibenwischer ein, fuhr los. Sie hatte sich die Strecke so oft auf einer Karte angesehen, dass sie genau wusste, wie sie fahren musste. Schnell war sie aus der Stadt, beschleunigte auf der Autobahn, fuhr Richtung Norden.
Kurz vor Mitternacht erreichte sie die Ostsee. Keine Wolke war am Himmel. Im hellen Licht des Mondes stürzte Lisbeth zum Strand, setzte sich in die Dünen. Der Sand war nass. Sie grub ihre Hände hinein, starrte auf das Wasser, ignorierte die Kälte.
Erst gegen Mitternacht ging sie zurück zu ihrem Auto, rollte sich auf der Rückbank zusammen, ihre Jacke als Decke, schlief sofort ein. Wie in den vergangenen Nächten lief sie im Traum wieder über eine verbrannte Ebene, suchte nach drei Steinen, verlor sie, bückte sich erneut.
Am Morgen bedeckte eine feine Eisschicht die Scheiben des Autos. Lisbeth stieß die Tür auf. Der Himmel war weit. Möwen trieben im Wind.
Bei einer Bäckerei holte Lisbeth sich noch warmes Gebäck und Kaffee, setzte sich an den Strand, aß und trank und schaute wieder auf das Meer. Zogen sich die Wellen zurück, hinterließen sie große Schaumreste auf dem Sand, die in der Sonne glitzerten und nach und nach in sich zusammenfielen.
Lisbeths Handy zeigte mehrere verpasste Anrufe. Sie drückte den Kaffeebecher zusammen, zündete sich eine Zigarette an und wählte Maliks Nummer. Er nahm sofort ab.
»Was ist passiert?«, fragte er, mit schwerer Stimme.
»Ich bin an der Ostsee.«
»Warum?«
»Ich kann das jetzt nicht erklären.«
»Wann kommst du wieder?«
»Ich fahre gleich los.«
»Was ist denn?«
Lisbeth schwieg, aschte in den Sand. »Mir geht es gut. Mach dir keine Sorgen.«
Malik atmete hörbar aus.
»Ich melde mich, wenn ich in die Stadt hineinfahre«, sagte Lisbeth, verabschiedete sich, legte auf. Sie ließ den Zigarettenstummel in den Kaffeebecher fallen. Es zischte. Auf dem Meer zog langsam ein Frachter vorbei. Lisbeth erhob sich, klopfte sich den Sand von der Hose, wollte loslaufen, doch stattdessen fiel sie zurück. Sie versuchte erneut, aufzustehen, aber ihre Muskeln gehorchten nicht. Gefühlt eine Ewigkeit kämpfte sie gegen sich selbst, dann gelang es ihr endlich, sich zu erheben. Stolpernd verließ sie den Strand, stieg in ihr Auto, wollte den Motor starten, aber ihre Hände lagen reglos auf ihren Oberschenkeln.
Sie schlug den Kopf gegen das Lenkrad. So fest, dass ihr für einen Moment schwindelig wurde.
»Es geht nicht«, sagte sie, lachte schrill, konnte es selbst nicht glauben.
Dort, wo sie am Strand gesessen hatte, war noch ein Abdruck im Sand. Lisbeth verwischte ihre Spur, lief zum Wasser und dann weiter, entfernte sich immer mehr von ihrem Auto. Eine Schar Möwen pickte in einem Teppich aus angespülten Muscheln. Sie flogen nicht auf, als Lisbeth dicht an ihnen vorbeilief. Die Schalen knackten unter ihren Schuhen. Sie erklomm die Dünen, schirmte ihre Augen mit der Hand ab. Vor ihr lag ein Bungalow. Die Holzfassade war verwittert. Ausgeblichene Vorhänge verdeckten die Fenster. Das Haus schien verlassen. Lisbeth stieg die Dünen hinunter, sofort war das Rauschen des Meeres nur noch gedämpft zu hören. Sie versuchte durch einen Spalt zwischen den Gardinen hineinzublicken, aber drinnen war es dunkel. Sie wandte sich ab, umrundete den Bungalow. In der Einfahrt standen Baufahrzeuge, gestapelte Steine auf einer Palette, ein Container, ein silberner Jeep. Auf der Treppe saß ein alter Mann und rauchte. Zu seinen Füßen ein schwarzer Hund. Der Hund sprang auf, bellte. Lisbeth hob die Hand und sagte: »Ich war hier früher immer im Sommer mit meinen Eltern.«
Der alte Mann musterte sie. »Ich erinnere mich. Das Kind mit der kaputten Haut.«
Lisbeth war froh, dass sie ihre Daunenjacke trug und er ihre Arme nicht sehen konnte.
»Machst du Urlaub?«, fragte er.
Sie nickte, ohne ihn dabei anzusehen.
»Und wo schläfst du?«
»Ich wollte im Ort fragen.«
Der alte Mann lachte und schnipste die Zigarette in die Dünen. »Wenn du willst, vermiete ich dir den Bungalow. Eigentlich sollte hier jetzt der Umbau beginnen, aber auf Menschen ist eben kein Verlass«, er kraulte den Hund, vergrub die rissigen Hände im schwarzen Fell, sah Lisbeth an.
»Für wie lange?«
»Anderthalb Wochen?«
»In Ordnung.« Lisbeth hielt ihm die Hand hin. Er schüttelte sie und griff dann in seine Hosentasche, zog einen Schlüsselbund hervor und überreichte ihn ihr zusammen mit einer Visitenkarte.
»Ist alles so wie früher hier. Wenn du was brauchst, ruf mich an.« Er nahm den Hund am Halsband, zog ihn mit sich, bugsierte ihn in den Jeep. Lisbeth rührte sich nicht, bis er davongefahren war. Erst dann drehte sie sich um, schloss die Tür auf und trat hinein. Es roch wie damals. Sie ging die Räume ab. Auch die Einrichtung war unverändert. Ausgeblichene Polster. Laminatboden. Möbel aus Kiefernholz. Sofort hatte sie ihren Vater vor Augen, wie er in einem weiten T-Shirt und Shorts mit sandigen Haaren durch die Zimmer lief.
Lisbeth trat auf die Terrasse. Durch die salzige Luft und die Sonne war das Holz noch heller geworden. Sie setzte sich auf einen verrosteten Stuhl und holte ihr Handy hervor. Die Besitzerin des Blumengeschäfts hatte versucht, sie anzurufen. Sie schaltete es aus und lehnte sich zurück.
Lisbeth schlief viel. Meist stand sie erst gegen Mittag auf. Die Nachmittage verbrachte sie am Strand, lief unaufhörlich, bis die Sonne unterging. Am Abend aß sie in einem der Restaurants im Ort. Man musterte sie. Als Frau ohne Begleitung fiel sie auf. Dass es niemanden an ihrer Seite gab, der die gleiche Regenjacke wie sie trug, oder dessen Hand sie hielt, während sie am Strand entlanglief. Lisbeth kümmerte sich nicht darum.
In einer kleinen Boutique hatte sie sich Turnschuhe, Oberteile, eine Sporthose, Unterwäsche und eine Reisetasche gekauft, in der Drogerie eine Zahnbürste, Seife, Zahnpasta. Es gefiel ihr, die neue Kleidung zu tragen und die ihr fremden Hygieneartikel zu benutzen. Die Zahnpasta schmeckte anders.
Nachts, wenn sie aufschreckte und ihr Haar nach dem Rauch der verbrannten Ebene aus dem Traum roch, zog sie die Turnschuhe an und ging am Strand laufen. Sie lief so lange, bis ihr Körper wieder müde wurde. Erst dann kehrte sie in den Bungalow zurück, legte sich schlafen, träumte nichts.
Wenn sie an Malik und Eden dachte, fühlte es sich an, als wären sie weit weg, in einem fernen Land auf einem anderen Kontinent.
Am fünften Tag rief ihre Mutter an.
»Wo bist du?«, fragte sie.
»Hat dich Malik angerufen?«, fragte Lisbeth. Sie saß im Wohnzimmer des Bungalows, die Beine ausgestreckt.
»Aus der Nase musste ich es ihm ziehen. Was ist passiert?«
»Ich bin im Bungalow«, sagte Lisbeth.
Ihre Mutter schwieg.
»Dort, wo wir immer Urlaub gemacht haben.«
»Warum?«, fragte ihre Mutter.
»Ich kann nicht zurück nach Berlin.«
»Was heißt, du kannst nicht?«
»Es geht einfach nicht.«
»Und was hast du jetzt vor?«
Lisbeth schwieg. Ihre Mutter seufzte. »Du musst Malik anrufen.«
»Er braucht mich nicht.«
»Was redest du da?«, rief ihre Mutter.
Lisbeth biss sich auf die Lippen. Die Haut in ihren Kniekehlen begann zu brennen. Sie fuhr sich über den Hals. »Ich muss jetzt auflegen«, sagte sie.
»Ruf ihn bitte an, sprich mit ihm.«
Lisbeth verstärkte den Druck ihrer Finger.
»Hast du gehört, was ich dir gesagt habe?«, fragte ihre Mutter.
»Ich ruf ihn an.«
»Versprich es mir.«
»Ich verspreche es dir.«
Ihre Mutter seufzte erleichtert. »Gut.«
Lisbeth legte auf.
Draußen war es dunkel geworden. Blinzelnd saß sie in dem fehlenden Licht. Sie machte sich einen Kaffee, ging zurück zum Sofa, wählte Maliks Nummer.
»Hallo«, sagte sie und kratzte sich an ihrem Schlüsselbein. Er sagte nichts.
»Ich muss für eine Weile hierbleiben.«
»Verdammt, Lisbeth.«
»Es tut mir leid.«
»Was soll ich Eden sagen?«
»Ich weiß nicht.«
»Habe ich etwas falsch gemacht?«
»Nein.«
»Kann ich etwas tun, damit du wiederkommst?«
Lisbeth schwieg.
Im Hintergrund erklang das Weinen des Kindes.
»Ich kann jetzt nicht weiter telefonieren«, sagte Malik.
»Ich melde mich«, beeilte sich Lisbeth zu sagen, aber da hatte er das Gespräch schon beendet. Benommen lag sie auf dem Sofa. Schließlich schaffte sie es, aufzustehen, schaltete das Licht an, ging ins Bad. Erst im Spiegel bemerkte sie, dass sie sich am Hals aufgekratzt hatte. Sie verrieb das Blut, wusch es ab, putzte sich die Zähne.
Als sie im Bett lag, nahm sie ihr Handy und suchte im Internet nach den Begriffen Floristin, Job, Ausland und scrollte sich durch die Anzeigen. Auf zwei Kreuzfahrtschiffen wurden Floristinnen gesucht. Lisbeth speicherte die Seiten und löschte das Licht.
Am nächsten Morgen lief sie über den Strand bis zum Ort. Im Kiosk befand sich in einem Hinterraum ein Internetcafé. Die Computer schienen schon seit langer Zeit nicht mehr benutzt worden zu sein. Schwerfällig dröhnten die Lüftungen. Lisbeth bezahlte für vier Stunden, erstellte eine Bewerbung, verschickte sie an die Adressen, die sie am Tag zuvor herausgesucht hatte. Sie fühlte sich benommen, als sie den Kiosk wieder verließ. Das Flimmern des Bildschirms stand ihr noch immer vor Augen. Die Wolken hingen an diesem Tag tief. Es roch nach Schnee, obwohl es nicht kalt war. Rauchend schlenderte Lisbeth zum Meer.
Das Wasser war aufgewühlt. Möwen schrien in der Ferne. Langsam lief sie Richtung Bungalow. Eine Frau kam auf sie zu. Erst als Lisbeth sie fast passiert hatte, sah sie das Baby, das die Frau unter der Jacke trug und fest umschlungen hielt. Lisbeth hatte Eden nur ein einziges Mal auf diese Art getragen. Sie war U-Bahn gefahren. Eden war erst wenige Wochen alt. Wie die Frau hatte Lisbeth einen dicken Wintermantel angehabt. Als an einer Station zwei Männer mit blonden zurückgegelten Haaren dazugestiegen waren, hatte Lisbeth sofort das Bild im Kopf gehabt, wie einer von ihnen ein Messer zückt und damit auf sie einsticht, ohne zu bemerken, dass sich das Kind unter ihrem Mantel befindet. Sie hatte zu schwitzen begonnen, hatte die Männer nicht aus den Augen gelassen und war zwei Stationen zu früh ausgestiegen. Danach hatte sie Eden nie wieder so eng am Körper getragen, hatte stattdessen immer den Kinderwagen genommen, auch wenn nur wenige der U-Bahn-Stationen einen Aufzug besaßen. Malik dagegen hatte immer nur das Tragetuch benutzt, hatte Eden behutsam an seiner Brust verstaut, sich vor nichts gefürchtet oder vielleicht bloß gewusst, dass er Eden im Ernstfall verteidigen könnte.
Lisbeth nickte der Frau zu und beeilte sich, den Abstand zu ihr zu vergrößern. Sie sah auf den Boden, wo Algen, Steine und Muscheln im Sand lagen.
»Vorsicht.«
Lisbeth hob den Kopf, blieb stehen.
Aufrecht stand die Kriegerin vor ihr. Ihre Augen waren wach. Die Lippen spröde, das Gesicht kaum gealtert. Nur ihr Haar war jetzt weiß, wie bei einer alte Frau.
Für eine Weile sahen sie sich nur an. Dann brach Lisbeth das Schweigen.
»Was machst du hier?«
»Baden«, sagte die Kriegerin und grinste.
Erst jetzt fiel Lisbeth auf, dass die Kriegerin ihre Schuhe und Socken ausgezogen hatte.
»Das meine ich nicht«, sagte Lisbeth.
»Ich bin hier aufgewachsen. Hast du das vergessen?«
Lisbeth schüttelte den Kopf. Natürlich hatte sie es nicht vergessen.
»Und du?«, fragte die Kriegerin.
»Urlaub«, sagte Lisbeth knapp.
»Allein?« Die Kriegerin sah sich um, als würde sie erwarten, dass im nächsten Moment eine Reisegruppe hinter Lisbeths Rücken hervorsprang.
»Allein«, sagte Lisbeth mit Nachdruck. »Ist es nicht ein bisschen kalt zum Baden?«
»Ich bin ganz andere Temperaturen gewohnt«, sagte die Kriegerin, zog ihre Laufjacke aus, die Jogginghose, den Sport-BH und den Slip, bis sie, bis auf ihre Mütze, nackt vor Lisbeth stand. Dann wandte sie sich ab und ging, ohne zu zögern, ins Meer hinein. Sie schwamm ein Stück, nur ihr Kopf war zu sehen. Lisbeth musste an ihre Mutter denken. Auch sie hatte sich nie nach ihr umgedreht, wenn sie ins Wasser gegangen war.
Die Kriegerin schwamm zurück, kam wieder heraus. Ihre Haut leuchtete rot durch die Kälte. Aber sie schien es nicht eilig zu haben, zurück in ihre Kleidung zu kommen, ließ sich Zeit beim Anziehen.
»Wo wohnst du?«, fragte sie.
Lisbeth deutete in die Richtung des Bungalows.
Die Kriegerin schloss den Reißverschluss ihrer Laufjacke und zog sich ihre Handschuhe an.
»Ich habe ein Zimmer im Hotel direkt am Pier. Gibt eine gute Bar dort. Wenn du magst, komm doch heute Abend vorbei, dann trinken wir ein Bier.« Sie nickte Lisbeth zu und lief dann den Strand entlang Richtung Ort. Noch eine Weile sah Lisbeth ihr nach, dann hastete sie zum Bungalow.
Sie hatte sich fest vorgenommen, nicht zum Hotel zu gehen, die Kriegerin vergeblich warten zu lassen, aber als es dunkel wurde, reagierte ihr Körper automatisch. Er zog sich die Schuhe an, schlüpfte in die Jacke und fuhr mit dem Auto in den Ort, parkte vor dem Hotel, stieg aus und betrat die Lobby. Ein riesiger Kronleuchter hing an der Decke, der Marmorboden spiegelte sein Licht, eine dunkel vertäfelte Bar teilte den Raum. Lisbeth sah die Kriegerin sofort. Sie saß in einem wuchtigen Ledersessel direkt vor der Fensterfront und guckte nach draußen auf das Meer, vor sich ein halb leeres Bierglas.
»Da bist du ja«, sagte sie, als Lisbeth sich neben sie setzte. Im Licht des Kronleuchters war das graue Haar der Kriegerin noch auffälliger. Lisbeth hatte das Bedürfnis, danach zu greifen, wollte sich vergewissern, dass es echt war. Schnell schob sie sich die Hände unter die Oberschenkel.
»Hast du es gefärbt?«, fragte sie.
Die Kriegerin nahm einen großen Schluck aus ihrem Glas und schüttelte den Kopf. »Muss wohl ein Gendefekt sein. Meine Großmutter ist auch in den Kriegsjahren ergraut.«
»Krieg?«
Die Kriegerin verzog spöttisch den Mund. »Stimmt, kein Krieg, friedenserhaltende Maßnahmen.« Sie streckte die Beine aus und lehnte sich zurück. Kommentarlos stellte eine Kellnerin ein Bierglas vor Lisbeth auf den Tisch und verschwand so lautlos, wie sie gekommen war. Lisbeth nahm einen Schluck, spürte den Schaum an ihren Lippen, wischte sich über den Mund. In ihrer unförmigen Daunenjacke, der ausgeblichenen Hose, den sandigen Schuhen, kam sie sich deplatziert vor. Sie veränderte ihre Position.
»Also, bist du noch Soldatin?«, fragte sie.
»Fallschirmjäger«, erklärte die Kriegerin. Der Stolz in ihrer Stimme war nicht zu überhören. »Und du?«
Lisbeth dachte an das Blumengeschäft, dachte an Malik, dachte an das Kind. »Ich bewerbe mich gerade auf Kreuzfahrtschiffen.«
»Als was?«
»Als Floristin.«
»Stimmt, das hattest du ja gelernt, bevor – « Die Kriegerin verstummte, senkte den Blick, verschob ihr Glas. »Kommt mir vor wie eine Ewigkeit, dass wir uns ein Stockbett geteilt haben.« Sie lachte, lachte wie früher, breit und mit allen Zähnen.
Lisbeth öffnete den Reißverschluss ihrer Daunenjacke. »Wie geht es deiner Großmutter?«, fragte sie.
»Gestorben. Schon vor einer Weile.«
»Das tut mir leid.«
»Muss es nicht. Sie war alt«, sagte die Kriegerin und lehnte sich zurück. »Was ist in deinem Leben passiert, seitdem wir uns das letzte Mal gesehen haben?«
»Nicht viel. Verschiedene Jobs. Verschiedene Orte. Zuletzt war ich Floristin in Berlin.«
»Und deine Familie?«
»Meiner Mutter geht es gut.«
Die Kriegerin nickte, griff in die Tasche ihres Mantels und legte drei vom Salzwasser rund geschliffene Steine neben ihr Bierglas. Lisbeth starrte auf die Steine.
»Was ist?«
»Woher hast du die Steine?«, fragte Lisbeth.
»Vom Strand. Da liegen einige.«
»Ich träume davon.«
»Von was?«
»Von Steinen.«
Das Gesicht der Kriegerin wurde ernst. Sie richtete sich in ihrem Sessel auf.
»Was genau träumst du?«, fragte sie.
»Ich laufe über eine Ebene. Die Landschaft ist wie in einem anderen Jahrhundert, alles ist voller Morast und Asche, es gibt keine Straßen. Manchmal treffe ich auf andere, aber wir ziehen grußlos aneinander vorbei. Und während ich laufe, mustere ich die ganze Zeit den Boden, suche nach Steinen. Erst wenn ich drei gefunden und sie in meiner Tasche verstaut habe, werde ich ruhiger. Aber dieser Zustand hält nie lange an, denn kurze Zeit später bemerke ich immer, dass meine Tasche ein Loch hatte, dass ich nicht mehr drei Steine bei mir trage, sondern nur noch zwei, einen oder keinen, und die Suche beginnt erneut.« Sie musterte die Kriegerin, versuchte, ihr Gesicht zu lesen, aber es verriet nichts.
»Das klingt sehr düster«, sagte die Kriegerin und erhob sich ruckartig. »Würde es dir etwas ausmachen, wenn wir nach oben gehen? Die Musik hier bereitet mir Kopfschmerzen.«
Erst jetzt registrierte Lisbeth die Geräusche um sie herum. Irgendwo wurde Klavier gespielt, vielleicht war es aber auch nur eine Konzertaufnahme, die zu hören war. Sie ließ ihr halbvolles Bier am Tisch zurück und folgte der Kriegerin. In der engen Kabine des Fahrstuhls standen sie so nah beieinander, dass sie sich fast berührten. Die Kriegerin musste sich am Spiegel abstützen, um nicht das Gleichgewicht zu verlieren. Sie fuhren in die oberste Etage, liefen über einen langen Flur. Ein dicker Teppich dämpfte das Geräusch ihrer Schritte. Mit einer unbedruckten weißen Karte öffnete die Kriegerin die Tür zu ihrem Zimmer. Helle Vorhänge verdeckten das Fenster. Dahinter vermutete Lisbeth das Meer. Die Kriegerin steckte die Karte ein. Das Licht ging an. Erst jetzt sah Lisbeth, dass überall auf den Ablageflächen Steine lagen. Manche rund geschliffen wie die, die die Kriegerin auf dem Tisch in der Lobby zurückgelassen hatte. Andere waren scharfkantig. Es gab kleine, große, helle, dunkle. Reglos stand Lisbeth da. Die Kriegerin zog ihren Mantel aus. Darunter trug sie nur einen Seidenpyjama. Die glänzende Oberfläche schimmerte im Licht. Sie setzte sich auf das Bett.
»Warum liegen hier so viele Steine?«, fragte Lisbeth.
»Warum träumst du meine Träume?«
»Deine Träume?«
Die Kriegerin nickte. »Ist das schon mal vorgekommen, dass du die Träume von anderen träumst?«, fragte sie.
Lisbeth vermied es, die Kriegerin anzusehen. Noch immer stand sie in der Mitte des Zimmers. »Kann ich hier schlafen?«, fragte sie.
»Du beantwortest meine Frage nicht.«
»Ich sollte nicht mehr Autofahren.«
Die Kriegerin seufzte. »Weil du ein halbes Bier getrunken hast?«
Lisbeths Haut begann zu spannen. »Ich dachte – «
»Das Bett ist groß genug«, sagte die Kriegerin.
Erleichtert löste sich Lisbeth aus ihrer Starre. Etwas unbeholfen setzte sie sich auf die Matratze.
»Ist dir nicht warm?«, fragte die Kriegerin und deutete auf die Daunenjacke.
»Stimmt.« Lisbeth zog sich die Jacke aus, fuhr sich über das Gesicht. Jetzt, wo sie der Kriegerin so nahe war, konnte sie deutlich ihren Alkoholatem riechen.
»Warum träumst du, dass du Steine sammelst?«, fragte sie, faltete die Daunenjacke zusammen, drückte die Luft heraus.
Die Kriegerin schwieg.
»Willst du nicht darüber sprechen?«
Die Kriegerin rutschte unter die Decke. »Es gibt keinen Grund.«
»Die Träume kommen aus dem Nichts?«, fragte Lisbeth. Die Kriegerin zuckte mit den Schultern, griff sich die Fernbedienung vom Nachttisch. »Lass uns etwas schauen.«
»Du willst jetzt fernsehen?«
»Irgendetwas.«
Lisbeth nickte.
Die Kriegerin schaltete den Fernseher ein, ging die Programme durch, entschied sich für eine billige Sitcom. Lisbeth lehnte sich zurück. Auch auf dem Fernseher lagen Steine.
Sie schauten schweigend. Mehrmals musste die Kriegerin über eine Pointe lachen. Ihr ganzer Körper vibrierte dabei. Irgendwann schlief sie ein. Ihr Kopf rutschte auf Lisbeths Schulter. Lisbeth bewegte sich nicht. Erst als die Kriegerin sich auf die andere Seite drehte, rührte sie sich, schaltete den Fernseher aus, stand auf, löschte das Licht, ging zum Fenster, schob den Vorhang zur Seite. Unter ihr lag die Ostsee. Lautlos brachen sich die Wellen. Lisbeth wandte sich ab, legte sich zurück ins Bett, deckte die Kriegerin zu, dachte an das Wasser, schlief ein.
Auch in dieser Nacht irrte sie ziellos über die Ebene, sammelte Steine. Aber diesmal vergaß sie dabei nicht, dass es irgendwo das Meer gab, das Salz und das Licht.
Eine von Lisbeths ersten Erinnerungen war, wie sie im Wohnzimmer auf dem Teppich stand und von ihren Eltern eingecremt wurde, im Hintergrund die Geräusche des leise gestellten Fernsehers.
Mit neun Monaten, zwei Jahre zuvor, war bei ihr ein atopisches Ekzem diagnostiziert worden. »Neurodermitis, vielleicht ist ihnen das der geläufigere Begriff«, hatte die Ärztin Lisbeths Eltern erklärt, Rezepte ausgestellt, Salben und Medikamente verschrieben und gesagt, sie sollten nicht zu behutsam mit Lisbeth umgehen. »Das Kind muss lernen, robust zu sein.«
Das Eincremen von Lisbeths Haut wurde zum abendlichen Ritual. Manchmal machten ihre Eltern ihr auch Wickel aus Schwarztee. Morgens, wenn sie ihr beim Anziehen halfen, achteten sie darauf, dass es Stoffe waren, die nicht rieben. Alle Milchprodukte wurden aus dem Haus entfernt. Auch Nüsse waren verboten.
Aber Lisbeths Haut blieb porös. Vor allem in den Nächten war der Juckreiz so stark, dass sie sich wälzte wie ein Tier. Ihr Wimmern weckte ihre Eltern. Sie kamen in ihr Zimmer, legten ihr die Hand auf die Stirn. Versuchten es mit kühlenden Tüchern, einer weiteren Schicht Creme. Oder sie stellten sie unter das kalte Wasser der Dusche. Lisbeth kratzte sich trotzdem, kratzte, bis es blutete. In der Schule versteckte sie sich in ihrer Kleidung und trug auch im Sommer lange Hosen und Oberteile.
»Warum sehe ich so aus?«, fragte sie ihre Eltern oft, hielt ihnen ihre wunden Arme vor das Gesicht. »Warum löse ich mich auf?« Sie bekam keine zufriedenstellende Antwort. An einem Abend schlug ihre Mutter ein Naturkundebuch auf und zeigte ihr Bilder von Korallen. »Auch deine Haut blüht.«
Aber Lisbeth wollte keine Haut, die aussah wie ein Nesseltier. In einem unbeobachteten Moment nahm sie das Küchenmesser, mit dem ihr Vater die Kartoffeln geschält hatte. Sie zog die Klinge über das Handgelenk, nicht tief, trotzdem füllte sich der Schnitt mit Blut. Einfach die Haut abziehen, dachte sie. Vielleicht wäre auf die Haut, die nachwachsen würde, mehr Verlass. Aber so weit kam sie nicht. Ihre Mutter fand sie in der Küche, nahm ihr seltsam ruhig das Messer aus der Hand, verband ihr den Arm. Lisbeth versuchte es nicht noch einmal. Der Schnitt wuchs zu. Es bildete sich Schorf. Aber auch den kratzte Lisbeth ab, fuhr mit der Zunge über das austretende Blut. Pulte an der Wunde. Wie an vielen anderen Stellen ihres Körpers blieb eine Narbe.
Lisbeth verbrachte die Nachmittage damit, sich vorzustellen, ihre Haut wäre nur ein Kostüm, Stoff, der sich ablegen ließ, umtauschbar wäre. Dass sie mit ihrer Mutter bloß zur Nachbarin gehen müsste und sich dort aus dem Schrank der Tochter eine neue Haut heraussuchen könnte, so wie sie es bei Kleidung tat, wenn ihre eigenen Sachen zu klein geworden waren. An den Wochenenden, wenn es warm war, nahm ihre Mutter sie mit zum See. Während Lisbeth auf der Decke im Schatten blieb, sich nicht traute, sich auszuziehen, schwamm ihre Mutter zum gegenüberliegenden Ufer. Es war so weit entfernt, dass Lisbeth die Augen zusammenkneifen musste, um den Kopf ihrer Mutter noch zu erkennen. Jedes Mal hielt Lisbeth die Luft an, bis ihre Mutter sich umdrehte und zu ihr zurückschwamm.
»Ich halte es nicht mehr aus«, sagte sie zu ihrem Vater. Sie war nachts aufgestanden und zu ihm in die Küche gekommen, wo er gerade damit beschäftigt war, Grünlilien umzutopfen.
»Kannst du nicht schlafen?«, fragte er, während er die Wurzelballen festdrückte.
Lisbeth nickte. Er wusch sich die Hände ab, hob sie hoch, trug sie nach draußen. Zum Haus gehörte eine Gärtnerei. Lisbeths Vater führte sie, seit er dreiundzwanzig war. Immer hatte er Erde unter den Nägeln, Blätter oder Zweige im Haar. War er zu lange in Innenräumen, sprang er auf und stürzte nach draußen, zwischen die Stauden, schnitt Zweige, harkte Laub.
»Irgendwann wirst du selbst zu einem Baum«, scherzte Lisbeths Mutter oft, griff ihm ins Haar, sammelte heraus, was sich über den Tag darin verfangen hatte.
Er setzte Lisbeth zwischen die Beete. Der Frühling hatte noch nicht begonnen, aber die Erde war nicht mehr gefroren. Lisbeth fröstelte in ihrem Nachthemd. Er gab ihr seinen Pullover, holte aus dem Gewächshaus zwei Gartenscheren.
»Alles, was vertrocknet ist, kann weg«, sagte er und deutete auf die braunen Stiele der Astern. Sie arbeiteten schweigend. Lisbeths Körper wurde ruhiger. Nach einer Stunde nickte ihr Vater ihr zu.
»Das reicht für heute.«
Von da an half Lisbeth ihrem Vater, so oft es ging, in der Gärtnerei. Arbeitete sie neben ihm, vergaß sie ihre Haut.
Manchmal holte ihre Mutter Lisbeth von der Schule ab. Mit der Straßenbahn fuhren sie zusammen nach Hause. Sie sprachen viel, vor Berührungen aber schreckte Lisbeth zurück. Jeder Hautkontakt verstärkte den Juckreiz.
Es war bei einer dieser Straßenbahnfahrten, dass sie von einer Frau angesprochen wurden. Sie hatte das blondierte Haar unter eine Regenhaube geschoben und trug ein graues Kostüm. Wasser tropfte von der Spitze ihres geschlossenen Schirms auf Lisbeths Füße.
»Entschuldigen Sie die Störung, aber das Kind braucht Salzwasser. Und Licht, Sonne. Fahren sie dorthin, wo es beides gibt«, sagte die Frau mit Blick auf Lisbeths trockene Hände. Ihre Mutter richtete sich auf und sah die Frau an, die sich jetzt vertraulich zu ihnen beugte: »Mein Neffe ist dadurch seit ein paar Jahren beschwerdefrei.«
Die Straßenbahn hielt. Die Frau nickte ihnen zu und stieg aus. Den Schirm öffnete sie im Gehen und ging mit federnden Schritten davon. Lisbeth und ihre Mutter sahen ihr noch nach, da war die Straßenbahn längst um die nächste Kurve gefahren.
Ihre Mutter erzählte ihrem Vater am Abend von der Frau und was sie gesagt hatte. Lisbeth lauschte an der Tür, sah durch das Schlüsselloch.
»Wir sollen mit ihr ans Meer?«, hörte sie ihren Vater fragen.
»Sie ist nicht die Erste, die uns das rät.«
»Und wie sollen wir das anstellen, Rita? Ich kenne niemanden mit einem Haus an der Ostsee. Und das mit dem Kurplatz haben wir doch schon probiert«, sagte ihr Vater ungehalten. »Außerdem, wer übernimmt für die Zeit die Arbeit in der Gärtnerei?«
»Was ist, wenn es ihr wirklich hilft?«
»Das Gärtnern hilft.«
»Sie ist erst acht.«
Lisbeths Vater seufzte.
»Du musst dich um nichts kümmern. Ich nehme das in die Hand«, sagte ihre Mutter.
In den Wochen danach fragte sie Freunde und Bekannte, ob sie jemanden kannten, der etwas am Meer vermieten würde. Obwohl ihr zunächst niemand helfen konnte, blieb sie hartnäckig. Schließlich schrieb ihr in der Kantine beim Mittagessen eine Arbeitskollegin einen Namen und eine Telefonnummer auf. Der Person gehöre ein Bungalow an der Ostsee. Vielleicht wäre noch etwas frei. Lisbeths Mutter telefonierte von einem Münztelefon. Mit den Fingern trommelte sie gegen das Glas. Sie erreichte sofort jemanden und hatte Glück. Für zwei Wochen im Sommer könnten sie kommen, sagte ihr der Mann am anderen Ende der Leitung. Am Abend, während sie ihr Brot mit Leberwurst beschmierte, erzählte sie davon. Auch, wie sie gegrinst und die Faust geballt hatte.
»Also, wir fahren ans Meer.« Sie sah Lisbeth an. »Freust du dich?« Lisbeth nickte zögernd. Ihr Vater hatte die Arme vor der Brust verschränkt. »Und die Gärtnerei?«
»Wann hast du das letzte Mal Urlaub gemacht?«
»Die Blumen müssen gegossen werden.«
»Wir finden jemanden, der das übernimmt.«