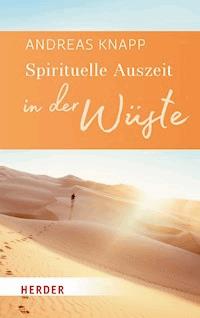Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: adeo
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Nach drei Jahren Bauzeit ist es so weit: Die neue armenische Kirche in Mossul steht kurz vor der Einweihung. Doch Architekt Ziyad Hani muss miterleben, wie das kunstvoll entworfene Haus Gottes von islamischen Extremisten in die Luft gesprengt wird. Der Schmerz darüber steht dem inzwischen in Deutschland lebenden Christen noch immer ins Gesicht geschrieben. Der IS wütet im Nahen Osten, zerstört gezielt die Wiege des christlichen Abendlandes und damit unsere kulturellen Wurzeln. Andreas Knapp hat sich auf Spurensuche begeben und Flüchtlingslager im Norden des Irak besucht. Hier leben noch Christen, die bis heute die Sprache sprechen, die auch Jesus sprach. Aramäisch. Ihre erschütternden Augenzeugenberichte helfen uns zu verstehen, warum die Menschen aus dem Nahen Osten zu uns fliehen. Das Buch und das lyrische Schaffen von Andreas Knapp wurden mittlerweile mit zahlreichen Preisen bedacht: Die englische Übersetzung von "Die letzten Christen" über das Schicksal der orientalischen Christen erhielt in den USA eine Goldmedaille (Independent Publisher Award), eine Silbermedaille (Benjamin Franklin Award) und wurde darüber hinaus für den Christian Book Award nominiert. Bereits im März war Andreas Knapp im Rahmen der neueren religiösen Lyrik in Luzern mit dem Herbert-Haag-Preis ausgezeichnet worden. Dieser ist mit 10.000 € dotiert.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 321
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sämtliche Dialoge und Geschichten sind authentisch. Zum Schutz der betroffenen Personen wurden allerdings Namen, Ortsangaben und Zusammenhänge verändert.
INHALT
Den Stummen eine Stimme geben
1. Dem Tod ins Auge sehen
2. „Bitte, helfen Sie uns!“
3. Ein Wiedersehen am Grab
4. Beileidsbesuche
5. Ein Zwischenlager für Menschen
6. „Wenn man euch in der einen Stadt verfolgt, so flieht in eine andere …“ (Mt 10,23)
7. Statt Einweihung: Sprengung
8. Petros Mouche: ein Bischof ohne Land
9. Nichts Neues unter dem Halbmond
10. Auf Sichtweite mit dem Islamischen Staat
11. Der Untergang des christlichen Morgenlandes
12. Eine Rakete im Dach
13. Garos Weltreise
14. Das Geheimnis der Erlösung heißt Erinnerung
15. Eine Sprache verstummt
16. Sind so kleine Hände …
17. „Selig, die keine Gewalt anwenden!“ (Mt 5,5)
18. An Karfreitag wird Ostern
19. Unser Bestes geben
Epilog: Fremde schenken Heimat
Literaturhinweise
Bildteil
Sie kamen aus den Steinbrüchen. Nach langen Jahren härtester Zwangsarbeit durften sie nach dem Tod des römischen Kaisers Diokletian wieder in ihre Heimat zurück. Die Christen der Stadt Rom zogen ihren Glaubensbrüdern auf der Via Appia entgegen. Sie beugten sich vor den ausgemergelten Körpern der Zwangsarbeiter und küssten ihnen die schwieligen und zerfurchten Hände: Denn mit diesen Händen hatten sie für ihren Glauben an Jesus Christus Zeugnis abgelegt.
Den Stummen eine Stimme geben
Die Christen im Nahen Osten waren über lange Zeit zum Schweigen verurteilt. Seit Jahrhunderten leiden sie unter Diskriminierungen durch eine muslimisch geprägte Gesellschaft und waren als Minderheit gezwungen, Unrecht stillschweigend hinzunehmen und unscheinbar im Schatten zu leben. Selbst mir als Priester und Theologen war die bewegende Geschichte der Christen in Syrien und im Irak lange Zeit unbekannt.
Wenn sie nun als Geflüchtete nach Deutschland kommen, müssen sie wieder schweigen: Denn noch sprechen sie unsere Sprache nicht. Und manchmal müssen die Christen in Flüchtlingsunterkünften ihre Identität verleugnen, weil sie sonst erneut Angriffen radikaler Muslime ausgesetzt wären.
Vor zwei Jahren lernte ich Christen aus dem Nahen Osten kennen, die jetzt in meiner Nachbarschaft in Leipzig-Grünau wohnen. Sie haben mir ihre Geschichten erzählt und diese haben mich so berührt, dass ich sie aufschreiben musste und weitergeben will. Vielleicht entsprechen sie nicht der „political correctness“, aber sie sind authentisch und damit korrekt. Es gibt eine „Autorität der Opfer“, die nicht wegzudiskutieren ist. Meine emotionale Nähe zu den Opfern von Verfolgung und Vertreibung lässt mich manchmal auch Ohnmacht, Trauer oder Empörung empfinden. Zugleich weiß ich, dass die Erfahrungen der Christen aus dem Irak und aus Syrien nur einen Mosaikstein im großen Bild der Weltgeschichte darstellen. Ihre Sichtweise etwa des Islam könnte durch viele andere und sehr unterschiedliche Perspektiven ergänzt werden. Und doch möchte ich mein Augenmerk auf diesen kleinen Mosaikstein richten – gerade weil er so oft verschwiegen und vergessen worden ist. Nur wenn wir uns auch an die Geschichte und Geschichten der Christen aus dem Orient erinnern, werden wir der – immer komplexen – Wirklichkeit ein wenig gerechter. Und nur wenn wir Solidarität üben mit den Opfern der verschiedensten Formen von Gewalt, kommen wir einem dauerhaften Frieden einen Schritt näher.
Ich danke dem Leiter des adeo Verlags Stefan Wiesner, Dorothea Bühler (Lektorat) und Gudrun Webel (Verlags-Assistentin) für die vertrauensvolle Zusammenarbeit. Mein besonderer Dank gilt Melanie Wolfers und Michael Lück für den kritischen Blick und viele hilfreiche Hinweise. Den Christinnen und Christen aus Syrien und dem Irak, die mir ihre Geschichten anvertraut haben, bleibe ich zu großem Dank verpflichtet.
Ihnen und allen Christen im Nahen Osten, die um ihres Glaubens willen verfolgt oder ermordet wurden, sei dieses Buch gewidmet.
1. Dem Tod ins Auge sehen
Die hohen Zäune aus Stacheldraht glitzern im gelblichen Flutlicht. Die Sicherheitsmaßnahmen am Flughafen von Arbil wirken beängstigend und mir wird bewusst, wie explosiv die Situation hier ist. Glücklicherweise herrscht derzeit im autonomen Kurdengebiet Ruhe; es könnte aber auch die Ruhe vor dem Sturm sein.
Ein Blick aufs Handy: Es ist Samstag, 7. November 2015, drei Uhr morgens. Nach zahlreichen Schleusen stehe ich endlich vor dem Flughafengebäude. Ich reibe mir die Augen. Nicht nur, weil ich mir gerade eine Nacht um die Ohren schlage. Sondern weil mir noch vor drei Tagen nicht im Traum eingefallen wäre, in den Norden des Irak zu fahren. Und jetzt schaue ich in eine dunkle Landschaft hinaus, die von Stacheldraht und Lichterketten durchzogen ist. Was um Himmels willen hat mich hierhergeführt?
In der Ferne ein Wetterleuchten. Das dumpfe Grollen erinnert an Geschützdonner. Die Front zwischen dem autonomen Kurdengebiet im Norden des Irak und den Kämpfern des sogenannten Islamischen Staates (IS) verläuft unweit von hier. Seit Herbst 2015 rückt die kurdische Peschmerga vor, um der IS-Miliz die Stadt Sindschar wieder zu entreißen. Peschmerga heißt: „die dem Tod ins Auge sehen“.
Das habe ich nicht unbedingt vor. An einer Totenfeier möchte ich allerdings teilnehmen. Neben mir steht mein Freund Yousif, dessen Vater vor drei Tagen verstorben ist. Er fährt sich mit der rechten Hand über den Kopf und ich höre das Knistern der kurz geschnittenen schwarzen Haare.
„Wo bleibt denn nur mein Bruder? Diese verdammten Checkpoints …“, brummt er ungeduldig. Auch ich trete von einem Bein auf das andere. Es ist nicht kalt, aber ich bin ziemlich nervös. Über uns ein merkwürdiges Krächzen. Ich schaue nach oben, kann jedoch im milchigen Zwielicht von Nachthimmel und künstlicher Beleuchtung nichts erkennen. Yousif folgt meinem Blick und erklärt: „Das sind Vögel.“ Welche Art von Vögeln ziehen hier durch die Nacht? Und warum bin ich hierhergeflogen – in ein Land, das zu betreten das Auswärtige Amt warnt und für das man kein Touristenvisum bekommen kann? Alles kommt mir so unwirklich vor in diesen zu frühen Morgenstunden.
Heute findet die Totenfeier für Abu Yousif statt. Was hätte Yousif darum gegeben, seinen Vater noch einmal lebend zu sehen! Vor zwei Jahren musste er den an Knochenkrebs schwer erkrankten Vater in Mossul im Rollstuhl zurücklassen, um das Leben seiner eigenen Frau und der beiden Kinder in Sicherheit zu bringen. Immer wieder äußerte er den Wunsch: „Ich möchte meinen Vater noch einmal sehen, bevor er stirbt.“ Einmal fragte er sogar: „Kommst du mit in den Irak?“ – wie man halt so fragt. Und ich antwortete: „Warum denn nicht? Ich komme mit!“ – wie man halt so sagt. Doch jetzt ist aus den Floskeln Ernst geworden. Und das ging ganz schnell.
Yousif hatte am vergangenen Montag bei der Ausländerbehörde von Leipzig einen Reisepass beantragt, um seinen todkranken Vater im Irak zu besuchen. Er plante, zu Beginn des neuen Jahres 2016 zu fliegen. Am letzten Mittwochnachmittag zeigte mir ein kurzes Vibrieren in der Hosentasche den Eingang einer SMS an: „Mein Vater ist gestorben.“ Yousif wohnt nur einen Block weiter in unserer Plattenbausiedlung am Stadtrand von Leipzig. Ich ging sofort zu ihm.
Sein Sohn Amanuel, zwölf Jahre alt, öffnete die Wohnungstür. Neben ihm Shaba, die um zwei Jahre jüngere Schwester.
„Euer Opa ist gestorben. Mein herzliches Beileid!“
Die beiden schauten mich entgeistert an.
Yousif erschien im Flur. Er hatte meine Worte gehört und hob die buschigen Augenbrauen.
„Ich habe es den Kindern noch nicht gesagt.“
„Oh nein!“, entfuhr es mir. Und ich legte mir die Hände vors Gesicht. „Das tut mir leid …“
„Schon in Ordnung“, fuhr Yousif fort, legte seine Arme um die beiden Kinder und wiederholte: „Euer Opa ist gestorben.“
Jetzt kam auch Tara, Yousifs bildhübsche Frau, aus der Küche und alle weinten. Mir stiegen ebenfalls Tränen in die Augen, auch aus Scham über mein Missgeschick.
Wir setzten uns ins Wohnzimmer. Yousif machte sich Vorwürfe: „Warum bin ich nicht früher geflogen …“
Ich beruhigte ihn: „Du hast alles versucht! Letzten Montag hast du deinen Reisepass beantragt! Niemand konnte ahnen, dass dein Vater so schnell stirbt.“
Yousif schaute auf: „Mein Vater ist jetzt im Himmel!“
Dann ging plötzlich ein Ruck durch seinen Körper und er stand auf.
„Ich versuche, am nächsten Dienstag zu fliegen. Am Montag habe ich noch einen wichtigen Termin im Jobcenter. Es geht um meinen ersten Arbeitsvertrag in Deutschland.“
Blitzschnell entscheide ich mich: „Am Dienstag also … Wenn es geht, komme ich mit!“
Wieder daheim klicke ich mich noch spätnachts im Internet durch die Homepage von Botschaft und Konsulat des Irak. Ein Touristenvisum gibt es nicht. Höchstens ein Geschäftsvisum, das vom Innenministerium in Bagdad genehmigt werden muss. Ich gehe mit einer Mischung aus Enttäuschung und Erleichterung zu Bett. Eine Reise in den Irak: klappt halt nicht.
Am nächsten Morgen rufe ich sicherheitshalber bei der Botschaft an. Keine Chance für ein Visum. Ohne mir große Hoffnungen zu machen, nur um des Gefühles willen, dass ich nichts unversucht gelassen habe, rufe ich auch noch beim Generalkonsulat des Irak an. Dort eine überraschende Information: Wenn ich nur in die „Autonome Region Kurdistan“ reisen will, sollte ich es unter einer bestimmten Telefonnummer versuchen, die man mir durchgibt. Klappt also doch!
Yousif meldet sich am Telefon. Der Termin wegen des Jobs wurde aufgrund einer Erkrankung bis auf weiteres verschoben. Er will nun schon am Samstag fliegen; dann könnte er am Sonntag an der Trauerfeier für seinen Vater teilnehmen. Er war schon bei der Ausländerbehörde: Er könne morgen seinen Pass abholen. Wird hoffentlich klappen.
Am Freitagmorgen ruft Yousif von der Ausländerbehörde aus an. Dort wurde ihm soeben sein Reisepass ausgehändigt. Hat geklappt.
Ich muss dringend los, denn freitags habe ich immer Dienst im Gefängnis. Wir brauchen aber noch Flugtickets. Übers Internet geht das ganz schnell. Doch weder Yousif noch ich besitzen eine VISA-Card. Ich rufe bei Stefan Wiesner vom adeo Verlag an. Wir hatten vor kurzem über ein Buchprojekt zum Thema „Flüchtlinge“ gesprochen und ich hatte auch die Idee erwähnt, Yousif im nächsten Jahr in den Irak zu begleiten. „Ich möchte morgen nach Kurdistan fliegen. Können Sie mir helfen?“
Herr Wiesner und die Verlags-Assistentin Gudrun Webel kümmern sich. Klappt super.
Ich bin den ganzen Tag über im Gefängnis. Am Abend nehme ich noch an einem Gesprächskreis in der Katholischen Studentengemeinde teil. Dort kann ich auch ins Internet. Die Tickets sind abrufbereit. Ich will sie ausdrucken: Klappt allerdings nicht.
Glücklicherweise findet sich eine Studentin, die am PC oberfit ist. Klappt doch noch!
Um 21 Uhr komme ich nach Hause. Ich hänge mich ans Telefon, um ein paar Termine abzusagen. Ich hätte auch noch einige Gespräche im Gefängnis zu führen, wo ich als Seelsorger arbeite. Dort jedoch läuft mir niemand davon. Ich bitte meinen evangelischen Kollegen, den Gefangenen die neuen Termine mitzuteilen. Wird schon klappen.
22 Uhr: Ich packe meinen kleinen Rucksack und stecke mir als Reiselektüre ein Buch über die Christen im Irak ein, das ich schon lange lesen wollte. Dann rufe ich Yousif an: Wir treffen uns morgen kurz vor sechs an der S-Bahn-Station. Wenn jetzt die Bahn nicht streikt, dann müsste eigentlich alles klappen.
Mir kommen die letzten drei Tage so unwirklich vor. Fast traumwandlerisch habe ich diese Reise organisiert – oder besser: Diese Fahrt hat sich wie von selbst organisiert. Und jetzt stehe ich auf kurdischem Boden. Ich trete fest auf: Nein, ich träume nicht!
Es ist inzwischen vier Uhr morgens und ich laufe mit meinem irakischen Freund vor dem Flughafengebäude von Arbil auf und ab. Yousif zündet sich eine Zigarette an und seufzt. Ich versuche in seinem breiten Gesicht zu lesen: Was mag in ihm vorgehen? Vor zwei Jahren ist er aus dem Irak geflüchtet, um dem Tod zu entgehen. Und heute kehrt er zurück, um dem toten Vater die letzte Ehre zu erweisen.
Immer noch stehen wir und starren in die Ferne, wo ab und zu Autoscheinwerfer auftauchen. Ein Taxi heult heran und schluckt zwei Männer, die mit uns im Flugzeug waren. Jetzt warten nur noch Yousif und ich am verschlafenen Provinzflughafen von Arbil. Der große Parkplatz gegenüber gähnt vor Leere.
Endlich wieder zwei Scheinwerferkegel, die auf uns zurasen. Ein uralter Opel Astra bremst scharf und kommt direkt am Bordstein vor uns zum Stehen. Ein kräftiger und leicht untersetzter Mann mit struppigem Haar steigt aus. Yousif läuft ihm entgegen und schließt ihn wortlos in seine muskulösen Arme. Immer noch schweigend lösen sich die beiden wieder aus der Umarmung. Was soll man auch sagen, wenn es für so vieles kaum Worte gibt: Angst und Ohnmacht, Flucht und Vertreibung, der Verlust von Vaterhaus und Vater.
Ich werfe meinen kleinen Rucksack in den Kofferraum; jetzt begrüßt mich Basman mit einem kräftigen Händedruck. Wir passieren einen Checkpoint, an dem uniformierte junge Männer schwer bewaffnet herumlungern. Mit einer müden Handbewegung winken sie uns durch. Noch zwei Checkpoints und bald erreichen wir Ankawa, einen Vorort von Arbil, der vor allem von Christen bewohnt wird. Hier im autonomen Kurdengebiet leben Christen relativ sicher. Zumindest vorläufig. Wir biegen in eine nur schwach beleuchtete Straße ein, die uns in eine Wohnsiedlung führt: Haus an Haus, alles im gleichen Stil.
Der Wagen hält vor einer Mauer, an der ein großes schwarzes Plakat hängt. In der Mitte leuchtet ein weißes Kreuz, um das herum sich ebenfalls weiße arabische Schriftzüge schlängeln. Yousif erklärt: „Die Todesanzeige für meinen Vater!“
Wir steigen auf einer rostigen Eisentreppe, die bei jedem Schritt metallisch klappert, in die erste Etage hinauf. Welch ein Wiedersehen: Morgens um halb fünf steht Yousifs Mutter Taghrid auf dem Balkon, der als Eingang ins Obergeschoss dient, und bricht laut in Tränen aus. Lange liegen sich Taghrid und Yousif in den Armen. Nach seiner gefährlichen Flucht ins Unbekannte vor zwei Jahren jetzt das Wiedersehen – doch ohne den Vater, der vor drei Tagen gestorben ist. Und kein Wiedersehen in der Heimat, sondern im Exil. Nicht in vertrauter Umgebung, sondern in einer fremden Stadt. Nicht im weiträumigen Elternhaus, sondern in einer winzigen Mietwohnung.
Yousif stammt aus Mossul und durch den Familienbetrieb einer Schlosserei hatte es sein Vater Abu Yousif zu einem gewissen Wohlstand gebracht: Sie besaßen ein großes Haus mit Garten, in dem sich Abu Yousif, der aufgrund seiner Erkrankung seit Jahren im Rollstuhl saß, gerne aufhielt. Doch dann hatte der sogenannte Islamische Staat vor anderthalb Jahren die zweitgrößte Stadt des Irak besetzt. Yousif und seine Angehörigen sind Christen. Und für Christen gibt es unter dem schwarzen Banner des IS keinen Platz.
So blieb ihnen nur die Flucht mit dem Allernötigsten. Seither lebt die Familie in dieser überbelegten Mietwohnung in Arbil.
Die Wände wirken kahl und traurig; nur an einer hängt ein Rosenkranz, aufgespannt zwischen zwei Nägeln. Wir setzen uns auf Sofas. Auf einem kleinen Tischchen steht ein schwarz umrandetes Foto des verstorbenen Vaters: ein Mann mit schlohweißem Haar und schmalem Gesicht, schon von der Krankheit gezeichnet, mit tiefliegenden Augen. Neben dem Totenbild leuchtet ein silbernes Standkreuz.
Die Witwe Taghrid trägt die Tracht der Trauernden: ganz in Schwarz – nur das ungekämmte, schulterlange Haar wird durch ein paar weiße Strähnen aufgelockert. Ihr faltiges Gesicht wirkt müde, sehr müde, auch wenn es sich jetzt durch Yousifs Besuch etwas aufhellt. Taghrid klopft an eine dünne Wand: Wenig später kommen Onkel und Tante von nebenan mit ihren zwei schmächtigen Mädchen zu uns. Janet und Wasan haben Augen wie schwarze Perlen und sind vielleicht vierzehn und sechzehn Jahre alt. Auch sie wurden aus Mossul vertrieben.
Der Islam ist eine Offenbarungsreligion, die sich im 7. Jhd. n. Chr. auf der Arabischen Halbinsel herausbildete. Die Grundlage des Islam ist der Koran. Diese religiöse Schrift wurde nach islamischer Überlieferung von Gott dem „Gesandten Gottes“ Mohammed (570–632) offenbart und gilt als unmittelbares göttliches Wort. Daneben stellt die Sunna (Brauch) die zweite zentrale Quelle des Islam dar: Die gesammelten Taten und Aussprüche des Propheten Mohammed (Hadithe) sollen den Gläubigen als Vorbild dienen.
Der Islam erhebt den Anspruch, die Lebenswelt der Gläubigen umfassend zu regeln. Für das religiöse Leben schreibt der Islam „fünf Säulen“ vor: das Glaubensbekenntnis, die Verrichtung der Gebete, die Almosensteuer, das Fasten im Monat Ramadan sowie einmal im Leben die Pilgerfahrt nach Mekka.
Innerhalb des Islam haben sich eine Vielzahl von Richtungen und Strömungen entwickelt. Der Islamische Staat gibt vor, den „ursprünglichen Islam“ wiederherzustellen.
Ein Wiedersehen zu nächtlicher Stunde, in der Freude und Schmerz ineinanderfließen und verschmelzen. Es gibt noch einen heißen Tee. Dann werden die Sofas zu Betten umfunktioniert; mir wird eine Couch im Flur zugewiesen. Dort bin ich allein. Ich lösche das Licht und schließe die Augen. Aber ich fühle mich viel zu aufgekratzt, um gleich einzuschlafen. Zu vieles dreht sich in meinem Kopf. Es kommt mir so unwirklich vor, dass ich jetzt im Norden des Irak gelandet bin, um an der Totenfeier für Abu Yousif teilzunehmen. Vor meinem inneren Auge werden Bilder wach. Wie hat das alles angefangen: der Kontakt zu Yousif und den anderen Geflüchteten aus dem Irak und aus Syrien?
2. „Bitte, helfen Sie uns!“
Der kleine Junge, vielleicht elf Jahre alt, fällt mir sofort auf. In seinen großen dunklen Augen liegt ein Hauch von Traurigkeit. Ich habe seinen Blick nur kurz erhascht und bin doch innerlich bei ihm hängen geblieben, als ich mich daranmache, Wasserkrüge und Apfelsaft auf die Tische zu verteilen. Knapp vierzig Leute sind der Einladung unserer Ordensgemeinschaft zur Gedenkfeier für Charles de Foucauld gefolgt.
Charles de Foucauld wurde 1858 als Sohn einer begüterten adeligen Familie in Straßburg geboren. Als Jugendlicher verlor er den christlichen Glauben. Er machte beim Militär Karriere und wurde als geographischer Erforscher von Marokko berühmt. Durch die Begegnung mit dem Islam stellte sich ihm wieder die Frage nach Gott und er fand zum Christentum zurück. Er wollte das Leben Jesu in Nazaret nachahmen und wie Jesus in einem einfachen Milieu von der eigenen Hände Arbeit leben. Er wurde Trappistenmönch in Syrien und später Einsiedler inmitten der Sahara, wo er mit einem Nomadenstamm der Tuareg Freundschaft schloss. Er teilte das Leben der Beduinen, schätzte ihre Kultur und suchte den Dialog mit dem Islam. Am 1. Dezember 1916 wurde Charles de Foucauld in den Wirren des Ersten Weltkrieges erschossen.
Meine Ordensgemeinschaft der „Kleinen Brüder vom Evangelium“ führt sich auf diesen Abenteurer und Wüstenmönch zurück. Seit zehn Jahren leben wir zu viert in einer Plattenbausiedlung am Stadtrand von Leipzig und laden jährlich am ersten Adventssonntag Freunde und Mitglieder unserer Pfarrgemeinde zu unserer Feierstunde ein. Als wir überlegten, was wir im Jahr 2014 thematisch anbieten könnten, kam meinem Mitbruder Gianluca die zündende Idee: „Charles de Foucauld hat sechs Jahre als Mönch in Syrien gelebt. Ich kenne einen syrischen Arbeitskollegen, der schon seit vielen Jahren in Leipzig wohnt und Christ ist. Der könnte uns von der Situation der Christen in Syrien berichten.“ Diese Idee gefiel uns und wir luden Gabriel und seine Familie ein.
Als unser kleines Fest beginnt, stellen wir erstaunt fest, dass noch andere Leute gekommen sind. Gabriel hat unsere Einladung sehr großzügig ausgelegt und Geflüchtete aus Syrien und dem Irak mitgebracht. Die meisten von ihnen sind offensichtlich erst vor kurzem in unser Stadtviertel gezogen, wo in den Plattenbauten aus DDR-Zeiten noch immer Wohnungen leer stehen. Und nun sitzen an unseren Tischen Frauen und Männer mit tiefschwarzen Haaren und dunklen Augen und einer Sprache, die ich nicht verstehe. Auch der kleine Junge gehört zu dieser Gruppe; er scheint mit seinem Vater gekommen zu sein.
Nach der Begrüßung beginnt der hochgewachsene Gabriel von seiner Heimatstadt Aleppo zu erzählen. Gespannt lauschen wir seinen orientalisch ausgeschmückten Schilderungen von einer uralten Stadt mit einer berühmten Zitadelle, die zum UNESCO-Kulturerbe zählt. Die Stadt Leipzig feiert im Jahr 2015 voller Stolz das tausendjährige Stadtjubiläum. Doch was ist das gegen das Alter der Städte im Nahen Osten, der Wiege der Stadtkultur: Aleppo kann auf 7000 Jahre zurückschauen! Doch noch älter ist der Krieg zwischen Kulturen und Völkern. Ein solcher Krieg tobt jetzt auch in Aleppo. Hubschrauber des syrischen Assad-Regimes werfen im Kampf gegen oppositionelle Milizen Fassbomben ab, die ganze Häuserblocks wegreißen. Fast 2000 dieser Eisentonnen, die mit Sprengstoff und Metallteilen gefüllt sind, wurden bis Ende 2015 auf Aleppo abgeworfen. Und die Terroristen des Islamischen Staates beschießen das Christenviertel, durch das die Front zwischen den tödlich verfeindeten Parteien verläuft.
„Wir Christen sitzen – wie so oft in der Geschichte meiner Heimat – zwischen allen Stühlen. Wir sind dem Terror schutzlos ausgeliefert. Als die Milizen des IS vor einigen Monaten unsere Straße zum wiederholten Mal mit Granaten beschossen, kam auch mein Schwager ums Leben. Und meine Schwester lebt mit ihren vier kleinen Kindern immer noch in Aleppo. Sie und ihr Mann wollten ihre Heimat nicht verlassen, aber jetzt bleibt ihr wohl als Witwe nichts anderes übrig. Nur: Wie soll sie mit den vier Kindern nach Europa kommen?“
Der Bericht über das Ausmaß der Zerstörung und vor allem über die Grausamkeit, mit der dieser Krieg geführt wird, erschüttert uns. Unsere Gedenkfeier bekommt in diesem Jahr eine sehr ernste Note. Wir haben alle die Nachrichten über den Krieg in Syrien verfolgt. Doch wenn dann Syrerinnen und Syrer vor einem stehen, die vor dem Terror geflohen und deren Familienangehörige umgebracht worden sind, so haben wir es nicht mehr mit anonymen Zahlen zu tun, sondern mit Gesichtern. Zu früh gealterte Gesichter, in denen großes Leid geschrieben steht. Gesichter, in denen noch die Angst wohnt.
Die dunkelbraunen Augen des kleinen Jungen. Als sich die Versammlung auflöst und wir damit beginnen, Geschirr zu spülen, kommt ein etwas gedrungener Mann um die vierzig auf mich zu. Er spricht nur ein paar Worte Deutsch. Neben ihm steht der Junge mit den pechschwarzen Haaren. Yousif, so heißt der Mann mit den breiten Schultern, spricht mich an. Ich verstehe nichts, doch der Junge beherrscht die deutsche Sprache schon ausgezeichnet und übersetzt: „Wir sind aus dem Irak, aus Mossul. Bitte helfen Sie uns!“
Mir wird ganz anders. Im Bruchteil einer Sekunde sehe ich die Fülle der Verpflichtungen, die auf mich warten: In den Wochen vor Weihnachten häufen sich die Dienste im Gefängnis und in der Pfarrei. Die Katholische Studentengemeinde bietet einen vierwöchigen spirituellen Kurs („Exerzitien im Alltag“) an und ich habe versprochen, jede Woche acht Begleitgespräche zu führen. Das und vieles mehr steht mir vor Augen. Ich weiß, dass ich jetzt sagen müsste: „Tut mir leid … ich würde ja gerne … aber ich habe keine Zeit.“ Und mich dann mit einem Achselzucken und einem bedauernden Gesichtsausdruck abwenden.
Doch ich kann nicht! Der Blick des Jungen nimmt mich gefangen. Ich kann nicht „Nein“ sagen. Ich frage nach: „Habt ihr niemanden, der euch unterstützt?“ Nachdem der Junge seinem Vater meine Frage übersetzt hat, schüttelt dieser den Kopf. „Gibst du mir eure Telefonnummer?“ Amanuel, so heißt der Junge, schreibt eine Handynummer auf eine Papierserviette. Am nächsten Tag rufe ich an, um einen Besuch zu vereinbaren. Seither ist mein Leben anders geworden.
Wenige Tage später klingele ich am Eingang eines elfstöckigen Wohnblocks in der Miltitzer Allee. Yousif lebt mit seiner Frau Tara und den beiden Kindern Amanuel und Shaba im dritten Obergeschoss. Man bittet mich ins Wohnzimmer, an dessen Wänden fromme Bilder hängen: eine etwas kitschige Darstellung des letzten Abendmahls und ein Bild vom „heiligen Georg“; daneben ein Kalender in arabischer Sprache mit dem Foto eines bärtigen Bischofs.
Yousif braucht Hilfe für seine Kinder. Es gibt Probleme in der Schule: Amanuel, ein hübscher zierlicher Junge, vertraut mir an, dass er von seinen muslimischen Mitschülern regelmäßig gegängelt wird, weil er ein kleines Kreuz umhängen hat. Amanuel hat dieses Kreuz immer getragen, auch als es in Mossul für Christen gefährlich wurde. Ich verspreche, mit dem Schulleiter Kontakt aufzunehmen. Dann bitte ich Yousif, mir mit Hilfe von Amanuel etwas von ihrer Geschichte zu erzählen.
Tara und Yousif stammen aus Mossul und gehören der syrisch-orthodoxen Kirche an, in der ihre Familie sehr engagiert gewesen ist. Doch ab 2003 änderte sich die Welt in Mossul.
Die USA und Großbritannien griffen den Irak an mit der Begründung, dass dieser Staat zu einer wachsenden Bedrohung werde, etwa durch die Produktion von Massenvernichtungsmitteln. Spätere Untersuchungsberichte zeigten, dass diese Kriegsgründe nur vorgeschoben waren. Vordergründig ging es in diesem Krieg um die Entmachtung des Diktators Saddam Hussein und den „Import“ von Demokratie, untergründig aber wohl auch um den „Export“ von billigem Erdöl.
Als Antwort auf die amerikanische Invasion in den Irak riefen muslimische Geistliche zum „Heiligen Krieg“ auf und viele fundamentalistische „Glaubenskämpfer“ aus der gesamten islamischen Welt sammelten sich zum Krieg gegen die „Ungläubigen“. Die Christen im Irak wurden für die Islamisten zum Freiwild.
Warum aber wurden ausgerechnet die einheimischen Christen ein bevorzugtes Ziel ihrer Anschläge? Da der Prophet Mohammed sowohl religiöser als auch politischer Führer war, sind im Islam Religion und Politik von Anfang an eng verwoben. Infolgedessen kann auch der Krieg eine religiöse Dimension bekommen. In der Wahrnehmung vieler Muslime sind die westlichen Länder „christliche“ Staaten. Und wenn man von diesen angegriffen wird, so werden die Christen im Nahen Osten als Kollaborateure und Verbündete der Amerikaner oder Briten verdächtigt. Die prekäre Lage der Christen wurde durch eine törichte Rede des amerikanischen Präsidenten noch verschlimmert: G. W. Bush bezeichnete seinen ölverschmutzten Krieg als „Kreuzzug“ und weckte damit tief sitzende Ressentiments der Muslime gegen den Westen. Die Christen im Irak, die sich in ihrer zweitausendjährigen Geschichte an keinem Kreuzzug beteiligt hatten, wurden in Sippenhaft genommen und mit Terror überzogen. Sie wurden zu Sündenböcken, an denen man die Aggression der „christlichen Besatzer“ (sprich: Soldaten der USA) rächen konnte.
Beispielsweise presste man den Christen Schutzgelder ab und berief sich dabei auf die alte islamische Praxis, dass Nichtmuslime zu einer Sondersteuer, im Koran „Dschizya“ genannt, verpflichtet sind. Gemäß dem islamischen Recht (= Scharia) müssen Christen die Dschizya für das Zugeständnis bezahlen, in einem – sehr eingeschränkten – Maß ihre Religion praktizieren zu dürfen.
Der Koran ist das „heilige Buch“ des Islam und enthält gemäß dem Glauben der Muslime die wörtliche Offenbarung Gottes. Diese wurde dem Propheten Mohammed durch den Engel Gabriel im Verlauf von 22 Jahren mitgeteilt.
Die frühen Offenbarungen (in Mekka) sind von Offenheit und Toleranz geprägt. Sie spiegeln die Situation des Propheten wider, der ohne politische Macht versuchte, die Einwohner von Mekka, aber auch Juden und Christen für die neue Religion zu gewinnen. Die späteren Offenbarungen (in Medina) sind anders geprägt: Mohammed hatte inzwischen politische und militärische Macht erlangt; er war nun religiöser Führer und Staatsmann in einem.
Der Koran besteht aus 114 Suren (Abschnitten), die nicht chronologisch, sondern ungefähr der Länge nach geordnet sind. Bei widersprüchlichen Aussagen gilt nach weit verbreiteter islamischer Lehre, dass die „jüngeren“ (die später offenbarten) die „älteren“ Sätze korrigieren bzw. aufheben.
Dementsprechend wird von vielen Koran-Gelehrten die Auffassung vertreten, dass die jüngeren Verse, die zum Kampf gegen die Nicht-Muslime aufrufen, alle anderen Verse, die zu einem friedfertigen Verhalten ermahnen, aufgehoben haben.
Yousif berichtet, dass die geforderten Summen von Jahr zu Jahr höher wurden. Man zahlte, denn man wusste, was sonst drohen würde: Zerstörung des Eigentums und Mord. Auch christliche Kirchen wurden Zielscheiben des Terrors im Namen des Islam. Aber noch dachten viele Christen nicht daran, Mossul zu verlassen, denn sie hegten die leise Hoffnung, dass der Spuk eines Tages ein Ende nehmen würde. So auch Yousif und seine Frau Tara.
Stattdessen kam es noch schlimmer. Eines Tages erhielt Yousif einen Anruf von unbekannt: „Ich werde dir den linken Arm abhacken.“ Yousif wusste sofort, worauf diese Drohung anspielte; denn er hatte sich auf seinen kräftigen linken Unterarm ein großes Kreuz tätowieren lassen. Yousif reagierte spontan: „Wenn du willst, dann versuche es!“ – und drückte die Aus-Taste.
Ihm stand deutlich vor Augen, dass er jetzt gefährlich lebt. Und dass auch seine junge Familie bedroht war. Wenige Tage später klingelte wieder das Telefon: „Wenn du in drei Tagen nicht verschwunden bist, fährst du zur Hölle!“ Yousif wusste, dass er jetzt schnell handeln musste, und verließ mit seiner Frau und den beiden Kindern Mossul. Ziel war Arbil, die Hauptstadt des autonomen Kurdengebiets im Norden des Irak. Dort war er zwar sicher, aber er fand keine Arbeit. Schweren Herzens rang er sich dazu durch, nach Europa zu flüchten. Am liebsten nach Deutschland oder Schweden.
Die Flucht musste er allein antreten. Für seine Frau und seine Kinder barg ein solches Unternehmen viel zu große Gefahren, denn der einzige Weg führte über die dunklen Machenschaften einer Schleuserbande. Der Preis, den man ihm nannte, belief sich auf 17 000 US-Dollar. Yousif verkaufte alles, was nur möglich war, und lieh sich von Freunden und Verwandten das noch fehlende Geld. Als er mir diese Geschichte ein Jahr später schildert, hat er immer noch 5000 Dollar Schulden.
Der Abschied von seiner Frau und den beiden Kindern schnitt ihm ins Herz. Die Schleuser brachten ihn über die türkische Grenze. Er durfte keinerlei Gepäck mit sich führen und musste seinen Pass abgeben. Tagelanges Warten. Dann fuhr man ihn mit einem PKW in eine andere Stadt. Nur mit der Kleidung am Leib wurde er in einem „Geheimverlies“ eines Lastwagens eingepfercht. Es war ein großer LKW, der über den Bosporus, Griechenland und den Balkan Gemüse nach Deutschland transportierte.
Im Innern des Containers war direkt hinter der Zugmaschine eine doppelte Wand eingebaut. Der Eingang befand sich im Container: An der Rückwand ließ sich eine Luke öffnen, die derart gut eingepasst war, dass man sie nicht sehen konnte. Yousif zwängte sich durch diese Öffnung in einen dunklen Zwischenraum, der so schmal war, dass er mit seinen breiten Schultern nur seitlich angelehnt stehen konnte. Auf dem Boden wellte sich Schaumgummi zum Sitzen und Liegen. In einer Ecke stapelten sich Plastikflaschen mit Wasser und Packungen mit Keksen; mehr war für die Ernährung nicht vorgesehen. Zwei handtellergroße Luftlöcher im Boden sollten dafür sorgen, dass der hier Eingezwängte nicht erstickte. Die Notdurft konnte durch diese Löcher erledigt werden, jedoch nur während der Fahrt. Dagegen war bei jedem Halt absolute Stille geboten.
Mit Herzklopfen hörte Yousif, wie die Luke von außen zugeschraubt wurde. Jetzt war er eingesperrt in einem dunklen Kerker. Der LKW fuhr los und später hörte er, wie Männer den Container beluden. Sieben Tage und Nächte verbrachte Yousif in diesem engen und lichtlosen Zwischenraum. Manchmal schlief er vor Erschöpfung ein, doch die Ängste peinigten ihn selbst im Schlaf: Was, wenn er in diesem Käfig ersticken würde? Was, wenn man ihn bei einer Grenzkontrolle entdecken sollte? Und konnte er den Schleusern trauen, denen er schon die gesamte Summe hatte aushändigen müssen? Würden sie ihn vielleicht auf irgendeiner einsamen Landstraße aus dem Verlies holen, um ihn umzubringen? Vor allem aber zerriss der Gedanke an seine Frau und die beiden Kinder, die er zurückgelassen hatte, sein Inneres.
Einmal wäre es fast schiefgegangen: Der LKW stand bereits längere Zeit und Yousif kämpfte mit dem Schlaf. Er wusste, dass er schnarchte und dass ihm dieses Geräusch zum Verhängnis werden könnte. Plötzlich schreckte er hoch. Da klopfte jemand mit einem metallenen Gegenstand an die Außenwand. Hatte sein Schnarchen ihn verraten und wollte jemand nachprüfen, ob es im Lastwagen einen verborgenen Hohlraum gibt? Das Herz schlug Yousif bis zum Hals und er wagte kaum zu atmen. Draußen debattierten laute Stimmen in einer fremden Sprache. Dann wurde der Motor des LKW angeworfen. Yousif atmete auf, sank entspannt auf den Boden und schlief fest ein.
Endlich, nach sieben Tagen Dunkelhaft, hörte er, wie der Lastwagen entladen wurde; dann brummte der LKW wieder los. Ein paar Stunden später blieb der Laster stehen. Die Luke wurde aufgeschraubt und geöffnet: Yousif kroch heraus und der Lkw-Fahrer half ihm beim Absteigen. Yousifs Glieder waren steif und er konnte kaum gehen. Er rieb sich die Augen, die so lange kein Licht gesehen hatten. Ein paar Straßenlaternen warfen ein spärliches Licht auf einen menschenleeren Parkplatz. Es war bitterkalt und außer dem laufenden Motor des Lastwagens war kein Geräusch zu hören.
Der Fahrer deutete in eine Richtung: Da würde der Bahnhof dieser Stadt liegen und Yousif sollte dort auf einen Mann warten, der ihm den Pass zurückgeben würde.
„Wie soll ich diesen Mann erkennen?“, fragte Yousif.
„Er wird dich erkennen – er hat ja dein Passbild!“
Der Lkw-Fahrer beeilte sich, ins Fahrerhaus zu klettern und Vollgas zu geben. Yousif stand ein paar Augenblicke wie verloren auf dem einsamen Parkplatz. Dann gab er sich einen Ruck und noch ganz steif stolperte er los. Von Schritt zu Schritt ein wenig schneller marschierte er die Straße entlang in die angegebene Richtung. An einem vorbeifahrenden Fahrzeug konnte er ein weißes Nummernschild erkennen in einer Schrift, die ihm nicht vertraut war: C – Chemnitz. Er war in Deutschland angekommen.
Vier Stunden wartete er vor dem Bahnhof von Chemnitz auf den Unbekannten, der ihm den Pass zurückgeben sollte. Eine rote Leuchtschrift zeigte minus 20 Grad an. Yousif zitterte vor Kälte am ganzen Leib. Niemand kam. Inzwischen graute der Morgen und Yousif fragte einen Passanten nach „Police“. Im Polizeirevier wollte man seine Papiere sehen. Yousif konnte sich nicht verständlich machen. Ein Polizist sah die bleierne Müdigkeit in Yousifs Gesicht und bot ihm einen bequemen Stuhl an. Yousif setzte sich und schlief sofort ein. Eine Stunde später wurde er wieder geweckt: Mit Hilfe eines Dolmetschers konnte Yousif seine Geschichte erzählen.
Man brachte ihn ins Asylbewerberheim. Dort konnte er zum ersten Mal seit vier Wochen wieder mit seiner Frau und den Eltern telefonieren. Nach vier Wochen Ewigkeit endlich ein Lebenszeichen!
Ein weiteres halbes Jahr lang musste Yousif in quälender Ungewissheit leben: Wird es in Ankawa ruhig bleiben? Gibt es eine Chance, dass Tara mit den Kindern bald nach Deutschland kommt? Werden die Dschihadisten seine in Mossul verbliebenen Eltern unter Druck setzen oder gar ermorden? Tag und Nacht quälten ihn Gedanken und Sorgen. Und er fühlte sich so hilflos in diesem neuen Land, dessen Sprache er nicht verstand und dessen Bürokratie er nicht durchschaute. Als sein Asylantrag endlich anerkannt wurde, konnte er Tara mit Amanuel und Shaba auf legalem Weg nachkommen lassen. Welch ein Wiedersehen am Flughafen in Berlin, nach so langen, bangen Monaten!
Zur selben Zeit besetzten die Milizen des IS seine Heimatstadt Mossul. Nun mussten auch seine Eltern und sein Bruder, die gesamte Verwandtschaft, ja, alle Christen diese Stadt verlassen und Richtung Ankawa flüchten.
3. Ein Wiedersehen am Grab
Die Erinnerungen an die erste Begegnung mit Yousif und die Eindrücke unserer Spontanreise nach Ankawa schwirren noch durch meinen Kopf. Es kommt mir so unwahrscheinlich vor, dass ich jetzt in Kurdistan gelandet und bei Yousifs Familie zu Gast bin. Ich drehe mich um, denn ich will endlich einschlafen. Draußen graut schon der Morgen.
Zwei Stunden später werde ich vom klappernden Geschirr im Nebenraum geweckt und stehe schnell auf, um mich anzuziehen.
Taghrid, Yousif und Basman sitzen schon auf einem der Sofas, alle über ein niedriges Tischchen gebeugt, auf dem Tassen für den Tee, Fladenbrote und eine Schale mit Joghurt stehen. Ich grüße mit „Marhaba“ (guten Tag), dann ein paar Brocken Englisch – und setze mich zu Yousif.
„Hast du gut geschlafen?“
Yousif schüttelt den Kopf.
„Ich wollte meinen Vater sehen, jedoch nicht auf dem Friedhof.“
Ich nicke und lege eine Hand auf seine Schulter.
„Ist dein Vater schon beerdigt?“
„Hier werden die Toten immer sofort begraben.“
„Und die Feier heute?“
„Die wird in der Kirche stattfinden. Im Sonntagsgottesdienst wird heute besonders für meinen Vater gebetet; anschließend gehen wir auf den Friedhof.“
Beim Verlassen der Wohnung will mir Yousifs Mutter einen Hinweis geben, dass ich nichts Wertvolles zurücklassen soll. Sie deutet auf meinen Rucksack und warnt: „Ali Baba!“ Ich verstehe und nehme Papiere und Flugticket mit.
Wir holpern in Basmans klapprigem Auto über die löchrigen Straßen von Ankawa. In dieser wüstenartigen Gegend wachsen weder Baum noch Strauch. Dafür schießen überall Betonkonstruktionen aus dem Boden. Doch die Baustellen sehen alle ziemlich verlassen aus. Yousif bestätigt mir, dass es in Kurdistan einen Bau-Boom gegeben hatte. Durch die Erdölförderung waren Gelder ins Land geflossen und mit diesen auch ausländische Firmen samt ihren Facharbeitern. Dazu sind seit Jahren viele Geflüchtete aus anderen Regionen des Irak in das politisch und wirtschaftlich einigermaßen stabile Kurdistan geströmt, darunter zahlreiche Christen. Aber der Verfall des Erdölpreises auf dem Weltmarkt führt seit über einem Jahr dazu, dass fast alle Bauprojekte eingestellt wurden. Die Regierung hat kein Geld mehr. Daher die viele Bauruinen.
Wirklich kein schöner Anblick: Betonpfeiler, die in den regengrauen Himmel ragen, umgeben von Schutthalden und verrosteten Eisengittern. Der trostlose Eindruck wird durch den Müll am Straßenrand zusätzlich verstärkt. Vom Wind zerfetzte Plastiktüten haben sich in den wenigen dornigen Sträuchern verfangen. Ein bizarrer Christbaumschmuck. Oder vielleicht eher ein Spiegelbild vieler Menschen hier: hinausgeworfen aus der eigenen Heimat, zum Spielball des Windes geworden, in einer kahlen und trostlosen Gegend hängen geblieben.
Ein großes Verkehrsschild zeigt in arabischer und lateinischer Schrift die Richtung nach Mossul an.
„Deine Heimat, Yousif!“, rufe ich von der Rückbank nach vorn.
„Das war einmal meine Heimat“, höre ich Yousif vom Beifahrersitz aus antworten und es liegt Trauer in seiner Stimme.
Basman sucht vor einem großen klotzigen Gebäude einen Parkplatz.
„Hier ist unsere Kirche!“
Trotz der lebhaften Phantasie, die man mir nachsagt, kann ich die ursprüngliche Zweckbestimmung dieses Gebäudes nicht erraten. Viele schwarz gekleidete Menschen strömen jetzt in dieses schmucklose Gebäude, das notdürftig zu einer Kirche umfunktioniert worden ist. An der Stirnwand hängt ein Kreuz, darunter steht ein Altar, auf dem Leuchter und ein Kelch blinken. Ein zurückgezogener roter Vorhang lässt den leicht erhöhten Altarraum wie eine Bühne erscheinen. Unten reihen sich etwa 300 Stühle, von denen die meisten schon besetzt sind. Ich gehe mit Yousifs Familie nach vorn und setze mich in die erste Reihe. Mir fallen die ernsten Gesichter der Frauen und Männer auf, wie von einem Trauerrand umrahmt. Manche von ihnen stehen mit gebeugtem Rücken: niedergedrückt von der Arbeit, vom Schicksal, vom Tod eines Freundes. Yousifs Anwesenheit, von der ja niemand etwas wissen konnte, wird zur großen Überraschung für diese trauernde Exilgemeinde. Auf den versteinerten Gesichtern blitzt plötzlich ein Lächeln auf und ein paar Leute gehen nach vorn, um den Heimgekehrten zu umarmen. Ein eigentümliches Wiedersehen an einem Ort, der Heimat und Fremde zugleich ist.
Allmählich kommt Bewegung in den Altarraum. Mehrere Männer in weißen Gewändern laufen hin und her, tragen Bücher oder Kerzen und beginnen zu singen. Die Melodik tönt fremd in meinen Ohren: orientalische Gesänge aus kräftigen Kehlen, mit schwermütigem Klang. Ein junger Mann mit schwarzem Bart und einem knallroten Gewand schwingt feierlich ein Rauchfass, an dem zwölf goldene Glöckchen lustig klirren. Eine ganze Wolke von Weihrauch steigt auf und ein betörender Duft erfüllt den Raum. Weitere Männer in bunten Gewändern tauchen auf: Priester oder Diakone. Seitlich im Altarraum steht ein rot gepolsterter Stuhl, auf dem ein alter Mann sitzt, sein Gesicht geziert mit einem silbergrauen Bart. Er trägt eine schwarze Kutte und eine rote, runde Kopfbedeckung.
„Das ist Bischof Saliba, der Altbischof von Mossul, der hier im Exil lebt“, raunt mir Yousif zu.
Der berückend schöne Gesang wogt zwischen den Männern im Altarraum und der Gemeinde hin und her. Jetzt erst bemerke ich, dass sich die Frauen Tücher über die Haare gelegt haben: dünne, fast durchsichtige Seidentücher, in Schwarz oder Weiß, manchmal mit Mustern durchwirkt. Während des Gottesdienstes stehen wir fast die ganze Zeit über. Das Lesepult in der Mitte stellt das Evangelium Jesu ins Zentrum. Die Sprache der Liturgie ist Syrisch.
Syrisch? Wieso das? Wir sind doch im Irak! Um welche Sprache handelt es sich bei Syrisch überhaupt? Auf jeden Fall nicht um die Landessprache von Syrien, denn diese ist Arabisch.
Ich erinnere mich daran, dass ich Yousif ganz zu Beginn unserer Freundschaft danach fragte, woher er stamme. Er nannte die Stadt Mossul und suchte dann auf seinem Smartphone die Übersetzung für das arabische Wort „Suryani“: Syrer.