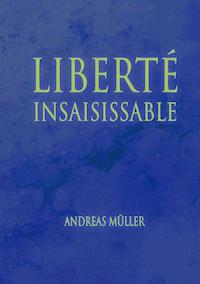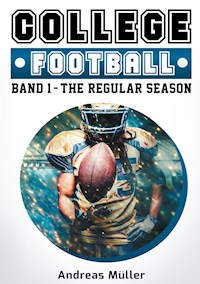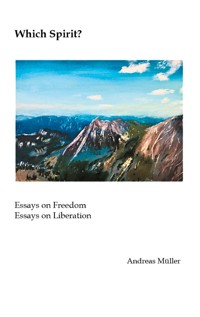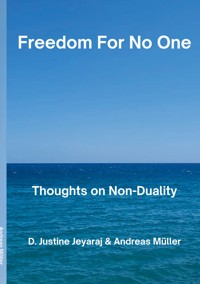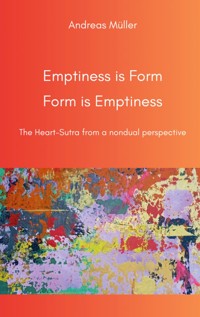Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Wartburg Verlag - c/o Evangelisches Medienhaus
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Es ist das Jahr 1905. Fürstin Marie von Schwarzburg-Sondershausen ist nach Arnstadt gekommen, um eine "Heil-, Pflege- und Erziehungsanstalt" zu eröffnen. Neugierig und aufgeregt blinzeln draußen vor der Tür der junge Schustergeselle Frieder Katt und die Schwesternschülerin Marie durch die Tür. Die Sonne glitzert in Maries braunem Haar, auch das kleine Silberkreuz an Maries Hals glitzert. Frieder weiß, dass Marie Diakonisse werden will. Doch es kommt alles ganz anders ... Es ist der Beginn der Geschichte des Marienstiftes, der Beginn einer geordneten sozialen Arbeit an Menschen mit körperlichen und geistigen Behinderungen, die es bisher nicht gab. Und es ist der Beginn der Geschichte der Katts, die über Generationen mit dem Marienstift verbunden ist. Eine packende Familiengeschichte, die den Leser mitnimmt auf eine wechselvolle Reise durch das 20. Jahrhundert – mit zwei Weltkriegen, den Goldenen Zwanzigern und den bedrückenden Jahren des Nationalsozialismus und der DDR. Eine Geschichte, die von Liebe erzählt, von tiefem Glauben und Gottvertrauen, von Schuld, Angst, Verzweiflung, Verrat und dem kleinen alltäglichen Glück. "Die Leute vom Marienstift" – in den Diakonischen Einrichtungen gleichen sie sich alle, ob im Marienstift Arnstadt oder anderswo. Überall sind ihre Erfahrungen ähnlich. Überall trifft man auf Menschen, die Unterstützung brauchen und auf Menschen, denen der Herrgott Kraft und Willen zum Helfen gibt. Überall fehlte und fehlt es mal mehr und mal weniger an Geld. Dennoch wird überall die Arbeit getan, die notwendig ist – und fast immer noch mehr.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 356
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
ANDREAS MÜLLER
Die Leute vom Marienstift
ROMAN
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© 2019 by Wartburg Verlag GmbH, Weimar
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Gesamtgestaltung und Satz: Anja Haß, Leipzig
ISBN 978-3-86160-568-3
www.wartburgverlag.net
Für Birgitt
Vorwort
Im Jahr 1905 war das Fürstentum Schwarzburg-Sondershausen einer der vielen Kleinstaaten im Deutschen Kaiserreich. Eine geordnete soziale Arbeit an Menschen mit körperlichen und geistigen Behinderungen war im Land zu Anfang des neuen Jahrhunderts nicht entwickelt. Darum wurde in Arnstadt eine »Heil-, Pflege- und Erziehungsanstalt« gegründet. Fürstin Marie von Schwarzburg-Sondershausen stiftete deren Grundkapital. Emil Petri, Superintendent in Arnstadt, organisierte und leitete die Anstalt. Spenden aus der Arnstädter Bürgerschaft unterstützten die neue Einrichtung. Im nach der Fürstin benannten »Marienstift« wurden geistig unterschiedlich entwickelte Körperbehinderte aufgenommen, behandelt und unterrichtet. Junge Leute wurden zum Beispiel zu Korb- und Stuhlflechtern oder Schuhmachern ausgebildet und die tägliche Arbeit durch evangelische Diakonissen des Eisenacher Mutterhauses und Helferinnen und Helfer getan.
Dieses Buch ist natürlich keine vollständige Geschichte des Marienstiftes in Arnstadt. Doch stehen hier Geschichten, die sich in einhundert Jahren ereignet haben oder ereignet haben könnten. Auch das einhundertste Jubiläum der Stiftung 2005 ist längst selber Geschichte. Wie viele Ereignisse, wie viele Menschen haben in der langen Zeit die Arbeit und das Leben im Marienstift geprägt! Von allen zu erzählen, reichten einhundert Bücher nicht aus.
Auf den folgenden Seiten sind Episoden aus dem Leben der »Leute vom Marienstift« zu lesen, wobei Familie Katt frei erfunden ist. In alten und aktuellen Mitarbeiterlisten wird sich der Name nicht finden. Ob diese Familie typische »Leute vom Marienstift« sind, weiß ich nicht. Wahrscheinlich gibt es gar keine »typischen« Menschen, auch nicht in sozialen, christlichen Einrichtungen. Die Generationen der Katts machen aber typische Erfahrungen in wechselnden politischen Zeiten, in denen sich die Arbeit mit kranken und behinderten Menschen beständig änderte und doch letztlich gleich und notwendig und gesegnet blieb.
Einige der Persönlichkeiten, die auftauchen, sind historisch. Im Anhang kann man ihre Lebensdaten erfahren. Sie haben sich im Stift engagiert oder eingemischt.
Doch auch wenn die geschilderten Szenen der Phantasie entspringen, so kommen hoffentlich viele Situationen und Leute vom Marienstift den Lesern und Leserinnen dennoch bekannt vor, denn in den diakonischen Einrichtungen gleichen sie sich alle – ob im Marienstift Arnstadt oder anderswo. Überall sind ihre Erfahrungen ähnlich. Überall trifft man auf Menschen, die Unterstützung brauchen, und auf Menschen, denen der Herrgott Kraft und Willen zum Helfen gibt. Überall fehlte und fehlt es mal mehr und mal weniger an Geld. Dennoch wird überall die Arbeit getan, die notwendig ist, und fast immer noch mehr.
Arnstadt, im April 2019
Andreas Müller
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
DIE GUTEN JAHRE (1905 –1914)
Im oberen Saal
Vor der Türe
Ein Tag im Heim zwischen den Jahren
Die guten Jahre
Ein Gruppenbild und Leute vom Stift, die nicht darauf zu sehen sind
Marie und Frieder
Der Besuch des Vaters
Sie spielen Krieg
Die gute Zeit geht zu Ende
Sedantag
Das Handwerkerhaus
Vor der dunklen Zeit
Kriegsgerüchte
Hochzeit
HUNGER UND GIFTGAS (1914 –1918)
Kriegsbeginn
Ein Kind im Krieg
Grundschullehrer Heinrich Meyer sucht die Nähe von Marie Katt
EINE FREMDE ZEIT UND EIN FREMDER MANN (1918 –1932)
Witwe Katt?
Ein Fremder
Das Leben geht weiter
Betteltour
Gesetze und Hoffnungen
Abschied
Die Abordnung
Notzeit
AUF LEBEN UND TOD (1933–1939)
Der Traum
Der erste Angriff
Ausgegrenzt
Angst
Ausbruch
Mitten im Strom
Die Wirklichkeit
Der Luftschutzkeller
Der Brand
WIEDER KRIEG (1939 –1945)
Frauen- und Kameradschaftsabende
Im Kirchsaal der Himmel, draußen die Welt
Der zweite Angriff
Kriegsnot
Die Witwe Marie Katt
Bombenangriff
Zwischen den Trümmern
Mai 1945
HOFFEN (1945 –1949)
Ein Flüchtling
Christa bleibt
Hilfsschwester Christa
Drei Frauen
Max Katt
Gottes Wege
»DON’T EAT THAT YELLOW SNOW« (1949 –1980)
Zwischen Ost und West
Hochzeitsplanung
Wieder eine Hochzeitsfeier
Ein Nachkriegskind
Gemeindefest 1953
Nach dem Fest
Der Tag nach dem Mauerbau
Gipsbett
Friedensfahrt
Im Netz
Sand und See
Mutter-Kind-Rüstzeit
ALLES WIRD ANDERS – ALLES BLEIBT GLEICH (1980 –2005)
Die »Kommune«, das Stift und Herr Götting
Im Untersuchungszimmer
Der Besuch des hohen Gastes
Zerbröckeln
Eine Nacht zwischen den Zeiten
Neue Zeit
Nachsatz
Biographische Angaben zu realen Personen im Roman
Zum Autor
Bildnachweis
Das Alte Haus, Heil-, Pflege- und Erziehungsanstalt
Die guten Jahre
(1905 –1914)
Fürstin Marie von Schwarzburg-Sondershausen
IM OBEREN SAAL
4. April 1905. Die wichtigen, festlich aufgeputzten Arnstädter mussten eng beieinander auf schmalen Stühlen Schulter an Schulter sitzen. Es war außergewöhnlich warm im oberen Saal des Kinderheims und es roch nicht nur nach Parfüm und frischer Farbe. Fürstin Marie von Schwarzburg-Sondershausen, die erste Frau im Fürstentum, saß ganz vorne in der Mitte. Sie durfte ihre Arme auf zwei gepolsterten Lehnen ruhen lassen, während die anderen Honoratioren nicht wussten, wohin mit ihren Armen. Für feine Leute schien der Turnsaal nicht gemacht.
Durch die Fenster strahlte die Frühlingssonne. Trotz der drängenden Enge richteten sich alle Augen auf die Fürstin auf dem Ehrenplatz. Das Festkleid der sechzigjährigen Dame war dem Anlass entsprechend würdig und auffällig bescheiden. So manche Arnstädter Bürgerin funkelte und glitzerte im neuen Frühjahrskleid bunter als ihre Landesherrin. Hier im Krüppelheim kamen die Kleider sowieso noch nicht zur Wirkung. Dann aber, im Schloss beim Festessen, würde man sie nicht übersehen.
Fürstin Marie sprach leise und freundlich mal nach rechts, mal nach links. Zur Linken saß der Wirkliche Geheime Rat von Wurm in seiner Funktion als Vorsitzender des »Vereins für Krüppelpflege im Fürstentum Schwarzburg-Sondershausen«. Der Mann war aufgeregter als es seinem Stand geziemte. Gleich musste er vor der Festversammlung seine Rede halten. Mit einem dreifach kräftigen »Hoch!« auf die Fürstin wollte er die Festansprache schließen und er hatte die berechtigte Sorge, dass ihm dabei die dünne Stimme versagen würde. Die Fürstin sprach beruhigend mit ihm über die ungewöhnliche Wärme im Monat April. Zur Rechten der Fürstin saß der Mann des Tages, Emil Petri. Der Superintendent brauchte ihren Zuspruch nicht.
Marie von Schwarzburg-Sondershausen repräsentierte an diesem Tag das Fürstenhaus allein. Sie tat es mit Würde. Begafft und bejubelt zu werden, war der Fürstin alltäglicher, hoher Dienst am Land.
Heute, in dem neuen Haus, war die Frau mehr bei der Sache als zu anderen Gelegenheiten. Dieses Marienstift lag ihr am Herzen. Auch eine Fürstin ging jeden Tag ihrem Herrgott einen Schritt entgegen. Und wenn sie durchs Land fuhr, machten sie die winkenden Untertanen nicht blind. Das Elend war nicht zu übersehen und die Not bettelnder Krüppel verfolgte sie oft bis in den Schlaf. Das Marienstift Arnstadt sollte helfen, die Not zu bezwingen. Die neue Anstalt war überfällig. Gott wollte sie. Gott will, dass allen Menschen geholfen wird.
Die Fürstin achtete auf jedes Wort, das Emil Petri sprach. Der Mann war ihr wichtig. Für sie war er wie eine Brücke aus ihrer Fürstinnenwelt in die Wirklichkeit – mehr noch, der Mann war wie ein Werkzeug, mit dem sie ihr Land bessern konnte. Superindendent Emil Petri war ein Organisator. Das neue Heim war sein Werk. Er verwandelte das Geld des Fürstenhauses und die Spenden der gutwilligen Bürger in eine moderne Anstalt zur Krüppelpflege, die erste ihrer Art in diesem kleinen Land. Erst vor drei Jahren hatte man ihn geworben, zum »Konsistorialrat« ernannt und ihm neben dem Dienst als Superintendent auch die Planung, Finanzierung und den Aufbau des Marienstiftes übertragen. Die erste Etappe der Arbeit war nun getan. Emil Petri war ein Macher. Ein schmaler, drahtiger Mann, Mitte fünfzig, mit Erfahrung und ungebrochenem Ehrgeiz. Fromm, nicht nur mit Worten. Ohne Zweifel war der Mann hier in Arnstadt am richtigen Ort und wusste das auch. Mit dieser Anstalt war der Anschluss an die Innere Mission, die aktive Sorge um die Armen und Verkrüppelten, wie sie überall in Deutschland längst üblich war, geschafft. Das Fürstentum brauchte sich nicht mehr zu verstecken und die Fürstin hatte ein christliches Werk angestoßen, das Wert besaß, weit über allen äußerlichen Schein ihres Daseins.
Auch Fürstin Marie tat ihre Arbeit souverän. Sie grüßte lächelnd Bankiers, Kommerzienräte und wackere Handwerksmeister. Sie dankte allen wichtigen Beamten und der ganzen ehrwürdigen Bürgerschaft. Wenn sie huldvoll lächelte, adelte es jeden, den ihr Lächeln traf. Die »Landesfee« sorgte für Spenden und gab Spendern ein gutes Beispiel.
In Gottes Welt gab es Fürsten und Krüppel. Die Arbeit der Fürstin war es, den Krüppeln Häuser zu bauen. Sie war sich sicher, dass Gott ihr diese Aufgabe gegeben hatte, und erfüllte sie ehrlich und gut.
VOR DER TÜRE
»Du guckst, als wolltest du deine Hände nie mehr waschen.« Frieder hatte sich frech vor das Mädchen gestellt, das den Mantel der Fürstin offenbar nicht mehr loslassen mochte. Er lachte ihr ins Gesicht. Die beiden standen jetzt alleine vor dem Saal des Heimes hinter einem Garderobentisch. Die Saaltür war geschlossen. Die Festgäste saßen drinnen auf ihren harten Stühlen. Alle Mäntel und Jacken hingen an den Haken, nur den einen, den Fürstinnenmantel mit seinen goldenen Knöpfen und dem Samtbesatz, hielt das Mädchen noch immer fest in ihren Armen. Träumend stand es da und schien durch die geschlossenen, weiß lackierten Saaltüren hindurchzublicken. Fürstin Marie hatte ihr gnädig die Hand gereicht. Der Handschlag wirkte nach.
Eigentlich hatte Frieder Katt dem hübschen Mädchen nur ein paar gute Worte sagen wollen. Es war zart und strahlend und er beobachtete Marie im Haus schon einige Tage. Nun hatte er es leider nur zu einem Witz gebracht und bereute ihn sofort. Mit Spott konnte er sie nicht beeindrucken.
Ihre schmalen Hände strichen noch immer über den teuren Stoff. Das Mädchen hieß Marie Xylander und war eine der Schwesternschülerinnen des Stiftes, eine Pfarrerstochter aus der Rhön. So viel hatte Frieder Katt schon herausbekommen.
Immer wenn Marie ihren Nachnamen aussprach, musste sie ihn und die Geschichte ihrer Familie, die früher einmal nur Holzmann hieß, erklären. Alle ihre Vorfahren waren Pfarrer und gebildete Menschen.
Marie Xylander war siebzehn Jahre alt, gekleidet in ein schwarzes Kleid und eine weiße Schürze. Eine Schwesternhaube und die Schwesternbrosche trug sie nicht. Noch war sie den Eisenacher Diakonissen nicht beigetreten. Marie träumte mit offenen Augen, was an dem außergewöhnlichen Tag, der Frühlingssonne und vielleicht auch an dem jungen Mann neben ihr lag, den Emil Petri persönlich zum Garderobendienst eingeteilt hatte. Die Schwesternschülerin mit den feinen Händen und der Schustergeselle mit den kräftigen Armen alleine vor der Saaltür – das alles vermochte eine Pfarrerstochter vom Land leicht zu verwirren.
Frieder Katt war Schustergeselle, Sohn des Schustermeisters Heinrich Katt, der mit Emil Petri einen Vertrag geschlossen hatte. Die verkrüppelten Füße der Bewohner der Anstalt brauchten besonderes Schuhwerk. Mehr noch, Meister Katt würde die fähigen Krüppel zu Schustern ausbilden, denn im neuen Haus sollte viel mehr geschehen als das bloße Verwahren behinderter Menschen. Die jungen Männer sollten Berufe erlernen. Schustergesellen, die selber verkrüppelte Füße und Beine hatten, wussten besser als die Gesunden, was Leidensgenossen wirklich brauchten. Der Sohn des Meisters, Geselle Frieder Katt, sollte täglich die Werkstatt leiten. Deshalb war er hier.
Die Sonne glitzerte in Maries braunem Haar, obwohl sie es züchtig und streng zu einem festen Knoten gebunden hatte. Auch das kleine Silberkreuz an Maries Hals glitzerte. Auf das Kreuz blickte Frieder skeptisch. Dieses Zeichens hätte es nicht bedurft. Frieder wusste, dass Marie Diakonisse werden wollte.
Mit Fräuleins in der Stadt kam Frieder meist leicht ins Gespräch. Jetzt aber suchte er krampfhaft nach einem Thema. Er nahm das naheliegende und sagte: »Diese Fürstin beeindruckt mich auch. Sie ist so erstaunlich menschlich. Ihr Mann soll da anders sein. Hast du gehört, dass Fürst Günther krank ist und deshalb nicht gekommen ist?«
Marie hatte es noch nicht gehört. Sie schüttelte den Kopf.
»Nichts gegen Fürstin Marie, aber den alten Petri finde ich noch erstaunlicher als sie«, fuhr Frieder fort.
In den vergangenen Tagen war der Herr Konsistorialrat wie ein Schutzmann von morgens bis abends durch das Haus gelaufen und hatte jeden und alles im Blick behalten, Anweisungen gegeben, gerügt und gelobt. Mit dem Schustergesellen war Petri nicht anders umgegangen als mit seinen eigenen Leuten.
Vor einer Autorität wie Emil Petri fühlte ein Mädchen wie Marie Xylander mehr Respekt als Zutrauen. Sie sah Frieder ungläubig an. Ein Schustergeselle hatte den Konsistorialrat Emil Petri zu respektieren, nicht aber »erstaunlich« zu finden.
»Glaubst du, ich mache Witze?«, fragte Frieder, der ihre Gedanken erriet. »Vor zwei Jahren stand hier eine hässliche alte Fabrik. Alles, was jetzt geworden ist, hat der Mann geschafft. Das neue Haus, euch Diakonissen, uns Handwerker. Petri kümmert sich um alles. Sogar die Krüppel, die hier übermorgen einziehen, musste er erst suchen. Freiwillig haben sich nur wenige angemeldet. Die Familien schämen sich für ihre kranken Kinder und befürchten das Gerede der Nachbarn. Die Krüppel haben Angst vor der Fremde und den Ärzten und dass sie es nicht schaffen mit der Lehre. Und Petri organisierte und predigte und redete gut zu. Ich finde das sehr erstaunlich.« Frieder blieb bei seiner Wortwahl und breitete vor Marie sein Wissen über die Gründung des Marienstiftes aus.
»Nicht mal alle Arnstädter Bürger waren von der Idee unsrer Fürstin begeistert. Ich weiß es von meinem Vater. So viele kranke, entstellte Leute mitten in der Stadt! Ohne Petri hätte auch unsere Fürstin das nicht geschafft!«
Marie hatte sich über das Stift nicht so viele Gedanken gemacht wie dieser Schuster. Maries Vater hatte bestimmt, was gut für sie war. Darum wurde sie Diakonisse. Darum war sie nun hier. Im Mutterhaus der Diakonissen in Eisenach hatte Schwester Gertrud gewusst, was aus Marie werden sollte. Als Gertrud im Marienstift Arnstadt gebraucht wurde, sollte Schwesternschülerin Marie sie dorthin begleiten, und es wurde ihr erlaubt. Alles war für Marie wie von selbst gekommen und nun arbeitete und lernte sie im Marienstift.
Noch immer hatte Marie zu dem Schustergesellen kein Wort gesprochen. Alleine vor der Türe stehen ließ sie ihn aber auch nicht.
»Und der Petri war einmal in Afrika. Ganz unten im Süden«, fuhr Frieder fort.
Vielleicht war es das, was den jungen Mann am meisten an Petri »erstaunte«, denn heute träumten alle jungen Männer von Afrika, von Schätzen und von Abenteuern.
»Ein Abenteurer oder ein Soldat war der Herr Petri nicht. Er war nicht einmal als Missionar auf dem Schwarzen Kontinent, nur ein Kirchenmann mit dienstlichem Auftrag.«
Bis eben noch hatte Marie verlegen wie ein junger Backfisch an Frieder vorbeigesehen. Jetzt hatte sie den Jungen durchschaut. Jetzt lächelte sie spöttisch auf ihn hinab, obwohl sie etwas kleiner war als er. Ihre kleinen Brüder im Rhöner Pfarrhaus schwärmten vom fernen Afrika genauso wie dieser Geselle. Hatte sich Frieder vielleicht auch ein paar schwarze Püppchen im Schrank versteckt wie ihre Brüder?
Warum Marie lächelte, ahnte Frieder nicht einmal. Er nahm ihr Lächeln dennoch als gutes Zeichen. Das schweigsame Mädchen war anders als die Fräuleins in der Stadt.
Marie ordnete die Mäntel noch einmal von rechts nach links und zurück und strich danach den der Fürstin zum zehnten Mal glatt. Ganz aus den Augen kam ihr Frieder aber dabei nicht. Drinnen im Saal sang der Kinderchor »Ich will den Herren preisen …« und danach alle zusammen »Lobe den Herren!«
Marie summte mit. Eine Pfarrerstochter wie sie, konnte nicht anders.
Danach redete Emil Petri. Seine scharfe Stimme drang bis ins Treppenhaus zu ihnen hinaus.
»Hör zu, Frieder! Vielleicht sagt er auch etwas über Afrika.«
Scherze auf seine Kosten liebte Frieder eigentlich nicht. Aber sie hatte mit ihm geredet und schien ihn nicht zu fürchten. Sie gefiel ihm nun noch mehr.
Petri predigte über den Beistand Gottes zum Bau des Heimes. Das war zu erwarten. Dann sprach er über die große Unterstützung aus dem Fürstenhaus.
»Es ist Sein Werk!«, rief Petri endlich, meinte den Herrgott und irgendwie klang dieser Ruf nicht mehr so selbstverständlich wie alle seine Sätze davor. Zumindest Marie fiel das auf. Sie hatte schon hunderte Predigten gehört und konnte vergleichen.
»Es ist Sein Werk!«, rief Petri noch einmal. »Und übermorgen soll in diesen Räumen die eigentliche Arbeit beginnen! Übermorgen ziehen sie ein, unsere Pfleglinge, und eröffnen die Reihe derer, denen wir dienen wollen, so gut wir können. Unsere Schwestern sehen den Pfleglingen mit freudiger Erwartung, aber auch mit einigem Bangen entgegen.«
Selbst Frieder begriff, dass einem Mädchen wie Marie vor der Arbeit im Krüppelheim bang sein musste. In diesem Haus musste sie jeden Dienst verrichten, der notwendig war. Die Pfarrerstochter musste Ekel und Scheu überwinden. Schuhe machte Frieder aus Leder, Nägeln und Leim. Damit kam jeder zurecht, der sich Mühe gab. Maries Pfleglinge aber waren armselige, hilflose Mädchen und Jungen, denen zuallererst der Dreck vom Leib gewaschen werden musste. In der Stadt gingen schlimme Gerüchte um, was für fremde Ungeheuer im Haus untergebracht werden sollten. Irre, die rund um die Uhr gefesselt werden mussten, damit sie ihren Pflegern nicht an die Gurgel gingen. Ungeheuer ohne Arme und Beine, Wilde aus den Dörfern im hintersten Wald. Gottlose Kreaturen.
Frieder glaubte nicht die Hälfte von all dem Gerede. War aber auch nur die Hälfte davon wahr, hatte das Mädchen keine leichte Zeit vor sich.
»So schlimm wird es nicht werden«, flüsterte er ihr zu. Mehr fiel ihm nicht ein. Und schon wieder hatte Frieder nicht die richtigen Worte gefunden.
»Gott will, dass allen Menschen geholfen wird«, zischte Marie scharf zurück. »Was hat ein Heide wie du in unserem christlichen Haus zu suchen? Nächstenliebe kennt keine Furcht.« Sie hätte ihm gerne noch mehr gesagt, kam aber nicht dazu.
Im Saal verklang der letzte Choral. Die Stühle scharrten über das Parkett. Die Gäste drängten hinaus. Schon schob man die Türen auf. Der Festakt zur Eröffnung der Heil-, Pflege- und Erziehungsstätte »Marienstift« war vorüber. Ungeduldig drängten die Arnstädter an die Garderobe und verlangten alle zugleich nach ihren Mänteln. Man hatte es eilig. Es lockte die Geladenen der zweite Teil dieses Vormittages, das Festessen im Schloss. Marie und Frieder taten ihr Bestes, aber nie hatten sie das richtige Kleidungsstück beim ersten Griff in der Hand. Da drängte sich ein vornehmer Diener im Livree durch die ungeduldige Menge und verlangte die Robe der Fürstin. Die fand Marie sofort.
Einige Festgäste hatten es nicht eilig. Das waren die, die man nicht zum Festessen ins Schloss geladen hatte und deren Laune deshalb nicht die beste war. Auf sie wartete nur eine dünne Suppe zu Hause. Da sie die letzten im Saal waren, fühlten sich zwei von ihnen unbeobachtet und redeten drauf los, um ihren Ärger zu vergessen. Die jungen Leute hinter dem Garderobentisch beachteten sie nicht.
»Gott sei Dank!«, sagte ein hagerer Herr in einem offenbar nur geborgten, viel zu großen Gehrock. »Gott sei Dank kommen nach Arnstadt nur die ›Bildungsfähigen‹. Die in Blankenburg trifft es schlimmer. Die Krüppel dort können gar nichts. Da werfen sie das schöne Geld völlig umsonst aus dem Fenster. Wenn du mich fragst, haben wir noch Glück im Unglück.«
Sein Gegenüber, ein stadtbekannter Schneider, dünn wie der Erste, nur nicht so lang, sagte: »Mir hat dieses neue Haus noch keinen Pfennig eingebracht. Meine Kleider werden hier nicht getragen.«
Der erste Hagere, ein Handschuhmachermeister, war ein »moderner Mensch«, ganz ein Kind des neuen Jahrhunderts. »Wir werden es erleben«, sagte er. »In ein paar Jahren braucht es solche Anstalten gar nicht mehr. Da werden keine Krüppel mehr geboren und wir werden in Automobilen fahren, fliegen und nur noch gesunde Kinder auf die Welt kommen lassen.«
»Kann sein. Bis dahin ist aber noch Zeit. Was werden denn die Krüppel heute jeden Tag machen?«, fragte der Schneider seinen Freund. »Richtig arbeiten wie wir müssen die wahrscheinlich nicht.«
Der andere nickte bedeutungsvoll und antwortete: »Die werden gepflegt und erzogen. Das steht so schon im Namen der Anstalt. Ich sage dir, irgendwie ist das gegen die Natur. Den Krüppeln hier könnte es besser gehen als uns, die wir im Schweiße unseres Angesichts das Brot verdienen müssen. So kann der Herrgott das doch nicht wollen.«
Sie besahen sich die frisch gestrichenen Wände, die heller und sauberer waren als ihre zu Hause. Schwesternschülerin Marie hatte jedes Wort gehört. Sie reichte ihnen die Mäntel mit zitternden Händen. Als das die Männer bemerkten, wurden sie verlegen und still.
»War eine erhebende Feier. Ein großartiger Anfang«, sagte der lange Hagere, und der kurze meinte: »Die tätige Nächstenliebe ist doch das Wichtigste am christlichen Glauben.«
Nun wollten beide Herren schnell hinaus und eilten die Treppe hinab, so als säße ihnen das Mädchen im Nacken.
Bevor auch Schwester Gertrud den geladenen Gästen ins Schloss folgen konnte, musste sie im neuen Haus für Ordnung sorgen. Es sollten alle von den Etagen zusammengesuchten Stühle zurückgetragen werden. Auch Marie und Frieder trugen Stühle.
»Die einen spazieren an die Festtafel, die anderen schleppen sich ab«, meinte Frieder. Bald war die Arbeit getan. Die Helfer machten Pause. Als wäre es selbstverständlich, brachte Frieder dem Mädchen einen Becher mit Tee. Er sah, dass Marie immer noch wütend war. Sie lehnte nicht ab, obwohl sie wusste, dass man sie und Frieder bereits beobachtete.
»Über das Geschwätz der alten Dummköpfe musst du dich nicht ärgern.« Frieder gab sich sehr abgeklärt. »Die lassen ihren Ärger raus, weil sie nicht mit ins Schloss durften. Ich kenne die. Kein Mensch nimmt die ernst.«
Sie standen am Fenster und sahen den Frühling über der Stadt. Das größte Gebäude war das neue Arnstädter Krankenhaus. Ein modernes Haus aus roten und gelben Backsteinen. Das Krankenhaus galt als große Errungenschaft, als Inbegriff des neuen Jahrhunderts.
»Warum arbeitest du nicht dort oder im Eisenacher Krankenhaus?«, fragte Frieder.
»Ich werde hier gebraucht«, antwortete Marie entschlossen. »Warum schleppst denn du hier die Stühle und arbeitest nicht unter deiner Schusterlampe in der Werkstatt zu Hause?«
»Als Geselle soll ich den Krüppeln das Schustern beibringen. Und außerdem bin ich hier etwas weiter weg von meinem Vater.«
»Ich glaube, du nimmst gar nichts ernst.«
»Dich schon«, antwortete Frieder, und sie wusste nicht wirklich, wie er das meinte.
»Egal, was du denkst, für mich ist die Anstalt eine heilige Sache. Es geht hier um Nächstenliebe und darum, dem Herrn Jesus zu folgen. Das gilt für alle und nicht nur für uns Schwestern und den Herrn Konsistorialrat.«
Das Mädchen sprach über fromme Sachen so selbstverständlich, wie Frieder über das Wetter. Das machte Eindruck. Er griff sich den schweren Ehrenstuhl der Fürstin, der als letzter im Saal stand, und trug ihn hinaus.
Heute ahnten sie nicht, wie ihr Leben im Stift übermorgen oder in ein paar Jahren aussehen würde. Bang vor der Zukunft war beiden. Marie bekämpfte ihre Furcht mit frommen Worten, Frieder mit Witzen.
EIN TAG IM HEIM ZWISCHEN DEN JAHREN
Wie heute war es jeden Morgen.
Die Glocken des Weckers schreckten Marie unbarmherzig auf und das Mädchen, das eben noch träumte, mochte so wenig wach werden wie alle anderen Schläfer im großen Haus. Erst das Geklapper der Töpfe aus der Küche brachte sie in die Wirklichkeit. Die Köchin musste noch früher als Marie an die Arbeit. Der Krach, mit dem sie jeden Tag begann, war wohl kein Versehen.
Marie knipste das elektrische Licht auf dem Nachttisch an. Da lag das Buch noch aufgeschlagen, das sie bis in die Träume verfolgt hatte. Marlitts »Goldelse«. Ein Geschenk einer Tante, weil die Autorin doch auch aus Arnstadt kam und »Helene vom Walde«, die Heldin, fast so verkrüppelt war wie die Pfleglinge, die Marie zu versorgen hatte. Maries Pfleglinge glichen den Romanfiguren der Marlitt nur wenig und ein glückliches Ende wie im Buch konnte Marie Xylander bei ihrer Arbeit nicht erwarten. Was wussten sie im Pfarrhaus in der fernen Rhön über die Arbeit ihrer Tochter in Arnstadt?
Marie stieg endlich aus dem warmen Bett und begann den Tag. Für die »Bangigkeit«, die sie damals am Einweihungstag gespürt hatte, war in den vergangenen Monaten keine Zeit geblieben. Aus »bange sein« war Entsetzen, Mitleid und dann das gute Gefühl einer Schwester bei der Arbeit geworden, die ihre Sache mehr und mehr verstand. Diese Marie, die sich im Halbdunkel ihrer Kammer ankleidete, die Haare zum Knoten steckte und die Bänder der weißen Schürze auf dem dunklen Kleid zur Schleife band, war in kurzer Zeit eine andere geworden.
Sie fror. Die zentrale Heizung, die man im Stift so viel lobte, begann erst jetzt mit der Arbeit. Bevor Marie die Kammer verließ, sah sie auf ein Kruzifix, das über ihrer Türe hing. Man hatte es in einem der Dörfer geschnitzt, in denen ihr Vater predigte. Ein Gebet hätte sie ihren Blick nicht genannt und doch konnte der Blick auf den Herrn nicht schaden, würde doch auch dieser neue Tag voller Ungewissheit und Überraschung sein, so wie jeder, den Marie bis heute im Stift erlebt hatte.
Die kleine Uhr, die Marie in der Schürzentasche trug, zeigte 5 Uhr 30. Obwohl es heute, zwischen Weihnachten und Silvester, keinen normalen Arbeitstag im Stift geben würde, war sie pünktlich. Sie stieg die Treppen hinab. Die modernen Lampen machten der Nacht ein Ende. Sie hob den Hausgong von dem Haken. Die Gongschläge drangen in jeden Schlafsaal und unter jedes Federbett.
Nun kam Leben ins Haus – lautes Husten und Gähnen, Fluchen und leises Lachen. Marie öffnete Tür um Tür und schaltete das Licht ein. Die ersten Kinder waren aus ihren Betten und schlurften und hinkten in die Bäder.
Schwester Gertrud betrat den Korridor. Sie trug ihre Haube und ihre Schwesterntracht am frühen Morgen so selbstverständlich korrekt, als wäre sie darin geboren. Nur die Brille mit den dicken Gläsern erinnerte daran, dass auch die leitende Diakonisse nicht vollkommen war. Sie begrüßte die Schwesternschülerin freundlich und fragte, ob alle Kinder gut aufgewacht seien. Damit übernahm die Diakonisse die Verantwortung für den Tag und glich einem Kapitän beim Betreten der Brücke.
Marie öffnete den Jungenschlafsaal, rief »Guten Morgen!« und begann ihre Arbeit.
Zuerst zog sie sanft einen schlaffen Arm zurück auf eine durchgeschwitzte Decke. Der Junge tat nur, als würde er noch schlafen. Auf Maries Berührung wartete er jeden Morgen.
Dem nächsten Jungen zog Marie die Decke vom Kopf, bewegte seine leblosen Beine und setzte ihn vorsichtig auf. Dann hielt sie ihm die Ente vor. Es war schon sehr dringend und nicht alles traf in die Flasche. Nachher würde Marie auch sein Bett frisch beziehen. Sie trug die Ente zum Ausguss. Mittlerweile kam sie mit dem Würgereiz besser zurecht als damals, als sie die Arbeit begonnen hatte. Marie wusch den großen Jungen, kleidete ihn mit Hilfe einer anderen Pflegerin an und setzte ihn in seinen Rollstuhl. Der erste Pflegling war für den Tag bereit. Andere im Saal wuschen sich selber. Marie musste nur aufpassen, dass sie es wirklich und gründlich taten.
Nun ging Marie zu den Kleinen. »Die Fürstin kommt!«, rief ihr Lisa entgegen. Lisa war ein gelähmtes Mädchen von neun Jahren. »Fürstin«, rief sie jeden Tag. Für Lisa war es wohl kein Scherz. Lisa liebte Marie. Eine alte Fürstin Marie kannte Lisa schließlich auch.
Selbst zwischen den Jahren geriet das Leben im Stift nicht aus der Ordnung. Die Ordnung dehnte sich nur und ließ mehr Lücken als sonst. Das Christfest mit seinen Träumen von Geborgenheit klang nach. Doch geputzt, gewischt und gekocht musste immer werden. Alle handwerkliche Arbeit, zu der die männlichen Pfleglinge ausgebildet wurden, geschah in diesen Tagen nur um ihrer selbst, ohne Lob oder Tadel, denn die Gesellen und Meister waren nicht im Haus.
Marie ging von Raum zu Raum und rief die Pfleglinge zur Morgenandacht. Es war fast sieben, als das Lied vom »frischen, neuen Morgen« über die Gänge schallte.
Auch Ernst Jakob, der »Kriecher«, saß dabei. Singen tat er nicht. Er hatte seinen Rollstuhl leicht Richtung Fenster gedreht und sah zu, wie Schneeflocken aus dem Morgendunkel gegen die Scheiben wehten. Ernst Jakob mochte den Winter nicht. Kälte und Schnee fesselten ihn noch härter an den Stuhl als im Rest des Jahres. Er war geboren, wie er war. Er wusste nicht, wie man geht und läuft. Dennoch träumte er jede Nacht davon.
Für diesen Tag hatte der Geselle Frieder Katt versprochen, Ernst zur »Eremitage«, einem beliebten Waldgasthaus, zu schieben. Aber jede fallende Flocke machte diesen Ausflug in das Leben fraglicher. Fast hätte Ernst darum gebetet, dass das Schneetreiben aufhöre. Aber das tat er nicht. Er war mit dem Herrgott nicht einig. Für Ernst Jakob war alles, war das ganze Leben eine einzige große Frage. Der unbenutzbare Weg vor dem Haus, die Gnade Gottes, von der die Kinder um ihn herum sangen, das kommende Jahr, das ihn auch nicht aus dem Rollstuhl befreien würde, der ewig wunde Hintern und die lächerliche Sehnsucht nach Mädchen, die in seinem Krüppelkörper tobte. All das war ihm eine bedrückende Frage nach dem Sinn seines Daseins.
Ernst Jakob war der Älteste unter den einunddreißig Pfleglingen im Marienstift. Im nächsten Jahr wurde er achtzehn. Er konnte reden wie ein großer Mann. Alle Kraft, die ihm in den Beinen fehlte, hatte sich in seinen Kopf gedrängt. Auch das tat ihm nicht gut. Ernst wusste zu genau, was war und wie es mit ihm werden würde. Nein, er sang nicht mit. Er hoffte nur, dass der Schneefall aufhöre, damit ihn Frieder am Nachmittag zum Biertrinken in die »Eremitage« schieben konnte.
Sie sangen »Oh Gott, du schöner Morgenstern«.
Der kleine Gerhardt, der sich an Ernsts Rollstuhl festhielt, krähte am lautesten. Der »Kriecher« musste lachen. Etwas trieb Ernst dazu, dem einarmigen Jungen über das schwarze Haar zu streichen. Gerhardt lächelte zurück.
Alle Plätze im Saal waren besetzt. Wie immer standen die ungelenken Rollstühle im Weg. Marie, nicht nur Lisa nannte sie »die Fürstin«, saß wie immer neben ihrem Lieblingspflegling. Wer Lisa nicht kannte, konnte denken, das blonde Mädchen säße zum Spaß im Rollstuhl. Ernst Jakobs Rollstuhl stand gleich dahinter, der Schwesternschülerin Marie ganz nah. Das war kein Zufall.
An diesem Morgen las Schwester Gertrud den Bibeltext. Es war die Geschichte der Heiligen drei Könige. Dann sagte sie dazu ihre Gedanken. Sie redete vom Schenken, vom Nehmen und vom Geben. Sie sagte, das Schenken mache den Schenkenden glücklich. Die Kinder teilten die Meinung der Diakonisse nicht. Niemals würden sie auch nur eines ihrer wenigen Weihnachtsgeschenke wieder hergeben.
Das Frühstück begann eine viertel Stunde später als üblich. Wie jeden Tag erwartete die Helferinnen und Schwestern nun Schwerstarbeit. Sie fütterten Haferbrei, schenkten Hagebuttentee aus, wischten wieder und wieder Pfützen vom Tisch. Sie schmierten, schnitten und reichten Brote, stopften Mäuler, säuberten Mäuler, klopften auf schmale, krumme Rücken, um krampfende Kehlen vor dem Ersticken zu bewahren.
Auch Marie arbeitete ohne Pause. Sie trug für ihren Tisch mit sieben Kindern die Verantwortung. Nicht jedes musste sich füttern lassen. Die Geschickten halfen den Ungeschickten so gut sie konnten. Aus der Ruhe brachte Marie nach den vergangenen Monaten beinahe gar nichts mehr. Marie rief und schimpfte nicht. Meistens lächelte sie sogar. Das war nicht an jedem Tisch so.
Schwester »von«, die mit Marie den Morgendienst teilte, hatte es mit den Kindern schwer, obwohl der Herr Christus gesagt hatte: »Lasset die Kinder zu mir kommen und wehrt ihnen nicht.« Wahrscheinlich hatten sich die Kinder, die Jesus gesegnet hatte, nicht mit Apfelgriebsen und unflätigen Worten beworfen. Jedenfalls hatte der Herr Christus einst mehr Geduld besessen als sie. Das eine oder andere ihrer lauten »lieben Kinder« hätte die Frau in der dunklen Diakonissentracht gern vor die Türe gesetzt. Schwester »von« hatte es schon an den Krankenbetten der Erwachsenen im Eisenacher Diakonissenhaus schwer gehabt. Man hatte sie nicht zufällig ins ferne Arnstadt entsandt. Nun kämpfte sich die Tochter aus einem verarmten Landadelshaus betend und manchmal auch still für sich fluchend durch den Alltag. Manchmal hasste sie sich selber, wenn sie lieblos war oder neidisch, etwa auf Marie, der die Zuneigung der Leute im Stift nur so entgegenflog.
Die Arbeit am Tisch hielt Marie nicht davon ab, immer wieder zur Türe zu sehen. Auch heute, zwischen den Jahren, würde Frieder kommen.
»Dein Prinz ist da!«, rief Lisa. Das Mädchen hatte Frieder zuerst gesehen. Alle kicherten.
Marie errötete. Schwester »von« rief laut: »Ruhe!«
Der Vormittag im Haus ging beinah alltäglich dahin. In den Werkstätten, bei den Bürstenbindern und Schustern wurde etwas öfter gelacht als sonst und die Pausen dauerten länger. Die Stuhlflechter trieben es besonders laut. Einmal trat der Konsistorialrat aus seinem Büro und sah nach dem Rechten. Dann ging er eine Runde durchs Haus und fünf Minuten lang herrschte Stille.
An diesem Tag ruhte die Schule. Die unbeschäftigten Schüler horchten neidisch auf das Pochen und Hämmern, das aus den Werkstätten tönte, denn dort hatten sie wenigstens etwas zu tun.
Behandelt, gepflegt und geübt wurde auch zwischen den Jahren. Massagen und elektrische Stimulationen mussten regelmäßig angewendet werden. Darauf legte der Anstaltsarzt größten Wert.
Auch Lisas Behandlung stand an. Wie immer musste Marie das Mädchen begleiten. Lisa konnte sich nicht an den festen Griff des Masseurs und das Zucken der Muskeln, wenn der Reizstrom floss, gewöhnen. Ihr Wimmern und Heulen war nicht zu ertragen. Lisa wusste, wie sie ihre Fürstin ganz für sich haben konnte. Stand Marie neben ihr, war alles nicht so schlimm. Der Masseur tat seine Arbeit, Lisa wimmerte nur leise und Marie hielt ihr die Hand. Auch die Schwesternschülerin hatte dabei etwas Zeit für sich.
In ihrer Schürzentasche steckte der Weihnachtsbrief des Vaters. Sie spürte das Papier. Die Sätze hätte sie auswendig aufsagen können. Maries Vater schrieb:
Wir alle haben unsere Pflichten vor Gott und den Nächsten zu erfüllen. Dafür sind wir auf der Welt. Deine Pflicht ist die tätige Nächstenliebe. Fast könnte ich dich darum beneiden, wenn du uns schreibst, wie dankbar deine Pfleglinge (zuvorderst deine Lisa) sind. Grüße das arme Mädchen von deinen Eltern und schenke ihr etwas von den Lebkuchen, die dir deine Mutter zusandte. Mit solcher Dankbarkeit für meinen Pfarrdienst kann ich im Amt hier in den Bergen nicht rechnen. Die Gottlosigkeit nimmt auch hier oben Jahr um Jahr zu.
Aber ich will nicht klagen, freue mich nur, dass du, liebe Tochter, deinen Weg als Diakonisse gehen willst und damit dein Zeugnis ablegst vor dem Herrn und der Welt. Gott segne dich im neuen Jahr 1906 im Arnstädter Marienstift! Der Tag deiner Einsegnung rückt näher. Im Sommer dann werden wir von unseren Bergen »steigen« und dich besuchen.
Ein Gefühl, gemischt aus Scham und Ärger, gärte in Marie. Der Brief machte ihr schon seit Tagen das Herz schwer. Hatte irgendjemand aus dem Stift ihrem Vater über Frieder und sie geschrieben? Hatte Schwester »von« den Eltern eine besorgte Mitteilung gemacht? Dabei war doch nichts vorgefallen, wofür Marie sich schämen müsste. Sie wusste nicht, was sie antworten sollte. Vielleicht würde sie eine Postkarte zum neuen Jahr hinauf in die Rhön schicken.
Lisas Behandlung war vorbei. Sie gingen zurück in den Gemeinschaftsraum. Lisa beschäftigte sich mit Handarbeiten, Schwester Marie kümmerte sich um wunde Stellen am Rücken eines anderen Kindes. Gebraucht wurde Marie in diesem Haus immer. Die Arbeit schreckte sie nicht.
Als die Glocke zum Mittag läutete, hatte das Leben im Haus wieder Pünktlichkeit.
Es gab Reste vom Weihnachtsessen, kein Fleisch mehr, aber immerhin Klöße und Bratensoße und, weil das nicht ausreichte, eine Kohlsuppe dazu, die den Kindern die Mägen füllte. Noch immer, nach all den Monaten, aßen die Pfleglinge so, als könnten sie nicht daran glauben, auch am nächsten Tag satt zu werden.
Das Mittagessen brachte für Marie wieder schwere Arbeit. Danach hatte sie etwas Zeit. Die Kinder hielten Mittagsschlaf, die Großen spielten auf den Gängen. Eine Stunde lang durfte Marie sich zurückziehen. Es gab eine ruhige Ecke im Haus nahe der Schusterei, in der Marie fast täglich zu finden war. Die »Goldelse« der Marlitt in der Hand saß sie dort am Fenster.
Als sie plötzlich beim Namen gerufen wurde, war es nicht Frieder, der nach ihr suchte. Schwester Gertrud stand vor ihr. Marie wagte nicht, der Diakonisse in die Augen zu sehen. Gewiss wusste sie alles und mehr.
Schwester Gertrud sagte: »Marie, ich werde bald ganz offiziell mit dir reden. Du musst dich entscheiden, wie es weiter geht. Sage jetzt nichts, sondern denke ruhig darüber nach. Geh in dich und bete um Gottes guten Rat. Dass ich mit dir sehr zufrieden bin, weißt du. Und dass wir hier im Stift eine Schwester wie dich brauchen, das weißt du auch. Nur verhätschle mir die Lisa nicht zu sehr! Sie wickelt dich nur so um die Finger. Und – halte Abstand zur Schusterei. Es wird sehr viel geredet im Stift. Du bist ein gutes Mädchen. Ich weiß das. Verzicht macht uns frei für den Dienst. Denke darüber nach, mein Kind! Verzicht und Pflichterfüllung ist unsere Antwort auf Gottes Erbarmen.«
Schwester Gertrud sah Marie bis ins Herz. Sie meinte es gut mit ihr. Dennoch ärgerte Marie sich darüber wie Gertrud Mitleid und Vorwurf mischte. Marie brauchte kein Mitleid. Marie hatte sich auch nichts vorzuwerfen. Sie liebte was sie tat – und sie liebte Frieder Katt. Fast war das ein und dasselbe. Jetzt sah sie Schwester Gertrud an. Die Vorgesetzte verstand das Mädchen und wusste, was sie erwartete.
Frieder Katt hatte als Geselle auch diesen Vormittag zwischen den Jahren bei den Lehrlingen verbracht. Als er aus der Werkstatt trat, war die Oberschwester längst weitergegangen. Marie reichte ihm heute nicht einmal die Hand.
»Was ist?«, fragte er, und sie antwortete nur: »Gar nichts.« Das konnte alles heißen.
Sie standen nebeneinander am Fenster. Draußen fiel immer noch Schnee.
»Ich werde trotzdem mit Ernst bis zur Eremitage gehen«, sagte Frieder. »Ich hab es ihm versprochen. Der Ernst tut mir leid.«
»Die Pfleglinge brauchen kein Mitleid, sondern Hilfe. Hörst du nicht zu, wenn Petri predigt? Seit wann tut Ernst Biertrinken gut?« Maries Stimme klang hart. Frieder wagte nicht, zu fragen, was wirklich los sei. Er wartete ab.
»Gertrud will mit mir sprechen«, sagte Marie endlich. »Sie will, dass ich mich entscheide. Sie will, dass ich mich einsegnen lasse. Irgendjemand hat meinem Vater über uns geschrieben. Er drängt mich auch.« Manchmal passte Maries Stimme nicht zu ihrem kindlichen Gesicht.
Die Mittagsstunde war vorbei. Überall regte es sich wieder.
Über den Gang quietschte ein Rollstuhl. Es war Ernsts dreirädriger Wagen. Er war überpünktlich.
»Ehe es noch dicker kommt«, rief er. »Oder schaffst du es nicht mit mir bei dem bisschen Schnee?«
Frieder und Ernst brachen auf.
Für die anderen Bewohner des Stiftes begann ein ruhiger Nachmittag. Die Mädchen stickten und häkelten. Drei von ihnen hielten mit Armstümpfen die Wolle. Die eine Hand arbeitete für zwei. Marie hatte sich an solche kleinen Wunder lange gewöhnt.
Ein guter Nachmittag ohne Krämpfe oder epileptische Anfälle. Eine gute Zeit im warmen Haus, ohne Hunger, ohne Verspottung.
Der Höhepunkt des Tages war die Singstunde. Noch einmal wurden Weihnachtslieder angestimmt. Die »Stille Nacht« klang kurz vor Silvester schon seltsam.
»Ännchen von Tharau« sang sich leichter. »Ännchen von Tharau hat wieder ihr Herz auf mich gerichtet in Liebe und Schmerz.« Liebe und Schmerz waren heimliche, große Themen im Haus, über die nur gesungen, nie laut geredet wurde.
Um 6 Uhr läutete der Gong zum Abendbrot. Alle saßen an ihren Plätzen. Bis auf Ernst Jakob.
»Sind die noch immer unterwegs?«, fragte Fräulein »von« laut durch den Saal. Jeder hier wusste die Antwort. »Man sollte zukünftig solche Freiheiten nicht dulden!« Das sagte Fräulein »von« zwar etwas leiser, doch noch immer laut genug, dass Schwester Gertrud es hören musste.
Ernst und Frieder kamen endlich zurück. Sie versuchten, sich während der Abendandacht in die hinterste Reihe zu schleichen. Der Gesang verstummte. Fräulein »von« entfuhr ein fassungsloses »Skandal!« Die Reifen von Ernsts Rollstuhl verdreckten unübersehbar die Dielen. Frieder bereute, nicht gleich auf der Türschwelle des Stiftes umgekehrt zu sein. Er war hier nur Gast, nur der Geselle vom Schustermeister. Er musste zu dieser Stunde nicht hier sein. Wie ein Schuljunge saß er nun da. Er blätterte sein Gesangbuch vor und zurück. Kaum, dass er es wagte, kurz zu Marie zu sehen.
Nach der Andacht rief die Oberschwester Ernst Jakob zu sich. Sie saß an ihrem Schreibtisch. Ernst Jakobs Rollstuhl hatte kaum Platz in ihrem Arbeitszimmer. Sie roch deutlich, dass ihr Pflegling getrunken hatte. Der ganze Raum stand voll von Bier- und Glühweingestank. Zwar wusste die Oberschwester, dass Ernst ihre Ermahnungen an sich abfließen lassen würde, doch hielt sie ihre Strafpredigt trotzdem. Sie zitierte die Hausordnung Wort für Wort und drohte mit Konsequenzen, denn der erste Vorfall dieser Art war es nicht und ein ernstes Gespräch mit Konsistorialrat Petri unvermeidlich. »Willst du wirklich zurück nach Stadtilm? Willst du uns wirklich verlassen?« Ernst verneinte.
Dann ließ sie ihn gehen. Schwester Gertrud hatte dem verkrüppelten Jungen gesagt, was notwendig schien – nicht mehr. Würde sie ihr Mitleid jemals beherrschen?
Der vergangene ruhige Nachmittag im Heim hatte Marie viel Zeit zum Nachdenken gelassen. Nun wusste sie, was sie wollte: weder Mitleid noch Nachsicht.
Als Oberschwester Gertrud Ernst Jakob ermahnte, saßen Marie und Frieder in der verglasten Veranda des Hauses. Jedermann sollte sie sehen. Das hatte Marie entschieden ohne Frieder lange darum zu fragen. Dieser Auftritt geschah aus Trotz. Frieder aber, den sehr wohl das schlechte Gewissen plagte, konnte Maries Willen nichts entgegensetzen.
»Musste das sein?«, fragte sie ihn nicht einmal leise. »Konntest du mit Ernst nicht pünktlich sein? Und warum hat Ernst so viel getrunken? Sie werden ihn rauswerfen.«
»Es gab Ärger«, antwortete Frieder.
»In der Eremitage?«
»Sie haben uns vorführen wollen und Ernst hat mitgespielt.«
»Wie denn?«, fragte Marie. »Warum hast du nicht besser aufgepasst?«
»Da waren ein paar Burschen aus meiner alten Schule. Ich weiß nicht, warum sie schlechte Laune hatten. Als ich Ernst in die Gaststube schob, merkte ich sofort, wie sie uns ansahen. Der Rollstuhl machte Dreck und der Wirt fluchte. Irgendjemand sagte: ›Was will der Krüppel hier?‹ Ich dachte: schnell ein Bier und weg. Dann ging es aber erst los. Sie machten Stimmung. Ob ich nur noch mit Krüppeln umgehe, fragte einer und ob ich jetzt vielleicht selbst schon einer von denen wäre. Im Kopf oder so. Ich habe nichts gesagt, Marie, ich wollte zahlen und raus, aber dann brachten sie Ernst einen Schnaps und noch ein Bier und ließen ihn hochleben. Und Ernst sieht mich an und sagt: ›So billig besaufe ich mich nie wieder!‹, und kippt einen nach dem andern.«
»Und du hast mitgetrunken?«
»Nicht viel.«
»Und dann?«
»Dann wollten sie sehen, wie er kriecht.«
»Und dann?«
»Habe ich auf den Tisch geschlagen.«
»Und dann?«
»Hat uns der Wirt rausgeworfen.«
Es war bitterkalt in der Glasveranda. Lange hielten Marie und Frieder es hier nicht aus.
Da traf ein strenger Blick Schwester Gertruds das Paar. Frieder ging und Maries Trotz schlug um in Bedauern.
DIE GUTEN JAHRE
»Gute Jahre«, so würden die Leute vom Stift und mit ihnen die halbe Welt die Zeit bis zum Krieg nennen. Die Erinnerung sollte sie verklären. Auch diese Zeit war voll mit Streit und Plage. Bessere Jahre jedoch, damit hatte die Erinnerung Recht, folgten den »Guten« nicht. Solange die Welt noch die Alte war, wurde gebetet und geheuchelt wie immer. Illusion und Ernüchterung tanzten im Kreis. Noch blieb alles, wie es war. »Oben« blieb dort, wo es meinte hinzugehören. »Unten« kam von seinem angeborenen Platz nicht weg. Arm und reich, perfekt und verkrüppelt, blöde und schlau, fromm und gottlos, alles schien fest dort verwachsen, wo es immer schon war. Doch der heile Schein trog. Die Katastrophen wurden längst vorbereitet. Die »guten Jahre« waren wie ein Ausatmen. Einatmen würde der gemeine Soldat bald Giftgas, das über Schlachtfeldern wabert, und sterbend würde er es auskotzen in den großen Wirbel, in dem die »guten Jahre« und er untergingen.