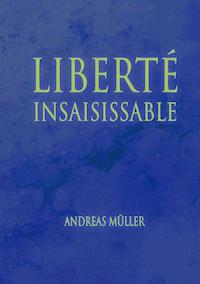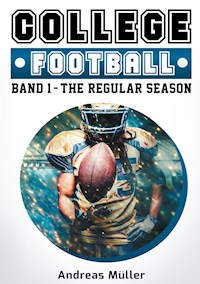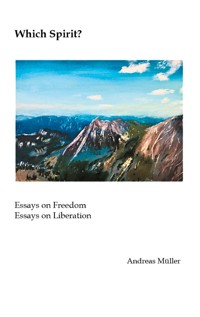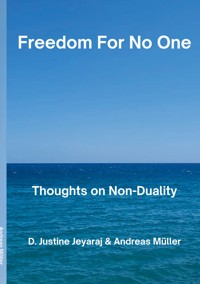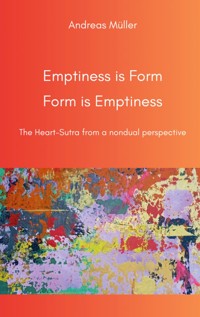Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: hep verlag
- Kategorie: Bildung
- Serie: hep LernCoaching
- Sprache: Deutsch
Andreas Müller verknüpft in gewohnt spritziger Weise wissenschaftliche Erkenntnisse mit praktischen Erfahrungen. Er entwickelt vor diesem Hintergrund eine Lernkultur, die sich am Ziel orientiert, die Selbstkompetenz der Lernenden zu fördern. LernCoaching wird dabei zu einer Schlüsselqualifikation von Lehrern, die nicht mehr Lehrer sind, in einer Schule, die nicht mehr wie Schule ist.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 83
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Andreas Müller
Eigentlich wäre Lernen geil
Wie Schule (auch) sein kann: Alles außer gewöhnlich
Reihe: LernCoaching
ISBN Print: 978-3-03905-926-3
ISBN E-Book: 978-3-03905-915-7
2. Auflage 2013
Alle Rechte vorbehalten
© 2013 hep verlag ag, Bern
www.hep-verlag.com
Inhalt
LernCoaching – eine andere Schule gestalten
1 »Ich verhelfe ihm zum Erfolg, dafür bin ich da.«
1.1 Spuren lesen
1.2 Den Erfolg organisieren
1.3 Eigentlich wäre Lernen geil
1.4 Unfall in Hinterindien
1.5 Katz und Maus
2 Wenn die Schule wüsste, was die Schule weiß.
2.1 Gemeinsame Antworten finden
2.2 Einander zum Erfolg verhelfen
2.3 Dem Zufall nachhelfen
3 Vielfalt ist nur dort ein Problem, wo Einfalt herrscht.
3.1 Lernen ermöglichen
3.2 Vielfalt statt Einfalt
Quellen
LernCoaching – eine andere Schule gestalten
Noch vor wenigen Jahren bekam virtuell eins auf den Mund, wem »geil« über die Lippen rutschte. Denn so etwas sagte man nicht.
Mittlerweile hat das Wort von der Gasse aus längst die Salons und Teppichetagen erobert. Wer etwas toll findet, findet es geil.
Der Aufstieg von »geil« in Richtung höherer sprachlicher Weihen ist ein kleines Beispiel dafür, wie die Zeiten und Ansichten sich ändern. Der Wandel manifestiert sich selbst in den filigranen Verästelungen des täglichen Lebens. Eben beispielsweise in der sprachlichen Ausdrucksweise. Das heißt: Die vielfältigen und tief greifenden Veränderungen in Wirtschaft und Gesellschaft machen vor nichts Halt.
Teil dieser Gesellschaft ist auch die Schule. Auch sie muss sich deshalb schleunigst wandeln. Dabei reicht es nicht, Gutes einfach plötzlich geil zu finden. Die Veränderungen müssen weiter gehen. Und tiefer.
Das heißt: Die Schule muss ihre Gestalt in einer Weise verändern, dass es auch Grund gibt, schulisches Lernen geil zu finden. Denn sowohl die individualempirischen wie die offiziellen Daten zeigen: Die Begeisterung fürs Lernen nimmt mit zunehmender Schuldauer ab. Es wird ungeil.
Dabei wäre gerade das Gegenteil wichtig: Die Freude am Lernen müsste wachsen, müsste sich entfalten. Denn wer sein Leben erfolgreich gestalten will, muss lernen können. Und wollen. Und muss es geil finden.
Das wäre gar nicht so schwierig. Denn eigentlich wäre Lernen geil. Die Frage ist nur, was die Schule daraus gemacht hat. Welches Verständnis liegt dem zugrunde, was in der Schule »lernen« genannt wird?
Die Lehrer spielen die Hauptrolle. Sie bilden eine geradezu symbiotische Einheit mit dem »Stoff«. Sie sagen, was zu gehen hat. Und wie es zu gehen hat. Sie sagen, was gut ist. Und was schlecht.
Daneben kann es nur Statisten geben. Eine Rolle, die auf Dauer lediglich für sehr schülerhafte Schüler die Bretter dieser Welt bedeuten kann.
LernCoaching ist deshalb mehr als eine Methode. Viel mehr. Es ist eine grundsätzlich andere Betrachtungsweise dessen, was in der Schule »lernen« genannt wird. Und das führt zu einer ganz anderen Rollenverteilung. Zu einer anderen Lernkultur. Zu einer anderen Schule. Zu einer Schule, in der Lernen geil sein kann.
Andreas Müller
1
»Ich verhelfe ihm zum Erfolg, dafür bin ich da.«
Darren Cahill
Coach von Andre Agassi
1.1 Spuren lesen
Das Image von Lernen ist zwiespältig. Gelinde gesagt! Häufig ist es kombiniert mit Modalverben. Meistens mit »müssen«. Selten mit »wollen«. Und kaum je mit »können« oder »dürfen«. Bei schulischem Lernen sinkt das Image noch ein paar Treppenstufen tiefer in den Keller.
Image lässt sich definieren als das, was bei der Nennung eines Begriffs an Gedanken und Emotionen hochkommt. Nimmt man diese Definition zum Maßstab, dann heißt Lernen zuerst und vor allem: auswendig lernen. »Wenn man die Ursachen für die Probleme des Schullernens analysiert, stellt man wiederholt fest, dass in der Schultradition hartnäckig gewisse Auffassungen von Wissen und Lernen existieren, die vielfach zur heutigen wissenschaftlichen Denkweise in Widerspruch stehen« (Lehtinen 1997).
Die Schule hat ihre Tradition von Kanzel und Kasernenhof erfolgreich durch alle Stürme der Zeit retten können. Die Muster gleichen sich jedenfalls: Jemand steht vorne. Und dieser Jemand sagt, was Sache ist. Jene, die hinten sitzen (oder stehen), harren mehr oder weniger geduldig der Dinge, die da kommen mögen. Dann werden sie in geschlossener Marschkolonne ins Manöver geführt. Oder in strenger Liturgie durch die Weihrauchnebel des Gottesdienstes.
Wüste der Beliebigkeit
Die schulischen Aktivitätsmuster entsprechen zumeist dieser Tradition. Als Folge davon findet das, was fälschlicherweise Lernen genannt wird, in sehr engen Bahnen statt. In einem Mix von Marschkolonne und Liturgie steuert es auf einen Punkt am Horizont hin, den nur der Lehrer kennt. Wenn überhaupt. Und sonst endet es halt irgendwo in der Wüste der Beliebigkeit.
Handlungsleitend sind zwar offiziell die Lehrpläne. LEHRpläne. Ein Lehrplan ist die Sammlung von ganz wichtigen Dingen, die zu lehren sich ein Lehrer verpflichtet fühlen muss. Sie sind so wichtig, dass sie einer hohen Abstraktion bedürfen. Das wiederum bedarf dann der Interpretation. Und weil zu viele Dinge so ungemein wichtig sind, bedarf es dann auch eines sogenannten Mutes zur Lücke.
Im Klartext heißt das: Jeder Lehrer kann mehr oder weniger das tun, was er will. Oder was er denkt, was die Kollegen denken, was wichtig sei. Oder wofür es praktische Arbeitsblätter gibt. Oder was so wichtig klingt, dass es auch dem eigenen Ego ein bisschen schmeichelt. Das heißt weiter: Lehrpläne und die Aura der Erhabenheit, mit der sie offiziell umgeben werden, sind das eine. Ihre Umsetzung in den schulischen Alltag ist hingegen etwas ganz anderes. Und vor allem: Lehrpläne sind äußerst praktisch, wenn es darum geht zu begründen, weshalb etwas nicht geht.
Geheime Lehrpläne
Nicht zu vergessen: Es gibt ja auch noch die inoffiziellen Lehrpläne. Das sind die Prüfungen, die sich irgendwo am Horizont wie drohende Gewitterwolken vor die Sonne schieben und die Sicht verdunkeln. Die Sicht aufs eigentliche Lernen.
Prüfungen (und die Noten, die es dafür gibt) determinieren das Verhalten aller Beteiligten. Aller!
Zwar gibt es unzählige Formen und Varianten von Tests und Prüfungen. Drei Grundvarianten haben sich jedoch etabliert:
1.) Prüfungen innerhalb eines Klassenverbandes: Sie dienen der Selektion. Je schwieriger und komplizierter, desto selektiver ist die Sache. Desto mehr Verlierer sitzen in den Bänken. Und als desto »strenger« gilt der Lehrer. Das heißt: Prüfungen sind ein mehr oder weniger subtil inszeniertes Machtspiel. Macht erzeugt Ohnmacht (häufig). Oder Widerstand (zunehmend). Oder aufwandökonomische Bewältigungsstrategien wie Bulimie-Lernen und Bescheißen (sehr häufig). Das Ziel schulischen Lernens heißt deshalb meistens: Prüfungen einigermaßen schadlos überstehen.
2.) Abschlussprüfungen: Die Lehrpersonen basteln aus dem »behandelten Stoff« einen Verschnitt. Die inszenierte Wichtigkeit hebt selbst das dürftigste Aufgabenblättchen in den pädagogischen Adelsstand. Ein anderer Aspekt: Zu viele Versager bei Abschlussprüfungen werfen ein schlechtes Licht auf den Lehrer. Deshalb werden die Lernenden entsprechend gedrillt. Gesucht sind Wiederkäuer. Und die leitende Fragestellung heißt (bis weit in die Erwachsenenbildung hinein): Was kommt in der Prüfung?
3.) Externe Prüfungen: Nicht immer können die Lehrpersonen die Prüfungen für ihre Schüler bedürfnisgerecht zusammenschustern. Manchmal finden sie halt »draußen« statt (z. B. Aufnahmeprüfungen) oder kommen von dort (z. B. Vergleichstests). Aber auch dieses Problem lässt sich lösen. Schließlich hat es in den Vorjahren schon Prüfungen gegeben. Die entsprechenden Aufgaben werden zu Bestsellern. Und das Büffeln kann beginnen. »Prüfungsvorbereitung« heißt das in der schulischen Sprachregelung.
Orientierung an Kommastellen
Dezidiert äußert sich Erno Lehtinen: »Den Schülern wird die generelle Auffassung vermittelt, dass das Ziel der Schularbeit darin besteht, sich, egal mit welchen Mitteln, um gute Noten und nicht um das Verstehen einer Sache zu bemühen« (Lehtinen 1997). Damit ist klar: Die äußeren Anforderungskriterien determinieren das schulische Denken und Handeln. Tue dies, dann kriegst du das. Der Schüler weiß: Ich brauche eine genügende Note. Wenn er aber gefragt wird, was das denn inhaltlich bedeute, was er gelernt haben werde, dann hat er nicht den Dunst vom Schimmer einer Ahnung. Und: Es ist ihm eigentlich auch wurst. Denn es ist offensichtlich gar nicht relevant: Die Mutter fragt nach der Note. Der Großvater will wissen, was er im Zeugnis habe. Der Bruder brüstet sich, weil er einen halben Punkt besser ist in Mathe. Die weiterführende Schule verlangt einen gewissen Notenschnitt. Wo man hinhört und hinschaut: Noten sind der Kompass auf dem Weg durch den schulischen Berechtigungsdschungel. Und diese Orientierung an Noten und Kommastellen verhindert eigentliches Lernen. Denn Noten sind meist inhaltsleer – eine Art Potemkin’scher Dörfer.
Eine Kulisse – und nichts dahinter. Denn eben: Kaum ein Lernender kann wirklich sagen, für welche Lernergebnisse eine bestimmte Note wirklich steht. Und die Lehrer wissen es auch erst, wenn sie die Punkte der Gauß’schen Kurve zugeordnet haben.
»Kulissenlernen« bezeichnet deshalb Erno Lehtinen als typisch für die Schulsituation. »Schüler und Studenten haben effektive Strategien erworben, die es ihnen ermöglichen, die äußeren Anforderungssituationen der Schule zu bewältigen, ohne ein gründliches Verständnis der zu lernenden Inhalte erreicht zu haben« (Lehtinen 1997). Kommt hinzu: Diese äußeren Anforderungssituationen werden zumeist nicht als Lern-, sondern als moralische Kontrolle wahrgenommen.
Ein Kernproblem ortet Erno Lehtinen deshalb im Umstand, »dass die traditionellen Konventionen, die der Sozialisations- und Selektionsfunktion der Schule gedient haben, als Folge der raschen Entwicklung der Gesellschaft heute in einen radikaleren Widerspruch mit derjenigen Aufgabe der Schule geraten sind, die mit dem Erwerb von Wissen und Handlungsfähigkeiten zusammenhängt, wie sie im Arbeitsleben und anderswo im sozialen und kulturellen Leben gebraucht werden« (Lehtinen 1997). Und Reusser/Reusser-Weyeneth doppeln nach: »Trotz permanenter Klagen über eine immer erdrückender werdende Stofffülle hat sich das Bild von Schule als einer Stoffvermittlungs- und Wissensanstalt bis in die jüngste Vergangenheit kaum wesentlich verändert« (Reusser/Reusser-Weyeneth 1997). »Halt, halt«, werden die Gralshüter des Systems einwenden: »So schlecht ist unser Schulsystem gar nicht.« Stimmt. Aber reicht das? »Nicht so schlecht sein«, ist das der Maßstab?
Einer Spur folgen
Die Menschen der Frühzeit mussten in der Lage sein, Spuren zu deuten. Spuren führten zu einer Beute. Oder sie rieten zur Flucht. Wer Spuren lesen konnte, mehrte seine Chancen, auf der Sonnenseite des Lebens zu stehen. Daran hat sich eigentlich nichts geändert. Denn: »Einer Spur folgen«, dort liegen die etymologischen Wurzeln von »Lernen«.