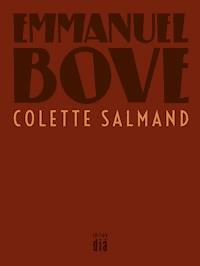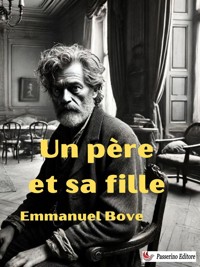Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edition diá Bln
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Werkausgabe Emmanuel Bove
- Sprache: Deutsch
Pierre Neuhart, ein kleiner Unternehmer um die vierzig, der sich auf den Abbau von Steinbrüchen konzentriert hat, lernt auf einer Soiree die siebzehnjährige Schönheit Eliane kennen und verliebt sich rettungslos in sie. Bereits nach kurzer Zeit zieht sie zu ihm, nicht zuletzt um dem Zusammenleben mit ihrer Mutter zu entrinnen. Die falschen Vorstellungen, die sich der eine jeweils vom anderen macht, verkehren die Liebesgeschichte bald in eine Leidensgeschichte, zumal die Abhängigkeit Pierres von Eliane in dem Maße wächst, wie sie ihn abfällig behandelt, schikaniert und dominiert. Nach einer tragikomischen Eifersuchtsszene weist er sie aus seiner Wohnung; Eliane geht, offensichtlich ungerührt. Doch nun ist Pierre Neuhart erst recht verloren: Eliane wird jetzt vollends zu seinem Lebensinhalt. Sie und ihre Liebe in grotesker Weise stilisierend, gerät er immer tiefer in Wahnvorstellungen und verkommt zusehends. Nach einigen Jahren trifft er Eliane zufällig in einer elenden Kneipe wieder. Sie ist ebenfalls ziemlich abgerissen, eine gescheiterte Schauspielerin. Sie hat auch jetzt nicht das geringste Interesse für ihn. Eine typische Bove-Geschichte, schlimm und faszinierend. "Eine Synthese aller Elemente meines Werkes." (Emmanuel Bove) Zum Weiterlesen: "Emmanuel Bove. Eine Biographie" von Raymond Cousse und Jean-Luc Bitton ISBN 9783860347096
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 143
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Table of Contents
Über dieses Buch
[Titelei]
[Frontispiz]
1
2
3
4
5
6
7
[Anzeige 1]
[Anzeige 2]
Impressum
Über dieses Buch
Pierre Neuhart, ein kleiner Unternehmer um die vierzig, der sich auf den Abbau von Steinbrüchen konzentriert hat, lernt auf einer Soiree die siebzehnjährige Schönheit Eliane kennen und verliebt sich rettungslos in sie. Bereits nach kurzer Zeit zieht sie zu ihm, nicht zuletzt um dem Zusammenleben mit ihrer Mutter zu entrinnen. Die falschen Vorstellungen, die sich der eine jeweils vom anderen macht, verkehren die Liebesgeschichte bald in eine Leidensgeschichte, zumal die Abhängigkeit Pierres von Eliane in dem Maße wächst, wie sie ihn abfällig behandelt, schikaniert und dominiert. Nach einer tragikomischen Eifersuchtsszene weist er sie aus seiner Wohnung; Eliane geht, offensichtlich ungerührt.
Doch nun ist Pierre Neuhart erst recht verloren: Eliane wird jetzt vollends zu seinem Lebensinhalt. Sie und ihre Liebe in grotesker Weise stilisierend, gerät er immer tiefer in Wahnvorstellungen und verkommt zusehends.
Nach einigen Jahren trifft er Eliane zufällig in einer elenden Kneipe wieder. Sie ist ebenfalls ziemlich abgerissen, eine gescheiterte Schauspielerin. Sie hat auch jetzt nicht das geringste Interesse für ihn.
Eine typische Bove-Geschichte, schlimm und faszinierend.
»Eine Synthese aller Elemente meines Werkes.« (Emmanuel Bove)
Mehr zum Autor und seinem Werk unter www.emmanuelbove.de
Der Autor
1898 als Sohn eines russischen Lebemanns und eines Luxemburger Dienstmädchens in Paris geboren, schlug sich Emmanuel Bove mit verschiedenen Arbeiten durch, bevor er als Journalist und Schriftsteller sein Auskommen fand. Mit seinem Erstling »Meine Freunde« hatte er einen überwältigenden Erfolg, dem innerhalb von zwei Jahrzehnten 23 Romane und über 30 Erzählungen folgten.
Nach seinem Tod 1945 gerieten der Autor und sein gewaltiges Œuvre in Vergessenheit, bis er in den siebziger Jahren in Frankreich und in den achtziger Jahren durch Peter Handke für den deutschsprachigen Raum wiederentdeckt wurde. Heute gilt Emmanuel Bove als Klassiker der Moderne.
Der Übersetzer
Thomas Laux, geboren 1955 in Düsseldorf. Studium der Germanistik und Romanistik, Staatsexamen, Promotion 1987 in Romanistik. Literaturkritiker und Übersetzer aus dem Französischen (u. a. Bove, Henri Thomas, Hervé Guibert, Jacques Chauviré).
Die Liebedes Pierre Neuhart
Roman
Aus dem Französischenvon Thomas Laux
Edition diá
1
Pierre Neuhart erhob sich abrupt und durchmaß mit großen Schritten sein Büro. Das geräumige Zimmer lag im ersten Stock eines altes Mietshauses an der Place Saint-Sulpice. Die Wohnungen, allesamt ohne Wasser und Gas, waren in Geschäftsräume umgewandelt worden. Man stieß in diesem Raum auf Pappordner, verschlissene Sessel und einen großen Tisch, der von Papierkram, Tintenfässern, Linealen und Leimtöpfen bedeckt war. Auf einem einbeinigen Tischchen am Fenster stand eine schwere, altmodische Schreibmaschine, deren solides und unpraktisches Äußere an die ersten Automobile denken ließ. An der Wand war in Kopfhöhe das Telefon installiert. Ein paar Plakate, die so schludrig angebracht waren, dass man zwischen ihnen und der Wand einen Arm hätte durchstecken können, schmückten den Raum.
Pierre Neuhart war nervös, denn er war an diesem Abend bei Madame Aspi eingeladen. Obwohl er einerseits bedauerte, die Einladung angenommen zu haben, war er andererseits auch von dem Gedanken angetan, sich ein wenig entspannen, in eine neue Welt eindringen zu können, das Milieu zu wechseln. Bevor er ausging, wollte er seine Korrespondenz erledigen. Er schob sie immer bis zur letzten Minute vor sich her, denn Geschäftsbriefe waren ihm eine Last.
– Simone, notieren Sie bitte, sagte er zu der Angestellten, mit der er sein Büro teilte.
– Es ist fast sechs. Und um sechs gehe ich ganz bestimmt, antwortete sie. Warum denken Sie nicht etwas früher an Ihre Korrespondenz?
– Sie tun, was ich Ihnen sage. Wenn Sie nicht zufrieden sind, dann tut’s mir leid. Sind Sie so weit? Gut. Adresse: Monsieur Muller, Rue du Rempart, Maubeuge. Kann’s losgehen? Betrifft: Ihr Schreiben vom 10. dieses Monats. Monsieur, wie ich sehe, haben Sie zwanzig Tonnen Kies, Sorte vier, sandfrei, bei mir bestellt. Die Fuhre geht morgen los. In Anbetracht der guten Beziehungen, die ich mit Ihnen unterhielt … ich habe nie irgendwas mit ihm gehabt … als ich mich seinerzeit noch in Maubeuge aufhielt, bin ich bereit, Ihnen hinsichtlich der Zahlung alle Freiheiten zu gewähren … was mir gar nicht in den Kram passt, aber was soll’s. In der Hoffnung, auch künftig Ihre Aufträge entgegennehmen zu dürfen, verbleibe ich mit geschätzter Hochachtung und so weiter, und so weiter …
Pierre Neuhart blieb stehen. Er blickte Simone lächelnd an.
– Ich würde lieber an jemanden wie Sie schreiben, sagte er, das wäre amüsanter. Wie mich diese Art Korrespondenz anödet! Ach ja, könnte ich nur … Noch einen Brief, und Sie dürfen gehen. Ist Ihnen das recht?
– Um sechs ist Feierabend. Ich will um sechs Uhr gehen.
– Dann wollen wir schnell fertig werden. Adresse: Monsieur Balié, 12, Avenue de la Révolte, Aulnay-sous-Bois. Betrifft: Ihr Schreiben vom 9. dieses Monats. Monsieur, zurzeit führe ich nicht ein Körnchen der Reissorte, die Sie bei mir in Auftrag gegeben haben. Per Telefon allerdings … Klingt gut, nicht wahr, per Telefon?
Simone legte ihren Stift hin und sagte:
– Das machen Sie doch extra. Wie Sie wollen, aber ich gehe jetzt. Sie kommen schon allein zurecht. Allmählich reicht mir Ihr Theater.
– Hören Sie, Simone, der Brief muss heute Abend unbedingt noch raus. Ich fahre fort … Per Telefon allerdings erteile ich meinem Vorarbeiter Order, nein, halt, meinen Vorarbeitern Order, dass eine erste Lieferung von dreißig Tonnen übermorgen bereitstehen soll. Der Saldo Ihres Auftrages bemisst sich entsprechend den Herstellungskosten. Wie bereits in der Vergangenheit, gehen Sie mir auch jetzt wieder auf die Nerven …
Wütend erhob sich die Angestellte.
– Sie sind es, der mir auf die Nerven geht! Ich verschwinde jetzt. Bis morgen also, und zwar nicht vor zehn. Das wird Ihnen eine Lehre sein.
Der zwanglose Ton und die Bekenntnisse ihres Chefs hatten Simone dreist gemacht. Kein Tag verging, an dem sie nicht unter einem beliebigen Vorwand für ein, zwei Stunden verschwand. Oft meinte sie, dass er »ganz schön blöde« sei, doch wie viele geschäftige oder nachsichtige Menschen maß er solch plumpen Vertraulichkeiten keine Bedeutung bei, übte sich stattdessen in Geduld und wartete, bis man ihm gewogener war.
* * *
Etwa zwanzig Jahre zuvor war Pierre Neuhart ein junger Mann ohne besonderes Talent gewesen, ausgestattet mit einer soliden Schulbildung und einer guten Erziehung und beraten von einer ehrenwerten Bauern- und Industriellenfamilie aus dem Norden. Nur die Politik interessierte ihn. Er träumte davon, sich durch journalistische Tätigkeiten oder irgendeinen Posten als Sekretär Eintritt in diese Welt verschaffen zu können. Ehrgeizig wie er war, sah er in diesen Berufen, insbesondere in letzterem, ein bewährtes Mittel, gesellschaftlich aufzusteigen, und selbst heute noch spitzte er unwillkürlich die Ohren, wenn in seiner Gegenwart die Rede auf eine junge Parteisekretärin kam. Eine solche Beschäftigung reizte ihn wegen der Beziehungen, die er womöglich anknüpfen durfte, wegen der Geheimnisse, zu deren Wahrung er die nötigen Machtworte aussprechen sollte, wegen der Wertschätzung und des Neids, zu deren Gegenstand er würde, und, zuallererst, wegen der Soireen, zu denen er leichter Zugang fände und auf denen er gewiss der Frau begegnen würde, die ihm aus Liebe zum Erfolg verhalf.
Mit achtzehn also ging er nach Paris, mietete ein kleines Zimmer im Quartier Latin und war, um seine Eltern zu beschwichtigen, bisweilen bei Freunden der Familie zu Besuch. Dabei legte er jedoch solch eine Arroganz an den Tag, dass er selbst die Wohlwollendsten brüskierte. Wurde ihm irgendein geruhsames Pöstchen verschafft, verzog er nur geringschätzig den Mund. Kam man ihm aber nicht entgegen, fragte er in unverschämtem Ton: »Was können Sie mir bieten?« Nie kam ein Wort des Dankes über seine Lippen oder die geringste Spur der Anerkennung. Ein Leben als Staatsmann erschien ihm um vieles begehrenswerter als alle Posten, die man ihm hätte offenhalten können, so dass er sogar Vergnügen dabei empfand, die Verbindungen seines Vaters zu verletzen, indem er die Verachtung, die er für sie hegte, ungeniert zeigte.
– Sie können sich wohl denken, sagte er einmal zum Inspektor einer Reederei, dass ich andere Ambitionen habe als Spritztouren auf See. Und außerdem: Wohin käme ich denn? Nach Port-Said? Und dann? Dann muss ich wieder zurück, und alles fängt von vorne an. Nein, das ist nichts für mich.
– Tja, dann machen Sie eben Spritztouren zum Montmartre …, erwiderte der Inspektor, der vom Lebenswandel des jungen Mannes schon Wind bekommen hatte.
In der Tat verkehrte Pierre Neuhart in der Gesellschaft von Müßiggängern und gescheiterten Existenzen, in der er sich mit dem Geld, das sein Vater ihm zukommen ließ, als Wohltäter aufspielen konnte – in der ersten Woche des Monats jedenfalls. Denn die finanzielle Zuwendung erhielt er stets zu Ultimo, und sie brachte ihn ein wenig in Verlegenheit, da er auf diese Weise, wie er fand, von den Hoteliers und Ladeninhabern mit einem beliebigen Angestellten verwechselt werden konnte. Den spontanen Einladungen beschwipster junger Leute oder gerade volljähriger Mädchen folgend, verbrachte er die Nächte – bald verschlug es ihn in ein abgelegenes Café, bald in eine Spielhölle. Doch wie als Ausflucht trug er stets die Miene eines Flüchtlings, der sich mit dem Pöbel eingelassen hat, vor sich her. Trotz dieser Verstellung verlotterte er immer weiter. Bald schon machte er keinerlei Anstalten mehr, seine Zerrüttung zu verbergen, ja, er gefiel sich sogar darin, sie noch zu übertreiben. Tagelang rasierte er sich nicht, gab sich ganz unbekümmert, erteilte jungen Frauen, die zu ihm kamen, einen Korb, als sei die Anzahl seiner Romanzen dergestalt gewesen, dass er an Liebe nicht mehr hätte zu denken brauchen. Richtete man das Wort an ihn, betrachtete er, die Zigarette im Mund, mit argwöhnischem Blick sein Gegenüber, als wolle er auf diese Weise zu verstehen geben, dass ihm nicht zu imponieren war. Er war einsilbig. Am Ende einer Unterhaltung sagte er nur knapp »verstanden« oder »kapiert«. Öfter kam die Polizei in sein Hotel. Wenn die Inspektoren ihn dann frühmorgens weckten und seine Papiere zu sehen verlangten, kam er dieser Aufforderung nur mit Herablassung nach, denn wie bei allen, deren sozialer Abstieg nur vorgeschützt ist, hielt er nichts davon, dass man ihn mit den Zuhältern und Gaunern, mit denen er ja immerhin verkehrte, über einen Leisten schlug. Gewöhnlich stand er um vier Uhr nachmittags auf. In regelmäßigen Abständen versuchte er sich ans Kokain zu gewöhnen, was ihm misslang. Von einer Reise nach Venedig träumte er; dort könne man angeblich mit Sicherheit reüssieren, »vorausgesetzt, man hat ein wenig Charme«. Aber sein Vater dachte nicht einmal daran, ihm die 20.000 Franc vorzustrecken, die seinen Berechnungen zufolge nötig waren, um da im Süden mit einem prallgefüllten Koffer einzutreffen und mit klarem Kopf und der gebotenen Unabhängigkeit manövrieren zu können. Er fasste den Entschluss, das Geld selbst zu verdienen. Man schickte ihn zu einem Tanzlehrer. Gewissenhaft verfolgte er dessen Unterricht. Mit derselben Sorgfalt, die Wilde aufs Fallenstellen verwenden, traf er die Vorbereitungen für seine Reise. Er ließ nichts unberücksichtigt, fragte seine Kameraden von der juristischen Fakultät, wie weit man gehen könne, ohne straffällig zu werden, kaufte Modemagazine für den Herrn und verfasste kleine Liebesbriefe.
Bevor er seine Pläne in die Tat umsetzen konnte, kam der Krieg. Für gewisse Leute war er ein Segen. Er zog als einfacher Soldat und ohne zuvor den Wehrdienst abgeleistet zu haben (er war freigestellt worden) als Dreiundzwanzigjähriger ins Feld. 1915 wurde er zum Offiziersanwärter ernannt. Obwohl mehrfach verwundet, bat er immer wieder um Rückkehr an die Front. Tagtäglich streifte er ein Stück seiner alten Haut ab. Das Leben, das er inmitten aller Gesellschaftsschichten und aller möglichen Individuen geführt hatte, kam ihm jetzt abstoßend vor. Tatsächlich wurde ihm während der Kriegsjahre der Ausnahmecharakter des Milieus bewusst, in das er geraten war – um einiges vergrößert allerdings. So wie es ihn zuvor nach Venedig getrieben hatte, zog es ihn jetzt nach Saloniki. Er kehrte als Leutnant zurück. Das Ende des Krieges war in Sicht. Der junge Mann, der von einem Abenteurerleben träumte, war ein anderer geworden.
Nach seinem Abschied aus dem Dienst wollte er das, was er sich von anderen erhofft hatte, aus eigener Kraft erreichen. Sein Vater, wohlhabender Fabrikant und Gemeinderatsmitglied von Bleuchâtel bei Maubeuge, besaß große Autorität im dortigen Wahlbezirk, wo er über 450 Stimmen verfügte, eine Zahl, die er leicht auf sechshundert erhöhen konnte, nachdem sich die Tapferkeit seines Sohnes herumgesprochen hatte. Außerdem pflegte er Beziehungen zu einem gewissen Hochet, dessen Ziegelei die bedeutendste in der Gegend war. Der Vater veranlasste seinen Sohn zum Eintritt in diese Fabrik. Die 400.000 Franc streckte er ihm vor. Pierre brachte das Geld in das Geschäft ein, das aufgrund der gewaltigen Wiederaufbauarbeiten in jeder Hinsicht gesichert war. Im Gegenzug wurde er zum zweiten Direktor ernannt, und Monsieur Hochet, der bereits alt und nach vier Jahren Kriegsgefangenschaft erschöpft war, wünschte nichts weiter, als sich um die Kunden und den allgemeinen Geschäftsablauf kümmern zu dürfen. Hocherfreut willigte Pierre ein. Schon bald, unter Aufbietung aller Kräfte, gliederte er der Fabrik ein Zement-, Kalk- und Gipslager an, machte Geschäfte mit dem Staat und betrieb, von neuen Erkenntnissen geleitet, den Wiederaufbau ganzer Dörfer, vergrößerte den Kundenstamm, sicherte Absatzmärkte. Nach drei Jahren legte sich seine Begeisterung. Jeden Samstag fuhr er nach Paris, irrte dort sonntags ziellos umher und war dabei so gelöst, dass er die Fabrik vollkommen vergaß. Maubeuge flößte ihm allmählich Abscheu ein. Er hielt weder die Stadt noch die Menschen in ihr aus, noch die langen, düsteren Baracken der Ziegelei. Montagmorgens sah er dermaßen erbärmlich aus, dass die Freunde es sich nicht verkneifen konnten, ihn auf seine vermutlich schlaflosen Nächte anzusprechen. Diese Anspielungen steigerten nur seine Angst vor der Rückkehr. Sobald ihn aber die Geschäfte wieder in Anspruch nahmen, vergaß er seine Ausreißmanöver und wurde wieder zu dem, der er zuvor gewesen war. Er telefonierte, machte seine Gänge durch die Fabrik, kam Verabredungen nach, ging auf Reisen, inspizierte die Arbeit und lag mit dem Bahnhof im Streit.
Als er einmal einen Tag länger als sonst fortgeblieben war, bemerkte der alte Monsieur Hochet, der bis dahin immer den Eifer seines Teilhabers hatte dämpfen müssen:
– Mir scheint, Pierre, Sie sind nicht mehr mit Leib und Seele bei der Sache. Sie setzen damit nur Ihre Zukunft aufs Spiel. Ich sag’s Ihnen in Ihrem Interesse. In meinem Alter, wissen Sie, möchte man gerne seine Ruhe haben.
Statt Pierre Neuhart anzuspornen, lähmte die Bemerkung ihn vollends. Monsieur Hochets Ziegelei flößte ihm eine noch stärkere Abneigung ein. »Mir reicht’s«, dachte er, »ich will mich hier mit dreißig nicht begraben lassen. Ich will frei sein. Ich will tun, was mir gefällt. Die können mir gestohlen bleiben mit ihren Ziegeln und ihrem Zement. Es ist einfach widerlich, dass man sich in die Arbeit stürzt und sich, kaum blickt man einmal auf, sagen lassen muss: ›He, nicht so stürmisch, Kleiner. Schön bei der Stange bleiben, das ist das Beste für dich!‹ Nein, wirklich, mir reicht’s.«
Mit dem zurückerlangten Geld ging Pierre Neuhart gegen den Willen seines Vaters, den dieser ›Verrat‹ empört hatte, nach Paris. Er hatte einen Plan: ein Steinbruchunternehmen aufzubauen, wofür die Verfügung über ein erhebliches Kapital unerlässlich war. Er spürte also einige Steinbrüche auf, schloss mit den Grundstückseignern einen Vertrag, in dem er ihnen als Gegenleistung eine geringe Beteiligung am Umsatz zugestand, erwarb dann die komplette Gerätschaft wie Backenbrecher, Sortierwalzen, Kipploren, Lastwagen, Sprengstoff, elektrische Bohrmaschinen und eröffnete direkt an der Place Saint-Sulpice das kleine Büro, in dem die Bestellungen zusammenliefen. Er war vollkommen frei. Dank der Verbindungen, die er noch in Maubeuge unterhielt, sicherte er sich in kürzester Zeit einen Kundenstamm. Ein neues Leben begann, das so unabhängig war, wie es seinem Wunsch entsprach. Wenn ihn der Müßiggang überkam, brauchte niemand darunter zu leiden. Er musste weder Rechenschaft ablegen noch Erklärungen geben. Hin und wieder ging er ins Theater oder ins Variété, mal in Begleitung einer zufällig beim Spaziergang kennengelernten Frau, mal mit Kollegen. Von einem regelmäßigen Umgang mit diesen hielt er freilich nichts. Es waren grobe Menschen, die stolz auf ihre bäuerliche Herkunft waren, während er sich im Gegenteil darauf versteifte, seine Herkunft zu verhehlen. Denn schon immer hatte er von Distinktion, guten Manieren und großen Empfängen geträumt. Während er seinen Geschäften nachging, sah er bereits den Tag, an dem er von den Rendezvous, die die Frauen der feinen Gesellschaft ihm gewährten, ganz und gar in Anspruch genommen war. Auch die Männer wären an seinen Gesprächen interessiert. Sie fänden nichts Außergewöhnliches an einer Begegnung mit ihm, da sie ihn ja als einen der Ihren betrachteten. Aber all das war nur Träumerei. Sein Leben war viel schlichter und wie betrübt vom stetig wachsenden Schatten seiner Hoffnungen. Die meiste Zeit verbrachte er in seinem Büro an der Place Saint-Sulpice. Er las viel, brachte jedem Buch dasselbe Interesse entgegen. Als er Madame Aspi kennenlernte, hatte er dieses ebenso lockere wie freudlose Leben bereits sieben Jahre lang geführt.
* * *
Nachdem Simone die Tür hinter sich zugezogen hatte, verharrte Pierre Neuhart noch einen Augenblick in Schweigen; dann brummte er: »Na schön. Werden die Briefe halt morgen geschrieben. Außerdem geht einem das ganz schön auf den Geist. Ich hätte nicht übel Lust, den ganzen Krempel hinzuschmeißen und auszugehen – allein schon beim Anblick dieses Büros. Kies Sorte vier. Ha! Was für Idioten diese Leute sind!«
In diesem Moment schlug es sechs. »Ich sollte mir trotzdem etwas anderes anziehen. Madame Aspi erwartet mich. Hoffentlich unterläuft mir nicht die Peinlichkeit, dass ich sie mit Madame d’Aspi anrede. Immer will ich ihr ein Adelsprädikat geben.« Er zog einen Kamm aus seiner Tasche, frisierte sich vor einem kleinen Spiegel an der Wand und kehrte in die Mitte des Zimmers zurück.