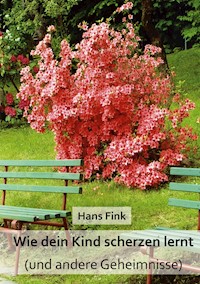Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Zum Unterschied von den anderen Ostblockstaaten genossen die nationalen Minderheiten in Rumänien beachtliche Rechte: Unterricht in der Muttersprache, Zeitungen, Bücher, Theater in der Muttersprache. Das gilt auch für die deutsche Minderheit. Im Dezember 1989, als das kommunistische Regime gestürzt wurde, lebten in Rumänien noch 200000 Deutsche. Schauplatz der vorliegenden Erzählung ist die kleine Stadt Lugosch im Banater Hügelland im Westen Rumäniens. Die Erzählung handelt von Erlebnissen der elfjährigen Paula Stein und ihres zehnjährigen Bruders Kai im Jahr 1983.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 149
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die vorliegende Erzählung ist 1985 im Bukarester Kinderbuchverlag „Ion Creangă“ für deutsche Leser veröffentlicht worden. Schauplatz der Handlung ist die kleine Stadt Lugosch im rumänischen Banat, einem Gebiet im Westen Rumäniens.
Die Originalausgabe war mit Zeichnungen der Künstlerin Sieglinde Bottesch illustriert.
INHALT
VORWORT
EINLEITUNG
Erstes Kapitel WAS IN DER SEEMANNSKISTE WAR
Zweites Kapitel DIE SCHATULLE ERWACHT
Drittes Kapitel EINMAL GEDULD, NOCH EINMAL GEDULD
Viertes Kapitel BEI STEINS BRENNEN DIE KARTOFFELN AN
Fünftes Kapitel PAULAS IDEE
Sechstes Kapitel ZWEI BRIEFE AN DIE GROSSELTERN
Siebtes Kapitel WESHALB MAN KAI
ZAUBERER
NANNTE
Achtes Kapitel EIN GEBURTSTAG, EIN HUND IN DER WOHNUNG UND EINE AUSSTELLUNG
Neuntes Kapitel BEI DER HOCHZEITSKÖCHIN
Zehntes Kapitel EIN JUNGE WEINT
Elftes Kapitel INSPEKTOR PAI LACHT
Zwölftes Kapitel PINGPONG BEI DER MILIZ
Dreizehntes Kapitel EVELYN SETZT DEN PUNKT AUFS I
SCHLUSS
Vorwort
Das ist ein Buch aus einem anderen Land, aus einer anderen Zeit. Anfang der achtziger Jahre, als ich es verfasste, lebte ich mit meiner kleinen Familie in Bukarest, der Hauptstadt Rumäniens, und war Redakteur der deutschsprachigen überregionalen Tageszeitung „Neuer Weg“. Das Land wurde von der Clique des Diktators Nicolae Ceauşescu regiert, die es in den Ruin steuerte. Der Alltag der meisten Menschen war von zwei Fragen geprägt: Erstens: Wo finde ich etwas zum Essen? Zweitens: Wie komme ich von hier weg? Das Land legal zu verlassen, war schwierig, und von den Grenzgängern wurden viele erschossen, oder sie ertranken in der Donau.
Anfang der achtziger Jahre lebten in Rumänien noch zahlreiche Deutsche. Zum Unterschied von allen anderen Ostblockstaaten räumte der rumänische Staat den nationalen Minderheiten (davon gab es offiziell sechzehn) bedeutende Rechte ein: Unterricht in der Muttersprache, Zeitungen, Theater und Bücher in der Muttersprache, allerdings nach einer angeblich kommunistischen Doktrin und von der Zensur kontrolliert. Auch die Deutschen besaßen diese Rechte, trotzdem wollten die meisten in die Bundesrepublik auswandern. Die Ceauşescu-Clique profitierte von diesem Umstand und ließ sich jeden Ausreisenden von der Bundesrepublik bezahlen, bis zum politischen Umsturz 1989 rund 220.000 Personen.
Gleichzeitig hat man die Ausreisewilligen als Landesverräter verunglimpft. Die Lehrer, Ingenieure, Agronomen und Forscher wurden sogar entlassen – auf die Straße gesetzt.
Um unter diesen Umständen ein Kinderbuch zu verfassen, dessen Handlung sich um eine rätselhafte Kaffeemühle dreht, welche Märchen erzählt, musste man verrückt sein – mehr als nur ein bisschen verrückt. Denn als irrationaler Gegenstand war diese Kaffeemühle eine Herausforderung für die Zensur. Zu meinem Erstaunen hat weder der Lektor noch ein Referent noch sonst wer Einwände gemacht. Ein anderer kritischer Punkt war der Polizeioffizier. In einem Kapitel tritt ein Polizeioffizier auf, der so handelt, wie ein Polizist handeln soll und damit eine positive Rolle spielt, dabei war die Polizei (in Rumänien damals Miliz genannt) als Werkzeug des Regimes allgemein verhasst.
Allerdings wurde mein Vorhaben durch mehrere Umstände begünstigt. Die deutschen Verlagslektoren suchten händeringend nach Manuskripten. Es gab kein Kinderbuch, dessen Handlung sich in der Gegenwart ereignet, mit der genauen Angabe von Stadtvierteln, Straßen, Brücken und Schulen, mit deutschen Familiennamen, mit überlieferten Bräuchen. Das friedliche Zusammenleben der Rumänen mit den nationalen Minderheiten war ein von der Politik erwünschtes Thema, und in meinem Fall spielt die Handlung im Banater Hügelland, wo Rumänen und Deutsche seit 200 Jahren gut miteinander auskamen. Auch die Tätigkeit im Rahmen der staatlichen Kinder-Organisation mit ihren zahlreichen Fachzirkeln war ein erwünschtes Thema, aber das ist nicht alles. Während sich die Kinder in den vorgeschriebenen Sitzungen mit politischem Inhalt oder mit Analysen der Lernerfolge langweilten, ist es im ganzen Land, von einem Ende bis zum anderen, vielen Lehrern gelungen, die Kinder in den Fachzirkeln für praktische Tätigkeiten zu begeistern: Basteln – Gemüsebau – Kleintierzucht – Pilzkulturen – Briefmarkensammeln – Numismatik – Radiotechnik – Gokart – Segelflug – Wandern – Lokalgeschichte. Aufschlussreich für die Vielfalt der Tätigkeiten und das Niveau der Leistungen war eine Ausstellung im Sommer 1974. Im Jahr davor hatten Pioniere u.a. im Donaudelta einen bis dahin nicht beachteten Parasiten identifiziert, der die Fischereigeräte angreift – vier Höhlen entdeckt und zwölf weitere kartografiert – Touristenwege markiert – im Căliman-Gebirge ein Reservat abgesteckt. Während eines dienstlichen Aufenthalts in Reschitza hatte ich einen Physiklehrer kennengelernt, dessen Bastelzirkel auf Landesebene ausgezeichnet worden war. Die aus Staniolpapier gewickelten Miniraketen, die ein Loch in manchen Vorhang brannten, stammten aus seinem Zirkel. Und eben dieser Physiklehrer ist einmal von der Polizei belangt worden, weil er sich die Bestandteile für seine wunderbaren Maschinen (nämlich Kugellager, Zahnräder, Gewinde usw.) auf einer Altmetall-Sammelstelle zusammensuchte, ohne sich um eine Erlaubnis zu kümmern.
Der Wohnungstausch mit dem Zuckerbäcker, der die Handlung einleitet, stammt aus der Familiengeschichte. Desgleichen die Seemannskiste, die gehörte meinem Linz-Großvater, der als Maschinist am Ersten Weltkrieg teilgenommen hat. Die Hochzeitsköchin von Bakowa war eine im Banat bekannte Persönlichkeit. Dem Ingenieur Nadelbart bin ich in einer Temeswarer Textilfabrik begegnet, als ich in den Ferien dort arbeitete. Das Urbild der Lehrerin Wenich unterrichtete an der Bukarester Deutschen Schule. Auch der Hahn Ghiţă hatte ein Vorbild im realen Leben, und zwar auf einem benachbarten Balkon; jenes Vorbild weckte uns im Sommer und im Winter.
Die „Raketenpost“ war eine für Kinder bestimmte, sehr beliebte wöchentliche Beilage des „Neuen Wegs“.
Der Schulinspektor Pai aber ist erfunden. Das Verbot für die Schüler, den Haupteingang zu benützen, hängt mit dem Persönlichkeitskult für den Diktator zusammen. Für den Fall, dass ein Parteibonze zu Besuch kommt, musste der Haupteingang staubfrei sein wie ein blankgeputzter Spiegel. Kein lebender Inspektor hätte es gewagt, sich laut anders zu äußern. Deshalb war dieses Thema ausgesprochen heikel, ein Tabu-Thema, und ich wundere mich bis heute, dass die Zensur darüber hinweggesehen hat.
Die Auflage der „Märchenmühle“ belief sich auf bescheidene 1.800 Exemplare – beim Kinderbuchverlag „Ion Creangă“ die Höchstauflage für eine Veröffentlichung in deutscher Sprache. Durch Zufälle habe ich erfahren, dass sie Anklang gefunden hat.
Während einer Dienstreise nach Lugosch im Februar 1988 begegnete ich dem Deutschlehrer Klaus Megerle, der an eben jener Schule unterrichtete, die als Schauplatz für die literarische Handlung gedient hat. Megerle leitete einen Schülerzirkel für Literatur, und dessen Mitglieder hatten meine Erzählung besprochen. Monate später zeigte mir die Kollegin von der Briefe-Abteilung der Redaktion eine ausführliche Zuschrift der Temeswarer Deutschlehrerin Edith Cobilansky. Deren Schüler waren von der Handlung so beeindruckt, dass sie sogar begannen, Magische Quadrate für die „Rakentenpost“ zu fabrizieren. Im selben Jahr begegnete ich im Cişmigiu-Park dem damals schon pensionierten Schulinspektor Jakob Neumann, der mich beglückwünschte.
Ein Schelmenroman, dessen Handlung um dieselbe Zeit in der Kleinstadt Heltau neben Hermannstadt spielt (im Text Heimbrichgenannt), fordert zu einem Vergleich heraus. Das ist die humorvolle Erzählung „Großvaters Hähne“ von Karin Gündisch, erschienen 1994 im Hanser-Verlag. Zum Unterschied von mir konnte sich die Autorin eine satirische Darstellung der Zustände erlauben. Die Hauptgestalt ist ein pensionierter Beamter, der die Kost aufbessern möchte, indem er zehn Hähne mästet, und der von seinen Mitbürgern erpresst oder bestohlen wird. Auch in dieser Erzählung tritt ein Polizeioffizier auf, ein Leutnant von der Verkehrsmiliz. Er setzt Jochens Vater mit der Bemerkung unter Druck, dass die Farbe seines VW-Käfers grau sei, während in den Papieren metallblau steht. Schließlich gibt er sich mit einer Packung ausländischer Zigaretten zufrieden …
Hans Fink
Einleitung
Im ersten Halbjahr 1983, als diese Geschichte sich zugetragen hat, ging Paula Stein in die fünfte Klasse und ihr Bruder Kai, der zu seinem Verdruss volle vierzehn Monate jünger war, noch in die vierte. Im Mittelpunkt steht eine uralte Spieldose. Die Stein-Großeltern, der Stein-Oti und die Stein-Omi, hatten sie paar Jahre vorher mit etwas Glück auf dem Dachboden gefunden.
Alle meine Kollegen wissen, wie gern ich mich als Handlanger anbiete, sooft man irgendwo einen Dachboden oder eine Rumpelkammer ausräumt. Dann kommen nämlich altmodische Gegenstände zum Vorschein, die vor fünfzig, vor achtzig, vor hundert und vor mehr als hundert Jahren benützt worden sind. Kennt ihr den Fregolli? Na also. Das ist ein Wäschetrockner in Form eines Holzrahmens mit parallel gespannten Drähten, der an zwei Rollen vom Küchenplafond hängt. In meiner Kindheit war der Fregolli noch weit verbreitet. Bei anderen kuriosen Dingen weiß ich weder Zweck noch Namen und lasse sie mir von alten Leuten erklären.
Ich genieße das Entrümpeln als eine Gratisreise in die Vergangenheit, und anschließend bedanke ich mich für die Verständigung. Ihr könnt euch denken, mit welcher Anteilnahme ich alle Nachrichten über die Spieldose zur Kenntnis nahm.
Auf jeden Fall gehören die Umstände, unter denen sie auftauchte, mit zur Geschichte.
I. KAPITEL
Was in der Seemannskiste war
Als die Stein-Großeltern aus dem Familienhaus in der Mondscheingasse in ein Haus der Inneren Stadt umziehen sollten, überlegten sie lange Zeit hin und her, was in die kleinere Wohnung mitzunehmen sei. Sie dachten jedes Mal mit Beklemmung an den Dachboden, wo sich in fünf Jahrzehnten wahre Berge von altem Hausrat angesammelt hatten. Ihre Kinder, nach und nach selbstständig geworden, brauchten ihn nicht mehr.
Was konnte man verschenken? Wie viel konnte man verkaufen? Wie viel musste man letzten Endes doch ins Feuer werfen? Auf manchen Dachböden ist kaum etwas zu finden außer Wespennestern und Spinnweben. Ich weiß nicht, was für Dachböden ihr schon gesehen habt, bei dem Haus aber, von dem hier die Rede ist, war es ganz anders. Deshalb verschob der Großvater das Ausräumen von Tag zu Tag.
Die Stein-Großeltern tauschten mit einem Zuckerbäcker, der das nötige Kleingeld besaß, um ein altes Stadtrandhaus bequem einzurichten. Er überließ ihnen dafür ein Appartement im zweiten Stock. Die Vorteile dort waren fließendes warmes Wasser, Zentralheizung und ein richtiges, gekacheltes Badezimmer mit eingebautem Klo. So ein Badezimmer wünschten sich die Großeltern schon lange, trotzdem fiel ihnen der Abschied schwer aufs Herz.
Dem Großvater tat es um seinen Garten leid. Spät abends, wenn niemand zuschauen konnte, schlich er über die schmalen Pfade zwischen den Gemüsebeeten und berührte jeden Baum. Der Großmutter schnürte die Trennung von den guten Nachbarn die Kehle zu – so freundliche Mitmenschen gab es bestimmt nicht mehr. Übrigens hatte sie längst erfahren: Je mehr Leute in einem Haus wohnen, um so weniger kümmern sie sich umeinander.
Schließlich kam die Reihe auch an den Dachboden. Tagelang schleppte der Großvater den alten Hausrat Stück für Stück in den Hof: ein zerbeultes Ofenrohr, Wackelige Stühle, einen Waschtisch, von dem die Farbe abblätterte, Bündel von Kalendern, vergilbt und ausgefranst, drei zerschlissene Rosshaarmatratzen, eine Petroleumlampe mit Spiegel, ein wurmstichiges altes Krautfass und einen nie gebrauchten Weinheber.
Nachmittags schickten die Nachbarn reihum ihre Söhne und Enkel zu Hilfe, damit sie bei den schweren Stücken mit Hand anlegen. Tatsächlich mussten vier Mann stemmen und heben, um den rostzerfressenen Küchenherd, der eigentlich längst zum Alteisen gehörte, über die steile Bodentreppe zu schaffen.
Wäre kein Zaun gewesen, hätten sich sehr bald alle Kinder des Viertels versammelt, um die verstaubten Sachen zu beäugen, zu betasten und nach eigenen Wertvorstellungen zu taxieren. Die Kinder hätten den Haufen untersucht wie Archäologen ein Hünengrab oder die Cheops-Pyramide. Wäre kein Zaun gewesen, hätten die Kinder einen Teil des ausrangierten Hausrats weggeschleppt und in Spielzeug umfunktioniert. Aus den seltsam geformten Flaschen wäre im Handumdrehen eine Apotheke entstanden; das verbogene Fahrrad hätte mit dem Waschtisch, dem Korbstuhl, den Messing-Vorhangstangen und dem Krautfass ein Motorboot ergeben. Gewiss eignete sich die alte Nähmaschine als Antrieb, um den rätselhaften Holzrahmen mit Drähten wie eine riesige Käfigtür am Nussbaum in die Höhe zu manövrieren.
Nach spätestens einer Woche freilich wären die meisten Fundstücke in den Mülleimern der Nachbarhöfe gelandet, der Rest in Holzkammern, in baufälligen Lauben, in leeren Schweinskoben und vielleicht sogar auf anderen Dachböden.
Der Haufen wurde so groß, dass man ein Pferd in ihm hätte verstecken können. Endlich sagte der Großvater: „Na, heit’ is Schluss mit tem Kraffl.“ Er machte eine letzte Runde und wollte schon aufatmen, als er zu seiner Verwunderung im hintersten Winkel noch eine Kiste entdeckte. Diese Kiste hatte er bis dahin nicht bemerken können, weil sie von allerlei Gerümpel umstellt war.
Der Großvater stellte die Kiste probeweise auf einen Dachbalken. Sie hatte die Ausmaße eines großen Koffers, war aber nicht schwer. Ihre festgefügten Bretter wurden zusätzlich von eisernen Bändern zusammengehalten. Sie war nicht verschlossen. Als der Großvater den Deckel aufhob, fand er, dass die Kiste fast leer war; den Inhalt hatte man durch ein Wachstuch gegen Staub und Nässe geschützt. Umständlich, weil allein, bugsierte er den Fund über die Bodentreppe. Er fragte die Großmutter, ob sie vielleicht wisse, was in der Kiste steckt, aber die Großmutter schüttelte den Kopf. Obwohl in jenem Haus aufgewachsen, hatte sie das klobige Ding nie gesehen. Wahrscheinlich stammte es noch aus des Urgroßvaters Jugendzeit.
Die Großeltern wurden neugierig. Weil es schon dunkelte, ließen sie die Arbeit genug sein, wuschen sich und aßen ihr Nachtmahl. Dann stellte sie die Kiste im großen Zimmer auf den Tisch, um ihren Inhalt in Ruhe zu betrachten.
Vorsichtig entfernte die Großmutter das Wachstuch. „Ja“, sagte sie sofort, „das stammt von meinem Vater, aus seiner Matrosenzeit.“ Man sah mehrere Päckchen Postkarten und Briefe, eine Seemannsmütze, einen zusammengerollten Gürtel, dessen Metallknöpfe Grünspan angesetzt hatten, und eine Kaffeemühle. Aus der Kiste kamen ferner zum Vorschein: ein Fläschchen mit Rosenöl, eine riesige Vogelfeder, vielleicht von einem Raubvogel, der kunstvoll aus Horn geschnitzte Griff eines Spazierstocks und ein Riesiges Taschenmesser. Zuunterst lag ein alter Atlas. Zwischen dessen Blättern steckten verblasste Fotos und zum Teil mit gotischer Schrift ausgestellte Schulzeugnisse.
„Dann war also diese Kiste sein Koffer, seine Seemannskiste.“
„Komisch, er hat nie ein Wort über diese Dinge fallen lassen. Das Einzige, was mir bekannt vorkommt, sind die Postkarten und Briefe, weil ein gleiches Päckchen in der Kredenzlade liegt und weil meine Mutter sie manchmal erwähnt hat.“
Daraufhin sprachen die Großeltern noch lange über den Urgroßvater, der jenes Haus in der späteren Mondschein-Gasse erbaut hatte, als sich dort noch Kukuruzfelder ausbreiteten, und der seit schon zwanzig Jahren im Friedhof ruhte.
Der Urgroßvater war als junger Mann zur See gefahren und hatte fremde Länder gesehen. Aus jedem Hafen schickte er seiner Braut bunte Ansichtskarten. Seine Braut nummerierte die Ansichtskarten und band je fünfundzwanzig zu einem Päckchen zusammen. Die fünf Päckchen ließen sich betrachten wie ein Bilderbuch vom Mittelmeer. Wie oft hat die Urgroßmutter in ihrem Bilderbuch geblättert!
Aber dann brach der Krieg aus, den man später den Ersten Weltkrieg nannte. Der Urgroßvater musste auf einem Kriegsschiff Dienst tun, und auf einmal kamen die Ansichtskarten viel seltener und mit großer Verspätung. Sie waren auch nicht mehr bunt, sondern grau, dazu trugen alle die Stempel von Militärbehörden. Anfang des dritten Kriegsjahrs blieben sie ganz aus. Was war geschehen? Wo befand sich der Bräutigam? War ihm etwas zugestoßen? Lebte er noch? Niemand konnte es sagen.
Irgendwo in der Adria war das Kriegsschiff „Magnet“ bei starkem Wellengang von einem Torpedo getroffen worden, und infolge der Explosion war der Urgroßvater ins Meer gestürzt. Da hat er um sein Leben schwimmen müssen, er ist von den Wellen hin und her geworfen worden wer weiß wie lange. Bewusstlos wurde er von einem anderen Schiff gerettet. Dann lag er zeitweilig in einem Spital. Von der Überanstrengung hatte der Urgroßvater einen Herzfehler bekommen und war nun kriegsuntauglich. Durch Vermittlung des Roten Kreuzes gelangte er endlich nach Hause.
Nach der Hochzeit fand der Urgroßvater Arbeit in der Temeswarer Bonbons- und Schokoladenfabrik „Kandia“ und begann sofort für ein Haus zu sparen. Was er von seinen Reisen mitgebracht hatte, lag in der Seemannskiste verstaut in einem Winkel. Er sprach nie darüber. Vielleicht hatte die Explosion, der Sturz in das tückische Meer, der schreckliche Kampf mit den Wellenbergen ihm die Erinnerung getrübt. Seine Seemannskiste wurde als erstes Stück auf den Dachboden des neuen Hauses gestellt, als das Haus noch ein Rohbau war. Dann hat man sie vergessen.
Natürlich berichtete die Großmutter den Verwandten bei nächster Gelegenheit über den Fund. Da kein Erwachsener Anspruch auf den Inhalt der Seemannskiste erhob und der Großvater den Griff des Spazierstocks lächelnd ablehnte – er und ein Spazierstock? „Kommt nicht in Frage!“ – verteilte sie die meisten Sachen nach Gutdünken unter ihre Enkelkinder. Sie behielt nur die Briefschaften, die Fotos und die Schulzeugnisse. Auf diese Weise gelangten Kaffeemühle, Horngriff und Vogelfeder von Temeswar nach Lugosch, in das neue Wohnviertel Mikro 2 und in den Besitz der Haupthelden unserer Geschichte – des Mädchens Paula und ihres Bruders Kai. Übrigens schien die Kaffeemühle ein echtes Spielzeug zu sein, denn sie hatte kein Mahlwerk. Die Feder, sagte später ein Kenner, stamme aus einem Adlerflügel.
Nach dem Umzug betrachtete die Großmutter in ruhigen Stunden gern die in der Seemannskiste gefundenen Papiere. Die vergilbten Zeugnisse gaben Aufschluss über Urgroßvaters Leistungen in der Volksschule, die er in Orschowa besucht hatte. Seine Leistungen waren sehr ungleich. Im Zeugnis der fünften Klasse beispielsweise stand vermerkt: Schönschreiben – mäßig, Aufsatz – gut, Rechnen – gut, Geschichte – gut, Geographie – gut, Zeichnen – sehr gut, Handarbeit – sehr gut, Turnen – sehr gut. Dann stand aber noch: Fleiß – schwankend, Betragen – mangelhaft, Religion – besorgniserregend. Die Großmutter wusste warum. In seiner Kindheit galt der Urgroßvater als unverbesserlicher Galgenstrick. Von den Streichen, die bekannt geworden sind, wirbelte der mit dem Weihwasser besonders viel Staub auf. Damals hatte der Junge zu Silvester ein Liter Tinte ins Weihwasserbecken der römisch-katholischen Kirche von Orschowa gegossen. Am Neujahrsmorgen 1906 zeichneten sich die frommen Gläubigen im Dunkel des Kirchenschiffs ahnungslos jeder ein tintenschwarzes Kreuz auf die Stirn.
Wenn lieber Besuch kam, zeigte die Großmutter zuweilen die alten Fotos und die Ansichtskarten, zögerte aber, den Umschlag mit den Zeugnissen aus der Schachtel zu nehmen. Eines Tages verbrannte sie dessen Inhalt im Aschenbecher. Denn seht ihr, die Stein-Großmutter hatte in ihrem Leben wenige Menschen kennengelernt, die so arbeitsam, herzensgut und aufrichtig waren wie der Urgroßvater.
II. KAPITEL
Die Schatulle erwacht
Auf einmal war die Mutter krank. Als Paula und Kai fast gleichzeitig von der Schule kamen, denn Kai hatte wieder gebummelt, fanden sie die Mutter in der Wohnung, wie es an ihrem freien Samstag zu sein pflegte. Es war aber nicht Samstag, sondern Dienstag, und die Mutter wirtschaftete nicht in der Küche oder im Badezimmer, sondern lag in zwei Decken gewickelt auf dem Ausziehbett im großen Zimmer und fühlte sich offenbar sehr schlecht.