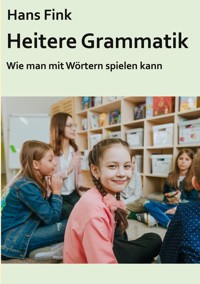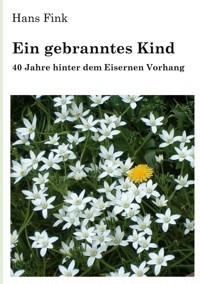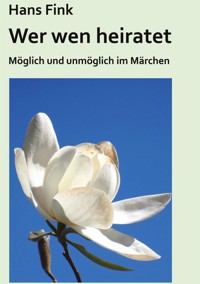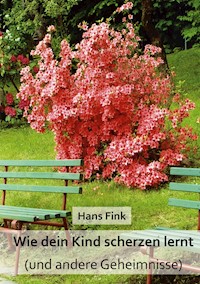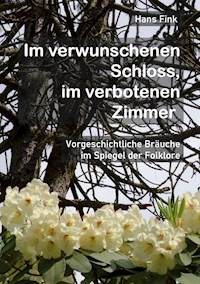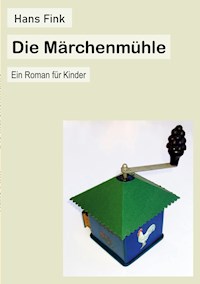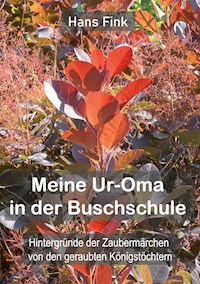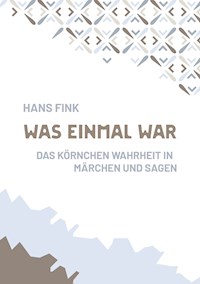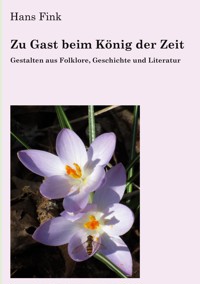
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der Verfasser stellt achtzig Gestalten vor aus Folklore, Geschichte und Literatur, die einen Europäer unsichtbar durch Alltag und Sonntag begleiten. Infolge des üblichen alphabetischen Prinzips bei Nachschlagewerken reichen hier einander die Hand: Aschenputtel und Asterix, Dornröschen und Emil Tischbein, Frau Holle und Graf Bobby, Hannibal und Harry Potter, Jules Verne und Julius Cäsar, Karl der Große und Karl Marx, Nobel und Odysseus, Schneewittchen und Schwejk.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 274
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Vorwort
Erste Einführung: Ein Exkurs zur Buschschule
Zweite Einführung: Die ungleichen Stiefschwestern
Alexander der Große
Ali Baba
Anne Frank
Arminius und Boudicca
Aschenputtel
Asterix
Bär, Dachs und Gans
Blaubart
Der Fliegende Holländer
Der hl. Nikolaus
Der Osterhase
Der Rattenfänger von Hameln
Der Starke Hans
Der Wasserdrache
.
Die Bremer Stadtmusikanten
Die kluge Bauerntochter
Die Schicksalsfrauen
Die Schildbürger
Doktor Dolittle
Don Quijote
Dornröschen
Emil Tischbein
Eulenspiegel
Faust
Figaro
Frau Holle
Graf Bobby
Graf Dracula
Gulliver .
.
Hagen von Tronje
Hannibal
.
Hänsel und Gretel
Harry Potter
Heidi
Heinzelmännchen und Salige Fräulein
Johanna von Orléans
(Jeanne dʼArc)
Joseph II
Jules Verne
Julius Cäsar
Karl der Große
Karl Marx
Karl May
König Artus
König Hänschen I., Reformator
König Matthias Corvinus
(Mátyás király)
Kore
Krabat
Marco Polo
Maria Theresia
Melusine oder die Saligen Frauen
Münchhausen
Nasreddin Hodscha
Nils Holgersson
Nobel
Odysseus
Orpheus
Peter der Große
Pinocchio
Pippi Langstrumpf
Prinz Eugen
Rapunzel
Robin Hood
Robinson Crusoe
Romeo und Julia
Rothschild ..
..
Rotkäppchen
Rübezahl
Rumpelstilzchen
Schliemann
Schneewittchen
Schwejk
Sherlock Holmes
Spartakus
Tewje, der Milchhändler
Theseus und Ariadne
Undine
Werther
Wilhelm Tell
Märchentypen aus dem Aarne-Thompson-Katalog
..
.
Bibliografie
Allgemeine Nachschlagewerke
Geschichte und Archäologie
Volkskunde und Völkerkunde
Pädagogik
Erzählforschung
Folklore-Sammlungen
Belletristik
Oper und Operette
Vorwort
Ein Erwachsener ist selten völlig allein. Von Schrecksekunden abgesehen geht es ihm gewöhnlich durch den Kopf, was der Vater, was die Mutter, was die Nachbarin übers Eck und was Physiklehrer Rudolf May unter vergleichbaren Umständen gesagt oder getan hätte. Das Bewusstsein eines jeden von uns begleitet eine Schar von Gestalten, deren Zusammensetzung sich von Individuum zu Individuum unterscheidet, abhängig von Kindheit – Schule – Freundeskreis – Lektüre – Kultur-Angebot. Im vorliegenden Buch werden achtzig Gestalten vorgestellt.
Meine Umschau begann bei den Märchen, Sagen und Comics, deren Helden sich dem Bewusstsein noch in der Kindheit einprägen. Dann zog ich das Brauchtum, Geschichte und Literatur in Betracht.
Schon im frühen 20. Jahrhundert ist die mündliche Überlieferung in Form von Märchen und Sagen auf einige Kernthemen zusammengeschrumpft. Diese werden nicht wie früher durch abendliches Erzählen vermittelt, sondern meist durch Filme oder Opern. Um dem Leser die Einordnung von Gestalten des Märchens und der Sage ins Universum der mündlichen Überlieferung zu erleichtern, habe ich Betrachtungen zu zwei Gruppen von Märchen vorangestellt.
Mehr als ein Dutzend Artikel beleuchten Gestalten der Geschichte von Alexander dem Großen bis Karl Marx. Was der Leser über sie weiß, wird durch Hintergrundinformationen ergänzt. Im Falle der Literatur nehmen die Kinderbücher viel Raum ein, weil ihre prägende Wirkung nicht oft genug vermerkt werden kann.
Alexander der Große ist eine Gestalt der Geschichte, doch wenn wir bedenken, dass er in Anekdoten, Sagen und Volksbüchern auftritt, ist er zugleich eine Gestalt der Folklore. – Johannes Faust war ein Arzt, Astrologe und Schwarzkünstler. Die Erinnerungen an ihn verdichteten sich zur Sage, und aus der Sage entstand ein Volksbuch. Dieselbe Sage hat Dichter, Schriftsteller und Komponisten zu erfolgreichen Werken angeregt. – Von König Matthias Corvinus, einer Gestalt aus Fleisch und Blut, wurden in Mittel- und Osteuropa noch vierhundert Jahre nach seinem Tod Anekdoten, Märchen, Sagen und mythische Geschichten erzählt.
Die Reihe der Beispiele lässt sich mit Marco Polo, Kaiserin Maria Theresia, Münchhausen und Zar Peter den Großen fortsetzen. Außerdem habe ich literarische Personen eingefügt, die sprichwörtlich sind: Odysseus, Romeo und Julia, Figaro, Pinocchio, Sherlock Holmes, Josef Schwejk.
So wie die hier versammelten Gestalten durch das in Nachschlagewerken übliche alphabetische Prinzip wie zufällig zusammentreffen, treten sie im Alltag, bedingt durch Dutzende nicht abgestimmte Abläufe, unerwartet nebeneinander.
Über sie kann man sich in einem Lexikon oder im Internet informieren. Das gilt auch für die Protagonisten von Märchen und Sagen, allerdings mit der Einschränkung, dass weder die ENZYKLOPÄDIE DES MÄRCHENS1 noch WIKIPEDIA die Erkenntnisse von Wladimir Propp übernommen haben. Seit der Veröffentlichung von dessen Abhandlung über die historischen Wurzeln des Zaubermärchens2 muss man nämlich zwischen Märchen unterscheiden, die erfunden worden sind, und Märchen, die sich aus Erinnerungen an aufgelassene Bräuche bildeten. Propp wieder war aus heutiger Sicht nicht auf der Höhe, weil seine Gewährsleute nur über Männerbünde, Männerhäuser und die Jugendweihe für Knaben berichteten, infolgedessen konnte er mit gutem Gewissen nur die männlichen Märchengestalten interpretieren. Im Falle der Hexe sowie der entführten Prinzessinnen hielt er sich zurück oder schlug wie bei Schneewittchen daneben. Die Forschungsberichte von Diedrich Westermann und Martin Gusinde haben ihn nicht erreicht.
Weil die Herausgeber der „Enzyklopädie des Märchens“ die Ausführungen Propps zur archaischen Jugendweihe nicht ernst nahmen, vermochten sie sich zum Inhalt der Märchen, die in der archaischen Jugendweihe wurzeln, ebenso wenig sachlich zu äußern wie zum Inhalt der historisch jüngeren Sagen über Heinzelmännchen, Salige Fräulein und verwandte Gestalten. Diese zwei Gruppen von Überlieferungen hängen durch denselben Brauch zusammen, doch liegen zwischen ihrer Genese anderthalb Tausend Jahre.
Natürlich stellt sich die Frage nach einer Grenze. Soll man Herkules, Galileo Galilei, Graf Dracula, Konrad Duden, Conrad Röntgen, Rudolf Diesel und Kaiserin Sissi in Betracht ziehen? Herkules, der nationale Heros Griechenlands, vollbrachte zahlreiche Heldentaten und stiftete angeblich die Olympischen Spiele (776 v.Chr.). Allerdings sind die Umstände jener Heldentaten und die auf sie bezogenen Redensarten wie den Augiasstall ausmisten nur Personen verständlich, die eine sogenannte klassische Bildung besitzen, jeder andere muss in einem mythologischen Lexikon nachschlagen oder WIKIPEDIA zu Rate ziehen. – Von Galilei, dem Begründer der neueren Naturwissenschaft, gibt es nur eine einzige Anekdote. „Und sie bewegt sich doch!“, soll der Professor gemurmelt haben, nachdem er seine Lehre vom heliozentrischen System, die vom Papst verboten worden war, im Prozess mit der Inquisition als „Irrtum“ widerrufen hatte. Glaubwürdig ist jene Aussage nicht, denn mit der Inquisition war nicht zu spaßen: Erst 33 Jahre vorher, im Jahre 1600, war der Gelehrte Giordano Bruno auf Befehl der Inquisition in Rom verbrannt worden. – Der Name des Gymnasiallehrers Konrad Duden (18291911) fällt täglich vieltausendmal, denn die von ihm angeregten Rechtschreibregeln sind in fünf europäischen Staaten verbindlich. Mehr von ihm gehört nicht zum Allgemeinwissen. Dasselbe gilt für den Erfinder des Röntgen-Apparats, Conrad Röntgen (1845-1923), und für den Erfinder des Diesel-Motors, Rudolf Diesel (1858-1913). – Das Leben der Kaiserin von Österreich schließlich wurde zwar wiederholt mit namhaften Schauspielerinnen verfilmt, es gibt auch eine ihr gewidmete Oper, aber diese Werke sind nur die Reaktion auf die Sensationslust eines kleinen Teils der Bevölkerung.
Das massive Interesse für Graf Dracula jedoch ist trotz der widernatürlichen Handlung und der scheußlichen Einzelheiten ungebrochen.
Zahlreiche von mir verwendete Informationen stammen aus der Internet-Enzyklopädie WIKIPEDIA, die zum Unterschied von anderen Quellen auf dem neuesten Stand und deshalb unentbehrlich ist. Dies gilt insbesondere für die sogenannte Rezeption, d.h. für die Popularität, für das Ansehen der betreffenden Gestalt in Europa und in der Welt. Deshalb möchte ich mich bei den anonymen Mitarbeitern von WIKIPEDIA herzlich bedanken.
Hans Fink
Abkürzungen
AT – das von Antti Aarne verfasste und von Stith Thompson überarbeitete Verzeichnis der Märchentypen
KHM – „Kinder- und Hausmärchen“ [der Brüder Grimm]
1 ENZYKLOPÄDIE DES MÄRCHENS – ein Lexikon in 15 Bänden, veröffentlicht 1977-2015. An ihm wirkten rund 1.000 Autoren aus 80 Ländern mit.
2 VLADIMIR PROPP: Die historischen Wurzeln des Zaubermärchens. [Leningrad, 1946.] München und Wien: Hanser, 1987.
Erste Einführung:
Ein Exkurs zur Buschschule
Zahlreiche Märchen, unter ihnen so bekannte wie die von Aschenputtel, Dornröschen, Rapunzel und Schneewittchen, sind aus Erinnerungen an einen uralten Brauch entstanden. Ich habe diesen Brauch wiederholt beschrieben.3
Bis in die Späte Bronzezeit (1200-800 v.Chr.) war die Buschschule in Europa ein komplexer Prozess der Ausbildung aller Knaben und Mädchen zu vollwertigen Stammesmitgliedern. Sie weist zahlreiche Parallelen zu den Traditionen der Urbevölkerung Afrikas, Australiens, Neuguineas und Amerikas auf. In den Märchen wird sie bruchstückhaft und verzerrt dargestellt.
Der Sitz der Buschschule befand sich in einer kleinen Siedlung tief im Wald, die gleich den Dörfern von einem undurchdringlichen Dickicht umgeben war, ehemals in Norddeutschland als Knick und in Süddeutschland als Gebück bekannt. Mittelpunkt der Siedlung war ein außergewöhnlich großes Gebäude ohne Eingang zu ebener Erde, siehe das Grimmʼsche Märchen „Rapunzel“ (KHM 12, AT 310). Allem Anschein nach stand jenes Gebäude sowohl den Männern als auch den Frauen zur Verfügung. Marko Kuhsohn begegnet, während er den Quälgeist Ellenbart verfolgt, erst tanzenden alten Weibern, dann tanzenden Frauen, dann tanzenden Mädchen (Der alte Ellenbart4, serbokroatisch, AT 511 A + 301 B). Auch manche Märchen des Typus AT 400 „Der Mann auf der Suche nach seiner verschwundenen Gattin“ sind aufschlussreich: Hier werden im verwunschenen Schloss geschwärzte oder in Tiere verzauberte Mädchen von Jünglingen in den sogenannten Qualnächten erlöst.
Propp hat die Funktionen des großen Gebäudes (welches er wegen seiner lückenhaften Bibliografie nur als „Männerhaus“ begriff) wie folgt beschrieben: Es ist ein Versammlungszentrum des Männerbundes. – Hier werden Masken und andere heilige Gegenstände des Stammes aufbewahrt. – Hier finden Tänze und Zeremonien statt. – Im Männerhaus wohnen die Absolventen der Jugendweihe bis zu ihrer Heirat. – Es dient als Unterkunft für Reisende.5 In zwei Märchen wird die Funktion als Treffpunkt der Stammesältesten deutlich: Im französischen Märchen „Hachko“6 (AT 650 A + 301) entdecken die drei Helden in der oberen Etage des verwunschenen Schlosses zwölf bärtige Greise, die um einen Tisch sitzen, halten sie für Dämonen und bringen sie um. – Im polnischen Märchen „Die Schmiedstochter und die schwarze Frau“7 (AT 710) beobachtet die Heldin in einem Zimmer, dessen Tür sie nicht öffnen soll, eine Gruppe von zwölf Männern, die sich zu beraten scheinen. (In den verchristlichten Varianten des Märchentypus AT 710 wird das Mädchen von der Gottesmutter erzogen, in einer rumänischen Variante dagegen, sie heißt „Lüge nicht!“, von der Fee Ilina, der mächtigsten der Feen.8)
Verantwortlich für die Erziehung und Ausbildung der herangewachsenen Kinder waren der Stammeszauberer und die Stammeshexe, zugleich Leiter des Männerbundes bzw. Leiterin des Frauenbundes. Bei der handwerklichen Ausbildung wirkten die Fachleute des Stammes mit: der Fachmann für Steine – der Fachmann für Holz – der Fachmann für Erdarbeiten – der Fachmann für Brücken und Wehre – der Fachmann für Dammbauten – der Fachmann für Bewässerung – der Fachmann für Metallarbeiten. Den praktischen Teil der sexuellen Aufklärung übernahmen männliche und weibliche Absolventen der Buschschule aus dem ärmeren Teil der Bevölkerung, wie es scheint unter dem Druck des Stammes-zauberers und seiner Vertrauten, siehe die Märchen des Typus AT 425 C „Die Schöne und das Tier“.
Der Leidensweg der Zöglinge begann während ihres Aufenthalts in der sogenannten Initiationshütte. Schreckgestalten verekelten ihnen die Speise oder entrissen ihnen das Essen; wer sich wehrte, wurde verprügelt – an den Haaren gezogen – zerkratzt – gewürgt – verbrüht – gefesselt – in ein Loch gesperrt – in den Rauch gehängt, siehe die Märchen vom Starken Hans und den geraubten Königstöchtern (AT 301 B). Man wollte ihre Sinne trüben, damit sie die Begegnung mit dem Tier-Ahnen, der sie angeblich verschlang und ausspie (Wolf, Schwein, Vogel, Schlange, Fisch), für wahr halten, ebenso den Ritus des zeitweiligen Todes und den Abstieg in die Unterwelt. Die Begegnung mit dem Tier-Ahnen, der den Knaben die Fähigkeiten eines großen Jägers verlieh, und das folgende kannibalische Mahl markierten die Aufnahme in den Stamm, damit verbunden war das Eintätowieren der Stammesmarken.
Die Verwandlung in einen Erwachsenen wurde durch das sogenannte Öffnen der Sinne eingeleitet. Zauberer und Hexe blendeten die Zöglinge mit einer ätzenden Flüssigkeit, betäubten sie durch fürchterliche Ohrfeigen und machten sie durch einen Stich in die Zunge zeitweilig sprachlos. (Die Erinnerung an die Beschneidung hat das europäische Märchen nicht bewahrt.9) Dann wurden sie mit einem Gift betäubt, daran erinnern der Apfel, von dem Schneewittchen kostet, sowie die Spindel, mit der Dornröschen sich verletzt. In der mündlichen Überlieferung lassen sich drei Formen der – imaginären – Umwandlung in einen Erwachsenen erkennen: (1) Zauberer und Hexe öffnen den Leib des Kandidaten und ersetzen Organe, z.B. die Leber. (2) Der Kandidat wird zerstückelt, das Fleisch durch Kochen von den Knochen gelöst und ersetzt. (3) Der Kandidat wird verbrannt.
Erstaunlicherweise hat sich die Erinnerung an die wohltuende Wirkung eines der oben genannten Verfahren in einigen Gebieten Böhmens bis in die Neuzeit erhalten, wo der Ritus in Form eines Heischegangs fortlebte. In Miletice bei Velvary etwa sind bis Mitte des 19. Jahrhunderts am Heiligen Abend zwei weibliche Masken aufgetreten, Peruchten genannt, welche an einem Burschen das Aufschneiden der Bauchhöhle und das Ersetzen der Gedärme durch Erbsenstroh mimten.10 Es besteht ein kategorischer Unterschied zwischen dieser als wohltätig anerkannten Handlung und dem vergleichbaren Eingriff der mythischen Bercht, die ihren Opfern die Leibeshöhle mit Kehricht, Backsteinen, Flachs, Werg oder Erbsenstroh füllt. Auf die Schreckenszeit in der Initiationshütte folgte der als Mutprobe ausgegebene Abstieg in die Unterwelt. Die Zöglinge kletterten an einem Seil in einen Schacht, der in einen künstlich aufgeworfenen Hügel führte, am Schachtgrund stellte ein Stollen die Verbindung zur Außenwelt her. Dieser Tunnel kommt bei zwanzig Märchentypen unter verschiedenen Namen vor. Oft heißt er Brunnen. Am merkwürdigsten ist die Bezeichnung Nabel der Erde (buricul pământului), die man in etlichen rumänischen Märchen findet, weil im alten Griechenland das Wort Nabel (omphalos) eine geläufige Bezeichnung der Hades-Eingänge war und weil der Ort, an dem Persephone angeblich in die Unterwelt verschleppt wurde, Nabel Siziliens (Umbilicus Siciliae) heißt. Die Gehilfen des Zauberers erschreckten die Zöglinge durch unheimliche Geräusche, durch Wassergüsse, Rauch, Wespenschwärme, Schlangen und Ratten. Im mecklenburgischen Märchen „Der Drachentöter“11 (AT 303 + 301 A) blecken Löwen die Zähne.12
In der europäischen Überlieferung bestehen gewöhnlich Knaben dieses traumatische Abenteuer, und damit bietet sie ein schiefes Bild, weil die Mädchen derselben Mutprobe unterworfen worden sind. Im niedersächsischen Märchen „Muschetier, Grenadier und Pumpedier“13 (AT 301) entführen drei Riesen drei Königstöchter und lassen sich an einem Seil tief in die Erde hinab. Vermutlich sind die Mädchen gleich den Knaben an einem Seil in die Tiefe geklettert. – Im holsteinischen Märchen „De witt Wulf“ 14 (AT 425 A) verstellen der Heldin im gläsernen Berg Ottern und Schlangen den Weg. – Im sizilianischen Märchen „Vom Re Porco“ 15 (AT 425 A) wandert sie vier Jahre, vier Monate und vier Tage unter der Erde. – Im Nenzen-Märchen „Der Quappfisch und die Prinzessin Marja“16 (AT 425 A) versuchen Schreiende, Weinende, Singende und Lachende die Heldin abzulenken und aufzuhalten, in ihre Füße und in ihren Kopf pressen sich spitze Eisenzacken; völlig erschöpft und blutend erreicht sie den Ausgang.
Parallel zu der Vorstellung von einer Unterwelt unter dem Erdboden gab es im Alten Europa, und zwar bei den Samen und bei den Slawen, die Vorstellung von einem Totenreich am Grunde der Gewässer. Im serbischen Märchen „Das Kind und der Teufel“17 (AT 325) springt die Zauberer-Gestalt mit dem Helden ins Wasser (wobei man sich vorstellen muss, dass der Stammeszauberer mit seinem Opfer an einer vom Publikum nicht einsehbaren Stelle auf das Ufer zurückkehrte). Angeblich weilten die Initianden bis zu ihrer Entlassung in der Tiefe des Wassers.
In der vermeintlichen Unterwelt galten die Zöglinge als gestorben und trugen zeitweilig Tier-Masken (entsprechend ihrem Totem), weil sich die Menschen nach ihrem Tod gemäß einer weltweit verbreiteten Vorstellung in Tiere verwandelten. Abweichend davon kommt in europäischen Märchen auch die Verwandlung in Pflanzen vor, man denke an das „Rätselmärchen“ der Brüder Grimm (KHM 160), in dem drei Frauen in Blumen verwandelt sind, und an das russische Märchen „Die Birke und die drei Falken“18 (AT 400).
Den Unterricht in der Buschschule geben die europäischen Märchen insgesamt nur bruchstückhaft wieder. Man erkennt es am besten durch einen Vergleich mit dem Bericht von Martin Gusinde, der im Feuerland als Zögling an der Jugendweihe der Yámana teilnahm.19 Auch der Bericht von Diedrich Westermann über die Ausbildung der Knaben und Mädchen bei den Kpelle in Liberia ist aufschlussreich. Ihm ist es gelungen, seinen Gesprächspartnern durch geschickt gestellte Fragen Geheimnisse zu entlocken.20 Aus den europäischen Märchen erfahren wir nichts über Gebote und Verbote, Regeln der gegenseitigen Hilfe, Lieder und Tänze mit magischer Kraft, die Beziehungen zu anderen Stämmen. Nur ausnahmsweise wird der Unterricht direkt dargestellt wie im dänischen Märchen „Der Prinz und der Wassermann“ (AT 314), wo der Held den Wassermann täglich begleiten muss, um ihm beim Säen und Pflanzen zu helfen, sodass er bald sehr geübt in der Gärtnerkunst ist.21 Sehr viel öfter müssen wir aus den sogenannten schweren Aufgaben auf den Inhalt des Unterrichts schließen.
In der Buschschule lernten die Knaben und Mädchen u.a. wie man eine Hütte baut – wie man einen Wald rodet – wie man ein von Steinen übersätes, von Disteln überwuchertes Brachfeld in einen Acker verwandelt – wie man die Körner der Nutzpflanzen von Unkrautsamen trennt – wie man einen verlandeten Fischteich vom Schlamm säubert und neu mit Fischen besetzt – wie man eine Brücke baut. All diese Lernziele kommen in den Märchen in Form von schweren Aufgaben vor, wobei sämtliche Forderungen maßlos übertrieben sind. Der Held bzw. die Heldin soll allein eine Arbeit verrichten, die üblicherweise von einer Gruppe erledigt wird, überdies mit untauglichem Werkzeug und innerhalb eines Tages oder einer Nacht. Zum Beispiel: Im Märchen soll nicht eine Hütte erbaut und eingerichtet werden, sondern ein Schloss. – Es soll nicht ein Baum gefällt werden, sondern ein ganzer Wald. – Es soll nicht ein Topf Körner ausgelesen werden, sondern tausend Säcke. – Die zu erbauende Brücke soll über das Meer führen und aus Kristall sein.
Der Held könnte die Aufträge des bösen Zauberers nicht bewältigen, wenn ihm dessen jüngste Tochter nicht heimlich mit ihren Hexenkünsten zu Hilfe käme. Manchmal bietet sie eine Schar von Geistern auf, in der wir die Gruppe von Zöglingen erkennen, so ist es in der rumänischen Überlieferung vom „Märchenprinzen und der Tochter des Nordostwinds“22 (AT 313). Im karelischen Märchen „Der Bärenjunge“ 23 (AT 425 A) ruft der Held ein Rudel Bären zu Hilfe, die sich im Nu in stattliche Burschen verwandeln und nach seinen Wünschen fragen. Analog dazu bietet der Held im belorussischen Märchen „Der Krebs als Zarensohn“24 (AT 425 A) Fische und Krebse auf und erteilt ihnen Aufträge. Im sizilianischen Märchen „Von der Schwester des Muntifiuri“25 (AT 403) kommt dem Helden eine Schar Mädchen zu Hilfe, als er über Nacht erst einen Springbrunnen errichten, dann einen Garten bepflanzen soll, in dem die Bäume und Blumen der ganzen Erde vertreten sind.
In den Varianten des Märchentypus AT 402 „Die Katze als Braut“ beobachten wir, wie die als Äffinnen, Frösche, Mäuse oder Ratten maskierten Mädchen unter Anleitung einer Lehrerin spinnen, weben, nähen, backen, töpfern und schmieden.
Mit Sicherheit lernten die Zöglinge auch tanzen wie in Afrika. In einigen Varianten des Märchentypus AT 306 „Die zertanzten Schuhe“ treffen sich Mädchen aus mehreren Ortschaften nicht mit verwunschenen Prinzen oder mit Teufeln, sondern mit einer Frau, die sich durch den Besitz des Weltenspiegels26 als Abbild der Stammeszauberin und Schulleiterin ausweist, um von ihr zu lernen. Es handelt sich um Tänze mit magischer Wirkung, wobei jeder falsche Schritt verhängnisvoll sein kann, aber davon erfahren wir nichts. In Afrika mussten die aus der Buschschule entlassenen Knaben und Mädchen nach ihrer Rückkehr ins Dorf vor der versammelten Dorfgemeinschaft eine Probe ihrer Tanzkunst geben, von deren Gelingen ihr Ruf abhing. Und siehe da, manche Varianten des Märchentypus AT 402 „Die Katze als Braut“ haben diese Prüfung konserviert. Die Braut des Helden tritt vor die Gäste und tanzt, ganz gleich, ob sie vorher zu einer Maus, Fröschin, Bärin oder Äffin verzaubert war. Dieses Motiv kommt in Varianten vor, die von den Bretonen im Westen bis zu den Uiguren im Osten erzählt worden sind. In einer ukrainischen Variante lädt der Zar zum Tanz ein.
Da schritt sie mit Iwan-Zarewitsch zum Tanz, und als sie tanzte, berührte sie kaum die Erde, so leicht und so schön tanzte sie. […]27
Als Zeugnis erhielten die Absolventen einen kugelförmigen Gegenstand von der Größe eines Apfels und ein Tüchlein, die bei der Eheschließung vorgezeigt werden mussten. Diese zwei Gegenstände werden in zahlreichen Märchen im Vorfeld der Hochzeit erwähnt, allerdings nicht sachlich definiert.
Die Buschschule ist in zwei Wellen aus dem gesellschaftlichen Leben verschwunden: zuerst am Ausgang der Bronzezeit, dann im frühen Mittelalter. Meines Wissens wurden die Ursachen für diesen Vorgang bisher nicht untersucht. Vermutlich hängt er mit Veränderungen im wirtschaftlichen Leben zusammen.
Ursprünglich umfassten die Stämme gleichberechtigte Sippen von Jägern und Fischern, aber im Laufe der Jahrhunderte fand eine vertikale und eine horizontale Differenzierung statt. Deshalb dürften die Menschen auf die gemeinsame Erziehung ihrer Kinder verzichtet haben.
Die Anfänge der vertikalen Differenzierung reichen weit zurück in die Vergangenheit. Das hat u.a. die Erforschung eines kupferzeitlichen Siedlungshügels in der Donautiefebene ergeben, der ab etwa 4600 v.Chr. mehr als drei Jahrhunderte lang bewohnt war. Er heißt Măgura Gorgana und befindet sich im Süden Rumäniens, bei dem Dorf Pietrile, nahe der Donau. Auf dem Hügel lebte eine Oberschicht in Häusern mit besonderer Ausstattung, zu der Jagdwaffen und bis zu 30 Zentimeter lange Feuersteinklingen gehörten, während sich rings um den Hügel eine viel ältere und bescheidener ausgestattete Außensiedlung befand.28 Die horizontale Differenzierung durch Arbeitsteilung war schon innerhalb der sogenannten Donauzivilisation im 5. Jahrtausend v.Chr. ausgeprägt.29 Deren Gesellschaft bestand aus Bauern, Webern, Töpfern, Schmieden und Händlern; die Tätigkeit der Schmiede setzt Bergarbeiter, der Handel entlang der Flusstäler Bootsbauer voraus. Viehzucht, Getreidebau und Metallverarbeitung ermöglichten die Akkumulation, die zu einer Spaltung in Arm und Reich führte, weil mangelnder Sachverstand oder Unwetter oder Krankheiten bei Teilen der Bevölkerung Verarmung und Elend bewirkten. Infolgedessen bildeten sich zwei Hauptklassen: Bauernschaft und Adel. Diese Spaltung ist einerseits in burgartigen Festungen greifbar, andererseits in den Grabbeigaben, die große Unterschiede aufweisen. Die Archäologen registrierten sie auf einem Gebiet, das sich vom Balkan über die Slowakei und Böhmen bis Mittel- und Süddeutschland erstreckt, von der Iberischen Halbinsel über Frankreich bis zu den Britischen Inseln.30
Es liegt nahe, dass dieses Gebiet dem Areal entspricht, auf dem die Buschschule in der Späten Bronzezeit aus der sozialen Wirklichkeit verschwunden ist. Wir dürfen von einem ausgedehnten Areal sprechen, weil die Märchen zahlreiche voneinander abweichende Angaben zur Jugendweihe enthalten:
Wir unterscheiden drei Formen, was das Geschlecht der Teilnehmer betrifft, nämlich: ausschließlich Knaben (AT 451), ausschließlich Mädchen (AT 402) und die gemischte Gruppe (AT 301, 303 A, 313, 325).
Es zeichnen sich mehrere Möglichkeiten ab, wie der Initiand aus dem Elternhaus zur Initiationsstätte gelangte: Er wurde dem Schulleiter bzw. der Schulleiterin übergeben (AT 314, 325, 710). – Die Gruppe der Initianden folgte einer Tier-Maske (AT 303, 311, 313, 405); solche Masken verkörpern Hirsch, Fuchs, Kater, Schwein, Eule. – Man führte das Kind bis in die Nähe der Initiationsstätte, die letzte Wegstrecke bewältigte es allein (AT 502, 709 und rumänische Balladen, die Monica Brătulescu analysiert). – Der Initiand legte den Weg allein zurück (AT 313). – Die Schulleiterin griff sich das Mädchen mit Einverständnis der Eltern (AT 310). – Der Schulleiter und seine Gehilfen inszenierten eine Entführung der Mädchen (AT 301, 302).
Wir stellen fest, dass Knaben und Mädchen in manchen Fällen gleichzeitig an der Jugendweihe teilnahmen und als künftiges Ehepaar nach Hause zurückkehrten (AT 301 und 303 A), während der Knabe in anderen Fällen früher initiiert wurde als seine Braut oder an einem anderen Ort initiiert wurde, denn er holte sie von der Initiationsstätte ab (AT 402, 408, 409 A).
Gemäß einer Vorstellung befanden sich die Initianden während der Ausbildungszeit unter dem Erdboden, gemäß einer anderen in der Tiefe eines Gewässers.
Der Tunnel im künstlich aufgeworfenen Hügel, der angeblich in die Unterwelt führte, weist zwei Profile auf: a) wie der Großbuchstabe [L] und b) wie ein Kellerhals.
Um die Körper der Initianden zu erneuern, haben Zauberer und Hexe a) sie rituell verbrannt und wiederbelebt oder b) sie rituell zerstückelt, gekocht und wiederbelebt oder c) rituell Organe ausgetauscht.
Eine derartige Vielfalt wäre auf einem kleinen Gebiet nicht möglich gewesen.
Parallel zur vertikalen Differenzierung dürfte sich der Männerbund – wie von Heinrich Schurtz und Hutton Webster bei den Naturvölkern beobachtet31 – aus einer Vereinigung, der alle erwachsenen (lies: initiierten) Männer angehörten, in einen elitären Klub verwandelt haben, in den man sich einkaufen musste.
Als die traditionelle Buschschule sich überlebt hatte, richteten Sippen, die am Brauch festhalten wollten, für ihre Töchter Initiationshütten außerhalb des Dorfes ein, wo diese von einer Maske tanzen lernten und von einer Maske rituell defloriert wurden. Wir könnten die spärlichen Belege kaum deuten, wenn dieser Brauch nicht auch in Afrika beobachtet und ausführlich beschrieben worden wäre.32
Eine andere Möglichkeit, um den Brauch fortzusetzen, war die Initiation im Anwesen der Sippe. Im Falle der Knaben ist dieser Ausweg schwach belegt: Der Held heißt Ascherich oder Aschenhans oder Aschenpeter, weil er zum Unterschied von seinen Brüdern im Herdwinkel sitzt. Im Falle der Mädchen ist der Ausweg durch die Märchen von Aschenputtel (AT 510 A) belegt. Auch in diesem Fall ist eine sachliche Interpretation nur möglich, weil ein entsprechender Brauch beim Stamm der Ejagham beobachtet und beschrieben wurde, die zum Volk der Ekoi gehören und teils in Kamerun, teils in Nigeria leben.33
In Mitteleuropa hat sich der Brauch der archaischen Jugendweihe durch ungeklärte Umstände bis ins frühe Mittelalter erhalten, bis zur Verbreitung des Christentums. Mitteleuropa bedeutet Frankreich, die Benelux-Länder, Deutschland, Tschechien, die Slowakei, Österreich, die Schweiz und Südtirol. An den Brauch erinnern die Sagen über Heinzelmännchen, Salige Fräulein und verwandte Gestalten. Von der Verbreitung des Brauchs zeugt einerseits die Unzahl der Sagen, andererseits die Vielfalt der Bezeichnungen, die sich nach den Landesteilen, nach dem Aufenthaltsort der Protagonisten und nach ihren Hilfstätigkeiten unterscheiden.
Im Emsland nannte man die Helfer Aulken, in Osnabrück Sgönaunken, in Thüringen Gupel, Heimchen, Zinselmännchen, Böhlersmännchen, Schlätzla oder Hütchen, in der Lausitz Lutken, im Bayerischen Wald Schrazen, in Tirol Orgen, in den Ostalpen Fänggen, in der Schweiz Schrätteli. Nach dem tatsächlichen oder angeblichen Aufenthaltsort während der Jugendweihe heißen die Helfer im Märchen Unterirdische, Erdmännlein, Seemännlein, Moosmännlein, Bergmännchen bzw. Erdweiblein, Seejungfrauen, Holzweibchen, Holzweiblein, Buschweibchen. Aus anderen Bezeichnungen geht hervor, wie und wo sie sich nützlich machten: Futtermännchen, Futterknecht, Buttermännchen, Dreschmännel, Kasmandl, Kasertörggelen, Sennenzwerg, Almlotterle (Landwirtschaft); Kohlenmandl (Köhlerei); Grubenmandl, Stollenmandl (Bergbau); Erzmännchen, Hüttenmännchen, Hüttenkobold (Metall-gewinnung und -verarbeitung).
In der Ukraine und in Rumänien überlebte der Brauch in Form der Mädchen-Spinnstube bis ins 20. Jahrhundert. Die rumänische Mädchen-Spinnstube hat Monica Brătulescu in einer 23 Seiten starken Studie beschrieben, die 1978 in Bukarest veröffentlicht wurde. An einer Stelle vermerkt sie Überschneidungen mit Riten der Naturvölker.34 Die ukrainische Mädchen-Spinnstube hat Bohdan Georg Mykytiuk in einer Monografie beschrieben, die primär von den Andreasbräuchen handelt. Sie wurde 1979 in Wiesbaden veröffentlicht und umfasst 340 Seiten.35
Seit ihrer Entstehung vor 3.000 Jahren, im Laufe von 120 Generationen, haben sich die Märchen von der Buschschule stark verändert: Die Erzähler glichen die Lebensumstände der Helden beständig ihren eigenen Lebensumständen an. – Sie übersprangen unverständliche Einzelheiten oder deuteten sie um. – Die Abbilder von Stammeszauberer und Stammeshexe, Urheber der grausamen Behandlung in der Initiationshütte, wandelten sich oft zum Gegner des Helden, dann tritt er zum Kampf gegen sie an und bringt sie um.
Diese Entwicklung war nicht frei von Widersprüchen. Betrachten wir beispielsweise die Tierahnen. Als Verschlinger tritt ein Wolf oder ein Schwein in Erscheinung, eine Schlange, ein Vogel oder ein großer Fisch bzw. ein Wal.
Im Rotkäppchen-Märchen (KHM 26, AT 333) ist aus dem Wolf ein Untier geworden, es wird getötet.
Auch aus dem Schwein ist ein Untier geworden, welches den Helden vernichten will, es wird getötet, und zwar von dem zauberkräftigen Schmied, der mit dem Helden verbündet ist (Greuceanu36, rumänisch; Das zweiköpfige Roß37, litauisch; beide AT 300 A).
Der Schlangenkönig verleiht dem Helden, weil der seinen Sohn vor dem Tod gerettet hat, die Kenntnis der Tiersprache, indem er ihn verschlingt und ausspeit (Das Schlangenkind38, rumänisch aus der Walachei, AT 670). Aus den meisten Varianten des Märchentypus AT 670 „Die Tiersprache“ ist dieses Motiv verschwunden. In einem deutschen Märchen aus Siebenbürgen schenkt der Schlangenkönig dem Helden ein Zauberpferd (Der Knabe und die Schlange39, AT 531).
Der [Riesen-]Vogel verschlingt den Helden aus Dankbarkeit, weil der seine Jungen gerettet hat, und als er ihn ausspeit, ist jener schmuck wie ein Königssohn (Das Männchen Sonderbar40, deutsch aus dem historischen Vorpommern, AT 301 A; Held Dunca, der Trunkenbold41, rumänisch aus Siebenbürgen, AT 301 A; Der starke Hans42, deutsch aus Siebenbürgen, AT 511 A + 301).
Die Heldin des Märchentypus „AT 403 „Die weiße und die schwarze Braut“ wird in mehreren Varianten ins Wasser gestoßen und von einem Fisch, Hai oder Wal verschlungen. Um sie zu retten, muss man jenes Tier töten (Von Sabedda und ihrem Brüderchen43, sizilianisch, AT 450 + 403; Das Mädchen mit dem Hirschbruder44, rumänisch aus Muntenien, AT 450 + 403). In einem komplexen ukrainischen Märchen wird der Held von einem Wal verschluckt und lebt ein Jahr lang im Walbauch, bis Jäger das Tier erschießen und zerteilen (Iwan Hatnichtsan und sein Bruder45).
3 Siehe: HANS FINK: Was einmal war. S. 95-163. – Meine UrOma in der Buschschule. S. 7-39. – Im verwunschenen Schloss, im verbotenen Zimmer. S. 34-113. – Heinzelmännchen im Heuboden. – Wer wen heiratet. S. 29-51.
4 Der alte Ellenbart (AT 511 A + 301 B). In: URSULA ENDERLE (Hg.): Märchen der Völker Jugoslawiens. S. 363-377, hier S. 371-372.
5 VLADIMIR PROPP: Die historischen Wurzeln des Zaubermärchens. S. 137-142.
6 Hachko (AT 650 A + 301). In: RÉ SOUPAULT (Hg.): Französische Märchen. S. 242-250, hier S. 249.
7 Die Schmiedstochter und die schwarze Frau (AT 710). In: SIGRID FRÜH (Hg.): Märchenreise durch Europa. S. 73-78, hier S. 76.
8 Nu minţi! (AT 710.) In: ION POP RETEGANUL: Poveşti ardeleneşti. S. 198-201.
9 VLADIMIR PROPP: Die historischen Wurzeln des Zaubermärchens. S. 87.
10 JOSEF HANIKA: „Bercht schlitzt den Bauch auf“ – Rest eines Initiationsritus? S. 42-43.
11 Der Drachentöter (AT 303 + 301 A). In: GOTTFRIED HENSSEN (Hg.): Mecklenburger erzählen. S. 21-24, hier S. 22.
12 Unsere Märchen reichen zurück in eine Vergangenheit, als im Süden des Kontinents noch Löwen und Berberaffen lebten. Die letzten Bestände von Löwen wurden erst rund 200 v.Chr. ausgerottet. Zum Zweck der Mutprobe haben die Gehilfen des Zauberers zwei Löwenfelle ausgestopft.
13 Muschetier, Grenadier und Pumpedier (AT 301). In: WILHELM BUSCH: Aus alter Zeit. S. 37-44, hier S. 38.
14 De witt Wulf (AT 425 A). In: WILHELM WISSER: Plattdeutsche Volksmärchen. Bd. 1, S. 266-274, hier S. 271.
15 Vom Re Porco (AT 425 A). In: LAURA GONZENBACH: Sicilianische Märchen. Erster Teil, S. 285-293, hier S. 289.
16 Der Quappfisch und die Prinzessin Marja (AT 425 A). In: E. POMERANZEWA (Hg.): Die Herrin des Feuers. S. 87-99, hier S. 94-95.
17 Das Kind und der Teufel (AT 325). In: WOLFGANG ESCHKER (Hg.): Serbische Märchen. S. 53-56, hier S. 54.
18 Die Birke und die drei Falken (AT 400). In: ALEXANDER N. AFANASJEW: Russische Volksmärchen. Bd. 2, S. 647-648.
19 MARTIN GUSINDE: Die Jugendweihe. In: Ders.: Urmenschen im Feuerland. S. 260-292.
20 DIEDRICH WESTERMANN: Die Kpelle. S. 241-252; 256-264.
21 Der Prinz und der Wassermann (AT 314). In: HEINZ BARÜSKE (Hg.): Dänische Märchen. S. 187-190, hier S. 188.
22 Făt-Frumos şi fata Crivăţului [Der Märchenprinz und die Tochter des Nordostwinds] (AT 313). In: DUMITRU LAZĂR (Hg.): Fata din dafin [Das Mädchen aus dem Lorbeerbaum]. S. 121-143.
23 Der Bärenjunge (AT 425 A). In: ÉVA PAPP (Hg.): Der Bärenjunge. S. 5-17.
24 Der Krebs als Zarensohn (AT 425 A). In: L. G. BARAG (Hg.): Belorussische Volksmärchen. S. 253-264.
25 Von der Schwester des Muntifiuri (AT 403). In: LAURA GONZENBACH: Sicilianische Märchen. Erster Teil, S. 220-227. – Auch enthalten in: FELIX KARLINGER (Hg.): Italienische Volksmärchen. S. 196-204.
26 Weltenspiegel – ein magisches Gerät in Form einer mit Wasser gefüllten und mit Pflanzenteilen sowie mit Kleintieren besetzten Schüssel. Aus deren Verhalten schloss der Zauberer auf die Zukunft.
27 Die Zarentochter als Kröte (AT 402 + 400). In: P. V. LINTUR (Hg.): Ukrainische Volksmärchen. S. 94-102, hier S. 98.
28 RENATE NIMTZ-KÖSTER: High Society. Ein prähistorischer Siedlungshügel in Rumänien zeigt, wie die Kupferzeit vor 6500 Jahren die Menschheit veränderte. Es bildete sich die erste Klassengesellschaft der Weltgeschichte. In: DER SPIEGEL, Nr. 44/2013. S. 116-117.
29 HARALD HAARMANN: Das Rätsel der Donauzivilisation. S. 113-146.
30 ALBRECHT JOCKENHÖVEL: Bauern und Krieger, Künstler und Händler – Bronzezeitliche Gesellschaft. In: ALBRECHT JOCKENHÖVEL und WOLF KUBACH (Hg.): Bronzezeit in Deutschland. S. 4547. – OTTO SCHERTLER: Die Kelten und ihre Vorfahren. S. 114-115.
31 HEINRICH SCHURTZ: Altersklassen und Männerbünde. Eine Darstellung der Grundformen der Gesellschaft. Berlin: Reimer, 1902. – HUTTON WEBSTER: Primitive Secret Societies. A Study in Early Politics and Religion. [1908.] Second edition, revised. New York: Macmillan, 1932. Siehe die Kapitel VI und VII.
32 EVA MAHONGO RAUTER: Das Mädchen lernt tanzen. Die weibliche Initiation bei den Luvale. In: MARIE-JOSÉ VAN DE LOO und MARGARETE REINHART (Hg.): Kinder. S. 348-365.
33 UTE RÖSCHENTHALER: Die Kunst der Frauen. S. 57-63.
34 MONICA BRĂTULESCU: Ceata feminină [Die Mädchen-Schar]. Siehe S. 51.
35 BOHDAN GEORG MYKYTIUK: Die ukrainischen Andreasbräuche und verwandtes Brauchtum.
36 Greuceanu (AT 300 A). In: PETRE ISPIRESCU: Legende sau basmele românilor. Bd. 1, S. 203-213, hier S. 210. Siehe auch: SIGRID FRÜH (Hg.): Der goldene Held Dragan. In: Dies: Das Zauberpferd. S. 93-97, hier S. 96-97.
37