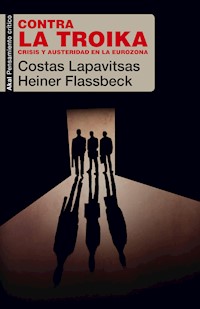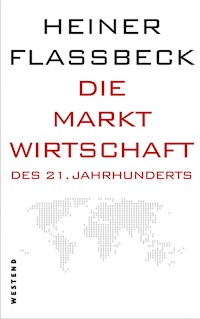
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Westend
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Ein neues Wirtschaftswunder ist machbar. Ohne Idee und ohne wirtschaftspolitische Kompetenz treiben die Regierungen der Industrieländer auf dem von den Finanzmärkten verwirbelten Strom der Weltwirtschaft: Wachstum wollen sie, aber auch Klimaschutz; die Konjunktur wollen sie anregen, aber auch die öffentlichen Haushalte konsolidieren; freien Handel wollen sie, verstehen ihn aber nicht; die Finanzmärkte wollen sie regulieren, wissen aber nicht wie. Die Politik scheitert. Die Industrieländer wissen nicht mehr, wie man die freie Entwicklung der Menschen zulässt, den Fortschritt aber ökologisch und sozial so sichert, dass nachhaltiges Wirtschaften möglich ist. Heiner Flassbeck zeigt, dass die Teilhabe aller Bürger am gemeinsam erarbeiteten Fortschritt notwendig ist, um erfolgreich zu sein. Er erklärt, warum Ökonomen, Politiker und Medien versagen, und zeigt, wie ein neues Wirtschaftswunder möglich wird, wenn man die vier großen Bereiche der Finanzen, des Handels und der sozialen und ökologischen Absicherung richtig miteinander verknüpft. Er macht Hoffnung, fordert aber gleichzeitig eine fundamentale politische Wende, bei der die Parteien- und Lobbydemokratie radikal reformiert wird.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 333
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ebook Edition
HEINERFLASSBECK
DIE MARKT WIRTSCHAFT
DES 21. JAHRHUNDERTS
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.westendverlag.de
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie. Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere fürVervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
ISBN 978-3-938060-81-0
© Westend Verlag Frankfurt/Main
in der Piper Verlag GmbH, München 2010
Satz: Fotosatz Amann, Aichstetten
Druck und Bindung: CPI - Clausen & Bosse, Leck Printed in Germany
Inhalt
Vorwort
Große Krisen, kleine Politik
Die großen Krisen
Finanzkrise
Sozial- und Armutskrise
Handelskrise
Klimakrise
Schuldenkrise
Die Ökonomen finden niemals die richtigenAntworten
Der heilige Freihandel
Falsche Preise und die kognitive Dissonanz der Ökonomen
Der falsche Lohn
Der falsche Wechselkurs
Der falsche Zins
Sparen und Investieren und der Zins
Deflation, Inflation und die Geldmenge
Der falsche Rohstoffpreis
Das Versagen der Ordnungspolitik
Der Wettbewerb als Dogma
Die angemessenen Antworten
Spekulation aufallen Märkten konsequent unterbinden
Teilhabe aller Menschen am gemeinsam erarbeiteten Fortschritt ermöglichen
Wettkampf der Nationen beenden
Die natürliche Welt retten
Für eine neue nationale und internationale Politik
Eine Chance für Europa
G 20 und die deutsche Isolation
Demokratie und Volkswirtschaft - der natürliche Gegensatz?
Anmerkungen
Literatur
Vorwort
Am Ende der 60er Jahre des vorigen Jahrhunderts zählte es zu den unumstößlichen Weisheiten, dass die Marktwirtschaft, die in Deutschland praktizierte soziale Marktwirtschaft zumal, ein System sei, das für alle Zeiten Wohlstand und Vollbeschäftigung garantieren könne. Eine Entwicklung mit hohen Wachstumsraten, großer monetärer Stabilität und voll ausgelasteten Arbeitskräften wurde einfach als Normalfall des Wirtschaftens mit Hilfe von Märkten empfunden. Märkte erschienen den meisten trotz vieler Mängel als der einzig effiziente Weg, Knappheiten richtig zu signalisieren und Anreize für Wohlstandsmehrung zu geben, wenn der Staat nur den richtigen Rahmen setzte.
Doch man hatte offenbar nicht wirklich verstanden, welche Grundelemente nötig sind, um das Wirken der Marktkräfte zu einem so vorteilhaften Ergebnis zu führen, denn schon Anfang der 1970er Jahre, wenige Jahre nach dem Ende des globalen Währungssystems, nach einem kleinen Ort in New Hampshire »Bretton Woods« genannt, zeigte sich die Marktwirtschaft von der Seite, die ihr eigentlich innewohnt, wenn der staatliche Rahmen nicht vollständig stimmt. Nicht ruhige und stabile Vorwärtsentwicklung ist die Normalität, sondern sind Schocks und Krisen, die nur von kurzen und eher zufälligen Phasen stabiler Prosperität unterbrochen werden.
Nichts könnte besser als die vergangenen beiden Jahre demonstrieren, wie anfällig das marktwirtschaftliche System ist, wenn den Marktkräften jeder Raum zur »Entfaltung« gelassen wird. Wir müssen beginnen zu verstehen, dass es eine einmalige Leistung der Nationen der Welt nach dem Zweiten Weltkrieg war, unter der geistigen Führung eines großen Ökonomen eine Ordnung zu schaffen, die immerhin zwei Jahrzehnte Bestand hatte und bereits als »goldenes Zeitalter« in die Geschichtsbücher eingegangen ist. Als diese Ordnung zerbrach, entstand nichts, das sie hätte ersetzen können. Ohne eine internationale Geldordnung, wie sie John Maynard Keynes erdacht hatte, ist alles Übrige Makulatur. Weder funktioniert der internationale Handel, noch haben die Nationen der Welt die Möglichkeit, sich konstruktiv in die internationale Arbeitsteilung einzubringen, noch können sie intern die Weichen richtig stellen für anhaltende Prosperität.
Die politischen Beobachter in Deutschland haben sich früh die Chance genommen, diese Zusammenhänge zu verstehen, weil sie Keynes schon bald als Gegner der Marktwirtschaft dämonisierten und weil sie, wie allzu oft in ihrer Geschichte, alle Erfolge allein auf deutsche Anstrengungen zurückführten. Ihren Ausdruck fand diese Vorstellung im Begriff des »deutschen Wirtschaftswunders«, das eng mit dem Namen von Ludwig Erhard verknüpft wurde. Der internationale Kontext des wirtschaftlichen Erfolges wurde konsequent in den Hintergrund geschoben, obwohl das »Wunder« der ersten beiden Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg ein internationales Wunder war und sich sofort in Luft auflöste, als die Zentralbank in Frankfurt das monetäre Ruder übernahm.
Nach Bretton Woods zerbricht jetzt gerade die Europäische Währungsunion. Es scheint, dass die Steuerung komplexer ökonomischer Systeme die Politik überfordert. Offenbar war es nur der historische Zufall, dass das Endes des großen Krieges mit den neuartigen ökonomischen Ideen von John Maynard Keynes, die von der großen Depression geprägt waren, zusammentraf, der der Welt zwei Jahrzehnte Verschnaufpause gab.
Als eine neu gewählte sozialdemokratisch geführte Regierung 1998 begann, Ideen für eine neue Finanzarchitektur der Welt in die Tat umzusetzen, wurden diese Protagonisten in der ganzen Welt als Ketzer und gnadenlos Gestrige verschrien. Nur ein Dutzend Jahre später fordert eine konservative Kanzlerin Angela Merkel eine Finanztransaktionssteuer, und der demokratische amerikanische Präsident Barack Obama besinnt sich der Regulierungen, die nach der großen Depression vor 80 Jahren notwendig gewesen und dennoch nur wenige Jahre vorher von einem anderen demokratischen Präsidenten namens Bill Clinton über Bord geworfen worden waren.
Trotz dieser Ansätze ist Optimismus fehl am Platz. Die Angst der Regierungen vor den »Finanzmärkten« und ihre mangelnde Bereitschaft, die komplexe Lage unvoreingenommen zu analysieren, bieten wenig Hoffnung. Europas Währungsordnung steht vor dem endgültigen Scheitern, und eine internationale Währungsordnung ist noch nicht einmal am Horizont erkennbar. Derweil drohen Deflation und ein Rückfall in die Rezession. Eine neue Runde im Kampf der Nationen ist zu erwarten, und die Umweltprobleme unserer Erde sind vollkommen unbewältigt. Die Zeit wird knapp. Zu sagen, es sei fünf vor zwölf, wäre eine unverantwortliche Verharmlosung des Zeitdrucks.
Die diversen Krisen, durch die unsere globalisierte Wirtschaft geht, haben eine gemeinsame Wurzel. Es ist die Unfähigkeit der Ökonomen, die Welt angemessen zu deuten. Weil sich die herrschende Meinung in der Lehre von der Wirtschaft weit von der Realität entfernt hat, ist es sozusagen notwendig, das Rad neu zu erfinden, um eine geeignete Richtschnur in die Zukunft zu spannen. Daher ist in diesem Buch zwischen der Analyse der Krisen und den Vorschlägen zu ihrer Bewältigung zu lesen, warum man die Welt nicht verstehen kann, wenn man nur ökonomische Standardwerke kennt.
Auch dieses Buch wäre nicht entstanden ohne die vielen Menschen, die mich fast täglich ermutigen, mit meiner Aufklärungsarbeit fortzufahren. Wann immer ich versuche, Zusammenhänge aufzudecken und möglichst gradlinige Schlussfolgerungen zu ziehen, finde ich extrem viel Interesse, ja geradezu einen Hunger nach dieser Art von Analyse. Deswegen will ich noch einmal den Versuch machen, eine realistische und dennoch optimistische Perspektive für das neue Jahrhundert zu entwickeln.
Wo es um die großen Fragen der Menschheit geht, ist kleinkariertes Gezänk der Ökonomen oder der Politiker sicher unangemessen. Aber weil es um so große Fragen geht, sollte man auch nicht so tun, als könnte man das Herz dem Verstand vollkommen und jederzeit unterordnen. Folglich wird meine Sprache nicht immer der eigentlich gebotenen Sachlichkeit Rechnung tragen, sondern auch Zuspitzung, Ironie und gar Polemik enthalten. Es liegt mir jedoch fern, irgendjemanden zu beleidigen oder zu verletzen. Manchmal muss man die Dinge aber mit Verve benennen, um einer von Medien überfütterten Öffentlichkeit klarzumachen, was man für fundamental falsch hält.
Auch dieses Buch hat Friederike Spiecker und Stephanie viel zu verdanken. Die verbliebenen Fehler gehen allein zu meinen Lasten.
Große Krisen, kleine Politik
Sind die deutsche und die internationale Politik den globalen Herausforderungen gewachsen? Als die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel im Oktober 2009 ihre Regierungserklärung abgab, war die entscheidende Botschaft, dass diese Regierung das Wachstum wieder beleben wolle. Als die Kanzlerin aber später gefragt wurde, aufweiche Weise sie das zu tun gedenke, fielen ihr genau zwei Punkte ein: Steuersenkung und Bürokratieabbau.
Steuersenkung und Bürokratieabbau - das soll das Geheimnis einer im Jahr 2009 installierten deutschen Regierung sein? Kann es sein, dass 30 Jahre nach Helmut Kohl und seiner geistig-moralischen Wende erneut eine schwarz-gelbe Regierung nichts anderes im Sinn hat, als genau das zu tun, was Helmut Kohl schon wollte und womit er grandios gescheitert ist? Nichts zeigt besser als dieser geistige Offenbarungseid, dass genau die Politiker, die Marktwirtschaft und Wettbewerb ständig im Mund führen, beide Konzepte in keiner Weise verstanden haben.
Auch berufen sich Politiker fast aller Couleur gerne auf Ludwig Erhard, den »Vater« des deutschen Wirtschaftswunders, um zu erklären, wie sie erfolgreich sein wollen. Sie wollen die Marktwirtschaft wieder beleben. Sie wollen ein Wachstum, das von den Unternehmen getragen wird und das verlangt - so ihre feste Überzeugung -, dass man diesen Unternehmen größtmögliche Freiheit gibt. Anders als Ludwig Erhard wissen sie aber nicht, welche entscheidende Rolle der Staat spielen muss, damit Wohlstand entstehen kann.
Wenn 30 Jahre nach dem Versuch der konservativen Parteien, ein Wirtschaftswunder zu wiederholen, und nach dem erfolglosen Versuch, das Wirtschaftswunder auf Ostdeutschland zu übertragen, wiederum eine konservativ-liberale Regierung nichts anderes im Sinn hat, als über Steuersenkungen und Bürokratieabbau ein »Wirtschaftswunder« in Gang zu setzen, dann läuft etwas fundamental schief in diesem Land.
Gibt es keine andere Politik, mit der man eine Wirtschaft beleben und am Laufen halten kann? Gibt es keinen größeren Plan, keine größeren Instrumente, mit denen man dafür sorgen kann, dass Unternehmen investieren und Arbeitsplätze schaffen? Ist das die Idee für ein gesellschaftliches System, in dem wir auf Dauer leben wollen und können? Ein System, in dem es nur diese beiden Instrumente gibt, um die Wirtschaft mit der Natur in Übereinstimmung zu bringen, um Menschen ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen, um den Bürgern die Teilhabe am Fortschritt der Gesellschaft zu erlauben? Das kann und das darf nicht wahr sein!
Es wird sich im Laufe dieses Buches immer wieder zeigen, dass unsere Politiker nicht sehen, dass die Marktwirtschaft nur überleben kann, wenn wir ein System schaffen, das nicht dazu da ist, einigen Wenigen Reichtum zu ermöglichen, sondern das genau umgekehrt gestrickt sein muss: Wer allen Bürgern eine systematische Chance auf die Verbesserung ihrer Lebensumstände gibt, kann es hinnehmen, dass im Zuge dessen ein paar Wenige etwas reicher werden als die Anderen.
Stattdessen wird heute schon die Tatsache, dass der Bürger überlebt, ohne zu hungern und vollständig aus der Gesellschaft ausgeschlossen zu werden, als Beweis dafür genommen, dass die Marktwirtschaft sozial ist. Es geht nicht mehr um die Teilhabe der Menschen am Fortschritt, sondern es geht nur noch darum, dass der »Leistungsträger« angemessen entlohnt wird und der Rest nicht vollständig unter den Tisch fällt.
Dieses System fährt gegen die Wand. Dieses System wird die nächsten Jahre nicht überleben. Die Verzweiflung der Bürger und die Frustration der Wähler mit den Parteien hat ohnehin schon dazu geführt haben, dass die Masse nicht mehr versteht, warum sie dieses und nicht ein anderes System gewählt hat. Deswegen müssen wir die Marktwirtschaft für das 21. Jahrhundert neu erfinden. In der Tat, es geht um ein Wirtschaftswunder. Aber ein neues Wirtschaftswunder wird nicht gelingen, wenn wir nicht begreifen, was die entscheidenden Bestandteile des damaligen Wirtschaftswunders waren und wie sie in die heutige Zeit versetzt werden können.
Dabei darf man allerdings nicht nur bei nationalen Befindlichkeiten und Lösungen verharren. Ein integraler Bestandteil der neuen sozialen Marktwirtschaft muss die Fähigkeit der Nationen sein, miteinander harmonisch umzugehen. Auch das war, wie im Vorwort erwähnt, ein vergessener Teil des alten Wirtschaftswunders, das mit dem Namen von John Maynard Keynes verbunden sein sollte. Es war nämlich dieser John Maynard Keynes, der entscheidend dazu beigetragen hat, dass das alte Wirtschaftswunder möglich wurde, und zwar nicht nur als Wirtschaftswunder für Deutschland, sondern als Wirtschaftswunder für fast die gesamte Welt. Dieser Grundgedanke ist heute noch viel wichtiger als vor 60 Jahren. Wenn es nicht gelingt, den Wettkampf der Nationen zu beenden, um zurückzukehren zu einer Welt, in der Handel keine Einbahnstraße ist, dann können wir national tun und lassen, was wir wollen, es wird nichts nützen.
Die unmittelbaren Folgen der Kapitulation der Politik vor den Unternehmern habe ich in meinem Buch Gescheitert an vielen Beispielen geschildert. Das wirtschaftliche System versagt, weil es nicht mehr aus einem Zusammenspiel von unabhängiger Politik, Unternehmertum und Arbeitnehmerinteressen gebildet wird, sondern weil die Politik von vornherein darauf ausgerichtet ist, die Arbeitnehmer zu schwächen und die Unternehmer zu stärken.
Nun mag man sagen, das sei ja klar, Geld regiert die Welt. Und doch ist das nicht ganz richtig. Die Duldungsstarre, mit der die Gewerkschaften ihren Niedergang verfolgt und hingenommen haben, die Unfähigkeit der Linken, eine alternative Politik zu definieren, und die Sprachlosigkeit weiter Teile des aufgeklärten Bürgertums erklären sich nicht allein mit dem Geld und dem Einfluss der Unternehmer.
Vieles erklärt sich erst, wenn man das »Weltbild« zur Kenntnis nimmt, das die übergroße Mehrheit der Ökonomen in den letzten 30 Jahren von der Wirtschaft geschaffen hat. Ohne das dauernde ideologische Trommelfeuer der herrschenden Auffassung in der Volkswirtschaftslehre hätte es diesen klaren Sieg des Neoliberalismus niemals gegeben. Nun kann man natürlich wiederum sagen, auch die Ökonomen waren alle gekauft - es gibt Anzeichen dafür, dass das bei nicht wenigen der Fall war -, aber auch das ist nicht der einzige Grund. Wie hätte es sonst dazu kommen können, dass auch viele Linke und honorige Keynesianer, die sicher nicht gekauft sind, dem Irrglauben anhängen, der Arbeitsmarkt funktioniere wie der Kartoffelmarkt?
Wir machen es uns zu leicht, wenn wir alles mit Konspiration erklären wollen. Natürlich gibt es Macht, natürlich gibt es massive Einflussnahme auf die Politik. Aber das würde die Welt nicht in der Art und Weise beeinflussen, wie wir es sehen, wenn die große Mehrheit der Ökonomen die Welt ganz anders deuten würde. Nein, machen wir uns nichts vor: Wenn selbst die linken Ökonomen und Politiker nicht in der Lage sind, die traditionellen Vorstellungen vom Funktionieren des Arbeitsmarktes radikal über Bord zu werfen - um nur ein wichtiges Beispiel zu nennen -, ist es müßig, über die große Konspiration der Arbeitgeber zu philosophieren.
Schließlich, und das ist für mich das zentrale Argument, würden die Konservativ-Liberalen eine völlig andere Politik machen, wenn sie das System verstehen und systematisch zu Gunsten der Unternehmer ausnutzen wollten. Denn das, was wir in den letzten Jahrzehnten, sowohl von schwarz-gelber wie von rot-grüner Seite gesehen haben, war auch für die Unternehmen keine gute Politik. Es war für die Mehrzahl der Unternehmen sogar eine Katastrophe, denn Deutschland war bis zum Jahre 2003 das absolute Wachstumsschlusslicht in Europa und hat nur Dank eines einseitigen Exportbooms in den Jahren danach eine gewisse Erleichterung erfahren. Die Investitionen in Sachanlagen sind überhaupt nicht gestiegen, im deutschen Binnenmarkt sind haufenweise Unternehmen pleite gegangen, der berühmte deutsche Mittelstand ist in erheblichen Teilen ruiniert, und nur die großen Exportunternehmen waren die Gewinner der vollkommen fehlgeleiteten und merkantilistischen deutschen Politik.
Wenn die Politiker das System verstehen würden, würden sie es nicht in große Krisen geraten lassen. Dem Hype um die Finanzmärkte folgte die Krise der Finanzmärkte. Wäre ein Politiker, der diese Märkte und ihre Refugien schützen will, mit offenen Augen in die Krise gelaufen? Sicherlich nicht! Hätte ein Politiker, der den deutschen Exportunternehmen auf Dauer Gutes tun will, die Krise des Euro angezettelt, in der am Ende die einzige Lösung sein wird, dass die deutschen Unternehmen klein beigeben und ihre Marktanteile wieder abgeben?
Nein, diejenigen, die versuchen, durch Aufklärung die Dinge voranzubringen, dürfen nicht aufgeben. Man darf sich nicht entmutigen lassen von den scheinbaren Misserfolgen, von den dicken Brettern vor den Köpfen, natürlich auch nicht von der Macht derer, die glauben, die Welt kaufen zu können.
Dennoch, realistisch muss man sein! Man muss Machtkonstellationen analysieren, und man muss wissen, dass in den Märkten Macht eine entscheidende Dimension ist. Aber man sollte auch die Macht des Wissens nicht unterschätzen. Wenn Bürokratieabbau und Steuersenkung das Einzige sind, was einer konservativliberalen Regierung einfällt, um ihre Art von Marktwirtschaft zu retten, dann haben die Aufklärer eine Chance. Wenn alle, die guten Willens sind, versuchen, einige zentrale Elemente eines alternativen Ansatzes zu verstehen und umzusetzen, dann kann das gelingen. Auch 1998, als nach 16 Jahren konservativer Politik das rot-grüne Projekt begann, hätte man dazu die Chance gehabt. Es gab aber weder in der Sozialdemokratie noch bei den Grünen eine kritische Masse von Wissen, die dem Lobbyismus der Berliner Unternehmerrepublik hätte standhalten können.
Die Finanzkrise bot und bietet eine Chance. Zwar hat sich die deutsche Regierung bis jetzt bemüht, nichts zu tun, um den Finanzmärkten Einhalt zu gebieten, aber das wird sich bitter rächen. Wir werden die nächsten Blasen erleben und wir werden erleben, dass ihr Platzen den Staat erneut vor die fatale Entscheidung stellen wird, ob er unreformierte Banken retten will oder nicht. Dann wird man nicht mehr sagen können, wir hätten es nicht gewusst. Dann wird man sagen müssen, wir haben es gewusst, aber wir haben nichts getan. Wir werden sehen, dass die Konjunktureuphorie, die zur Jahresmitte 2010 herrscht, Ernüchterung Platz macht, weil die Erholung wieder nur auf Exportsand gebaut ist.
Dann wird sich auch hier die Frage stellen, greift der Staat -Sparpaket hin oder her - wieder in expansiver Richtung in die Wirtschaft ein oder nicht? Dann werden die Regierenden und die sie beratenden Ökonomen darlegen müssen, warum ihre Konjunkturhoffnungen getrogen haben. Dann wird man erläutern müssen, wie es einen Aufschwung geben soll, ohne dass die Menschen mit der berechtigten Erwartung in die Zukunft schauen, dass ihr Einkommen wieder einmal steigen wird und sie teilhaben am Gesamterfolg der Gesellschaft. Dann wird die Politik erklären müssen, wo der Export auf Dauer herkommen soll, wenn die Exportmärkte sich deutsche Produkte nicht mehr leisten können. Dann wird man auch eine Begründung dafür finden müssen, warum man im Jahr 2009 hektisch in einer großen Koalition eine Schuldenbremse in die Verfassung geschrieben hat, die sich schon zwei Jahre später als fatale Bremse für vernünftiges Handeln erweist.
All das ist nicht zu erklären. Und selbst wenn alle Medien auf der Seite der herrschenden Meinung sind, es wird niemanden mehr überzeugen. An dem Punkt werden die Menschen - in ähnlicher Weise wie in den 30er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts - eine Schicksalsfrage zu entscheiden haben, und dann wäre es gut, wenn es nicht nur zwei extreme Positionen gäbe. Es wäre gut, wenn zwischen der Rechten und der Linken eine Position der Vernunft zu finden wäre, die das System der Marktwirtschaft nicht in Bausch und Bogen verdammt, aber auch nicht zum Heiligtum erklärt, das doch nur dem Schutz der Geldmächtigen dient.
Der Rückzug des Staates muss gestoppt werden. Marktwirtschaft kann ähnlich wie ein Fußballspiel nicht ohne strikte Regeln und ohne durchgreifende Schiedsrichter funktionieren. Das würde auch jeder gute Ordoliberale aus der Freiburger Schule unterschreiben. Es ist aber nicht genug. Es muss nicht nur jedes Spiel auf jedem Markt vom Staat geleitet werden, der Staat muss auch und in jeder Hinsicht konsequent darüber entscheiden, ob überhaupt ein Markt vorliegt und ob der Markt eine vernünftige Lösung erwarten lässt. Diese Einsicht ist untergegangen in der ideologischen Auseinandersetzung Staat gegen Markt, die die letzten 30 Jahre geprägt hat. Darüber hinaus muss der Staat zwingend und permanent das gesamte System makroökonomisch steuern. Eine Marktwirtschaft entwickelt sich nicht von alleine in die richtige Richtung und schon gar nicht mit dem richtigen Tempo. Zentrale Preise wie Zinsen, Wechselkurse und die Preise für umweltrelevante Güter müssen vom Staat bzw. von den Staaten in Kooperation festgelegt werden.
So ergibt sich ein System, in dem der Markt vielleicht nur noch die Minderheit ist. Aber das schadet nicht. Es geht eben nicht darum, ob wir für den Markt oder für den Staat sind, es geht alleine darum, ob wir für ein bestimmtes Problem eine vernünftige Lösung finden. Ist diese Lösung stärker vom Markt getragen, ist es gut, ist sie stärker vom Staat getragen, ist es auch gut.
Der naive Glaube an den Rückzug des Staates, an Steuersenkung, Deregulierung und an Privatisierung hat sich als Irrglaube erwiesen. Auch der Glaube an den Exportüberschuss, die immerwährende Kraft des Gewinnens gegenüber anderen Nationen muss zu Grabe getragen werden. Die gewaltigen globalen Ungleichgewichte und die nicht minder großen Ungleichgewichte in der Europäischen Währungsunion sind ein Warnsignal ersten Ranges. Wer Exportweltmeister sein will, muss auch Importwelt meister sein. Es geht nicht an, dass Länder wie Deutschland, China und Japan immer Überschüsse haben und andere Länder wie die USA und Großbritannien, Frankreich, Italien und die südeuropäischen Länder in der Europäischen Währungsunion immer Defizite. Die Schuldenberge, die diese nicht mehr wettbewerbsfähigen Volkswirtschaften auftürmen, können nicht zurückgezahlt werden. Die Gläubiger stehen mit leeren Händen da, und am Ende müssen die Währungen von Defizitländern abgewertet werden, um den Überschussländern ihre Exportvorteile zu nehmen.
Wir müssen genauer analysieren, wie die wichtigsten Märkte, die eine soziale Marktwirtschaft tragen, wirklich funktionieren. Die Verherrlichung der Finanzmärkte muss ebenso beendet werden wie das Abmeiern der Arbeitsmärkte. Es ist genau falsch herum, was die Politiker der neoliberal konservativen Regierungen der letzten 30 Jahre uns haben glauben machen wollen: Es sind nicht die Finanzmärkte, die zum Wohlstand beitragen, und es ist nicht die Flexibilisierung der Arbeitsmärkte, die Vollbeschäftigung herstellt. Es sind vielmehr hoch motivierte Investoren in Sachkapital und Arbeitskräfte, die mit guten Ideen den Wohlstand sichern.
Damit die Marktwirtschaft unter den Bedingungen, die wir in dieser Gesellschaft für vernünftig und für richtig halten, funktioniert, muss es eine Machtbalance am Arbeitsmarkt geben. Das bedeutet einerseits, dass der Niedergang der Gewerkschaften aufgehalten werden muss, damit sie wieder als gleichberechtigte Partner des Kapitals auftreten können. Um das zu gewährleisten, müssen der Sozialabbau und die geradezu lächerliche Diskussion über Lohnabstandsgebote und ähnliche Kinkerlitzchen beendet werden. Das bedeutet aber andererseits, dass sich der Staat in Deutschland bereit erklärt, die zentrale makroökonomische Aufgabe zu akzeptieren, das heißt, für Vollbeschäftigung zu sorgen. Denn nur wenn der Staat für Vollbeschäftigung sorgt, sind die Machtverhältnisse am Arbeitsmarkt so, dass gesellschaftliche Ergebnisse erwartet werden können, die einer sozialen Marktwirtschaft würdig sind.
Für Vollbeschäftigung zu sorgen bedeutet auch, dass der Ideologie der Unabhängigkeit der Zentralbanken endlich abzuschwören ist. In der Krise hat sich ohnehin gezeigt, dass Zentralbanken, wenn die Not groß ist, sofort und ohne dass politischer Widerspruch geduldet werden könnte, eingreifen müssen, um das Schlimmste zu verhindern. Der zentrale Geburtsfehler der Europäischen Währungsunion war, dass man der Zentralbank die Verantwortung für Beschäftigung nicht gegeben hat.1 Die große Krise der Europäischen Währungsunion, an deren Wurzel das deutsche Lohndumping steht, unterstreicht dies eindrücklich. Die Europäische Zentralbank hat von Anfang an nicht versucht, in der Frage der Wettbewerbsfähigkeit zwischen den Mitgliedstaaten der Politik aufklärend zur Seite zu stehen. Stattdessen hat sich die Zentralbank in der Rolle gefallen, unterstützt von besonders konservativen nationalen Zentralbanken wie etwa der Deutschen Bundesbank, die Ideologie der Flexibilisierung der Arbeitsmärkte hochzuhalten, weil diese Ideologie es ihr ermöglichte, die andere Ideologie zu verteidigen - wonach die Inflationsrate unabhängig von den Arbeitsmärkten und geldneutral ist.
Das alles kann aber nur gelingen, wenn der MakroÖkonomik wieder zu ihrem Recht verholfen wird. Dazu braucht man eine ganz neue kritische gesellschaftliche Diskussion dieser Fragen. Wirtschaftsfragen sind zu wichtig, als dass sie der Staat der zufälligen Selektion von Universitäten überlassen könnte. Es gab in Deutschland einmal eine Reihe von relativ unabhängigen Instituten, die dafür sorgen sollten, dass relevante akademische Erkenntnisse umgesetzt werden konnten in praktische Wirtschaftspolitik. Diese Institute, einst hießen sie die führenden Wirtschaftsforschungs-institute, hat man durch den Wissenschaftsrat ihrer eigentlichen Funktion berauben lassen. Man hat sie zu rein akademischen Instituten umgebildet, die sich im Rattenrennen um Veröffentlichungen in sogenannten anerkannten Zeitschriften behaupten müssen. Das Ergebnis ist, dass diese Institute keinerlei wirtschaftspolitisch relevantes Wissen mehr produzieren, aber noch mehr von dem Schrott, mit dem uns die Universitäten überfluten.
Es gibt für einen Ökonomieprofessor an einer Universität keinerlei Zwang, sich mit einer wirtschaftspolitisch relevanten Frage auseinanderzusetzen. Es ist sogar genau umgekehrt: Je irrelevanter seine Fragestellung, umso leichter fällt es ihm, in einem der berühmten »anerkannten Journals« zu veröffentlichen. Denn nur wer eine kleine Schraube in einer ganz kleinen Nische des akademischen Hauses der Ökonomik ändert oder fester dreht, hat die Chance, überhaupt gehört zu werden. Wer sagt, das ganze Haus sei schief und krumm, wer sagt, die Statik sei schon immer falsch berechnet gewesen, wird national wie international ignoriert. Es ist geradezu zum Credo der akademischen Ökonomik in den letzten Jahrzehnten geworden, das »Standardmodell« nicht infrage zu stellen, sondern sich lediglich darauf zu konzentrieren, dieses Standardmodell zu »verbessern«. Das Standardmodell aber reflektiert nichts anderes als den Versuch, den Markt als die absolute und übergreifende Macht des Gesellschaftslebens zu installieren. Nur was einer Marktlösung zugänglich ist, ist in dieser abwegigen Vorstellung überhaupt würdig, einer akademischen Erörterung zuteil zu werden.
Auch hier braucht man einen vollkommenen Neuanfang. Es müssen ökonomische Institutionen und Sachverständigenräte geschaffen werden, die unabhängig und mit Ökonomen unterschiedlicher Ausrichtung besetzt werden und systematisch das Pro und Kontra bestimmter Politikoptionen diskutieren und veröffentlichen. Es ist vorbildlich, dass der amerikanische Kongress im Jahr 2009 eine Entschließung gefasst hat, die daraufhinausläuft, dass von nun an keine ökonomische Institution und kein Beratungsgremium mehr besetzt werden dürfen, ohne dass unterschiedlich ausgerichtete Wissenschaftler in ihnen vertreten sind.
»Die Regierung, die Industrie, die Wall Street und die Wissenschaft beschäftigen typischerweise Ökonomen, die alle eine ähnliche Ausbildung und einen ähnlichen Hintergrund haben und die dann Vorhersagen treffen, welche Optimismus verbreiten und alle in die gleiche ökonomische Richtung laufen... Wenn ein Financial Risk Couneil aus Mitgliedern besteht, die ganz unterschiedlichen Strömungen angehören, können ein allzu optimistischer Konsens und die üblichen Weisheiten vermieden werden. Dadurch würde der Kongress in die Lage versetzt, sich in angemessener Weise und konzentriert mit den bekannten und unbekannten Risiken auf einem komplexen, hoch interaktiven Gebiet zu beschäftigen.«
Man muss die Politik zwingen, sich mit unterschiedlichen Positionen auseinanderzusetzen. Wir haben in den letzten Jahren ein unvorstellbares Klein-Klein erlebt, wenn es um wirtschaftspolitische Konzeptionen ging. Reformen des Gesundheitswesens wurden als eine bedeutende wirtschaftspolitische Errungenschaft betrachtet. Die schon nach zwei Jahren vollkommen irrelevante Verfassungsreform, die Föderalismusreform genannt wurde, stand für viele für einen wirtschaftspolitischen Neuanfang, für den berühmten Ruck, den der frühere Bundespräsident Herzog schon vor über zehn Jahren dem deutschen Volk unsinnigerweise anempfohlen hat.
Eng verbunden mit dem Versagen der Ökonomen ist der Aufstieg der Juristen. Ihre Dominanz in den Ministerien und übrigen Verwaltungen hat den Aufstieg des einzelwirtschaftlich- unternehmerischen Denkens dramatisch beschleunigt. Da Juristen überhaupt nicht dafür ausgebildet sind, gesamtwirtschaftliche Zusammenhänge zu verstehen und zu bewerten, neigen sie intuitiv dazu, einzelwirtschaftliches Denken unmittelbar für jede Art der wirtschaftlichen Entscheidung zu verwenden. So gibt es bei Konflikten zwischen Gewerkschaften und Unternehmern für den Juristen nur den Ausgleich der unterschiedlichen Interessen, er wird aber niemals eine eigenständige Wertung der Interessen vor einem übergeordneten Hintergrund vornehmen. Wo ein gut ausgebildeter Volkswirt sagen könnte, dass in manchen Situationen beide Seiten, Unternehmer und Gewerkschaften, gesamtwirtschaftlich Falsches tun, ist ein derartiges Urteil für den Juristen undenkbar. Bei widerstreitenden Interessen kann es für ihn nur einen Kompromiss in der Mitte geben. Das gilt auch für alle übrigen Bereiche der Politik. Ich habe selbst erlebt, wie Juristen in Ministerien in der Frage internationaler Finanzkrisen juristisch geurteilt haben, ohne auch nur den Hauch einer Ahnung davon zu haben, welches Problem überhaupt zu lösen war.
Wer die Materie nicht versteht, hält sich an das Verfahren der Konfliktbereinigung und sonst nichts. Folglich werden Interessen definiert, also etwa »Interessen« von Ländern, die in einer Finanzkrise stecken, und das Interesse des eigenen Landes, soweit es unmittelbar und konkret greifbar ist, und es wird eine Lösung gesucht durch Aushandeln dieser verschiedenen Interessenstandpunkte. Das ist zwar in den meisten Fällen vollkommen unsinnig, wie später zu zeigen sein wird, aber es schafft eine scheinbar praktikable Vorgehensweise, ganz gleich wie schlimm die mittel- bis langfristigen Folgen dieser Vorgehensweise sind.
Den gleichen Irrsinn erleben wir in den Klimaschutzverhandlungen. Jedes Land definiert nationale Interessen und verteidigt dann seine vermeintlichen Interessen mit Zähnen und Klauen gegen die vermeintlichen Interessen der anderen. Interesse wird dabei einfach definiert als die Möglichkeit, das eigene Verhalten trotz der drängenden Klimaschutzfrage möglichst wenig zu ändern. Nie wird die schlichte Frage gestellt, warum es sinnvoll sein soll, das eigene Verhalten in einer Welt, die sich laufend und schnell ändert, möglichst wenig anzupassen. Es werden nur bereits vorhandene Interessen berücksichtigt und alle anderen Interessen, also Interessen, die sich noch nicht am Markt und in den Lobbys manifestieren, von vorneherein als irrelevant ausgeschlossen. So wird auch der Natur kein eigenständiges Interesse eingeräumt. Deswegen darf man die Natur genau bis zu dem Punkt ausbeuten, wo man mit den Interessen anderer Menschen, anderer Nationen oder sonstiger menschlicher Institutionen in Konflikt gerät. Ob das für die Natur selbst verträglich ist, wird nicht gefragt, weil die Natur ja keine Anwaltskanzleien beauftragen kann, ihre »Interessen« zu vertreten.
Die großen Krisen
Finanzkrise
Die große Krise der globalen Finanzen ist keineswegs zu Ende. Sie hat nur eine Pause eingelegt. Die Staaten haben zwar Notmaßnahmen ergriffen und die reale Wirtschaft stabilisiert, aber da die Politik in den meisten Ländern noch nicht einmal im Ansatz begriffen hat, was da eigentlich passiert ist, schwelt der Brand weiter und kann jederzeit neu ausbrechen.
Die Herde rennt
Anfang 2010 fand sich auf der ersten Seite der Financial Times eine interessante Frage: »Warum sind eigentlich bisher so wenige Spitzenbanker hinter Gittern?« Denn bisher ist nur ein einziger Banker rechtskräftig verurteilt worden: Mister Madoff. Er war zwar nur ein Hedgefondsmanager und kein richtiger Banker, aber immerhin, er ist verurteilt worden. 150 Jahre Gefängnis hat er bekommen, weil er etwa 65 Milliarden Dollar veruntreut hat. Aber was war eigentlich mit den anderen 3000 Milliarden, die in der Krise untergegangen sind, wenn man Schätzungen glauben darf? Waren die ehrlicher und besser angelegt?
Schon hier dringen wir zum Kern der Sache vor. Was war der Unterschied zwischen Herrn Madoff und den »richtigen« Bankern, also den Investmentbankern oder den übrigen Spielern in den globalen Kasinos? Nun, Herr Madoff hat ein sehr einfaches Spiel gespielt, das man in der deutschen Sprache »Schneeballsystem« und im Englischen »Ponzigame« nennt, nach einem italienischstämmigen Betrüger in den USA der 1920er Jahre. Bei diesen Spielen lockt man Geldgeber mithilfe eines besonders attraktiven Renditeversprechens. Das ist nicht verboten. Ein Verbrechen wird daraus erst, wenn man die versprochene Rendite gar nicht durch echte Investitionen in Sachanlagen oder sonstige stabile Finanzanlagen erzielt, sondern immer mehr Leute um ihr Geld bittet, um damit dann die Rendite für die ersten Teilnehmer auszuzahlen. Irgendwann bricht das Schneeballsystem zusammen, und alle wissen ganz genau, dass der Organisator ein Betrüger war und ins Gefängnis muss.
In einem Ponzigame gewinnen die Ersten, und die Letzten verlieren. Doch ist das wirklich anders bei scheinbar seriösen Bankern, die immer noch oder schon wieder 25 Prozent Rendite versprechen? Wird nicht auch dort Geld gesammelt, Geld investiert und in der Krise verloren, wenn man nicht rechtzeitig aussteigt?
Zunächst wirkt noch harmlos, was auf den normalen legalen Finanzmärkten geschieht. Das Geld der Anleger wird »investiert2«. Man legt es in amerikanischen Hypothekenpapieren, in Derivaten von Rohstoffen, in Währungen oder in Aktien an. Doch was geschieht dann? Woher kommen die Erträge? Wurden sie durch produktive Investitionen in realen Unternehmen erwirtschaftet oder durch sichere langfristige Anlagen wie Staatsanleihen? Nur dann ließe sich zu Recht sagen, dass es kein Madoffgame oder kein Ponzigame war.
Mit realen Investitionen in Betriebe oder mit dem Kauf von Staatsanleihen lässt sich jedoch keine Rendite von 25 Prozent erwirtschaften. Wie also erzielen die Banken auf Dauer eine solche Rendite, die sie anscheinend alle »brauchen«, um ihre Eigenkapitalgeber zufriedenzustellen?
Eine einfache gesamtwirtschaftliche Überlegung hilft hier entscheidend weiter. Gesamtwirtschaftlich gesehen, gibt es nämlich nur Kapital und keine Trennung von Eigen- und Fremdkapital, weil ja das Eigenkapital des einen das Fremdkapital des anderen ist. Das wiederum bedeutet, dass man generell sehr hohe Renditen auf Kapital erzielen muss, will ein großer Akteur systematisch und dauerhaft auf sein Eigenkapital 25 Prozent Rendite erzielen. Denn die Verwendung von Kapital geschieht ja in einem Wettbewerbsprozess bzw. die verschiedenen Verwendungen von Kapital sollten im Wettbewerb miteinander stehen. Bei zwei Prozent realem Wachstum erzielt aber auch Kapital insgesamt nur zwei Prozent »nationale Dividende« und das auch nur dann, wenn die Arbeitnehmer sich ebenfalls mit zwei Prozent zufrieden geben. Welcher Teil des Kapitals macht dann Verlust, um beim Eigenkapital der Banken 25 Prozent zu ermöglichen? Das Fremdkapital!
An den Finanzmärkten wird offenbar in großem Maßstab ein Spiel gespielt, bei dem es auf die Rendite von Sachanlagen gar nicht ankommt. Man setzt gar nicht auf die Dividende (oder den Zins), die man mit einer Anlage auf lange Sicht erzielen kann, sondern hofft darauf, dass der Preis des gerade gehaltenen Vermögenstitels kurzfristig steigt. Wenn zum Beispiel viele Anleger glauben, dass die Aktienkurse zulegen, und daraufhin große Summen in Aktien investieren, dann steigen die Aktienkurse tatsächlich genau deswegenweil so viele daran glauben.
Wenn aber der »Wert« eines Unternehmens an der Börse innerhalb eines halben Jahres um 100 Prozent steigt, hat dann der wirkliche Wert dieses Unternehmens im Sinne seiner Produktivkraft oder seiner Wettbewerbsfähigkeit notwendigerweise auch um 100 Prozent zugenommen? Die gleiche Frage stellt sich bei Rohstoffen: Wenn viele Leute ihr Geld in Rohstofffutures anlegen und deswegen die Rohstoffpreise steigen - wurden damit reale Werte geschaffen? Oder ist nur etwas umverteilt worden: Die Produzenten von Rohstoffen werden reicher, während die Konsumenten ärmer werden, weil sie nun für die Güter des täglichen Bedarfs mehr zahlen müssen. Sind Werte entstanden dadurch, dass man amerikanische Hypotheken gebündelt und im Rest der Welt verscherbelt hat?
Das zeigt das Prinzip: Auf den Finanzmärkten werden keine Werte geschaffen, sondern es wird nur umverteilt. Der Gewinn des Einen ist der Verlust des anderen. Das beste Beispiel sind Währungen. Eigentlich kann eine Anlage in fremder Währung, für sich genommen, keinen Ertrag erbringen. Es ist ja nur der Tausch von Geld gegen Geld. Wer Aktien in einem anderen Land kauft, muss zwar auch in die fremde Währung tauschen, aber er hofft ja vielleicht auf Dividende. Das Währungsgeschäft an sich ist nur die Verfügung über ein anderes Geld, was im Prinzip genauso wenig gewinnbringend sein sollte wie das Halten des eigenen Geldes. Das Halten fremder Währungen sollte selbst dann keinen Ertrag abwerfen, wenn man es kurzfristig auf einem Konto deponiert. Zwar kassiert man dafür einen Zins, doch dürfte dieser eigentlich nicht höher liegen als im eigenen Land, dennjede Differenz würde nur anzeigen, dass im Land der Fremdwährung ein höheres Inflationsrisiko besteht. So zeigt allein die Tatsache, dass Währungsspekulation eines der größten Geschäfte überhaupt ist, wie krank unser Finanzsystem geworden ist.
Hinzu kommt das, was man im Englischen eine »fallacy of composition« nennt, was bedeutet, dass nicht alle das Gleiche tun können, was ein Einzelner tut. Wenn bestimmte Währungen durch die »Investition« von Banken und Hedgefonds aufwerten, müssen notgedrungen andere Währungen abwerten. Schon deswegen kann niemals ein Wert entstehen, und das Gerede vom »Werteschaffen«, das die Banker so gerne verbreiten, um ihr Tun zu tarnen, erweist sich ohne jeden Zweifel als hohle Phrase.
Trotzdem bleibt das Treiben auf den Finanzmärkten nicht folgenlos, denn es schädigt die Realwirtschaft. Nehmen wir zum Beispiel den ungarischen Forint, der in den letzten zehn Jahren vor der Finanzkrise aufgewertet hat. Dadurch verloren die ungarischen Unternehmen an internationaler Wettbewerbsfähigkeit, und manch eine Firma wurde in die Pleite getrieben, obwohl sie vielleicht kerngesund war. Ähnlich war es in Island. Auch die isländische Wirtschaft konnte eine gewaltig aufgewertete isländische Krone nicht mehr verkraften und brach zusammen. Entstanden an irgendeiner Stelle »Werte«? Entstand ein Wert, weil Hedgefonds oder japanische Hausfrauen ihre Gelder für drei Tage, drei Wochen oder auch drei Monate nach Island transferierten? Nein, die Spekulation verursachte gewaltige Schäden, aber nirgendwo wurden Werte geschaffen.
Die spekulativ verzerrten Preise sind für die reale Wirtschaft, für die Menschen also, die wirklich arbeiten und Geld verdienen könnten, irgendwann nicht mehr zu verkraften. In den USA endete die Spekulationsblase mit den Ramschhypotheken genau in dem Moment, als die Menschen damit überfordert waren, ihre Rechnungen zu bezahlen. Durch die Spekulationen auf den Rohstoffmärkten war der Ölpreis auf 150 Dollar pro Barrel gestiegen, was das Benzin so stark verteuerte, dass die finanzschwachen Bewohner in den US-amerikanischen Vororten nicht mehr gleichzeitig ihren weiten Weg zur Arbeit und ihre Hypothekenzinsen begleichen konnten. Also mussten die ersten ihre Häuser verkaufen, wodurch die Immobilienpreise zunächst stagnierten und dann immer rasanter fielen.
Die ganze Spekulationspyramide, dieses ganze Kettenbriefsystem brach in sich zusammen. Nun offenbarte sich, dass viele Hypotheken zwar völlig wertlos waren, aber zu strukturierten Wertpapieren gebündelt weltweit an Banken und Anleger verkauft worden waren. Billionen mussten abgeschrieben werden und rissen diverse Kreditinstitute in die Pleite. Die Währungs- und Immobilienspekulationen waren nichts anderes als ein Madoff-System - nur ein verzögertes Madoff-System sozusagen. Ein paar Jahre lang konnte man sich der Illusion hingeben, man habe aus dem Nichts Einkommen und Gewinn geschaffen, weil es gelungen war, die Preise für Häuser und Rohstoffe nach oben zu treiben. Dies ist der einzige Unterschied zum Madoff-System oder Ponzigame: Für ein paar Jahre lassen sich die Preise an entscheidenden Märkten so verzerren und verunstalten, so kaputt machen und so weit von der Wirklichkeit entfernen, dass Scheingewinne herauszuschlagen sind.
Vorübergehend sieht das eindrucksvoll aus, die Banken erzielen prächtige (Buch)Gewinne, und ihnen schwillt die Brust. Die Medien bejubeln nach der Krise genau wie vor der Krise diese Scheingewinne der Banken. In manchen Ländern werden sie wie eine nationale Großtat gefeiert. Doch folgt ein paar Jahre später zwingend der Verlust. Aus dem Kasino kommt eben nicht mehr heraus, als man hineingetragen hat.
Und der Vergleich mit dem Kasino ist noch der denkbar beste Fall bei diesen Ponzi-Systemen. Denn dann wäre es ja nur ein Nullsummenspiel, bei dem sich für die Anleger Gewinne und Verluste ausgleichen. Doch für fast alle Menschen kommt weit weniger als null heraus, weil der Staat gezwungen ist, die Verluste der Kasinozocker zu übernehmen und die angerichteten Schäden zu beseitigen. Die während der Scheinblüte materialisierten Gewinne aber, die in Form von schönen Yachten auf dem Mittelmeer schaukeln, dürfen natürlich nicht angetastet werden. So wird aus dem Nullsummenspiel ein gewaltiges Negativsummenspiel für die Gesellschaft als Ganzes.
Vor der großen Krise haben ganz viele Zocker mit ganz viel geliehenem Geld Nullsummenspiele gespielt, um die berühmten 25 Prozent Rendite zu verdienen. Da man aber mit Nullsummenspielen weder 25 Prozent noch irgendeine andere Rendite erzielen kann, musste es schiefgehen. Alles andere war logisch unmöglich.
Nehmen wir noch einmal den Fall Ungarn. Westliche Banken haben die Ungarn systematisch dazu gebracht - man muss es in der Tat so sagen -, ihre Hypotheken in Schweizer Franken aufzunehmen, weil dort die Zinsen niedriger waren als in Ungarn.3 Doch niemand hat den Ungarn gesagt, dass sie ein erhebliches Risiko eingehen, wenn sie scheinbar günstige Fremdwährungskredite aufnehmen. Denn durch ihre Nachfrage nach Schweizer Franken und deren Umtausch in ungarische Forint zum Hausbau wurde die ungarische Währung aufgewertet und damit die ungarische Wettbewerbsfähigkeit systematisch kaputt gemacht. Auf ihr beruhen aber zu einem erheblichen Teil die Einkommen, aus denen die Kredite bedient werden müssen. Hinzu kam, wie schon erwähnt, die übrige Spekulation, der »carry trade« mit den Währungen, die auch den Forint aufgewertet hat, weil die globalen Zocker mit kurzfristigen Anlagen Zinsvorteile nutzen konnten. Sowohl in Island wie auch in Ungarn war die Inflation relativ hoch, und die Notenbanken trieben die Zinsen in die Höhe, um die Inflation zu bekämpfen. In Japan oder der Schweiz, wo die große Masse des durch die Gegend gekarrten Geldes herkam, waren die Zinsen dagegen wegen geringer Inflation oder gar Deflation sehr niedrig.
Die Währungsspekulationen und die Kredite der Ungarn in Fremdwährungen hatten zur Folge, dass das ganze Land vor dem Kollaps stand, weil es wegen seiner mangelnden Wettbewerbsfähigkeit international nicht mehr kreditwürdig war und seine Reserven nicht ausreichten, um den abstürzenden Forint zu stabilisieren. Wie immer in solchen Fällen griff schließlich der Internationale Währungsfonds ein und verlangte von Ungarn eine restriktive Sparpolitik. Das war besonders absurd, weil zeitgleich Staaten wie Deutschland genau das Gegenteil taten: Dort wurden schuldenfinanzierte Konjunkturprogramme aufgelegt, weil man genau wusste, dass rigoroses Sparen die Rezession noch verschlimmert. Doch den Ungarn wurde eine unsinnige Sparpolitik zugemutet. Sie lief unter dem Motto, man müsse die Finanzmärkte davon überzeugen, dass die Währung stabilisiert werden könne.
Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen: Die gleichen Finanzmärkte, die vorher dafür gesorgt hatten, dass der ungarische Forint aufgewertet wurde, die also angeblich unglaubliches Vertrauen in die ungarische Währung hatten, genau diese Finanzmärkte müssen nun nach der Krise durch prozyklische Politik, durch Erhöhung der Zinsen, durch Kürzung der Budgets und durch Lohnsenkung davon überzeugt werden, dass die ungarische Regierung in der Lage ist, den Forint-Kurs 30 Prozent unter seinem vorherigen Wert zu stabilisieren.
Doch über diese Absurdität der angeblich so wunderbar globalisierten und finanzialisierten Wirtschaft wird nicht ernsthaft geredet. In den G-20-Communiques liest man absolut nichts dazu. Das ist nicht neu. Als ich 1998 als Staatssekretär im Bundesfinanzministerium anfing, war die Asienkrise gerade vorbei, und die Lateinamerikakrise in vollem Schwange. Beides waren eindeutig Währungskrisen der gleichen Art, ausgelöst durch carry trade. Aber auch damals hat niemand gefragt: Was ist da eigentlich passiert?