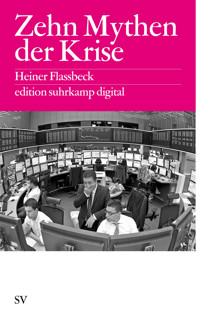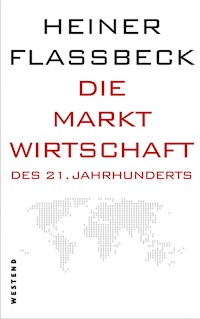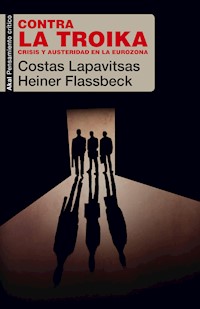19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Globalisierung war eine wunderbare Idee. Nachdem die politische Spaltung in Ost und West überwunden war, schien der friedlichen Kooperation aller Menschen nichts mehr im Wege zu stehen. Würde man nur alle Hürden aus dem Weg räumen, so die liberale Vorstellung, bildete sich eine spontane Ordnung, die den Traum vom freien und wohlhabenden Erdenbürger wahr werden ließe. Doch nach der großen Krise, nach Trump und Brexit ist das Projekt gescheitert. Die liberale Wirtschaftstheorie ist prinzipiell ungeeignet, die Dynamik einer Marktwirtschaft zu verstehen und valide politische Empfehlungen zu geben. Weder für die globale Kooperation der Nationen noch für die angemessene nationale Politik gibt es heute ein tragfähiges Konzept. Die Autoren zeigen, wie man das auf der Basis einer modernen Wirtschaftstheorie schafft.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 433
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
3Heiner Flassbeck/Paul Steinhardt
Gescheiterte Globalisierung
Ungleichheit, Geld und die Renaissance des Staates
Suhrkamp
Übersicht
Cover
Titel
Inhalt
Informationen zum Buch
Impressum
Hinweise zum eBook
5Inhalt
Cover
Titel
Inhalt
Vorwort
I
. Globalisierung und Digitalisierung ‒ die Herausforderungen unserer Zeit
Warum ist die liberale Globalisierung gescheitert?
Das vergiftete Angebot des Neoliberalismus
Freihandel als Lösung?
Rigide Löhne und die Drohung mit der Globalisierung
Die große Angst
Was verlangt die Globalisierung?
Handel zwischen Hoch- und Niedriglohnland
Handel bei Kapitalwanderung
Handel bei Wanderung von Arbeit
Digitalisierung als Bedrohung?
Der Roboter als Jobkiller?
Warum ist die Produktivität so schwach?
Warum steigen die Investitionen nicht?
Die Scheinantworten des Liberalismus
Die Ordnungsprinzipien des Wirtschaftsliberalismus
Tauschhandlungen
Der Wettbewerb und seine Feinde
Wettbewerb zwischen wem und um was?
Das Wissensproblem und seine Scheinlösung
Der politische Liberalismus
Freiheit und Zwang
II
. Der demokratische Staat und die Gesamtwirtschaft
Geld, Kapital und Arbeit
Geld als staatliche Institution
Geld und Steuern
Kapital und Produktivität
Arbeit und Lohn
Demokratie und Nationalstaat
Der Staat
Demokratie
Gemeinwohl
Souveränität
Grundzüge einer neuen Ökonomik
Keynesianismus und Neoklassik als Antipoden?
Sparen und Investieren als Wissenschaftsprogramm
Wer entscheidet über das Sparen und das Investieren?
Das Einkommen als Ausgleichsmechanismus
Die Leistungsbilanz und das Sparen der Nationen
Preisverhältnisse im internationalen Zusammenhang
Konstante reale Wechselkurse
III
. Der Neoliberalismus als Regression
Der Arbeitsmarkt ist kein Markt
Slim pickings
Eugen von Böhm-Bawerk und die Macht des Marktes
Der empirische Befund
Es gibt keine individuelle Produktivität
Der Exportkanal
Funktionslose Ungleichheit
Natürliche Ungleichheit?
Formale oder materielle Gerechtigkeit bei der Besteuerung?
Die globale Ungleichheit nimmt ab
Das unabdingbare Prinzip der Gleichverteilung der Einkommenszuwächse
Funktionslose Gewinne
Investitionen in Sachanlagen: Die Achillesferse der neoklassischen Revolution
Unternehmen als Sparer erschüttern die Grundfesten des Liberalismus
Steuern für Unternehmen erhöhen?
Säkulare Stagnation?
Finanzmärkte produzieren falsche Preise
Effiziente Märkte?
Währungsspekulation
Rohstoffspekulation
Verzerrte Preise
IV
. Geld als Domäne des Staates
Geld, Banken und unternehmerische Haftung
Bargeld und Giralgeld
Defekte des zweistufigen Bankensystems
Sind Banken normale Unternehmen?
Banken sind keine Intermediäre
Geld als Ware und der Monetarismus
Geld als Ware
Monetarismus à la Chicago
Objektivierte Geldversorgung
Vollgeld: Monetarismus in neuen Kleidern
Onkel Dagobert und Säcke voller Geld
Allokation von Kapital durch den Zins?
Der Staat und die Zentralbank
Zentralbankfinanzierung und Inflation
Disziplinierung des Staates durch die Märkte?
Insolvenzregime für Staaten?
Die europäische Krise ist keine »Staatsschuldenkrise«
Feste Wechselkurse und feste Versprechen
Währungsrelationen dürfen kein Marktergebnis sein
Der Wechselkurs und reale Schocks
V
. Moderne Wirtschaftspolitik und die Rolle des Staates
Welche Aufgaben stellt die Globalisierung der Wirtschaftspolitik?
Internationale und wirtschaftspolitische Schocks
Flexible Arbeitsmärkte?
Schöpferische Zerstörung und Vollbeschäftigung
Merkantilismus als Lösung?
Die Integration Chinas in die Weltwirtschaft
Rückbesinnung auf die Bedeutung von Arbeit
Ungleichheit bekämpfen
Gleicher Preis für gleiche Arbeit
Flexible Löhne oder flexible Gewinne?
Gibt es eine »Dienstleistungslücke«?
Eine neue Rollenverteilung für die Wirtschaftspolitik
Die Aufgaben der Geld-, Finanz- und Lohnpolitik
Grundzüge einer Geschäfts- und Zentralbankenreform
Geschäftsbankenreform
Zentralbankreform
Öffentliche Daseinsvorsorge
Die Rente
Welche Währungsordnung für die Entwicklungs- und Schwellenländer?
Eine neue internationale Finanzarchitektur
Klimawandel und Umweltschutz
Klimawandel und die Dynamik der Marktwirtschaft
Umweltschutz als Präferenz
Kosten und Arbeitsplätze
Steuerung über die Preise, wie denn auch sonst
Verteilungswirkungen ausgleichen
Globale Lösungen und der Markt
Ein globales Paradox
Preise und Mengen
Literaturverzeichnis
Fußnoten
Informationen zum Buch
Impressum
Hinweise zum eBook
3
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
7Vorwort
Die Globalisierung war eine wunderbare Idee. Nachdem die große politische Spaltung in Ost und West, in Plan und Markt nach dem Fall der Berliner Mauer überwunden war, schien der friedlichen Kooperation aller Menschen nichts mehr im Wege zu stehen. Warum sollten die Menschen nicht in Freiheit miteinander kommunizieren und arbeiten und damit gemeinsam ihre persönliche Wohlfahrt mehren können?
Die hinter diesem Konzept der Globalisierung stehende Philosophie war denkbar einfach: Würde man nur die nationalen institutionellen Hürden aus dem Weg räumen, bildete sich auf globaler Ebene eine spontane gesellschaftliche Ordnung, in die sich jeder Einzelne nach seinen individuellen Fähigkeiten zum Nutzen aller einbringen könnte. Die globale Arbeitsteilung freier Menschen wäre die Krönung der uralten Idee des Liberalismus gewesen. Sie hätte die Freiheit des Individuums und gleichzeitig seine Effizienz maximiert. Der Traum vom freien und zugleich wohlhabenden Erdenbürger schien zum Greifen nah.
Alexis de Tocqueville, der Autor des großen Buches über (die Demokratie in) Amerika, hatte bereits im Jahr 1840 erwartet, die Demokratie werde eine solche offene und global vernetzte Gesellschaft hervorbringen:
In demokratischen Zeitaltern bewirkt die gesteigerte Beweglichkeit der Menschen und die Ungeduld ihrer Wünsche, dass sie unaufhörlich ihren Standort wechseln und dass die Bewohner der verschiedenen Länder sich vermischen, sich sehen, sich angehören und nachahmen. Nicht nur die Angehörigen eines gleichen Volkes werden 8sich so ähnlich; die Völker selber gleichen sich wechselseitig an, und alle zusammen bilden für das Auge des Betrachters nur mehr eine umfassende Demokratie, in der jeder Bürger ein Volk ist. Das rückt zum ersten Male die Gestalt des Menschengeschlechts ins helle Licht. (Zitiert nach Heidenreich 2002, S. 269)
Doch die Hoffnungen Tocquevilles auf die segensreichen Folgen des »demokratisches Zeitalters« wurden vom realen Verlauf der Geschichte bitter enttäuscht. Es hätte nicht der Wahl eines Präsidenten Trump bedurft, um zu sehen, dass der ökonomische und politische Liberalismus, der die gesamte Welt in den vergangenen vierzig Jahren mehr als jede andere Idee geprägt hat, kläglich gescheitert ist.
Die Unzufriedenheit vieler Menschen, die in der Wahl eines offen reaktionären Präsidenten zum Ausdruck kam, belegt nicht nur die politische Unfähigkeit des Liberalismus, die nötige Balance zwischen Freiheit und Gleichheit zu wahren, sondern viel mehr noch seine Unfähigkeit, die sozialen und wirtschaftlichen Zusammenhänge in komplexen modernen Gesellschaften in ihrer Interaktion angemessen zu deuten und darauf basierend tragfähige politische Konzepte zu entwickeln.
Während die philosophischen und politischen Probleme des Liberalismus intensiv diskutiert worden sind, ist immer noch unverstanden, warum er auf seinem ureigenen Gebiet ‒ der Gestaltung der wirtschaftlichen Kooperation ‒ so eklatant versagt hat. Bis heute hält die große Mehrheit der Ökonomen an dem Dogma fest, »der Markt« solle bei fast allen wichtigen gesellschaftlichen Entscheidungen die Führungsrolle übernehmen, und dem Staat stehe lediglich die Rolle eines Rahmensetzers und Lückenfüllers zu.
Das war schon immer eine unangemessene Vorstellung 9von den Aufgaben eines Staates. Inzwischen ist sie jedoch schlicht durch die Realität widerlegt. Ja, es ist keine Übertreibung zu sagen, dass der Untergang des Liberalismus von vorneherein unvermeidlich war, da er weder für die unabdingbare globale Kooperation der Nationalstaaten noch für die daraus sich ergebenden Folgen auf der nationalen Ebene ein zufriedenstellendes intellektuelles Konzept entwickelt hatte.
Was bis heute nicht verstanden wird: Die wirtschaftliche Theorie hinter dem Liberalismus ist nicht nur an manchen Stellen unzureichend und verbesserungsbedürftig. Nein, diese »Theorie«, der man eigentlich schon das Signum einer Theorie nicht zugestehen sollte, ist prinzipiell nicht in der Lage, die Dynamik eines marktwirtschaftlichen Systems zu verstehen, und daher ungeeignet, um aus ihr valide politische Handlungsempfehlungen abzuleiten.
Wer auf dem theoretischen Fundament des Wirtschaftsliberalismus eine historische oder politische Analyse vornimmt, liegt zwingend falsch. Denn wirtschaftsliberale Theorien, insbesondere die sogenannte Neoklassik, interpretieren gesellschaftliche Systeme, die dynamisch und jeweils historisch einmalig sind, als ein wiederkehrendes Spiel von Zuständen (Gleichgewichtszuständen), dessen Grundcharakteristik vollkommen statisch und ahistorisch ist.
Aus einem dynamischen Ablauf, der essenziell aus sequenziellen Zusammenhängen besteht ‒ also einer Abfolge von Ereignissen, die sich nur im Ablauf der realen Zeit begreifen lassen ‒, hat die liberale Ökonomik eine Kunstlehre entwickelt, bei der sich zeit- und geschichtslos Angebots- und Nachfragekurven schneiden. Liberale Öko10nomik ist im Kern der gescheiterte Versuch, fast alle relevanten wirtschaftlichen Phänomene als die Lösung des Problems der Verteilung knapper Güter über einen perfekten Markt zu erklären.
Offensichtlich geworden ist die Konzeptionslosigkeit des Wirtschaftsliberalismus in der großen globalen Krise an den Finanzmärkten, die 2007 begann und in den beiden Jahren danach die Weltwirtschaft erschütterte. Höchst ineffiziente Kapitalmärkte haben damals gezeigt, dass das Dogma der Überlegenheit der marktwirtschaftlichen Steuerung aller Wirtschaftsbeziehungen nicht richtig sein kann. Aber auch die nicht enden wollende Arbeitslosigkeit, die obszöne, weil dysfunktionale Ungleichheit, die Hilflosigkeit bei der Integration der Entwicklungsländer in die Weltwirtschaft und der in vielen Ländern der Welt immer stärker zunehmende Druck, der Armut durch Abwanderung zu entkommen, zeigen, wie fundamental falsch die liberale Weltdeutung ist.
Dennoch kam der Wirtschaftsliberalismus ‒ nach einem kurzen Intermezzo der Staatsintervention und einer aufkeimenden Einsicht in das fundamentale Versagen von Märkten ‒ fulminant zurück. Es war schiere wirtschaftliche Macht, die den politischen Entscheidungsträgern unmittelbar nach der Krise klargemacht hat, dass der Staat zwar den Retter in der Not spielen darf, dass daraus aber keineswegs der Schluss gezogen werden könne, dass über die Aufgaben- und Machtverteilung zwischen Markt und Staat neu nachgedacht werden müsse.
Die Systemkrise, die sich damals offenbarte, ist inzwischen als Thema aus dem öffentlichen Diskurs weitgehend verschwunden. Überwunden aber ist sie keineswegs. Deflationäre Tendenzen, Nullzinsen, die anhaltend hohe 11Arbeitslosigkeit, die Krise des Freihandels und die Unfähigkeit, die Investitionsdynamik früherer Zeiten wiederzubeleben, belegen zehn Jahre später, dass von einer Rückkehr zur Normalität nicht die Rede sein kann.
Dieses Buch zeigt an den Brennpunkten der Globalisierung detailliert auf, warum die (neo)liberale Hoffnung, den Staat auf die Rolle eines Rahmensetzers und Lückenfüllers reduzieren zu können, getrogen hat. Die Kapitalmärkte beispielsweise brauchen tagtäglich Hilfestellung vom Staat, um überhaupt funktionieren zu können; die sogenannten Arbeitsmärkte brauchen die Stabilisierung durch den Staat ganz unmittelbar, und das Geldwesen ist ‒ anders als es der Liberalismus glauben macht ‒ eine Domäne des Staates.
Die überragende Bedeutung der staatlichen Steuerung der Marktprozesse führt die Nationalstaaten jedoch in ein Dilemma. Denn es gibt keinen Mechanismus, der dafür sorgen könnte, dass die auf nationaler Ebene gefundenen Preise, Löhne und Zinsen sich so ergänzen, dass schwere Konflikte zwischen den Staaten verhindert werden können. Daher ist die internationale Koordination der Politik unumgänglich, wenn eine Weltordnung angestrebt wird, die den intellektuellen und kulturellen Austausch zwischen Menschen aus unterschiedlichen Ländern, den Handel mit Gütern und Dienstleistungen zum Vorteil aller daran Beteiligten und die Bewegungsfreiheit des Einzelnen über die nationalen Grenzen hinweg ermöglicht.
Kurz gesagt: Der demokratische Nationalstaat braucht eine globale Ordnung, und die globale Ordnung braucht handlungsfähige Nationalstaaten. Denn nur in einem demokratischen Nationalstaat können die Preise gefunden 12werden, die zugleich effizient und demokratisch legitimiert sind, und nur mithilfe eines globalen Ordnungsrahmens ist ein fairer Interessenausgleich zwischen den Staaten möglich.
Die Bewältigung dieser Aufgabe ist allerdings viel anspruchsvoller, als es uns der liberale Mythos von der spontanen Selbstregulierung gesellschaftlicher Systeme vierzig Jahre lang vorgegaukelt hat. Zentrale Voraussetzung für eine harmonische und friedfertige Koordination der Zusammenarbeit der Nationalstaaten ist nämlich ein übereinstimmendes Verständnis der zentralen ökonomischen Zusammenhänge.
Ein solches Verständnis hat es in den vergangenen dreihundert Jahren nur ein einziges Mal gegeben: Unter den Delegierten aus fast fünfzig Ländern, die sich am Ende des Zweiten Weltkrieges in dem kleinen Ort Bretton Woods im US-Bundesstaat New Hampshire trafen. Dort hat man sich in der Tat (allerdings ohne deutsche Beteiligung) erfolgreich auf die Grundzüge der Ausgestaltung eines globalen Geldsystems verständigt, das für mehr als zwanzig Jahre ein globales Wirtschaftswunder ermöglichte.
Heute sind die Aufgaben, die es auf der globalen Ebene zu bewältigen gilt, viel umfassender und komplexer. Insbesondere muss die ökologische Dimension der globalen Zusammenarbeit mit der ökonomischen Dimension in Einklang gebracht werden. Es ist keine Übertreibung, wenn man konstatiert: Die Staatengemeinschaft steht heute vor der größten Herausforderung der Menschheitsgeschichte.
13I. Globalisierung und Digitalisierung ‒ die Herausforderungen unserer Zeit
Fragte man die Menschen überall auf der Welt nach den größten Herausforderungen ihrer Zeit, die Antworten wären ziemlich ähnlich. Die meisten würden die Globalisierung und die Digitalisierung als die Phänomene identifizieren, die das Potenzial haben, ihr Leben entscheidend zum Guten wie zum Schlechten zu verändern.
Das ist mehr als erstaunlich. Die Digitalisierung ist zwar ein neues Phänomen, aber die Rationalisierung von Arbeit prägt die Menschheitsgeschichte schon seit Jahrhunderten, so dass man meinen würde, wir hätten inzwischen gelernt, damit umzugehen. Verwunderlich ist auch, dass es weder den internationalen Organisationen noch der internationalen Politik gelungen ist, für die sogenannte Globalisierung auch nur das Gerippe einer »Global Governance« vorzulegen, ja, dass noch nicht einmal begonnen wurde, die damit aufgeworfenen Fragen ernsthaft zu diskutieren.
Woran liegt es, dass die Welt unfähig ist, die Folgen eines uralten Phänomens wie der Verdrängung menschlicher Arbeit durch technischen Fortschritt zu verstehen oder sich auch nur auf Grundzüge einer internationalen Wirtschaftsordnung zu einigen? Lässt sich das mit widerstreitenden Interessen der gesellschaftlichen Akteure erklären? Doch wer verhindert, dass etwa die Arbeitnehmer und ihre Interessenvertreter wenigstens Lösungsansätze benennen? Und warum sollten die Interessen von Regierungen, die doch immerhin durch den Glauben an die wohltätige Wirkung des freien Handels, freier Märkte 14und des freien Unternehmertums geeint sind, so unterschiedlich sein?
Es muss tiefer liegende Gründe dafür geben, warum die Politik nicht verstanden hat oder nicht verstehen will, wie eine funktionsfähige Wirtschaftsordnung auf nationaler und internationaler Ebene auszugestalten wäre. Offenkundig ist jedenfalls, dass eine solche Wirtschaftsordnung nur auf der Basis einer empirisch abgesicherten ökonomischen Theorie entworfen werden kann.
Doch eine solche umfassende ökonomische Theorie gibt es allerdings noch nicht. Entscheidend für jede neue Theorie muss aber sein, dass, wie wir das in diesem Buch versuchen, eine Neubestimmung des Verhältnisses von »Arbeit« und »Kapital« vorgenommen wird und »Geld« seinen Platz als zentrales Steuerungsinstrument der Wirtschaft einnimmt.
Warum ist die liberale Globalisierung gescheitert?
In den letzten Jahren hat sich eine Flut von Äußerungen über uns ergossen, die alle einen Tenor haben: Globalisierung und Digitalisierung überfordern die Masse der Menschen. Sie verunsichern die Bürger und Wähler, die sich daher vermehrt dem »Populismus« verschreiben. Sie liefen also denen hinterher, die versprechen, sie seien in der Lage, die unumgänglichen Anpassungsschmerzen, die von der Globalisierung und der Digitalisierung hervorgerufen werden, zu lindern oder gar zu verhindern.
Die Wahl Donald Trumps in den USA und die Stimmengewinne »extremistischer« Parteien in ganz Europa, 15wie zuletzt die der deutschen AfD, werden von den Leitmedien und den Parteien »der Mitte« fast unisono diesem Globalisierungs-/Digitalisierungskomplex zugeschrieben. Ob zunehmende materielle Ungleichheit oder Unzufriedenheit mit der eigenen wirtschaftlichen Situation, alles ist am Ende aus der konventionellen Sichtweise das Ergebnis der mangelnden Bereitschaft der Menschen, sich den Anpassungserfordernissen der neuen Welt zu stellen, die dem Einzelnen zwar wehtun mögen, im Großen und Ganzen aber unseren Wohlstand erhöhen. Wollt ihr, so die unterschwellige Botschaft der Populismuswarner, die bittere Medizin von »Flexibilität« und »Anpassungsbereitschaft« nicht schlucken, wird euch am Ende der Populismus mit seiner unerträglichen Leichtigkeit des Seins zur Hölle schicken.
Die Kritik an der Globalisierung ist scheinbar umfassend, aber sie ist zugleich unkonkret und unstrukturiert, weil bei allen unterschiedlichen Blickrichtungen und ganz unterschiedlicher Kritik praktisch nie infrage gestellt wird, dass der freie Handel Gutes tut. Die Globalisierung, sagt etwa Peter Bofinger, schade zwar dem Einzelnen, nütze aber den Nationen (Kaufmann 2016). Die Manager in Deutschland und anderswo seien in Alarmstimmung, schreibt beispielsweise das Handelsblatt (Reuters 2016), weil es immer mehr Menschen schwierig finden, mit der sich schnell verändernden Welt klarzukommen. Man fürchtet neue Handelskriege, weil die Populisten nicht bereit sind, die notwendigen Härten des globalen Strukturwandels gegen den Widerstand ihrer Bevölkerung durchzusetzen. Thomas Fricke sieht die »entgleiste Globalisierung« als das entscheidende Problem unserer Zeit an (Fricke 2016) und findet gar einen engen Zusammen16hang zwischen der Globalisierung und den Suizidraten in bestimmten Regionen der USA (ebd.), kommt aber nicht auf die Idee, zu fragen, an welcher Stelle und warum die Globalisierung entgleist ist.
Mark Schieritz fürchtet in der Zeit, dass Deutschland für sein »Bemühen«, als Vorsitz der G20 die »Wunden der Globalisierung zu heilen«, kaum internationale Partner findet (Schieritz 2016), vergisst aber geflissentlich, dass Deutschland selbst mit seinen Handelsbilanzüberschüssen jeden Tag neue Wunden schafft. Seine Kollegen in der gleichen Gazette sehen einen Aufstand gegen den Freihandel, obwohl es doch, so ihre feste Überzeugung, in Deutschland mehr Gewinner als Verlierer des Freihandels gibt (Nienhaus & Tönnesmann 2016). Ob Deutschland vielleicht ein besonderer Gewinner ist, vergessen auch sie zu fragen. Dazu gesellt sich Pascal Lamy (ein früherer Generaldirektor der Welthandelsorganisation), der zum Besten geben darf, dass »Populisten« sagen, Importe seien schlecht und Exporte gut, obwohl jeder drittklassige Ökonom (Lamy ist kein Ökonom) wisse, dass das Unsinn sei. Woher aber Lamy weiß, dass Importe gut sind, erfährt man nicht.
Das ARD-Magazin Plusminus schafft es (Krull 2016), mithilfe der Bertelsmann-Stiftung und des Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln zu »erklären«, dass Freihandel auf jeden Fall gut ist. Julian Nida-Rümelin glaubt (Nida-Rümelin 2016), dass Phasen der Entglobalisierung sehr gefährlich seien, was man daran erkennen könne, dass eine solche Phase Mitte des vergangenen Jahrhunderts im »Nationalsozialismus und im Zweiten Weltkrieg« geendet habe. In der FAZ, wie könnte es anders sein, wird ausführlich beschrieben (Armbruster 2017), 17wie sehr der freie Handel von der Gegenseitigkeit lebt und daher keineswegs einseitig zu Lasten bestimmter Länder gehen könne ‒ wenn auch Härten für Einzelne freilich leider nicht zu vermeiden seien. Auch hier kommt der deutsche Fall nicht vor.
Richard David Precht, Philosoph, Weltversteher, Autor und Entertainer, wiederum hat die Digitalisierung entdeckt, die den Menschen die Arbeit nimmt (vgl. z. B. Phoenix 2017). Er wird nicht müde, davor zu warnen, dass uns ungefähr übermorgen die Arbeit ausgehen wird. Die dritte, die digitale industrielle Revolution droht, Chaos und Umsturz erschienen am Horizont, Gewerkschaften würden obsolet, die SPD verliere ihre Arbeiterklientel, und die Parteien hätten insgesamt keine Antworten auf die enormen neuen gesellschaftlichen Herausforderungen. Die CDU habe gar nichts verstanden, die Linke wolle zurück in die siebziger und die AfD sogar zurück in die fünfziger Jahre.
Wie weit neben der Sache die aktuelle Diskussion zur sogenannten Digitalisierung liegt, hat Philip Plickert in der FAZ (Plickert 2015) eindrucksvoll demonstriert. Die dort zitierten »Experten« begreifen offenbar nicht, dass sie einem uralten Vorurteil aufsitzen. So sagt der Arbeitsmarktforscher Richard Freeman von der Universität Harvard: »Sobald Roboter und Computer etwas billiger erledigen können, nehmen sie den Menschen die Jobs ab ‒ außer, diese sind bereit, weniger Lohn zu akzeptieren.«
Das ist falsch. Natürlich werden durch den technischen Fortschritt immer wieder bestimmte Jobs (nicht aber »Jobs schlechthin«) vernichtet, weil Maschinen etwas besser, zuverlässiger und schneller können. Das hat sich seit Beginn der Menschheitsgeschichte nicht geändert. Und 18wenn die Menschen von Beginn der Rationalisierung (die weit vor der Industrialisierung begann) an erfolgreich versucht hätten, den Verlust eines bestimmten Arbeitsplatzes (ihres Arbeitsplatzes) durch Lohnsenkung zu verhindern, hätte es den steigenden materiellen Wohlstand schlicht nicht gegeben.
Das erkennt sogar der Autor der FAZ, wenn er richtigerweise feststellt:
Auf die Dauer hat sich nicht bewahrheitet, dass die neue Industriewelt keine Arbeitsplätze mehr bietet ‒ im Gegenteil. Durch steigende Produktivität nahm mit der Zeit der Wohlstand auch in der Breite der Bevölkerung zu. Der Einsatz moderner Maschinen verbilligte die Produktion, die Preise fielen, und damit konnte auch die Nachfrage zunehmen. Statt der alten Berufe in Landwirtschaft und Handwerk, die überflüssig geworden waren, bildeten sich neue Industrieberufe heraus.
Er kann aber keine vernünftige Schlussfolgerung daraus ziehen, weil er nicht zugeben kann, dass es steigende Löhne sind, die man braucht, um die Rationalisierung abzufedern. Daher schreibt er schwammig über »steigenden Wohlstand und steigende Produktivität«, kann aber nicht erklären, warum die Preise fallen müssen, damit der Wohlstand steigen kann.
Das vergiftete Angebot des Neoliberalismus
Der neue Wirtschaftsliberalismus trat in den siebziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts mit dem Versprechen an, mithilfe einer einzigen zentralen Stellschraube alle wirtschaftlichen Probleme zu lösen. Das Stichwort dazu heißt »Flexibilisierung«. Gemeint war zwar die Fle19xibilisierung aller Lebensbereiche, aber vorneweg und in der Hauptsache ging es um den sogenannten Arbeitsmarkt. Inflexible Löhne waren aus der großen Kontroverse zwischen dem Keynesianismus (entstanden in den dreißiger Jahren des 20. Jahrhunderts) und der alten klassischen Gedankenwelt vom Beginn des 19. Jahrhunderts (begründet von Adam Smith und David Ricardo, aber entscheidend modifiziert und zu einer allgemeinen Theorie der Märkte umgebaut von Léon Walras) als das entscheidende Merkmal des neuen gesamtwirtschaftlichen Denkens hervorgegangen.
Inflexible Löhne wurden jedoch auch in der neuen, keynesianischen Gedankenwelt, die sich erstmals in der Geschichte der Ökonomik (auch Karl Marx blieb einzelwirtschaftlichem Denken verhaftet) auf die Analyse gesamtwirtschaftlicher Zusammenhänge konzentrierte, als hinzunehmendes Übel angesehen oder gar als soziale Errungenschaft, die man aus politischen Gründen nicht infrage stellen sollte. Auch im Zuge der keynesianischen Revolution wurden inflexible Löhne nur selten explizit als eine entscheidende Voraussetzung für erfolgreiche wirtschaftliche Entwicklung angesehen. Deswegen stellte man sich in den siebziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts nur halbherzig gegen den Versuch der Vertreter des alten liberalen Paradigmas, erneut die Flexibilität aller Preise einschließlich der Löhne als den wichtigsten Faktor einer erfolgreichen Entwicklung der Wirtschaft hervorzuheben.
Als im Gefolge der Ölpreisexplosionen in den siebziger Jahren hohe Inflation und hohe Arbeitslosigkeit zugleich auftraten (die berühmte Stagflation), war die Stunde der Liberalen gekommen. Nun konnten sie scheinbar über20zeugend belegen, dass Systeme, in denen der wichtigste Preis einer Marktwirtschaft, der Preis für Arbeit nämlich, inflexibel ist, unlösbare Konflikte schaffen, die mit den Rezepten des Keynesianismus nicht zu bekämpfen sind. Nur flexible Preise und unabhängige Notenbanken, so die Botschaft des »neuen Wirtschaftsliberalismus«, würden die Bedingungen schaffen, die es erlaubten, diese Probleme in den Griff zu bekommen. Der Neoliberalismus verband sich mit dem Monetarismus und schuf auf diese Weise ein nur schwer zu überwindendes theoretisches Bollwerk. Monetarismus ist die uralte Lehre, die darauf setzt, es könne gelingen, eine Geldmenge zu definieren und technokratisch so zu steuern, dass die Inflation für immer zu einer Randerscheinung des Wirtschaftsgeschehens degradiert würde.
Doch was dieser »Neoliberalismus« an konstruktiven Lösungen zur Überwindung der Probleme der wirtschaftlichen Entwicklung anbot, war extrem dürftig und gar nicht so neu. Neben der Flexibilisierung aller Preise kannte und kennt er nur den freien Handel als notwendige und hinreichende Bedingungen für Wohlstand und wirtschaftliche Entwicklung. Folglich wurde die Globalisierung als das Mittel schlechthin erachtet, um dafür zu sorgen, dass überall auf der Welt freie Unternehmer auf freien Märkten das tun, was sie nach Meinung der Wirtschaftsliberalen besser können als jeder Staat: die Chancen des technischen Fortschritts über unternehmerische Investitionen konsequent nutzen und dadurch die optimale Versorgung aller Menschen mit Wirtschaftsgütern aller Art sicherstellen.
Betrachten wir also die Lösungsvorschläge des Neoliberalismus genauer und beginnen mit der Frage, ob es 21überhaupt den Freihandel gibt, den die Liberalen beschwören. Braucht man tatsächlich flexible Löhne und Preise, um den Herausforderungen der Globalisierung wirksam begegnen zu können? Und inwieweit überfordern uns heute tatsächlich die Sachverhalte, die unter dem Stichwort der »Digitalisierung« diskutiert werden?
Freihandel als Lösung?
Kaum ein Thema brachte in den letzten Jahren mehr Menschen auf die Straße als TTIP, das geplante Freihandelsabkommen zwischen den USA und der EU. Viele Menschen haben offenbar ein gutes Gespür dafür, dass bei solchen Abkommen wichtige Werte einer Ideologie geopfert werden. Auf der anderen Seite steht die große Mehrheit der Ökonomen, die »den Freihandel« mit Klauen und Zähnen verteidigt. Für sie ist der Freihandel absolut notwendig, damit die Wirtschaft effizient arbeitet. Wenn sich jedes Land, so die dahinterstehende Idee, auf die Herstellung der Güter spezialisiert, die es am günstigsten produzieren kann, gewinnt die Welt insgesamt.
Nichts ist den liberalen Ökonomen und Politikern so heilig wie der freie Handel. Er ist schließlich das Einzige, was die liberalen Ökonomen zur Erklärung des »Wohlstands der Nationen« anzubieten haben. Diese »Theorie« basiert im Kern immer noch auf einer Doktrin, die der englische Ökonom David Ricardo vor 200 Jahren postuliert hat. Damals befürchtete man, dass der freie Handel sogar schaden könnte, weil einige Länder in der Lage seien, alle handelbaren Produkte effizienter herzustellen. Um solche absoluten Vorteile auszugleichen, müss22ten unterlegene Länder durch Protektionismus dafür sorgen, dass auch ihre Produzenten eine Überlebenschance hätten.
Dagegen stellte David Ricardo sein berühmtes Prinzip, wonach es im internationalen Handel nicht auf die absoluten, sondern auf die komparativen Vorteile ankomme. Wenn also, das ist ein Beispiel von Ricardo, in einem Land ein Produzent besonders gut Schuhe herstellt, ein Produzent in einem anderen Land aber besonders effizient ist bei der Herstellung von Tuch, dann können die beiden selbst dann miteinander Handel treiben, wenn der Hersteller von Schuhen auch Tuch günstiger herstellen könnte. Die Spezialisierung, also die Konzentration des Schuhherstellers auf die Produktion von Schuhen und die des Tuchherstellers auf Tuch, würde für beide nach dem Austausch ein insgesamt besseres Ergebnis erbringen.
Schon dieses Beispiel zeigt, wie realitätsfern Ricardos Idee ist. Denn offenbar nimmt er an, dass der Schuster mit der Herstellung von Schuhen vollständig ausgelastet ist, so dass er gar nicht auf die Idee kommt, gleichzeitig Schuhe und Tuch zu produzieren. Es gibt aber in der wirklichen Welt keine voll ausgelastete Volkswirtschaft. Jeder wird, wenn er absolute Vorteile hat, alle Vorteile nutzen und sich nicht auf die Herstellung eines Produkts beschränken.
Zudem unterstellt Ricardo, dass ‒ bei Vollbeschäftigung ‒ die Entlohnung der Arbeitskräfte jederzeit und in allen beteiligten Ländern exakt die jeweilige Knappheit von Arbeit und Kapital widerspiegelt. Das ist eine weitere heroische Annahme. Für den internationalen Handel sind nämlich nominale Größen entscheidend, weil sie ‒ zusammen mit den Währungsrelationen ‒ die für den Handel entscheidenden Preise bestimmen.
23Was passiert zum Beispiel, wenn, wie das sehr oft zu beobachten ist, die Inflationsraten zwischen den Ländern weit auseinanderlaufen? Nehmen wir beispielsweise an, die Zuwächse der ausbezahlten Löhne in einem Land überschritten den Produktivitätsfortschritt weit stärker als in einem anderen. Dann verteuern sich die Produkte des ersten Landes systematisch, und die Nachfrage nach diesen Produkten geht zurück, obwohl sich an den Knappheiten von Arbeit und Kapital nichts geändert hat bzw. beide vollkommen gleich sind.
Es müsste dann zumindest einen funktionierenden Mechanismus geben, der dafür sorgt, dass die weit auseinanderlaufenden Preise und Löhne ‒ in internationaler Währung gerechnet ‒ ausgeglichen werden. Nun könnte man vermuten, dieser Mechanismus sei der Devisenmarkt. Diese Vermutung ist jedoch falsch. Währungen sind heute zum Spielball von Spekulanten geworden und werden von ihnen oft über Jahre in die vollkommen falsche Richtung getrieben, da sie Inflations- und Zinsdifferenzen in unterschiedlichen Währungsräumen ausnutzen, um kurzfristige Gewinne zu machen. Auf diese Weise werten die Währungen von Ländern mit hoher Inflation auf und die von Ländern mit niedriger Inflation ab, was genau das Gegenteil dessen ist, was zum Handelsausgleich beitragen könnte. Ricardos Verteidigung des Freihandels läuft also auch an dieser Stelle ins Leere.
Damit aber nicht genug. Die neoklassische Theorie des internationalen Handels unterstellt zudem, dass Direktinvestitionen (also die Verlagerung von Sachanlagen), die von Produzenten aus Ländern mit hoher Produktivität in Ländern mit niedriger Produktivität und niedrigen Löhnen getätigt werden, jederzeit von den relativen Preisen 24von Arbeit und Kapital gelenkt werden. Man nimmt folglich an, dass der westliche Produzent eines mobilen Telefons, der seine Produktion nach China verlagert, für die Produktion in China eine völlig neue Technologie erfindet, die wesentlich arbeitsintensiver als die zu Hause verwendete ist, um dem niedrigeren Preis von Arbeit in China Genüge zu tun. Diese Annahme ist nicht mehr fragwürdig, sie ist lächerlich.
Die neoklassische Gleichgewichtstheorie unterstellt, dass Unternehmen keinen Gewinn machen. Vor allem dürfen die Unternehmen in der neoklassischen Logik keinen Gewinn machen, der sich aus einem monopolistischen Vorsprung ergibt. Wenn also mobile Telefone in China produziert werden, dann wird nach dieser Vorstellung die erfolgreiche westliche Technologie weggeworfen, und man erfindet für China eine neue arbeitsintensivere Technologie. Mit der stellt man dann das gleiche Produkt in gleicher Qualität her und bietet es auf dem Weltmarkt genau zum gleichen Preis an.
Damit verzichtet der Produzent ‒ wiederum laut neoklassischer Theorie ‒ auf den Gewinn, den er gemacht hätte, wenn er die höhere westliche Produktivität mit den niedrigeren chinesischen Löhnen kombiniert hätte. Dann hätte er nämlich seine Lohnstückkosten, also den Lohn pro Stunde, dividiert durch den (realen) Produktionswert pro Stunde, deutlich senken können. Diese Chance nimmt der Unternehmer jedoch nicht wahr, da er ja keinen »Extra-Gewinn« machen darf.
Direktinvestitionen haben heute so gewaltige Effekte, dass man zum Beispiel den chinesischen Handel in keiner Weise mehr mit dem Handel eines westlichen Industrielandes vergleichen kann. Der chinesische Handel besteht 25nämlich zum großen Teil aus dem Handel mit Produkten westlicher Unternehmen, die ihren Standort in China haben. Man schätzt, dass es sich bei sechzig bis siebzig Prozent der gesamten Exporte Chinas nicht um Exporte von chinesischen Unternehmen handelt, sondern um Exporte ausgelagerter westlicher Unternehmen. Dies zeigt, dass die klassische Begründung für den Freihandel nicht auf tönernen, sondern auf gar keinen Füßen steht.
Daraus folgt, dass die gesamte Freihandelsideologie dieser Welt auf einer Theorie beruht, die nicht nur unrealistisch, sondern eindeutig falsch ist. Der internationale Handel mag folglich frei sein, wir wissen jedoch nichts darüber, ob er auch effizient ist. Die Gleichsetzung von Effizienz und Freiheit ist es aber, die als Grund und Rechtfertigung für den Abschluss von TTIP und anderen Freihandelsvereinbarungen vorgetragen wird.
Wir wissen folglich auch nicht, ob die Liberalisierung des Handels effizient ist. Die Idee, dass jeder Eingriff in den freien Handel schädlich und ineffizient ist, ist einfach falsch. Ein Land beispielsweise, das sich gegen massive Importe aus einem anderen Land wehrt, in dem Unternehmen mit extrem hohen Monopolgewinnen hohe Produktivität mit niedrigen Löhnen kombinieren, ist nicht zu verurteilen. Eine dagegen gerichtete protektionistische Maßnahme kann insgesamt die Wohlfahrt auf der Welt verbessern, weil sie verhindert, dass im Prinzip gesunde Unternehmen im Inland durch solche Monopolgewinne geschädigt werden.
Noch schlimmer als all diese Effekte ist, dass einige Länder versuchen, in merkantilistischer Manier viel mehr zu exportieren, als sie importieren. »Globale Ungleichgewichte« heißt dieses Phänomen, das in krassem Gegensatz zur 26Freihandelsdoktrin steht. Deutschland ist hier als sogenannter Exportweltmeister der größte Sünder weltweit. Für den wirtschaftlichen Erfolg oder Misserfolg, den der internationale Handel für die beteiligten Länder hat, sind Überschüsse oder Defizite im Handel viel wichtiger als potenzielle »Produktivitätseffekte«. In Wirklichkeit gibt es, sobald nennenswerte und dauerhafte Außenhandelssalden auftreten, für die Handelspartner überhaupt keinen Anreiz mehr, mit einem Land Abkommen abzuschließen, das seine Überschüsse verteidigt.
Weder gewaltige Wechselkursänderungen noch Direktinvestitionen noch Lohndumping sind Gegenstand der Freihandelsideologie. Das heißt, Verteidiger des Freihandels fällen ihre Urteile auf Basis einer Doktrin, die mit der realen Welt nichts zu tun hat. Was die globalisierte Wirtschaft viel dringender braucht als eine doktrinäre Auseinandersetzung über Handelspolitik, ist ein Währungssystem, das verhindert, dass sich einzelne Länder über Lohndumping oder ähnliche Maßnahmen über lange Zeit ungerechtfertigte absolute Vorteile verschaffen können.
Rigide Löhne und die Drohung mit der Globalisierung
Die Liberalen haben in der Diskussion um die Folgen der Globalisierung schon früh die Agenda vorgegeben, mit einem gewaltigen politischen Paukenschlag und mit einer massiven Drohung zugleich. Weil, so ihre mit Aplomb vorgetragene These, nach dem Fall der Berliner Mauer viele Länder in Osteuropa und in Asien (mit China als einer neuen wirtschaftlichen Supermacht) ihre Grenzen für den 27Warenaustausch öffneten, könne der Westen nicht so weitermachen wie bisher. Angesichts des Auftauchens neuer Teilnehmer an der internationalen Arbeitsteilung hätten sich die Knappheitsverhältnisse zwischen Kapital und Arbeit in der gesamten Welt fundamental verändert.
Weil in den Entwicklungs- und Transformationsländern Arbeit reichlich vorhanden, Kapital aber knapp sei, müssten sich die Preise für Kapital und Arbeit auf der globalen Ebene an diese neuen Knappheitsrelationen anpassen. Arbeit müsse billiger und Kapital teurer werden. Inflexible Löhne in den Industrieländern würden unweigerlich Arbeitslosigkeit nach sich ziehen. Verteilungskämpfe in den reichen alten Ländern würden das Kapital außer Landes treiben, weil es immer die Alternative gebe, sein Kapital in einem aufstrebenden Staat anzulegen.
Vermutlich hat keine These die internationale Diskussion um die Folgen der Globalisierung so stark dominiert wie diese einfache, ja primitive Ableitung, die sich direkt aus der neoklassischen »Theorie« eines »Arbeitsmarktes« ergab. Diese Theorie ist zwar nicht zu halten, aber die gegen sie vorgebrachten Argumente waren ebenfalls äußerst dürftig. Der entscheidende Grund: Die »progressiven Ökonomen« weigerten sich, die neoklassische Arbeitsmarkttheorie vollständig zu verwerfen. Hätten sie sich von Anfang an nicht auf die Knappheitsverhältnis-These eingelassen, sondern die Rolle der Löhne als Stabilisator der inländischen Nachfrage hervorgehoben, hätten sie zeigen können, dass es keineswegs so ist, dass die chinesischen Arbeiter die Löhne in Deutschland mitbestimmen. In Wirklichkeit geht es bei der Öffnung der Märkte und damit bei der Globalisierung nur um Strukturwandel und um wirtschaftliche Dynamik. Beides kennt der Neolibe28ralismus nicht und für beides hat er folglich keine Antwort.
Die große Angst
Die größte wirtschaftliche und politische Bedrohung unserer modernen Gesellschaften geht ohne Zweifel von der Arbeitslosigkeit aus. Arbeitslosigkeit ist zu Recht für viele Beobachter wie für die Betroffenen selbst der entscheidende Hinweis darauf, dass wir nicht so weitermachen können wie bisher. Doch die Folgerungen, die daraus gezogen werden, führen zumeist in die Irre. Ökonomen wie Nicht-Ökonomen, Arbeitgebervertreter wie Gewerkschafter, besonders aber wohlmeinende Philosophen und kritische Intellektuelle sehen unsere Welt in einem Gegenstrom der Globalisierung und Digitalisierung, der die liebgewordenen Annehmlichkeiten des Wohlfahrtsstaates unweigerlich hinwegspülen wird.
Aus ihrer Sicht verweigern sich nur noch Ewiggestrige und blinde Isolationisten der Einsicht in die historische Notwendigkeit, unseren Lebensstandard radikal infrage zu stellen und individuelle Lebensrisiken wie Arbeitslosigkeit, Alter und Krankheit statt durch den Staat in Zukunft privat abzusichern. Ist der Wohlfahrtsstaat also am Ende, weil mehr arme Länder dieser Erde aktiv am Welthandel teilnehmen wollen? Überrennen Millionen Chinesen die Grenzen der reichen Länder und erzwingen mit Gewalt ihre Teilhabe am allgemeinen Wohlstand auf unsere Kosten? Wenn ja, wieso haben dann alle reichen Länder den Absatz ihrer Güter nach China dramatisch erhöht?
29Solche Fragen muss man nicht beantworten, wenn man den Doomsday-Propheten der Globalisierung oder der Digitalisierung geben möchte. Es genügt dafür offenbar, die entscheidenden Stichworte in den Raum zu werfen, und schon ist der verhängnisvolle Kreislauf von Gürtel-enger-Schnallen und Über-die-Verhältnisse-Leben in Gang gesetzt, der immer mit dem Schleifen des Wohlfahrtsstaates endet.
Was verlangt die Globalisierung?
Jenseits des öffentlich zelebrierten Erschauerns im Angesicht der Globalisierung kann man ganz einfache Regeln für das friedvolle Zusammenleben der Nationen auf wirtschaftlichem Gebiet aufstellen. Alle Regeln, von wem auch immer sie aufgestellt werden, können nur darauf hinauslaufen, zu fordern, dass jedes Land sich an seine eigenen Verhältnisse anzupassen hat, also nicht über seinen Verhältnissen leben darf. Mehr kann einfach kein Staat von einem anderen verlangen und mehr kann keine globale Regelung von einzelnen Ländern und ihren Bürgern erzwingen. Mehr zu fordern, würde ja bedeuten, dass man von dem einen fordert, bewusst unter seinen Verhältnissen zu leben, was logischerweise bedeutet, dass man einen anderen zwingt, über seinen Verhältnissen zu leben, denn alle zusammen können weder unter noch über ihren Verhältnissen wirtschaften (Flassbeck & Spiecker 2016).
Übersetzt in ökonomische Terminologie bedeutet das: Jedes Land muss seine Ansprüche genau an seine eigene Produktivität anpassen. Auf einzelwirtschaftlicher Ebene 30ist diese Regel unmittelbar einleuchtend: Auf Dauer kann ein Wirtschaftssubjekt nicht mehr ausgeben, als es einnimmt, das heißt, jeder muss das, was er beansprucht, auch erarbeiten. Gibt er mehr aus, lebt er über seinen Verhältnissen, er verschuldet sich und muss einen Gläubiger finden. Der Gläubiger ist derjenige, der ihm glaubt, dass er seine Schulden eines Tages zurückzahlen kann, seine Produktivität also ausreicht, um das in Anspruch Genommene zu begleichen.
In der anderen Richtung gilt das Gleiche: Auf Dauer kann man nicht weniger ausgeben, als man verdient. Denn wer unter seinen Verhältnissen leben will, muss einen Schuldner finden, also jemanden, der bereit ist, über seinen Verhältnissen zu leben. Wer Gläubiger (oder Netto-Sparer) werden will, muss andere finden, die sich verschulden wollen. Wenn niemand bereit ist, sich in der Höhe zu verschulden, in der ein anderer sparen möchte, gibt es keinen Abnehmer für das, was dieser andere quasi über seine eigenen gegenwärtigen Wünsche hinaus produzieren will. Dann fehlt ihm die Nachfrage, die er für seine Einkommenserzielung benötigt, und der Sparplan scheitert.
Was bedeutet die Regel, sich an seine Produktivität, sich an seine eigenen Verhältnisse anzupassen, für den internationalen Handel? Von der internationalen Arbeitsteilung können auf Dauer alle nur dann profitieren, wenn kein Land seine Wettbewerbsfähigkeit durch Protektionismus oder ähnliche Maßnahmen auf Kosten anderer Länder steigert. Gleichberechtigt miteinander Handel treiben können alle nur dann, wenn kein Land auf Dauer über seine Verhältnisse lebt und keines darunter.
Geschieht dies dennoch, werden also durch massive 31Verstöße gegen die allgemeine Regel langfristig Gläubiger- und Schuldnerpositionen aufgebaut, kommt es zwischen Staaten mit einer je eigenen Währung über kurz oder lang zu Anpassungen der Wechselkurse. Verliert ein Land durch eine ständig anwachsende Schuldnerposition an Kreditwürdigkeit, wird seine Währung abgewertet. Umgekehrt muss ein Land mit einer immensen Gläubigerposition früher oder später seine Währung aufwerten, das heißt, seine Guthaben im Ausland entwerten. Das Wechselkursventil, obwohl in vieler Hinsicht problematisch, ist quasi der Beweis dafür, dass probatere Mittel zum Ausgleich der unterschiedlichen wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit von Nationen versagt haben.
Länder selbst sind allerdings keine Wirtschaftssubjekte, sondern bestehen vielmehr ihrerseits aus einer Vielzahl von Wirtschaftssubjekten. Wie kann ohne das Notventil des Wechselkurses dafür gesorgt werden, dass die einzelwirtschaftliche Regel, jeder habe sich langfristig an seine Produktivität anzupassen, auch auf nationaler Ebene durchgesetzt wird? Ein Land passt sich langfristig automatisch an seine Produktivität an, wenn das durchschnittliche reale Pro-Kopf-Einkommen (pro Stunde zum Beispiel) im gleichen Tempo wächst wie die durchschnittliche Produktivität (also der Zuwachs des Realeinkommens pro Stunde). Dies wird logischerweise ‒ und das ist durch vielfältige empirische Erfahrung bestätigt ‒ am besten dadurch erreicht, dass die Nominallöhne im Durchschnitt der Volkswirtschaft um die Summe aus erwarteter durchschnittlicher Produktivitätssteigerung und der Zielinflationsrate wachsen.
Diese einfache Lohnregel impliziert zum einen, dass nicht nur die Beschäftigten, der »Faktor Arbeit«, sondern 32auch die Kapitalseite angemessen an der wirtschaftlichen Entwicklung beteiligt wird. Zum anderen erlaubt sie eine stabile Inflationsrate, weil der Abstand zwischen Nominallohnsteigerungen und Produktivitätssteigerung (die Entwicklung der sogenannten Lohnstückkosten) die entscheidende Determinante der gesamten Kostenentwicklung ist, die wiederum die Preisentwicklung weitgehend bestimmt (wie später gezeigt wird).
Es ist also gerade die Teilhabe der breiten Masse der Bevölkerung an der Produktivitätsentwicklung via Lohnkostensteigerung, die mit der Regel für die internationale Arbeitsteilung harmoniert. Dagegen führt eine Strategie des Unter-den-eigenen-Verhältnissen-Lebens, also der Versuch, die breite Masse über Jahre hinweg nicht an Produktivitätssteigerungen teilhaben zu lassen, mit Sicherheit in eine nationale und in eine internationale Sackgasse. Deutschland steckt seit Jahren in beiden, weil es den Herausforderungen der Globalisierung begegnen wollte, indem es selbst den Gürtel enger schnallte, und damit auf die Bereitschaft anderer setzte, eine immer höhere internationale Verschuldung zu akzeptieren.
Handel zwischen Hoch- und Niedriglohnland
In Deutschland verdiente ein Arbeiter im Jahr 2000 etwa 25 000 Euro brutto, ein chinesischer Arbeiter verdiente umgerechnet etwa 1150 Euro. Wie können zwei Länder miteinander Handel treiben, deren Lohnniveaus so weit auseinanderliegen? Müssten nicht sämtliche Produkte in China hergestellt worden sein, und müsste nicht Deutschland alle Güter von dort importiert haben?
33Nein, denn entscheidend für die Wettbewerbsfähigkeit eines Produktes am Weltmarkt ist ‒ bei gegebener Qualität ‒ sein Preis, und dieser wird nicht vom absoluten Niveau der Löhne bestimmt, zu denen es produziert wird, sondern von den Löhnen im Verhältnis zur Produktivität, also den Lohnstückkosten. Wie viel Lohn in einem Produkt, einem »Stück«, steckt, hängt von der Höhe des Kapitalstocks ab, mit dessen Hilfe es hergestellt wird. Besteht das Gut zum Beispiel nur aus Handarbeit und wird es an einem Tag von einem Handwerker produziert, so betragen die Lohnstückkosten genau den Tageslohn des entsprechenden Handwerkers. Wird das Gut jedoch mit einer Maschine produziert, die ein Arbeiter bedient, und kann der mittels dieser Maschine zehn Stück am Tag herstellen, dann betragen die Lohnstückkosten genau ein Zehntel seines Tageslohns. Verdient dieser Arbeiter beispielsweise das Fünffache des Handwerkers, kann er ein einzelnes Stück immer noch preiswerter anbieten als sein Konkurrent.
Daraus folgt, dass die gegenwärtigen hohen Lohnkosten in Deutschland so wenig vom Himmel gefallen sind wie die niedrigen chinesischen. Beide haben sich in kleinen Schritten aus der Vergangenheit heraus entwickelt. Sie sind der Spiegel der Produktivität, die wiederum auf dem erwirtschafteten Kapitalstock eines Landes beruht. Wer den aktuellen Stand der Lohnstückkosten hierzulande für generell zu hoch erklärt, ignoriert die historische Entwicklung von Produktivität und Kapitalstock, oder er behauptet, der (west)deutsche Kapitalstock sei wegen der allmählich stärkeren Öffnung der Märkte seit dem Ende des Ost-West-Konflikts schlagartig obsolet geworden, entwertet durch die zunehmende Globalisierung. Diese Vor34stellung ist angesichts der Spitzenstellung vieler deutscher Exporteure auf den Weltmärkten (und insbesondere in den Niedriglohnländern) offensichtlich absurd.
Der Preis eines Gutes hängt allerdings nicht nur von den Lohnstückkosten, sondern auch von den Kapitalkosten ab, also den Kosten, die der in der Produktion eingesetzte Kapitalstock verursacht. Um in unserem Beispiel zu bleiben: Der Arbeiter muss die Maschine erst einmal haben, bevor er mit ihr produzieren kann. Würden die Lohn- und Kapitalkosten der kapitalintensiven Produktionsweise zusammen den Produktivitätsvorteil gegenüber der arbeitsintensiven Herstellung überwiegen, wäre das kapitalintensiv produzierte Gut nicht konkurrenzfähig. Die kapitalintensive Produktionsweise wäre dann entweder gar nicht entstanden oder sie würde von einer arbeitsintensiveren Produktionsweise verdrängt.
Doch wer hat jemals beobachtet, dass maschinelle Webstühle Handwebern weichen mussten? Im Gegenteil: Stets war und ist die Menschheit bemüht, einen möglichst großen Kapitalstock aufzubauen, weil der technische Fortschritt vergleichsweise wenig produktive Tätigkeiten überflüssig macht und man sich produktiveren Beschäftigungen zuwenden kann, mit denen sich höhere Einkommen und damit ein größerer Wohlstand erzielen lassen.
Das heißt nichts anderes, als dass mittel- bis langfristig die Entwicklung hin zu einem ständig steigenden Kapitaleinsatz eine Art Naturgesetz in der Welt der Ökonomie ist. Könnten die Weber langfristig so schlecht bezahlt werden, dass sich der Bau eines maschinellen Webstuhls niemals rentiert? Nein, das ist nicht vorstellbar. Das aber bedeutet zwingend, dass weder die historische Entwicklung unseres Kapitalstocks noch die unserer Löhne ein Irrtum war.
35Ist nun die Produktivität in Deutschland aufgrund des vorhandenen Kapitalstocks um so viel höher als in China, dass die Lohnstückkosten trotz der unterschiedlichen Lohnniveaus gleich sind, findet keine Verdrängung am Weltmarkt statt, importiert also das Hochlohnland nicht automatisch alles aus dem Niedriglohnland. In den Bereichen, in denen die deutschen Lohnstückkosten über den chinesischen liegen, findet Handel statt, bei dem die billigeren Anbieter die teureren auf dem Weltmarkt verdrängen. Das ist der internationale Strukturwandel, bei dem Deutschland bisher hervorragend abgeschnitten hat.
Hochlohnländer spezialisieren sich auf Güter, die allein mit einer besonderen Technologie hergestellt werden können. Nur wer über einen entsprechend großen und hoch spezialisierten Kapitalstock und das entsprechende Fachwissen verfügt, kann auf dem Weltmarkt hoch spezialisierte Güter anbieten. Das sind in der Regel nicht die Anbieter aus Niedriglohnländern, da diese Länder sich ja gerade dadurch auszeichnen, dass sie (noch) nicht so stark industrialisiert und spezialisiert sind.
Sobald man also, anders als die meisten ökonomischen Lehrbücher, nicht nur von zwei Handelsgütern auf dem Weltmarkt ausgeht, sondern realistischerweise eine riesige Produktpalette in Betracht zieht, verliert die Vorstellung vom knallharten internationalen Verdrängungswettbewerb, in dem die reichen Nationen unweigerlich verlieren, jede Plausibilität. Das übliche theoretische Modell, in dem Hersteller beliebig zwischen verschiedenen Produktionstechniken wählen können, um sich optimal an das Faktorpreisverhältnis für die Produktionsfaktoren Arbeit und Kapital, also das Lohn-Zins-Verhältnis, anzupassen, ist unrealistisch und irreführend.
36Dabei sind es nicht nur Anpassungsfriktionen oder die zeitlich begrenzte Immobilität von Produktionsfaktoren, die dafür verantwortlich sind, dass es keine beliebige Anpassung an das Faktorpreisverhältnis gibt. Es geht um etwas viel Grundsätzlicheres. Man kann schlicht ein Handy oder einen Mercedes nicht beliebig arbeitsintensiv produzieren. Wollte man das, müsste man erst eine völlig neue, auf höhere Arbeitsintensität zielende Produktionsweise erfinden. Das wäre nicht nur teuer, sondern auch sinnlos. Die kapitalintensive Produktionsweise ist langfristig immer die überlegene, weil sie mehr Wohlstandspotenzial und damit die Voraussetzung für auf der ganzen Welt steigende Löhne schafft. Daher führte eine durch niedrigere Arbeitskosten getriebene hypothetische Parallelentwicklung arbeitsintensiverer Produktionsverfahren auf lange Sicht immer ins Aus. Wer das nicht glaubt, suche einen Unternehmer, der in China oder Indien mit der Technologie der siebziger Jahre moderne weltmarktgängige Rechner herstellt.
Doch selbst wenn das Vorhalten einer arbeitsintensiveren Produktionsweise technisch möglich wäre, fände es nicht statt. Und zwar aus dem einfachen Grund, dass es viel rentabler ist, die heute üblichen kapitalintensiven Produktionstechniken mit den Billiglöhnen der aufholenden Länder zu kombinieren. Die dadurch möglichen temporären Monopolgewinne machen jede andere Lösung von vornherein unwirtschaftlich. Nur weil die ökonomischen Standardmodelle unterstellen, Monopolgewinne spielten in den Kalkülen der Unternehmen keine Rolle, hat die herrschende Lehre keinerlei Zugang zu einer realistischen Analyse des internationalen Handels und der Faktorwanderung. Tragisch ist dabei, dass sich fachfremde Intellek37tuelle ‒ freilich ohne zu wissen, was sie tun ‒ die Annahmen der Standardmodelle zu eigen machen und auf dieser Basis die Globalisierung zu analysieren versuchen.
Handel bei Kapitalwanderung
Befürworter von Lohnkostensenkungen in den reichen Ländern führen als Argument dafür regelmäßig die Möglichkeit des Kapitals an, in Niedriglohnländer abzuwandern. Die hiesige Arbeitslosigkeit zeige, dass zu wenig im Inland investiert werde. Das läge daran, dass aufgrund der vergleichsweise zu hohen Löhne die Rentabilität des Kapitals zu gering sei. Böten sich außerhalb Deutschlands gewinnträchtigere Anlagemöglichkeiten, würden diese auch genutzt und das Kapital fließe ab.
Dieser Mechanismus habe seit Ende des Ost-West-Konflikts und der damit einhergehenden intensiveren Teilnahme ärmerer Volkswirtschaften am Welthandel eine neue Dynamik erreicht, an die man sich hierzulande anzupassen habe. Die Knappheitsverhältnisse der Produktionsfaktoren hätten sich grundlegend gewandelt: Es stünden eben sehr viel mehr Arbeitskräfte zur Verfügung, zugleich brächten diese aber keinen auch nur annähernd so hohen Kapitalstock mit in die Weltwirtschaft ein wie ihre Kollegen aus den Industrienationen, so dass der Faktor Kapital im Vergleich zu Arbeit viel knapper geworden sei. Diese gestiegene Knappheit mache es notwendig, das Kapital durch niedrigere Löhne zum Bleiben zu bewegen, da die niedrigen Löhne in den aufholenden Volkswirtschaften eine enorme Sogwirkung auf das hiesige Kapital ausübten (vgl. Sinn 2003, S. 91ff.).
38Richtig ist an dieser Sichtweise, dass es für hiesige Unternehmer tatsächlich lohnend sein kann, ihre kapitalintensiven Produktionstechnologien mit den in den aufholenden Volkswirtschaften herrschenden Billiglöhnen zu kombinieren. Das war schon immer eine Möglichkeit, vorübergehende Monopolgewinne zu erzielen, und mag seit 1989 einfacher zu realisieren sein. Auch für Unternehmer in den Billiglohnländern selbst besteht ein großer Anreiz, die westlichen Technologien zu kopieren, das heißt, diese zu importieren, um dann in Kombination mit den niedrigen heimischen Löhnen überdurchschnittliche Gewinne zu erwirtschaften. Denn sofern die Lohnentwicklung im Niedriglohnland der durchschnittlichen Produktivitätsentwicklung in der dortigen Gesamtwirtschaft folgt, können über Jahre und sogar Jahrzehnte hinweg beachtliche Monopolgewinne erzielt werden, da das Produktivitätsniveau dort aufgrund des niedrigen Ausgangswertes des Kapitalstocks noch lange unterhalb dessen liegen wird, was in den reichen Ländern erreicht ist.
Abwegig ist es jedoch, die Kapitalwanderung in Niedriglohnländer für die hiesige Arbeitslosigkeit verantwortlich zu machen. Denn wer die wirtschaftliche Entwicklung der Bundesrepublik nach dem Zweiten Weltkrieg oder etwa die Polens seit dem Fall der Mauer betrachtet, stellt fest, dass Kapitalwanderungen nicht schlagartig und in großem Maßstab, sondern allmählich erfolgen. Sonst hätte der Aufbau des westdeutschen Kapitalstocks nach dem Krieg viel schneller geschehen müssen. Auch Polen müsste mit seinen Billiglöhnen nach dreißig Jahren längst hoch industrialisiert sein, wenn die Nettokapitalbewegung von Hoch- zu Niedriglohnländern so gewaltig wäre, wie dies die Globalisierungspessimisten behaupten.
39Das überschaubare Ausmaß von Kapitalverlagerungen erklärt sich einerseits dadurch, dass sie nicht risikolos zu bewerkstelligen sind. So muss etwa das erforderliche »Humankapital« im Niedriglohnland vorhanden sein, also das Know-how auf allen Ebenen des Produktionsprozesses. Die wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen der aufholenden Volkswirtschaft müssen stabil genug sein, um Unternehmen dazu zu bringen, langfristig in diesem Land zu investieren. Häufig wechselnde Regierungen mit unterschiedlichen wirtschaftspolitischen Konzepten können auf in- wie ausländische Investoren ebenso abschreckend wirken wie mangelnde innere Sicherheit.
Gegen die Angst vor massiver Kapitalabwanderung in Niedriglohnländer und drohender Kapitalknappheit in Hochlohnländern spricht jedoch noch ein viel grundlegenderes Argument. Fasst man die wirtschaftliche Entwicklung als einen Prozess auf, in dessen Verlauf Gewinne und damit Kapital entstehen, geht es gar nicht in erster Linie um das gegenseitige Ausstechen der Unternehmer, Arbeitnehmer oder Länder beim angeblich nur sehr langsam (via Sparen) vermehrbaren Produktionsfaktor Kapital. Wenn tatsächlich Gewinnchancen in Niedriglohnländern genutzt werden können, vermehrt sich das im Entwicklungsprozess der aufholenden Länder so dringend benötigte Kapital durch den Prozess selbst. Also auf eine Weise, welche die Kapitalbilanz des Niedriglohnlandes nicht belastet und es ihm erlaubt, mehr Güter als sonst möglich aus den Hochlohnländern zu importieren.