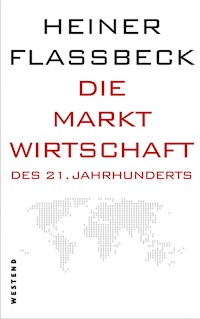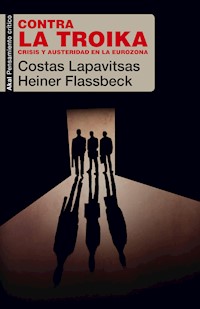15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Westend Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
EUROPA OHNE KRISE IST MÖGLICH ARGUMENTE FÜR EINE ABKEHR VOM NEOLIBERALISMUS Der Euro steckt seit 2008 in einer tiefen Krise, die nicht enden will und den Fortbestand der Währungsunion gefährdet. Doch Deutschland verweigert sich der Einsicht, dass es selbst eine entscheidende Schuld an der Misere hat. Stattdessen werden "Krisenländer" wie Griechenland, Portugal und Spanien als Schuldige an den Pranger gestellt. Jörg Bibow und Heiner Flassbeck zeigen in ihrem Buch, dass die Eurogruppe unter der Führung Deutschlands für die unnötige Verlängerung der Krise verantwortlich ist. Die verordnete Austeritätspolitik und die sogenannte "Arbeitsmarktflexibilisierung" haben die Krise vertieft und verlängert. Bis heute wird nicht verstanden, dass Lohnsenkung unmittelbar die Arbeitslosigkeit erhöht, weil man damit die Binnennachfrage zerstört. Und Frankreich zeigt in diesen Tagen, dass es diese Lektion nicht gelernt hat.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 264
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Ebook Edition
Jörg Bibow, Heiner Flassbeck
Das Euro-Desaster
Wie deutsche Wirtschaftspolitik die Eurozone in den Abgrund treibt
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.westendverlag.de
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig.
Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
ISBN 9-783-86489-709-2
© Westend Verlag GmbH, Frankfurt/Main 2018
Umschlaggestaltung: Buchgut, Berlin
Satz und Datenkonvertierung: Publikations Atelier, Dreieich
Inhalt
Vorwort
Über Wolfgang Schäuble ist nach seinem Ausscheiden als Bundesfinanzminister viel geschrieben worden. Der deutsche Mainstream hat den Mann, den schon vorher praktisch niemand kritisieren wollte, in den Himmel gehoben. Er habe Eurostaaten gerettet und als Erster den deutschen Staatshaushalt konsolidiert.
Wir haben uns in diesem Buch im Detail mit der Entwicklung der Krisenstaaten im Euroraum beschäftigt und kommen zu einer etwas anderen Würdigung. Will man sie in einem Satz bündeln, würde unsere Schlussfolgerung heißen: Er hat Eurostaaten an den Abgrund getrieben und exakt zum falschen Zeitpunkt zugelassen, dass der deutsche Staatshaushalt einen Überschuss ausweist.
Der frühere Bundesfinanzminister hat mehr als jeder Finanzminister zuvor die wirtschaftliche Entwicklung in Europa zu verantworten. Und die Ergebnisse sind schlicht katastrophal. Nicht nur, dass Europa viel weniger gewachsen ist, als es möglich gewesen wäre. In Sachen Arbeitslosigkeit liegt Europa heute gemäß den offiziellen Zahlen noch immer bei neun Prozent, während sich ein vergleichbarer Wirtschaftsraum wie die USA mit deutlich unter fünf Prozent historischen Tiefstständen nähert. Das Niveau der Arbeitslosigkeit in ganz Südeuropa einschließlich Frankreichs ist immer noch extrem hoch – und das liegt nicht an verkrusteten Arbeitsmärkten, sondern allein an geringer Wachstumsdynamik.
Europa ist aber nicht kaum gewachsen und weist hohe Arbeitslosigkeit auf, es hat auch sein Inflationsziel nicht erreicht. Die EZB kämpft seit Jahren mit Null- beziehungsweise Negativzinsen gegen deflationäre Tendenzen. Das wird in Deutschland heftig kritisiert, aber man will gleichzeitig nicht wahrhaben, dass es die deutsche Lohndeflation unter Rot-Grün war, die den Keim der Deflation in die Europäische Währungsunion eingepflanzt hat.
Das bedeutet nichts anderes, als dass alle makroökonomischen Ziele weit davon entfernt sind, erreicht zu werden. Die Austeritätspolitik, wie sie unmittelbar nach Beginn der Krise von Deutschland als Krisenmanager verordnet wurde, war schlicht absurd. Man hätte die Vorgaben des Stabilitäts- und Wachstumspaktes niemals extrem restriktiv ausgestalten dürfen, und man hätte niemals versuchen dürfen, diese Vorgaben einzuhalten.
Zudem – und das ist sogar noch wichtiger und unsere Hauptkritik in diesem Buch – hat die Eurogruppe die Krisenländer dazu getrieben, die Arbeitsmärkte zu »flexibilisieren«, was nichts anderes hieß, als »zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit« die Löhne zu senken. Das war der Kardinalfehler, weil es unmittelbar zu einem starken Rückgang der Binnennachfrage führte und deswegen zu weiter steigender Arbeitslosigkeit, statt, wie von der Eurogruppe, dem IWF und Schäuble erwartet, die Arbeitslosigkeit zu senken.
Genau an diesem Punkt zeigt sich, wie fatal der Glaube des Mainstreams an die Validität des neoklassischen Arbeitsmarktmodells war und ist. Nur wer dieses Modell komplett über Bord wirft, hat eine Chance, eine angemessene Diagnose mit einer funktionierenden Therapie zu verbinden. Wir zeigen dazu die Alternative sowie die angemessene Politik in solchen Krisenfällen.
Dieses Buch konnte nur durch die großzügige Unterstützung von zwei Arbeitskammern realisiert werden: Die Chambre des salariés in Luxemburg hat sich mit unbürokratischem Engagement in die Bresche geworfen und es ermöglicht, die umfangreichen Untersuchungen, die für dieses Buch notwendig waren, durchzuführen. Aber auch die Arbeitskammer des Saarlandes hat das in ihren Möglichkeiten Stehende getan, um in Kooperation mit den Luxemburger Kollegen das Gesamtprojekt zu ermöglichen. Dafür danken wir den beiden Kammern – nicht ohne den Hinweis, wie wichtig es ist, solche Institutionen zu haben, die es auch der Arbeitnehmerseite ermöglicht, unabhängige Studien zu einem so zentralen Thema in Auftrag zu geben.
1 Fiskalische Austeritätspolitik und Lohnsenkung: eine fatale Kombination als »Anpassungsprogramm« in den Eurokrisenländern
In diesem Buch geht es um die konkreten Auswirkungen der Politik der Eurogruppe und der sogenannten Troika auf die Eurokrisenländer. Bis heute haben die meisten Beobachter nicht verstanden, was dort passiert ist und warum der Einbruch der Produktion so gewaltig war. Das liegt daran, dass überwiegend nicht gesehen wird, welch fatale Entwicklung von den Lohnsenkungen ausging, die mit staatlicher Austeritätspolitik kombiniert wurden. Im Fokus des ersten Teils stehen die Eurokrisenländer und ihre Erfahrungen in der Zeit seit 2008.
Die Europäische Währungsunion (EWU) befindet sich seit 2008 in einer Dauerkrise. Davon sind zwar nicht alle Mitgliedsländer gleichermaßen stark betroffen, aber der Fortbestand des Euro ist weiterhin infrage gestellt. Die Wirtschaftspolitik der Eurozone hat offensichtlich eklatant versagt, vermag es aber nicht, das einzugestehen und Konsequenzen für eine neue Politik zu ziehen. Schob man die Verantwortung für die Krise zunächst auf die Finanzmärkte, wurde danach – nahezu übergangslos – die »verantwortungslose« Fiskalpolitik bestimmter Mitgliedsländer als vermeintliche Krisenursache identifiziert, die Krise wurde zur »Staatsschuldenkrise« umgedeutet. Daraufhin wurde, fast reflexartig, eine allgemeine Austeritätspolitik eingefordert, begleitet von »Strukturreformen« zur Erhöhung der »Flexibilität« der Wirtschaft in der Zukunft. Schließlich entdeckte man den Verlust von Wettbewerbsfähigkeit als das allen Krisenländern gemeinsame kritische Manko. Dieses sollte nach der offiziellen Lesart der Eurogruppe durch Lohnsenkungen sowie Maßnahmen zur Arbeitsmarktflexibilisierung behoben werden.
Die Troika-Anpassungsprogramme, die im Zuge der Krisenbekämpfung entwickelt wurden, enthielten eine Kombination von fiskalischer Austeritätspolitik (oder staatlicher Sparpolitik) und Lohnsenkungspolitik. Durch diese Politikmischung sollten die Eurokrisenländer sowohl ihr internes als auch externes Gleichgewicht wiederherstellen. Ein internes Gleichgewicht ist durch Vollbeschäftigung, Preisstabilität und nachhaltige öffentliche Finanzen gekennzeichnet, ein externes Gleichgewicht durch eine nachhaltige Position der Leistungs- und Auslandsvermögensbilanz.
Staatliche Sparpolitik zielt primär auf die Nachhaltigkeit der öffentlichen Finanzen. Ob bei der Verwirklichung dieses Zieles negative Wirkungen auf Beschäftigung und Preisstabilität auftreten können und in welchem Ausmaß, wird in der Literatur kontrovers diskutiert. Diese Frage betrifft Höhe und Vorzeichen des »Multiplikators«, der wir uns hier widmen wollen. Lohnsenkungspolitik dagegen zielt primär auf das externe Gleichgewicht, auf die Wiederherstellung der Wettbewerbsfähigkeit. Innerhalb einer Währungsunion kann dies nicht durch Wechselkursabwertung, sondern nur durch »interne Abwertung« geschehen, also einer Verbesserung des nationalen Lohnstückkostenniveaus im Vergleich zu den Handelspartnern. Aus der Sicht der Protagonisten dieser kombinierten Anpassungsstrategie würden möglichst flexible Löhne, begünstigt durch entsprechende Strukturreformen, etwaige Schäden der Sparpolitik begrenzen helfen. Unterstellt wird hierbei offenbar, dass Lohnsenkungen zu schnellen Beschäftigungsgewinnen führen.
Wir bezweifeln die bei dieser kombinierten Anpassungsstrategie unterstellte Kompensation negativer Beschäftigungswirkungen grundsätzlich. Wir argumentieren, dass diese Hypothese auf einem Trugschluss beruht, der sich aus dem zentralen Schwachpunkt der Mainstream-Arbeitsmarkttheorie resultiert. Unsere Gegenhypothese lautet, dass Lohnsenkungspolitik die ohnehin zu erwartenden negativen Wirkungen fiskalischer Austeritätspolitik auf Nachfrage- und Beschäftigungsentwicklung verstärken wird. Sollte diese Anpassung in einem deflationären Wirtschaftsumfeld passieren, ist sogar noch mit zusätzlichen Belastungsfaktoren für die Konjunktur und die Beschäftigung zu rechnen.
Betrachtet man die Tiefe und Dauer des wirtschaftlichen Einbruchs in der Folge des kombinierten Einsatzes von Spar- und Lohnsenkungspolitik in den Jahren 2010 bis 2013, so ist die Prima-facie-Evidenz für unsere Gegenhypothese geradezu erdrückend. Beschäftigungs- und Inflationsentwicklung in der Eurozone belegen das Scheitern der gewählten Wirtschaftspolitik zweifelsohne. Die Arbeitslosigkeit verharrt bis heute auf einem extrem hohen Niveau. Löhne und Preise steigen kaum, oder es herrscht sogar offene Deflation. Die Eurozone insgesamt wandelt seit geraumer Zeit am Abgrund einer Deflation. Nur deswegen hat selbst die EZB nach langem Zögern im letzten Jahr doch noch ein Programm der »quantitativen Lockerung« (QE) aufgelegt, um Inflation und Inflationserwartungen zu erhöhen. Doch auf die erwünschten inflationären Wirkungen wartet man weiterhin, während auch die sogenannte »Erholung« der Wirtschaft kraftlos, fragil und unausgewogen bleibt. Generell besteht ein grotesker Widerspruch zwischen einer Wirtschaftspolitik, die einerseits die Löhne senken, andererseits aber die Inflation erhöhen will.
Vertreter der offiziellen Wirtschaftspolitik wenden ein, dass es gewisse »Erfolgsgeschichten« gegeben habe. Und einflussreiche Forscher und Berater der Wirtschaftspolitik (zum Beispiel des IWF) reden sich damit heraus, dass man die Multiplikatoren leider »unterschätzt« habe. Das klingt so, als sei man heute schlauer, habe aus Fehlern gelernt. Auch das ist zu bezweifeln, denn die eigentlichen Gründe für das Scheitern der Politik werden überhaupt nicht weiter hinterfragt.
Ziel unserer Untersuchung ist es daher, theoretisch zu begründen und empirisch zu belegen, dass die in den Eurokrisenländern verfolgte Politik, Lohnsenkungen – als Mittel zur Wiederherstellung der Wettbewerbsfähigkeit – und fiskalische Austerität zu kombinieren, maßgeblich war für Tiefe und Dauer des beobachteten Einbruchs. Dieser Nachweis ist von großer Bedeutung für zukünftige Anpassungsprogramme und auch, um ein grundsätzliches Überdenken der Wirtschaftspolitik der Eurozone anzuregen. Schließlich ist die Eurokrise bis heute ungelöst.
1.1 Die offizielle Krisendiagnose und ihre Schwächen
Wirtschaftspolitisches Versagen erster Klasse
Seit 2008 ist die weltwirtschaftliche Entwicklung durch vielfache Krisen und Instabilitäten gekennzeichnet. Kaum ein Land oder eine Region der Welt konnte in dieser Zeit eine wirklich befriedigende Wirtschaftsentwicklung erzielen. Unter den westlichen Industrieländern sticht die Eurozone allerdings als die Region hervor, die sich am schlechtesten von der globalen Finanzkrise (2008 bis 2009) und anschließenden Eurokrise (seit 2010) erholt hat – ein Prozess, der bis heute nicht abgeschlossen ist. Zum Jahresende 2015 hat das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der Eurozone gerade wieder das Vorkrisenniveau von Anfang 2008 erreicht – das entspricht acht Jahren Nullwachstum. Das ist ein trauriger Rekord, der selbst die Erfahrungen Japans seit 1991 in den Schatten stellt. Genauer gesagt lag die Binnennachfrage in der Eurozone selbst zum Jahresende 2015 immer noch circa drei Prozent unterhalb ihres Vorkrisenniveaus. Die Lücke zwischen BIP und Binnennachfrage entspricht dem mittlerweile sehr hohen Leistungsbilanzüberschuss der Eurozone, der sich seit dem Beginn der Krise aufgebaut hat. Dieser Überschuss zeigt, dass die Eurozone in dieser Zeit sogar von weltwirtschaftlichen Wachstumsimpulsen profitiert hat, die eigene Wirtschaftsentwicklung wäre ansonsten noch schwächer ausgefallen.
Die außergewöhnlich schlechte Wirtschaftsentwicklung der Eurozone hatte sicher eine Reihe von Ursachen. Angesichts der katastrophalen Ergebnisse sollte es aber außer Frage stehen, dass die Europäische Währungsunion (EWU) fehlkonstruiert ist und die Wirtschaftspolitik eklatant versagt hat. Dennoch ist leider festzustellen, dass die politisch Verantwortlichen bis heute nicht die notwendigen Schlüsse aus dieser Erfahrung gezogen und eine grundlegende Korrektur der Wirtschaftspolitik eingeleitet haben. Die Reformen der Regimearchitektur der Währungsunion blieben halbherzig und gingen zum Teil sogar in die falsche Richtung. Die Wirtschaftspolitik der Eurozone hat sich weiterhin hartnäckig und unbeirrbar auf nur zwei Dinge konzentriert: die Konsolidierung der Staatsfinanzen und die Wiederherstellung beziehungsweise Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit, und zwar durch Druck auf die Löhne in den Krisenländern.
Wenngleich es heute außer Frage stehen müsste, dass diese Wirtschaftspolitik eklatant versagt hat, findet eine kritische Auseinandersetzung mit ihrem Scheitern in der politischen Debatte speziell in Deutschland, dem zunehmend hegemonialen Mitgliedsland der EU/EWU, bis heute nicht statt. Zunehmend labil wird dagegen die politische Situation in denjenigen Euro-Mitgliedsländern, die deutlich stärker als Deutschland von der Krise erfasst wurden – wobei Deutschland mancherorts sogar immer mehr im Verdacht steht, von der Eurokrise auf Kosten seiner Partner zu profitieren. Die Eurozone ist gespalten, die Partner driften auseinander. Die Wirtschaftspolitik der EWU bedarf einer dringenden und grundlegenden Kursänderung, um ihr endgültiges Scheitern noch zu verhindern.
Krisenbekämpfung kann nur erfolgreich sein, wenn sie auf einer angemessenen Ursachendiagnose beruht. Die offizielle Krisendiagnose weist eklatante Schwächen auf, das Versagen der Wirtschaftspolitik ist so gesehen wenig überraschend. Es scheint fast, man sei im Kreis der politisch Verantwortlichen weiterhin in erster Linie darum bemüht, das eigene krasse Versagen schönzureden. Ums Schönreden der Entwicklung ging es auch bereits vor dem Ausbruch der Krise. Otmar Issing, der erste Chefökonom der EZB (1999 bis 2006), der zuvor selbige Funktion bei der Deutschen Bundesbank ausgeübt hatte, erklärte in einer Rede im Jahr 2005 (Issing 2005):
»On the eve of the changeover, I wrote a commentary on diversity and monetary policy in the euro area. To the question whether a single one-size monetary policy could fit all parties involved – be they national entities, social partners or economic actors – my answer was: ›One size must fit all‹. The political decision on the creation of EMU had resolved all discussions on whether monetary union should precede or follow political unity and the fulfilment of the criteria for an optimum currency area. Today, in light of the evidence gathered so far in the euro area, I am more confident in saying: One size does fit all!«
Die Theorie optimaler Währungsräume ist auf sogenannte asymmetrische Schocks fokussiert. Diese können eine spezielle Gefahr für eine Währungsunion darstellen, weil die gemeinsame Geldpolitik und der gemeinsame Wechselkurs als Mittel zur Bekämpfung von Schocks ungeeignet sind, die die einzelnen Mitgliedsländer recht unterschiedlich betreffen. Sich auf diese Theorie berufend, hatten viele Ökonomen die Euro-Währungsunion als ein hoch riskantes politisches Projekt angesehen. Gegen Ende seiner Amtszeit als EZB-Chefökonom erklärte Issing in obiger Rede, dass sich Befürchtungen über nichtnachhaltige Divergenzen innerhalb der Währungsunion als unbegründet erwiesen hätten, die Euro-Währungsunion würde viel besser funktionieren, als erwartet worden war, das Projekt sei ein großer Erfolg. Insbesondere die einheitliche Geldpolitik würde allen Mitgliedsländern passen. Otmar Issing muss laut geträumt haben.
Deutschland durchlebte vor der Krise unter dem Euro eine Dauerstagnation der Binnennachfrage, allein die Exporte dienten als Motor des mageren Wachstums. Andere Euroländer dagegen, speziell die späteren Eurokrisenländer, wiesen eine sehr starke Binnenkonjunktur auf. Die einheitliche Geldpolitik der EZB wirkte zum Beispiel in Spanien sehr expansiv: Kredite sprudelten, Immobilienpreise kletterten rasant, Konsum und Löhne wuchsen stark. In Deutschland wurde die staatlich konzertierte »Lohnmoderation« von Konsumstagnation und fallenden Immobilienpreisen begleitet, während Deutschlands Banken kaum heimisches Geschäft hatten. Bei einheitlicher Geldpolitik sind solche divergierenden Prozesse selbstverstärkend, die Wettbewerbspositionen driften auseinander, und die Ungleichgewichte in den Handelsbilanzen und Auslandsvermögenspositionen schwellen immer weiter an.
Forschungspublikationen der EZB aus jener Zeit bezeugen, dass der Zentralbank Divergenzen der nationalen Lohnstückkostenentwicklung und entsprechend anschwellende Handels- und Leistungsbilanzungleichgewichte innerhalb der Währungsunion nicht vollständig entgangen waren. Im Monatsbericht vom Mai 2005 urteilte sie hierzu jedoch unbesorgt (EZB 2005, S. 77):
»The competitiveness (›real exchange rate‹) channel, although slow to build up, eventually becomes the dominating adjustment factor.«1
Ähnliche (Fehl-)Urteile finden sich auch in den periodischen Finanzsystemstabilitätsberichten der EZB, die noch bis zum Ausbruch der Krise jegliches Bewusstsein für die Brisanz der Situation vermissen ließen. So schrieb die EZB im Dezember 2006 hierzu (EZB 2006b, S. 9):
»With the euro area financial system in a generally healthy condition and the economic outlook remaining relatively favourable, the most likely prospect is that financial system stability will be maintained in the period ahead.«
Sogar nach dem Ausbruch der Finanzmarktstörungen im August 2007 brauchten die Verantwortlichen noch einige Zeit, um die akut drohenden Gefahren für die Eurozone überhaupt zur Kenntnis zu nehmen. Den krönenden Abschluss dieser Art von offizieller Schönrederei lieferte dann Joaquín Almunia, EU-Kommissar für Wirtschaft und Finanzen, der zum zehnjährigen Jubiläum der Währungsunion folgenden Lobgesang anstimmte (Almunia 2008: iii):
»A full decade after Europe’s leaders took the decision to launch the euro, we have good reason to be proud of our single currency. The Economic and Monetary Union (EMU) and the euro are a major success. For its member countries, EMU has anchored macroeconomic stability, and increased cross border trade, financial integration and investment. For the EU as a whole, the euro is a keystone of further economic integration and a potent symbol of our growing political unity. And for the world, the euro is a major new pillar in the international monetary system and a pole of stability for the global economy. As the euro area enlarges in the coming years, its benefits will increasingly spread to the new EU members that joined in 2004 and 2007.«
Diese Worte wurden im Frühjahr 2008 veröffentlicht, also rund ein dreiviertel Jahr nach dem Ausbruch der Unruhen auf den Euro-Geldmärkten. Bereits am 9. August 2007 hatte sich die EZB zum ersten Mal gezwungen gesehen, den Banken auf den Euro-Geldmärkten mittels Feinsteuerungsoperationen mit rund 90 Milliarden Euro Liquidität zur Hilfe zu eilen. Im März und Juni hatte sie zuvor ihre Leitzinsen jedoch um jeweils 25 Basispunkte erhöht und dabei auch noch weitere Zinsschritte angedeutet.
Seit dem Frühjahr 2007 war eine Krise im sogenannten »Subprime« -egment der amerikanischen Immobilien- und Hypothekenmärkte zur Gewissheit geworden. Unsicherheit herrschte nur noch darüber, wie weit diese Krise letztlich im internationalen Finanzsystem streuen würde. Klar war allerdings von Beginn an, dass europäische Banken sehr hohe Risikopositionen auf dem US-Hypothekenmarkt eingegangen waren. Dem akuten Ausbruch von Unruhen auf den Euro-Geldmärkten im August 2007 waren zum Beispiel entsprechende Probleme der deutschen IKB Bank sowie der französischen BNP Paribas vorausgegangen.
Mit anderen Worten, spätestens ab dem Sommer 2007 mussten die europäischen Behörden davon ausgehen, dass den europäischen Banken schwere Verluste aus ihren US-Engagements drohten. Sie mussten dazu auch mit hausgemachten Bankenproblemen rechnen, da laut Einschätzung der EZB auch auf den Immobilienmärkten der Eurozone fast zeitgleich mit den USA eine Trendwende stattfand. Ergänzend kann man hier noch erwähnen, dass die offiziellen Berichte der EZB und EU-Kommission gezeigt hatten, dass Kapitalströme und externe Ungleichgewichte der neuen EU-Mitgliedsländer in Zentral- und Osteuropa Ausmaße erreicht hatten, welche die Situation in früheren Krisenregionen Lateinamerikas und Südostasiens um ein Vielfaches übertrafen. Auch hieran waren die Banken der Eurozone, wie überall bekannt war, maßgeblich beteiligt gewesen (EZB 2006a).
Aber die wirtschaftspolitischen Akteure der Eurozone zogen es damals vor, wegzuschauen und Schönwetterreden zu halten. Die EZB, wie stets und immer allein von Sorgen um vermutete Inflationsrisiken geplagt, erhöhte noch im Juli 2008 ihre Leitzinsen und deutete in ihrer Kommunikation weitere Straffungen ihres geldpolitischen Kurses an. Bundesbankpräsident Axel Weber zeigte sich auch im Juni 2008 noch überzeugt (Weber 2008, S. 6–7):
»The euro area remains on solid fundamentals with regard to real economic growth. This view is underlined by the Eurosystem staff projections published yesterday. And also the outlook on Germany as laid out in the Bundesbank forecast published today supports this assessment.«
Die Europäische Kommission hatte im Frühjahr 2008 zwar ihre Wachstumsprognose für die Eurozone wegen der Finanzmarktunruhen, steigender Rohstoffpreise und weil die USA am Rande einer Rezession standen, auf 1,7 Prozent für das Jahr 2008 sowie 1,5 Prozent für 2009 zurückgenommen. Sie befand aber immer noch:
»The EU economy holds up relatively well due to sound fundamentals.«
Auch dieser Verweis auf solide Fundamentaldaten muss im Nachhinein natürlich besonders verwundern, bedenkt man, wie sehr EZB und EU-Kommission seit der Krise auf die zwingende Notwendigkeit weitreichender Strukturreformen gedrängt haben.
Der Zusammenbruch der US-Investmentbank Lehman Brothers am 15. September 2008 traf die wirtschaftspolitischen Schlafwandler der Eurozone dann wie ein Schlag. Die Banken Europas und der USA standen im Zentrum der internationalen Finanzkrise, die, wie man dann schnell begriff, die akute Gefahr einer Weltwirtschaftskrise in sich trug. Die Situation auf den Finanzmärkten und der Einbruch der Wirtschaftstätigkeit war gravierend genug, die wirtschaftspolitischen Akteure der wichtigsten Volkswirtschaften der Welt zu geeintem Handeln zu bewegen. Die EZB beteiligte sich im Oktober 2008 an einer international koordinierten Zinssenkungsrunde. Die Europäische Kommission unterbreitete noch im November 2008 einen »European Economic Recovery Plan«, ein fiskalpolitisches Konjunkturprogramm im Umfang von 200 Milliarden Euro. Im Rahmen der G20 war die EU an den auf den G20-Gipfeln in Washington im November 2008 und London im April 2009 gefassten Beschlüssen zur Bekämpfung der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise beteiligt. Man einigte sich unter anderem auf fiskalpolitische Expansion, Vermeidung von Handelsrestriktionen, Re-Regulierung der Banken und Finanzmärkte sowie auf eine Aufstockung der Schlagkraft des Internationalen Währungsfonds, um der nunmehr auch viele Entwicklungsländer betreffenden Krise wirksam begegnen zu können (UNCTAD 2009, Bibow 2012b).
Kurz, im Angesicht der akuten Gefahr einer weltwirtschaftlichen Depression erlebte die Wirtschaftspolitik der EU ein »keynesianisches Moment«: Zumindest für einen Moment lang wurde die notorische Haushaltskonsolidierungsmaschinerie der EU-Behörden ausgeschaltet und stattdessen auf Konjunkturstimulierung gesetzt. Selbst in Deutschland, wo im Herbst 2009 eine Bundestagswahl anstand, wurde spontan ein gewichtiges Konjunkturprogramm aufgelegt. Dieser Punkt ist besonders wichtig: Denn tatsächlich kam es mithilfe der expansiven Finanzpolitik bereits ab dem Sommer 2009 und noch kraftvoller im Jahr 2010 zu einer weltwirtschaftlichen Konjunkturerholung, die zunächst auch die Eurozone einschloss. Nach Jahren der Stagnation vor der Krise wuchs speziell Deutschland plötzlich sehr stark.
Zu diesem Zeitpunkt konnte man nicht bestreiten, dass ein zentraler Bestandteil der Finanz- und Wirtschaftskrise eine Bankenkrise war. Insbesondere Deutschland war hiervon von Beginn an besonders stark betroffen (Bastasin 2015). Die IKB Bank war nur der Anfang gewesen – es folgte eine ganze Reihe von Landesbanken sowie, nicht minder spektakulär, der Fall der Hypo Real Estate und der Commerzbank, die sich damals im Begriff der Übernahme der krisengeschüttelten Dresdner Bank befand.
Ebenfalls vom Beginn an im Mittelpunkt des Geschehens stand die Bankensituation Irlands. Das dortige Bankensystem übertraf die Größe der irischen Volkswirtschaft um das Sechsfache. Viele ausländische, besonders auch deutsche Banken verfügten dort über Niederlassungen, um Unternehmenssteuervorteile auszunutzen. Irland war dann das erste EU-Mitgliedsland, das im Oktober 2008 eine Blanko-Staatsgarantie für alle Bankeinlagen und -schuldverschreibungen ausgesprochen hatte – Deutschland wurde kurz darauf das zweite. Die Nervosität auf den Finanzmärkten zur irischen Bankensituation – mit entsprechend düsteren Aussichten für die irischen Staatsfinanzen – blieb dennoch so hoch, dass der damalige deutsche Finanzminister Peer Steinbrück im Februar 2009 öffentlich folgendes Zugeständnis machte (Benoit 2009):
»The euro-region treaties don’t foresee any help for insolvent countries, but in reality the other states would have to rescue those running into difficulty.«
Dass Europas Banken gewaltige Probleme hatten, war also kein Geheimnis – die Finanzmärkte wussten es, die Wirtschaftspolitik wusste es auch. Von naiven neoliberalen Ideen verleitet, hatte man die Banken zwanzig Jahren zuvor von der Leine gelassen. Zunächst der gemeinsame Binnenmarkt und dann der Euro hatten vor allem Europas Banken zu internationalen Wetteskapaden inspiriert. International hatte man sich deswegen in Reaktion auf die Krise auf vielfältige Initiativen zur Re-Regulierung der Banken geeinigt. Man wollte diese damit wieder sicherer machen und zukünftige Bankenkrisen verhindern.
Dringender war allerdings die akute Bankenkrise: Um die zu überwinden, brauchte man einerseits einen Wirtschaftsaufschwung, denn eine Rezession kann Bankenprobleme in Form notleidender Kredite nur verschärfen, und andererseits günstige Finanzierungsbedingungen, die eine Rekapitalisierung des schwer angeschlagenen Bankensystems auch gestatten würden. Denn die Notwendigkeit der Rekapitalisierung der Banken war angesichts der hohen Verluste sowie sich abzeichnender erhöhter Regulierungsanforderungen eine weitere Gewissheit. Und zunächst hatte man ja auch – selbst in Deutschland und Europa – grundsätzlich richtig reagiert: Nach langer Abstinenz erlebte die nach deutschen wirtschaftspolitischen Vorstellungen (fehl)konstruierte Währungsunion ein keynesianisches Wiedererwachen.
Der Moment der Einsicht und wirtschaftspolitischen Vernunft erwies sich allerdings als sehr kurz. Ein schicksalhaftes Ereignis im Herbst 2009 leitete eine erneute Wende zur kollektiven Unvernunft ein: Die frisch gewählte griechische Regierung unter Ministerpräsident Giorgos Papandreou offenbarte, dass die von der konservativen Vorgängerregierung hinterlassene Lage der Staatsfinanzen deutlich schlechter war, als in den nach Brüssel gemeldeten offiziellen Statistiken zum Ausdruck gekommen war. Angesichts der Größe der griechischen Volkswirtschaft betraf diese Meldung eigentlich nur einen Nebenkriegsschauplatz. Für die deutsche Wirtschaftspolitik und die deutschen Medien war Griechenland jedoch ein gefundenes Fressen: Griechenlands Staatsschuldenkrise wurde prompt zum Hauptschauplatz gemacht, und die Krise der Eurozone wurde auch offiziell zur »Staatsschuldenkrise« umgedichtet (Pisany-Ferry 2014).
Diese Strategie entsprach keiner ernsthaften Ursachendiagnose, sie entsprang einer rein ideologisch motivierten Dichtung. Es war die Gelegenheit, das private Versagen in staatliches Versagen umzudeuten. Deutschlands »Ordoliberale«, die Gralshüter der vermeintlichen Weisheiten der »Freiburger Schule«, ergriffen diese Gelegenheit beim Schopf. Die vielen Verfehlungen des sogenannten »Stabilitäts- und Wachstumspaktes« (SWP) waren den deutschen Überordnungshütern schon lange ein Dorn im Auge gewesen. Jetzt sahen sie ihre Chance gekommen, der finanzpolitischen Solidität einen vermeintlich wasserdichten Schutzmantel zu verpassen.
In den Folgejahren wurden Deutschlands EU- beziehungsweise Europartner zu immer neuen fiskalpolitischen Regeln und Pakten vergattert. Deutschland hatte sich selbst unmittelbar nach dem kurzen keynesianischen Moment von 2008 – offenbar erschrocken über den eigenen Mut – schon im Jahr 2009 eine sogenannte »Schuldenbremse« verpasst, eine grundgesetzlich verankerte Verpflichtung zu einem ausgeglichenen Staatshaushalt. Deutschlands EU- beziehungsweise Europartner sollten sich ähnlichen Selbstverpflichtungen zur Solidität ihrer Staatsfinanzen ergeben. Das gemeinsame Fiskalregelwerk wurde so gestrafft und die Strafverhängung bei Nichteinhaltung (fast) automatisiert.2
Auch für die laufende Fiskalpolitik wurde tatsächlich bereits im Jahr 2010 die Wende zurück zur bedingungslosen Sparpolitik eingeleitet. Selbst international erzwang Europa unter deutscher Führung innerhalb der G20 die fiskalpolitische Wende beziehungsweise die Spaltung der G20, weil andere G20-Länder unter US-Führung den Umschwung zur Konsolidierung, wie auf dem G20-Gipfel von Toronto im Juni 2010 beschlossen, für verfrüht hielten (UNCTAD 2010, 2011).
Dass die fiskalpolitische Wende in der Währungsunion im Jahr 2010 verfrüht und auch zu drastisch war, steht heute ganz außer Frage. Die Eurozone scherte in Folge aus dem weltwirtschaftlichen Konjunkturverbund aus und befand sich im Jahr 2011 erneut in einer Rezession. Die Binnennachfrage der Eurozone schrumpfte rekordmäßig für acht Quartale in Folge von Frühjahr 2011 bis Frühjahr 2013, wobei steigende Exporte in den Rest der Welt Schlimmeres verhinderten. Erst seit Sommer 2013 zeigen die offiziellen Berechnungen des BIP für den Durchschnitt der Eurozone wieder Wachstum an. Die wichtigsten konjunkturellen Indikatoren bestätigen diese Berechnungen allerdings nicht, sie zeigen bis heute bestenfalls eine langjährige Stagnation. Rechnet man Deutschland, das immer noch von seiner Exportstärke profitiert, heraus, muss man von einem Rezessionsszenario sprechen – und das seit 2011!
Um es nochmals zu wiederholen: Das wirtschaftspolitische Versagen der verantwortlichen Behörden ist so krass, dass es überhaupt nicht zu leugnen ist. Unter den Euro-Mitgliedsländern war die Krise in Griechenland besonders tief und hält unvermindert bis heute an. Auch Lettland, das Anfang 2014 Mitglied der Euro-Währungsunion wurde, erfuhr bei damals bereits festem Wechselkurs zum Euro eine sehr tiefe Krise, hat sich aber seither zumindest teilweise wieder erholt, wenn auch nicht im Sinne einer neuen Wachstumsdynamik. Besonders stark von der Eurokrise betroffen sind auch die »Programmländer« Portugal, Irland und Zypern sowie Spanien und Italien. Jedes Krisenland weist dabei Besonderheiten auf, jedoch bestehen auch einige Gemeinsamkeiten. Sowohl die Gemeinsamkeiten als auch die länderspezifischen Besonderheiten in den Erfahrungen während dieser Zeit gilt es kritisch zu beleuchten.
Die eigentliche Ursache der Eurokrise – das ist inzwischen in der internationalen Literatur und Kommentierung kaum noch bestritten – war die Politik der »Lohnzurückhaltung« in Deutschland. Deutschland hat damit gegen die fundamentalste Regel in einer Währungsunion verstoßen, nämlich die Notwendigkeit, sich mit der Lohnpolitik an das gemeinsam beschlossene Inflationsziel anzupassen (Flassbeck/Spiecker 2005 und Flassbeck/Lapavitsas, 2015).
Diese Politik hatte in Deutschland eine Stagnation der Binnennachfrage bei sich schleichend verbessernder Wettbewerbsposition zur Folge. Gewaltige Ungleichgewichte in den Handelsbilanzen und Auslandsvermögenspositionen türmten sich so auf, an denen Europas Banken in verschiedenen Rollen beteiligt waren. Während zum Beispiel Spaniens Banken die heimische Preisblase durch freimütige Immobilienkreditvergabe anfeuerten, sorgten Deutschlands Banken über die Euro-Geld- und Wertpapiermärkte für ihre Refinanzierung. Ob direkt oder indirekt, die Banken der Eurozone waren so gegenüber den Risiken der Ungleichgewichte der Währungsunion stark exponiert, abgesehen von den Risiken, die sie zum Beispiel in den USA und in Ost- und Zentraleuropa eingegangen waren.
Das Staatshaushaltsproblem Griechenlands war ein Sonderfall. Nichtsdestotrotz wurde die Eurokrise ideologisch motiviert in eine Staatsschuldenkrise umgedichtet, was entsprechende Reformen des Fiskalpolitikregimes und den erneuten Kurswechsel zur Sparpolitik rechtfertigen sollte. Eine Staatsschuldenkrise wurde sie in der Eurozone – abgesehen von Griechenland – aber nur als Folge der Finanz- und Wirtschaftskrise und als Folge einer fehlkonstruierten Währungsunion und katastrophal fehlgeleiteter Wirtschaftspolitik.
Verfehlte Austeritätspolitik und der »Multiplikatorstreit«
Im Folgenden wird zunächst die verfrühte und zu drastische Konsolidierungspolitik betrachtet, die Gegenstand des »Multiplikatorstreits«, einer Diskussion um die Höhe des Multiplikators in den Krisenländern, wurde. Später wird der Aspekt der »internen Abwertung«, neben der Konsolidierung der zweite Grundpfeiler der Anpassungsprogramme, näher untersucht.
Das theoretische Konzept des Multiplikators wurde Anfang der 1930er im Kreis des sogenannten »Cambridge Circus« entwickelt. Dieser Kreis von Keynes’ Doktoranden setzte sich kritisch mit der von Keynes 1930 veröffentlichten Treatise on Money auseinander. Insbesondere Richard Kahn und James Meade halfen so, den Weg für Keynes’ 1936 veröffentlichte General Theory zu bereiten. Der im Jahr 1931 von Kahn veröffentlichte Aufsatz mit dem Titel »The relation of home investment to unemployment« konzentriert sich auf die Beziehung zwischen primären und sekundären Beschäftigungseffekten eines schuldenfinanzierten öffentlichen Investitionsprogramms. Die »sekundären« Effekte verkörpern dabei die Idee des Multiplikators: Wenn der Staat seine Ausgaben erhöht, führt der ursprüngliche (primäre) Impuls erhöhter Ausgaben (und entsprechender Einkommen) zu weiteren »sekundären« Ausgaben (vor allem derjenigen, die von den primären Wirkungen begünstigt werden), und der gesamte durch das staatliche Konjunkturprogramm induzierte Beschäftigungseffekt fällt entsprechend höher aus, übertrifft das ursprüngliche Konjunkturprogramm (und etwaige damit verbundene neue Schulden) um ein Vielfaches – daher »Multiplikator«.
Kahn selbst hielt damals eine Bandbreite des Multiplikators zwischen 1,5 und 2 für realistisch. Ein Anstieg der Staatsausgaben in der Größenordnung von einem Prozent des BIP würde dann also einen Anstieg von eineinhalb oder gar zwei Prozent des gesamten BIP auslösen. Kahn berücksichtigte Importe, sinkende Arbeitslosengeldzahlungen sowie mögliche Preiseffekte als Faktoren, die den Nachfrageimpuls auf die heimische Wirtschaft mildern können. Die recht ähnliche Analyse von Meade aus dieser Zeit spricht hier von »leakages«, Abflüssen im Einkommenskreislauf, die den Multiplikator reduzieren (Dimand 1994).
Kahn unterstellte in seiner Analyse, dass die fiskalpolitische Expansion in einer unterbeschäftigten Wirtschaft stattfände und von akkommodierender Geldpolitik begleitet würde, also keine Verdrängungseffekte (»Crowding-out«) privater Investitionen aufgrund steigender Zinsen stattfinden würden. Dieser kritische Punkt betraf auch und besonders den damals notorischen »Treasury View«, der Position des britischen Schatzamts aus jener Zeit, wonach staatliche Schulden notwendigerweise private Investitionen im vollen Umfang verdrängen würden, weil nur eine gegebene Menge Ersparnis zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung stünde. Kahns Analyse zeigte dagegen, dass die Ersparnis im selben Umfang wie das staatliche Investitionsprogramm im Expansionsprozess zunimmt – ein sehr zentraler Punkt im Theoriegebäude der General Theory von Keynes (Clarke 1988).
Keynes formulierte den Multiplikator in seiner General Theory als »Investitionsmultiplikator«, sein »normales psychologisches Gesetz« betonend, wonach der Konsum gemeinsam mit dem Einkommen wächst, aber um absolut weniger, also gewöhnlich ein Teil des Einkommens gespart wird. Er beschrieb die Höhe der marginalen Konsumneigung so auch als Bestimmungsfaktor der Zusammensetzung zwischen Investitions- und Konsumgütern bei steigender Produktion und Beschäftigung. Bei Unterbeschäftigung wird ein Anstieg der Investitionen daher gewöhnlich auch den Konsum anregen, statt diesen zu verdrängen, wie dies in der »(neo-)klassischen« Vollbeschäftigungstheorie der Fall sein würde.
Da Investition und Ersparnis im Gleichschritt steigen, zeigt der Multiplikator dabei auch an, wie stark die Einkommen letztlich wachsen müssen, aus denen die (gestiegene) Ersparnis im neuen Gleichgewicht getätigt wird. Keynes sprach hier von der »logischen Theorie des Multiplikators«. In Bezug auf dessen Höhe betonte er neben den internationalen Handelsbeziehungen, die nicht nur als »leakage«, sondern auch bezüglich möglicher Rückkopplungseffekte für die heimischen Exporte wichtig sind, die Abhängigkeit von der Konjunkturlage. Bei hoher Unterbeschäftigung vermutete er einen sehr hohen Wert des Multiplikators. Auf (unsicheren) US-Daten von Simon Kuznets beruhende Schätzungen des Multiplikators in Höhe von 2,5 hielt er für die USA unter Krisenbedingungen für »unwahrscheinlich niedrig« (Keynes 1936, S. 128). In seiner eigenen späteren Analyse der britischen Kriegswirtschaft unterstellte er einen Multiplikator von rund drei (Keynes 1940).
In der Lehrbuchliteratur der – zunächst keynesianischen – Nachkriegszeit fand Keynes’ Multiplikatortheorie insbesondere als »fiskalpolitischer Multiplikator« Eingang. Für eine offene Volkswirtschaft lässt sich der modellierte Zusammenhang durch folgende Formel ausdrücken und veranschaulichen:
Dabei steht AA für »autonome Ausgaben«, und m ist der Multiplikator: