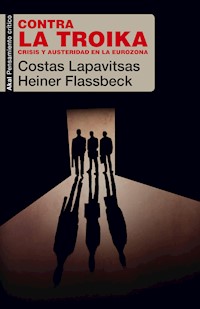Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Westend Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Die Ökonomen rätseln seit Jahrzehnten über die Frage, ob und wie Volkswirtschaften, obwohl sie miteinander Handel treiben, in ihrer monetären Politik möglichst unabhängig bleiben können. Heiner Flassbeck zeigt in dieser grundlegenden Arbeit, die er für diese Neuauflage ausführlich kommentiert hat, dass das nicht möglich ist. Wer Handel treibt, muss auch im Bereich des Geldwesens eng kooperieren. In einem Nachwort erläutert er, was in dieser Hinsicht in Europa schief gelaufen ist.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 284
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ebook Edition
Heiner Flassbeck
Preise, Zins und Wechselkurse
Warum offene Volkswirtschaften untrennbar miteinander verbunden sind
Eine vollständig kommentierte Neuauflage
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.westendverlag.de
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig.
Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
ISBN 978-3-86489-749-8
© Westend Verlag GmbH, Frankfurt/Main 2018
Umschlaggestaltung: mxd, Westend Verlag GmbH
Satz und Datenkonvertierung: Publikations Atelier, Dreieich
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Der theoretische Kern dieser Arbeit entstand in den Jahren 1977 bis 1979, einer Zeit also, in der die praktischen Erfahrungen mit einem System flexibler Wechselkurse scheinbar noch wenig Anlass boten, die theoretischen Grundlagen des Paradigmas marktbestimmter Wechselkurse fundamental in Frage zu stellen: Zwar gab es das Phänomen des »Überschießens« der Wechselkurse schon, doch die Richtung der Wechselkursänderungen stimmte in der Regel mit den Unterschieden in den »fundamentalen Daten« der beteiligten Volkswirtschaften überein. In dem lange Zeit als Glaubenskrieg geführten wissenschaftlichen Streit um feste versus flexible Wechselkurse war es ruhig geworden. Eine Position »contra flexible« existierte praktisch nicht mehr. Auch alte Beschreibungen und Erklärungen spekulativer Auswüchse an sich selbst überlassenen Devisen- und Kapitalmärkten wie die von Wicksell, Keynes und Hayek waren in Vergessenheit geraten oder wurden als Elaborate vorwissenschaftlicher Spekulation abgetan.
Doch Anfang der 1980er Jahre begannen die Mauern zu bröckeln. Die tatsächliche Entwicklung der Kurse zwischen den wichtigsten Weltwährungen, die nicht einmal mehr in die »richtige« Richtung gingen, gab dem herrschenden Paradigma eines sich selbst stabilisierenden und stetig verändernden Wechselkurses Rätsel auf, die einer Lösung nicht mehr nahe gebracht werden konnten. Zwar hielt sich die (normale) Wissenschaft zunächst mit ad hoc-Hypothesen über Wasser, doch die Erschütterung durch immer neue Anomalien brachte sie in eine ausweglose Lage. Jetzt scheint der Weg frei, von vorne ein System marktbestimmter Wechselkurse zu überdenken.
So ist es nicht nur an, sondern auch in der Zeit, diesen Versuch des Verstehens eines komplexen Phänomens der wissenschaftlichen Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Dabei ist es unvermeidlich, dass alte Erklärungsmuster herausgefordert und überkommene Denkstrukturen in Frage gestellt werden. Das gilt nicht nur inhaltlich, sondern auch hinsichtlich des verwendeten wissenschaftlichen Instrumentariums. Nur die etablierte ökonomische Theorie verfügt über eine einheitliche Methodik, innerhalb derer praktisch alle Erklärungsversuche stattfinden und die eine kaum zu unterschätzende Rolle bei der Immunisierung gegen kritische Vorstöße spielt. Das allgemeine, zeitlose Gleichgewicht ist das am meisten verbreitete dieser Konzepte. Der Außenseiter dagegen kann (noch) nicht ein ähnlich ausgefeiltes Instrumentarium bzw. eine weitgehend normierte Sprache vorweisen. Normalerweise genügt schon das, um seinen Ansatz als vorwissenschaftlich zu qualifizieren. Doch die erschütterte herrschende Lehre reagiert anders. Übermächtige Anomalien bereiten den Boden, auf dem man Nachdenken wieder erwarten kann.
Inzwischen hat die Politik, in ihrem Bemühen, die größten Auswüchse des Systems flexibler Wechselkurse zu mildern, die Theorie weit überholt und das Experiment marktbestimmter Wechselkurse beendet. De facto besteht spätestens seit März 1987 ein System fester, aber anpassungsfähiger Wechselkurse. Doch nur ein viel tieferes theoretisches Verständnis außenwirtschaftlicher Zusammenhänge kann dem jetzt zum Durchbruch gekommenen politischen Pragmatismus eine Basis geben, auf der sich ein neues stabiles Weltwährungssystem aufbauen lässt. Nur wenn die Kernprobleme der Informationsverarbeitung am Devisenmarkt sowie die auch in einem System flexibler Kurse unumgänglichen Anpassungsprozesse verstanden werden, kann man ein System fester Wechselkurse und die ihm inhärenten Anpassungszwänge verstehen und politisch bewerten. Erst dann, wenn ein System fester Wechselkurse in diesem Sinne verstanden wird, kann man es fest institutionalisieren. Bis dahin jedoch scheitern politische Optionen für feste Wechselkurse am mangelnden Verständnis der notwendigen Anpassungszwänge und zusätzlichen Friktionen bei marktbestimmten oder veränderbaren Kursen. Der Patient weiß inzwischen zwar, dass das Schmerzmittel nicht heilt, er hat aber noch nicht begriffen, dass die Nebenwirkungen des Schmerzmittels die eigentlichen Krankheitssymptome längst nebensächlich gemacht haben.
Letztlich wirft die Problematik der Erörterung von Anpassungsprozessen in offenen Volkswirtschaften aber Fragen auf, die allgemeine, auch für die Welt gültige Deutungen erfordern. Nicht alle lassen sich im Rahmen einer rein außenwirtschaftlich orientierten Arbeit lösen. So muss ich den Leser darauf vertrösten, dass weitere Anstrengungen nötig sein werden, und mich hier auf die Aufgabe beschränken, den Weg abzustecken, der mir am ehesten erfolgversprechend erscheint.
Für Hilfestellung bei der Überwindung von vielfältigen Hindernissen bis zur Veröffentlichung dieser Arbeit schulde ich einigen Menschen besonderen Dank: Hajo Riese und Horst Tomann für Ihre Bereitschaft, sich mit dem Gesamtkonzept auseinanderzusetzen. Alfred Bosch und Reinhold Veit für eine wichtige Kontroverse zur Zahlungsbilanztheorie. Peter Bofinger, Willi Koll und Gerhard Maier-Rigaud für viele anregende Diskussionen und langjährige Ermunterung. Barbara Girke für umfangreiche und prompt erledigte Schreibarbeiten. Vor allem jedoch Stephanie; nicht alleine für eine die ganze Zeit andauernde moralische Unterstützung, sondern zudem für Hilfe bei Detailarbeiten, ohne die eine veröffentlichungsreife Form kaum entstanden wäre. Aber auch diese Personen können es selbstverständlich ablehnen, für noch verbliebene Fehler und Missverständnisse verantwortlich gemacht zu werden.
Berlin, im Oktober 1987
Heiner Flassbeck
Nachwort zum Vorwort
Als ich dieses Vorwort im Oktober 1987 schrieb, ahnte ich nicht, dass nur wenige Jahre später in Europa ein System unverbrüchlich fester Wechselkurse eingeführt werden würde, ohne dass man die Anpassungszwänge, die einem solchen System inhärent sind, verstanden hatte. Die Europäische Währungsunion (EWU) wurde schon Anfang der neunziger Jahre geschaffen, ohne dass man sich von den entscheidenden Paradigmen der alten Lehre verabschiedet hätte. Im Gegenteil, Monetarismus und ein vorwissenschaftlicher Glaube an die Inflationsgefahr, die von staatlichen Defiziten ausgehen könne, prägte das Denken, das den Vertrag von Maastricht bis heute kennzeichnet.
Entsprechend ist es gekommen, wie es kommen musste. Die EWU ist 20 Jahre nach ihrer offiziellen Gründung in enormen Schwierigkeiten, weil bis heute kaum jemand die Anpassungsaufgaben in Systemen fester und flexibler Wechselkurse verstanden hat, die den Kern dieser Arbeit aus den 1970er Jahren bildeten. Es ist deswegen mehr als bloße Nostalgie, wenn ich versuche, mit dieser Veröffentlichung erneut Verständnis für die enorme Bedeutung von Währungssystemen zu erzeugen. Heute, mit Blick auf die Erfahrungen der vergangenen zwanzig Jahre, ist ein gewisser Optimismus angebracht. Heute müsste es möglich sein, zumindest in Europa, denen, die offenen Geistes sind, Zusammenhänge nahezubringen, die für das Zusammenleben offener Volkswirtschaften absolut unabdingbar sind.
Ich werde die Arbeit, die mich zehn Jahre lang intensiv beschäftigt hat, durchgängig an den Stellen kommentieren, wo man heute die Zusammenhänge nicht mehr ohne weiteres kennt und wo es aus heutiger Sicht besonders wichtig erscheint, auf die damals ausgearbeiteten Sichtweisen hinzuweisen.
Meine heutige Position zu den wirtschaftspolitischen Folgerungen, die aus dieser Arbeit zu ziehen sind, lege ich in einem langen Nachwort nach dem letzten Kapitel dar.
Genf, im April 2019
Einführung
Veränderungen der Umtauschkurse der Währungen der größten westlichen Industrieländer sind in den Jahren seit 1973 zu einem festen Bestandteil der täglichen wirtschaftlichen Erfahrung geworden. Zwar werden größere Schwankungen registriert, doch die Tatsache der Veränderung als solche findet kaum noch Aufmerksamkeit. Ebenso wird der fundamentale Unterschied zwischen den Bedingungen für interregionalen und internationalen Handel, der mit dieser Tatsache geschaffen wurde, zwar wissenschaftlich untersucht, doch bleiben die Ergebnisse meist unergiebig.1 Zwar geht die längste Phase marktbestimmter Wechselkurse zwischen den großen Industrieländern einher mit der längsten Phase andauernder wirtschaftlicher Fehlentwicklungen in der jüngsten Wirtschaftsgeschichte, doch gibt es andere Erklärungen für die Wirtschaftsprobleme, zumal eine Zurechnung auf die Währungsverhältnisse nicht ohne Weiteres möglich ist.
Die Irritationen, die überaus starke Schwankungen der Wechselkurse hervorrufen, werden in der Regel von der Wissenschaft mit ad hoc-Erklärungen beantwortet. Die sogenannten fundamentalen Daten wie Zins und Preisdifferenzen oder Leistungsbilanzsalden werden ergänzt durch Haushaltsdefizite, die Konjunktursituation, allgemeines politisches Vertrauen oder gar geographische Lageunterschiede in Krisensituationen. Doch kann der Versuch solcher Erklärungen, selbst wenn er erfolgreich im Sinne der Übereinstimmung von Explanans und Explanandum wäre, zum eigentlichen Phänomen des marktbestimmten Wechselkurses vordringen? Kann er begreiflich machen, warum in ein weltoffenes System von Preisen und Zinsen jeweils an den nationalen Grenzen ein neuer Preis eingeführt wird? Kann man mit diesen ad hoc-Erklärungen zeigen, welche Wirkungen die Einführung des neuen Preises auf die Zuteilungsfunktion der alten Preise hat? Und schließlich, kann man damit zeigen, in welcher Weise und unter welchen Voraussetzungen die Realisation nationaler Zielfunktionen durch den variablen Umtauschkurs erleichtert wird?
Dies alles zu verneinen heißt, einen anderen Weg zu gehen. Da es (bisher) keine befriedigende Wechselkurserklärung gibt, liegt es nahe, den Weg reiner Deskription zu verlassen und hypothetische Determinationsmuster des marktbestimmten Wechselkurses zu Untersuchen. Die Implikationen solcher Muster für die dynamische Effizienz von Märkten und für die Erreichbarkeit wirtschaftspolitischer Ziele sind dann herauszuarbeiten. Darüber hinaus ist nach den Gründen zu fragen, die einer Erklärung der Wechselkursbewegungen so offensichtlich im Wege stehen. Ersteres heißt nicht, die alten Schlachten der sechziger Jahre noch einmal zu schlagen, als dem Eintreten für flexible Kurse und der Hoffnung auf nationale Autonomie die Furcht vor der Zerrüttung des offenen Welthandelssystems gegenübergestellt wurde. Letzteres aber fordert dazu heraus, die »alten Vorurteile« erneut einer Überprüfung zu unterziehen, denn die Schlacht für flexible Wechselkurse wurde nur gewonnen, weil die Voraussetzungen, sprich, die Erkenntnisse über die tatsächliche Funktionsweise eines solchen Systems, falsch waren.2
Insgesamt geht es bei dieser Arbeit, positiv gewendet, um zweierlei: Erstens, zu zeigen, ob und wie marktbestimmte Wechselkurse makro- und mikroökonomische Anpassungsprozesse, also den dynamischen Ablauf von Volkswirtschaften im Vergleich zu Festkurssystemen verändern können. Zweitens, anzudeuten, dass »flow-Theorien« nicht hinreichend sein können, um den Wechselkurs dynamisch zu erklären, und dass »Stock Theorien« nicht die Informationsvoraussetzungen bieten können, bei denen sie über Entscheidungslogik hinausgehen.
Das Erkenntnisziel bleibt also durchaus unpolitisch. Es geht nicht um die Abwägung der gesamten Kosten und Nutzen fester und flexibler Wechselkurse und damit um die Grundsatzentscheidung über das anzustrebende Währungssystem, sondern nur um eine vollständigere Darstellung der Kosten eines Währungssystems, das vielfach von vornherein dem politischen Kalkül entzogen scheint, weil es auf den ersten Blick Marktrationalität beanspruchen kann. Die Legitimation für eine solche Aufgabe leitet sich direkt aus der Inflationstheorie und ihren Schlussfolgerungen für die Wirtschaftspolitik ab. Wer die Allokationsfolgen starker Veränderungen des Geldwertes in der Zeit untersucht und beurteilt, hat schließlich den Bereich der Marktrationalität generell nicht verlassen. Gleiches muss für Veränderungen des Geldwertes im Raum auch gelten. Das Paradox von Geldwertänderungen, die direkt der Marktlogik unterliegen, ist hier freilich offensichtlicher. Dennoch ist der Konsistenzfrage nicht auszuweichen.3
Teile der theoretischen Überzeugung, die diese Arbeit tragen, habe ich an anderer Stelle veröffentlicht. So im Zusammenhang mit Fragen der Veränderung der Wettbewerbsfähigkeit von Volkswirtschaften4 und Fragen der internationalen Handelsbeziehungen5. Hier soll daher im Mittelpunkt die Suche nach einem konsistenten Rahmen für einen theoretischen Ansatz stehen, dessen Erkenntnislogik von Unwissen geprägt ist. Unwissen nämlich hinsichtlich der konkreten Determination eines Marktphänomens, dessen Komplexität nur durch Reflexion auf metatheoretischer Ebene zu erfassen ist. Konkreter: Versuche, konkurrierende Erklärungen zu den früher herrschenden zu finden, sind zum Scheitern verurteilt, weil sie –, partial-analytisch – wiederum nur Ausschnitte einer Wirklichkeit fokussieren, die – weil zukünftig und unsicher – prinzipiell nicht als Ganzes fassbar ist.
An dieser Stelle trifft sich die außenwirtschaftliche mit der binnenwirtschaftlichen Theorie.6 Wer prinzipiell die Bedeutung von Unwissen und Unsicherheit für elementare Bausteine wirtschaftlicher Dynamik hält, kann binnenwirtschaftliche nicht beliebig von außenwirtschaftlichen Phänomenen trennen. Das betrifft sowohl die Dominanz der Vermögensmärkte als auch die generell begrenzten Möglichkeiten, das System (automatisch) zu stabilisieren. Dennoch halte ich die Unterschiede zwischen binnenwirtschaftlicher und außenwirtschaftlicher Entscheidungssituation für ausreichend groß, um außenwirtschaftlich wesentlich optimistischer zu sein. Die Unsicherheit ist eben doch in stärkerem Maße eine Funktion der zeitlichen als der räumlichen Verteilung von Ereignissen.
Das erste Kapitel der Arbeit skizziert die Ideengeschichte der Versuche einer außenwirtschaftlichen Absicherung bzw. Abschottung. Dass dabei nicht nur neue Erkenntnisse, sondern immer wieder andere Ziele das Denken und Handeln bestimmten, relativiert politische Sachzwänge, die heute praktische Folgerungen aus der Ernüchterung bezüglich flexibler Wechselkurse scheinbar verhindern.
Das zweite Kapitel behandelt das, was man den eigentlichen außenwirtschaftlichen Konflikt nennen könnte, den Zwang nämlich, Güter aus dem Ausland so zu bezahlen, dass die eigene Kreditfähigkeit erhalten bleibt. Dieses Zahlungsbilanzproblem war in der Diskussion um flexible Wechselkurse, ähnlich wie zu Zeiten des Goldstandards, in den Hintergrund getreten, weil eine Automatik des Zahlungsbilanzausgleichs postuliert wurde.
Das dritte Kapitel untersucht die wichtigste Rechtfertigung für die Existenz flexibler Wechselkurse, nämlich die Tatsache, dass dieses System es formal erlaubt, die nationale Geldmenge autonom zu steuern, wenn die Entstehungskomponente »Devisenmarktintervention« der Geldmenge ausgeschlossen ist und Zahlungsbilanzausgleich dem Automatismus flexibler Wechselkurse überlassen bleibt. Ob und inwieweit die formal gegebene nationale Entscheidungsfreiheit in Form der monetären Isolierung auch eine materielle ist, bedarf eingehender Analyse.
Im vierten Kapitel soll die Frage nach der konjunkturellen Isolierung durch marktbestimmte Wechselkurse aufgeworfen werden. Allgemein geht es dabei aber nicht nur um die direkte Übertragung konjunktureller Impulse, sondern auch um die Möglichkeiten einer beschäftigungspolitischen Autonomie infolge der monetären Autonomie und um das Zusammenwirken von Wechselkurs-, Zins- und Preisänderungen im Konjunkturverlauf.
Das fünfte Kapitel widmet sich der Annäherung einer Beschreibung von Anpassungsprozessen auf mikroökonomischer Ebene bei flexiblen Wechselkursen. Hier wird sich zeigen, warum die Frage der Geldwertstabilität im Raum für Anpassungsprozesse im Raum von entscheidender Bedeutung ist. Dabei soll von alternativen Annahmen bezüglich der Determination des Wechselkurses ausgegangen werden. Aus dieser Analyse ergibt sich dann schon, dass die Formulierung makroökonomischer Gleichgewichtsbedingungen keineswegs eine geeignete Methode ist, um sich dem dynamischen Phänomen Wechselkurs umfassend anzunähern. Schließlich ist zu fragen, welcher Stellenwert der Gleichgewichtskonzeption in der währungstheoretischen Forschung überhaupt zukommt.
Das Schlusskapitel dient der Reflexion des Standes der theoretischen und empirischen Arbeiten zum Thema »marktbestimmte Wechselkurse« und der Problematisierung wirtschaftspolitischer Folgerungen beim derzeitigen Wissensstand.
Insgesamt gesehen bieten die Ergebnisse dieser Arbeit eher ein Forschungsprogramm als fertige Lösungen. Das kann aber nicht anders sein, hat doch die Wissenschaft sich allzu sehr blenden lassen von der oberflächlich vorhandenen Marktrationalität und zu wenig nach den Informationsbedingungen gefragt, die Marktrationalität jenseits der schlichten Tatsache der Existenz eines Marktes allein rechtfertigen können. So ist zu nächst aufzuarbeiten, was versäumt wurde, und ein neues Interpretationsmuster anzudeuten, bevor der Weg frei ist für konkrete Lösungen und Therapien.
Nachwort zur Einführung
Wie extrem irrational Systeme flexibler Wechselkurse sein können, habe ich in den siebziger Jahren sicher schon geahnt, aber nicht im heutigen Sinne gewusst. Die volle Bedeutung von einfachen Währungsgeschäften auf der Basis vorhandener Zinsdifferenzen, die durch die Zinsfestlegung der nationalen Notenbanken möglich wird und zu perversen Wechselkursbewegungen führt (carry trade ist hier das Stichwort), ist mir erst zu Beginn der neunziger Jahre klar geworden, als es schon einige Beispiele für diese Spielart der Finanzspekulation gab. Die sogenannte Wissenschaft ist allerdings bis heute in diesem Feld weitgehend abstinent geblieben, obwohl (oder weil) damit die Doktrin der »effizienten Märkte« am klarsten widerlegt werden kann. Ich komme darauf später noch ausführlicher zurück.
I. Vom Goldstandard zu marktbestimmten Wechselkursen
Die Geschichte der Beziehung von Nationalstaaten zu ihren Handelspartnern ist geprägt von dem Versuch, zwar größtmöglichen Nutzen aus dem Güter- und Kapitalaustausch zu ziehen, die mit der Tatsache der Wirtschaftsbeziehungen notwendigerweise verbundenen Einschränkungen der eigenen Handlungsfreiheit jedoch weitgehend auszuschalten. Betraf dies in den Zeiten des Weltgeldstandards »Gold« ausschließlich die realen Beziehungen, so sind Regimes nationalen Papiergeldes auch durch Versuche monetärer Abkoppelung gekennzeichnet. Anders als im regionalen Güter- und Kapitalaustausch wurden internationale Anpassungszwänge von Anfang an überwiegend nur als (scheinbar) vermeidbares Übel akzeptiert.
Ist sich aber die Wissenschaft bezüglich des Verdikts über Abschottung in Form administrativer Behinderungen des Güter- und Kapitalverkehrs seit Adam Smith und David Ricardo weitgehend einig, so hat sie doch selbst immer wieder Versuche unternommen, der Idee der monetären Abkoppelung eine theoretische Grundlage zu geben. Insbesondere die Marktdetermination des Wechselkurses schien geeignet, das Postulat der monetären Abkoppelung mit dem Postulat des Freihandels auf marktrationale Weise zu versöhnen. So ist für die Geistesgeschichte der Außenhandelstheorie nicht nur die analytische Trennung von sogenannter monetärer und realer Analyse kennzeichnend, sondern auch die Rationalisierung einer Trennung von Gütersphäre und Geldsphäre durch den marktbestimmten Wechselkurs. Freilich hat das ein Aufkeimen neomerkantilistischer Ansätze im Zuge der Beschäftigungsprobleme1 der siebziger und achtziger Jahre ebenso wenig verhindert wie die Diskussion über eine Reform des Weltwährungssystems. Beides ist Ausdruck von Anomalien, die das Erklärungsschema des herrschenden neoklassischen Paradigmas fundamental in frage stellten.
Nachwort
Ob und wie Freihandel und das Währungssystem miteinander kombinierbar sind, ist auch heute keineswegs geklärt. Die Standardtheorie unterstellt weiterhin, es gebe auch hier so etwas wie neutrales Geld, das über Grenzen hinweg zur Verfügung gestellt wird, ohne den »realen« Austausch zu stören. Das ist der Versuch der Rettung der Theorie (des Glaubens) durch ein irreales Modell, die man sich als Laie einfach nicht vorstellen kann.
I.1. Die Anfänge im Merkantilismus
Nur was der Wissenschaftler für möglich erklärt, erscheint möglich. Erklärt er etwa, die Isolation einer offenen Wirtschaft sei nicht realisierbar, wird die Isolation nicht in Angriff genommen. Anpassungen müssen dann hingenommen werden. Wird nationale Autonomie für möglich »erklärt«, werden selbst festgefügte Institutionen politisch über Bord geworfen.2 Wird dagegen die bestehende soziale Ordnung als die natürliche Ordnung angesehen, gibt es von vornherein keinen Anlass, über Alternativen zu bestehenden Handlungsregeln nachzudenken. Der Übergang von einer rein kausalen Deutung zu einer finalen Sicht erfolgt erst dann, wenn theoretische Alternativen erarbeitet werden und damit die Auswirkungen anderen Verhaltens oder anderer Institutionen überschaubar geworden sind. Während so der Prozess der Emanzipation des Menschen von der Natur in den Naturwissenschaften eine zunehmende Bedeutung der kausalen Systematisierung des Erkenntnismaterials mit sich brachte, vollzog sich in der Ökonomie und in den Sozialwissenschaften allgemein eine Bewegung in gegenläufiger Richtung. Mit der Abkehr vom Bild der »ordre naturel« ging die Identifikation des finalen mit dem kausalen Aspekt der beobachteten Wirklichkeit verloren, der finale wurde auch für das Gesamtsystem wirtschaftlicher Vorgänge absolut dominant.3
Fragen der von der Wissenschaft angebotenen Handlungsmöglichkeiten und die allgemeine Sicht der sozialen Ordnung bestimmten auch die Anschauungen über den potenziellen Konflikt zwischen externen Einflüssen und internen wirtschaftspolitischen Zielen. Zum ersten Mal bewusst problematisiert wurde dieser Fragenkomplex in dem Zeitalter, das wir heute Merkantilismus nennen.4
Das, was sich an wissenschaftlicher Analyse zwischen dem Beginn des 16. und dem Ende des 18. Jahrhunderts aus den Schriften zu Wirtschaftsfragen herausdestillieren lässt, ist zunächst im Grunde nichts anderes als die Übertragung einzelwirtschaftlicher Erfahrung auf gesamtwirtschaftlich zu beobachtende Phänomene. Geprägt von dem politischen Nationalismus der gerade entstehenden größeren Staatengebilde, richtet sich das Interesse des volkswirtschaftlichen Denkens nahezu ausschließlich auf die Schnittstelle von nationalem mit internationalem wirtschaftlichem Handeln, nämlich den Saldo des Außenhandels. Entsprechend der einzelwirtschaftlichen Logik wird jeder Überschuss der Einnahmen über die Ausgaben als positiv und wohlstandsmehrend angesehen; das Entgelt für diesen Überschuss in Form von zusätzlichem Metallgeld steht für die Mehrung des Vermögens des Landes zur Verfügung.
Die Anhäufung von »Vermögen« ist für die Mehrzahl der merkantilistischen Autoren das vordringliche Ziel der wirtschaftlichen Aktivität. Weil ihnen die produktive Wirkung von Investitionen nicht bewusst ist, »sparen« aber – dem einzelwirtschaftlichen Denken wiederum entsprechend – als Tugend selbstverständlich war,5 bedeutete Vermögen schlicht die Anhäufung wertvoller Metalle. Konsum war ökonomisch bedeutungslos, er führte nur dazu, »dass der eine verliert, was der andere bekommt, ohne die Nation insgesamt reicher zu machen«.6 Spiegelbild der Gleichsetzung von Sparen und Vermögen ist – wie schon erwähnt – das Unverständnis merkantilistischer Autoren für die Bedeutung von Investitionen und damit für den Einsatz von Kapital. Durchweg wird Kapital mit Geld gleichgesetzt und der Zins in direkter Abhängigkeit von der umlaufenden Geldmenge – quantitätstheoretisch – erklärt. Das macht seinerseits verständlich, dass dem gesamten Bestand an Geld eine so große Bedeutung zugemessen wird. Daraus wiederum folgt die Konzentration auf den Außenhandel, denn eine positive Handelsbilanz ist der einzige Weg, um die inländische Geldmenge zu erhöhen.
So lässt sich also aus dem Weltbild des Merkantilismus durchaus konsistent die Zuspitzung der Analyse auf die Handelsbilanz erklären. Die eigentliche Konfusion betrifft weniger den außenwirtschaftlichen Aspekt als das Verständnis von Vermögen und Vermögensrechnung.
Im Merkantilismus existiert also kein unmittelbarer Konflikt zwischen außenwirtschaftlichen und binnenwirtschaftlichen Zielen. Dagegen ist der permanente Konflikt zwischen den Handelspartnern um die Überschussposition im Außenhandel unumgänglich. Dieser wird ausgetragen mit einer Vielzahl von staatlichen Maßnahmen zur Abwehr von Importen und zur Förderung von Exporten.
Neben der Handelsbilanztheorie des Außenhandels, die sich unmittelbar auf die Vermehrung der Metallbestände richtet, gibt es aber im Merkantilismus eine weitere Argumentationskette, die einen positiven Saldo von Exporten zu Importen als wünschenswert erscheinen lässt. Die merkantilistischen Autoren erkennen nämlich, dass die Exporte eines Landes Ergebnis des Einsatzes seiner eigenen Arbeit sind, während Importe – vor allem solche von Fertigprodukten – eigene Arbeit verdrängen. Exportüberschüsse bedeuten also mehr Beschäftigung für die eigenen Arbeiter. Dieses »Beschäftigungsbilanz-Argument« wird parallel und als Ergänzung zum Handelsargument benutzt.7 Allerdings sind die Rollen jetzt vertauscht, die Beschäftigung ist das Ziel und die positive Handelsbilanz das Mittel, während in der ursprünglichen Theorie mehr Beschäftigung u. a. ein Mittel war, um mehr Ressourcen für den Export zur Verfügung zu haben.
Mit dieser Neuzuordnung von Zielen und Mitteln gab sich der Merkantilismus, trotz des bis in unsere Zeit reichenden Erfolges der »Beschäftigungsbilanztheorie«8, die entscheidende Blöße, die vor allem Adam Smith nutzte, um die Widersprüchlichkeit der gesamten Doktrin aufzuzeigen. Denn wenn Beschäftigung das Ziel der wirtschaftlichen Tätigkeit ist, dann lässt sich zeigen, dass dieses Ziel ebenso gut wie durch vermehrten Export durch vermehrte Produktion für die Nachfragekategorie erreicht werden kann, die ohnehin viel besser als Ziel allen wirtschaftlichen Handelns zu begründen ist: den Konsum. Der Außenhandel hat durch die Beschäftigungsbilanztheorie seine Einzigartigkeit verloren, die sich noch mit der Handelsbilanztheorie, zumindest innerhalb des merkantilistischen Systems, halten ließ. Wie fragwürdig die Theorie des positiven Beschäftigungssaldos ist, lässt sich leicht an einer naheliegenden Konsequenz aus dieser Vorstellung zeigen. Um die Beschäftigung zu erhöhen, ist es natürlich angebracht, die Geldlöhne der Arbeiter im Inland zu senken, was die internationale Wettbewerbsfähigkeit des Landes stärken wird.
Da das gleiche in anderen Ländern auch geschieht, hat der weltweite Wettbewerb die »natürliche« Folge, die Löhne der Arbeiter auf das Existenzminimum zu senken und dort zu stabilisieren.9 Trotz dieser offensichtlichen Fragwürdigkeit hat auch dieses Ergebnis der Beschäftigungsbilanztheorie bis heute überlebt, wie das allgegenwärtige Argument von der Notwendigkeit der Verbesserung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit – zur Erhaltung von Arbeitsplätzen – vor Augen führt.10
Nachwort
Auch heute ist merkantilistisches Denken längst nicht überwunden und der wichtigste Hort dieses Denkens ist offensichtlich Deutschland. Das Land, das durch Lohnzurückhaltung (im Rahmen der Europäischen Währungsunion) zum größten Überschussland aufgestiegen ist und zum europäischen Champion zugleich, glaubt heute fester denn je an diese 300 Jahre alte und längst überwunden geglaubte Doktrin. Dass auch der immer wieder hochkommende Flirt bestimmter Varianten des Keynesianismus mit dem Merkantilismus nicht sinnvoll ist, zeigt die Fußnote zehn.
I.2. Der klassische Automatismus
Entscheidend für die Überwindung der merkantilistischen Doktrin durch David Hume und Adam Smith war die Erkenntnis, dass die internationale Arbeitsteilung nicht fundamental anders abläuft als die interregionale. Mikroökonomisch bedeutet das die Integration des Außenhandels in eine auf das Individuum abstellende Interpretation des gesamten ökonomischen Prozesses, die den Konsum als Ziel allen wirtschaftlichen Handelns herausstellte11 und die somit auch Export und Import bzw. deren Saldo und dessen Auswirkungen auf die Akkumulation von Edelmetall keine besondere, weil nur konsumaufschiebende, Wirkung zumessen konnte. Makroökonomisch gelang Hume der vollständige Nachweis, dass (in einem internationalen Währungssystem, das sich auf Gold stützte) auch ohne Eingriff der Nationalstaaten jedes Land die Menge an internationalem Geld (Metall) erhalten wird, die es angesichts seines relativen Preisniveaus benötigt, um einen Ausgleich zwischen Exporten und Importen herzustellen. Damit war nicht nur die These vom notwendigen permanenten Konflikt der Handelspartner um den Handelsbilanzüberschuss widerlegt, sondern auch die immer wiederkehrende Sorge der Merkantilisten bezüglich einer »Geldknappheit« in deren eigenen – quantitätstheoretischen – Rahmen. Viner beschreibt die Bausteine, die zu dieser Theorie führen konnten, als fünf Stufen:
1. Die Erkenntnis, dass internationale Nettosalden nur in internationalem Geld bezahlt werden können.
2. Die Erkenntnis, dass die Geldmenge über das Preisniveau (mit)bestimmt.
3. Die Erkenntnis, dass Export- und Importvolumen von den relativen Preisniveaus im In- und Ausland abhängen.
4. Das Zusammenfügen der ersten drei Bausteine zu einer. konsistenten Beschreibung (Theorie) einer sich selbst regulierenden internationalen Verteilung des Metallgeldes.
5. Die Erkenntnis, dass diese Theorie die Basis zerstört für die traditionelle Sorge um die Angemessenheit der inländischen Geldmenge, zumindest auf lange Sicht.12
Der von Hume ausgearbeitete Mechanismus lässt sich leicht beispielhaft im Fall eines Zuwachses der Geldmenge und einer daraus sich ergebenden Steigerung des Preisniveaus im Inland darstellen. Die Preissteigerung führt zu einer Verminderung der Wettbewerbsfähigkeit und damit zu einer Verschlechterung der Handelsbilanz, was einen Geldabfluss auslöst. Dieser hält so lange an, bis das heimische Preisniveau wieder so weit gesunken ist, dass die Handelsbilanz ausgeglichen werden kann. Der Mechanismus wirkt selbstverständlich auch bei einer aus anderen Gründen (z. B. Nachfrageveränderung) eintretenden Verschlechterung der Handelsbilanz; immer sind es Preisanpassungen im Inland, die das Gleichgewicht wiederherstellen.13
Die Wirkung der Geldmengenveränderung beruht auf einer einfachen quantitätstheoretischen Vorstellung, ohne die möglichen Auswirkungen der monetären Kontraktion auf das Einkommensniveau infolge der Arbeitsweise des Transmissionsmechanismus (Zinssteigerung) zu beachten. Der Anpassungszwang der Zahlungsbilanz ist als unabwendbar erkannt oder zugunsten des Freihandels und der optimalen internationalen Arbeitsteilung selbstverständlich hinzunehmen, denn er entspringt der »natürlichen Ordnung der Dinge«.
Ebenso wenig wie die Auswirkungen der monetären Restriktion auf das Einkommensniveau und damit der intertemporale Güteraustausch Eingang in die klassische Analyse findet, stehen die monetären Auswirkungen des internationalen Güteraustauschs im Vordergrund bei David Hume und seinen Nachfolgern. Für die Analyse ist es scheinbar irrelevant, ob eine ausgeglichene Handelsbilanz vorausgesetzt wird. Kann man, ohne den Kern der Überlegungen zu ändern, den realistischen Fall einführen, dass der Saldo der Handelsbilanz dem Saldo der Kapitalverkehrsbilanz entspricht, also Kapitalverkehr generell zulassen? Es entsteht dann zwar eine weitere Quelle von Störungen des externen Gleichgewichts, aber auch eine weitere Instrumentenvariable neben dem Preisniveau, nämlich der inländische Zinssatz. Im Goldflussmechanismus vollziehen sich Anpassungen der Kapitalbilanz nicht anders als Anpassungen der Handelsbilanz; durch Goldabfluss erzwungene monetäre Restriktion führt zu Zinssteigerungen, die den Goldabfluss verlangsamen und schließlich sogar umkehren, bis das Gleichgewicht wiederhergestellt ist.
In der klassischen Theorie spielen folglich Friktionen der »transitional period« (I.Fisher) analytisch keine Rolle. Auch hier gilt der Satz: »productions are always bought by productions (…) money is only the medium by which the exchange is effected.«14
Die Erkenntnislogik der klassischen Theorie schließt also von vornherein den Konflikt zwischen internen Zielen und außenwirtschaftlichen Anpassungszwängen dadurch aus, dass das Erkenntnisziel auf die Darstellung einer neuen Gleichgewichtsposition reduziert ist. Das ist ein bedeutender Punkt. Eindeutig überwunden hat die klassische Theorie nur den unmittelbaren Konflikt der Handelspartner im merkantilistischen System (»den Kampf um den Überschuss«) durch die Demonstration der Vorteile beider Seiten auf der Basis einer haltbaren Definition von Vermögen. Nur umgangen hat sie die Auseinandersetzung mit dem Konflikt zwischen internen und externen Zielen durch die Wahl der Methode. Das ist ein schwerwiegender Mangel. Gerettet werden kann die klassische Theorie gegen methodische Angriffe scheinbar nur, indem der Zeithorizont der Analyse mit »langfristig« umschrieben wird. Dann wäre die Sachaussage der Klassiker als teleologische Aussage interpretierbar, wenn die Ziele menschlichen Handelns als ebenso langfristig unterstellt werden. Doch nicht einmal das geschah, als Keynes seinen Frontalangriff gegen den klassischen Automatismus unter Hinweis auf die kurzfristigen Friktionen, die der internationale Güteraustausch mit sich bringt, startete.
Nachwort
Bemerkenswert ist an dieser Stelle, wie konsequent die Klassiker die sogenannte Quantitätstheorie des Geldes bei ihren Analysen einsetzten. Das zeigt hier schon, dass eine Welt, in der das Preisniveau nicht vom Geld in irgendeinem Sinne bestimmt wird, die größte Herausforderung für die gesamte ökonomische Theorie darstellt. Auch darauf wird zurückzukommen sein.
I.2.1. Konflikte bei Keynes
Es schien ganz offensichtlich und war dennoch zunächst eine ungewohnte Sichtweise, dass eine Änderung der Parität um das Ausmaß der Entwertung den schmerzlichen und langwierigen Prozess der Deflation ersetzen könnte. Keynes16 verallgemeinerte die Konfliktsituation zwischen internem und externem Gleichgewicht und folgerte, dass es nicht nur in solchen Ausnahmesituationen geboten sei, die Parität zu ändern, sondern dass generell das Ziel der internen Stabilität der Währung dem der Stabilität des Außenwertes vorzuziehen sei, folglich der Goldstandard beseitigt werden müsse. Es war nur eine konsequente Weiterführung dieser Auffassung, dass auch der Konflikt zwischen der Anpassung an Zahlungsbilanzdefizite und Vollbeschäftigung mit Änderungen des Wechselkurses zu beantworten sei, nicht aber mit inländischer Zinspolitik und Deflation. Dies bedeutete zum einen natürlich explizit eine Ablösung der kausalen Ordnung und zum anderen die erneute Hinwendung zur Priorität kurzfristiger nationaler gesamtwirtschaftlicher Ziele.
Die Überwindung der Klassik durch Keynes begann also lange bevor Keynes seine »General Theory« schrieb. Sie begann mit seinem Versuch, im »Tract on Monetary Reform« eine Lösung, zumindest aber eine Milderung, des Konfliktes zwischen interner Stabilität des Geldes und externer Stabilität, d. h. stabilem Außenwert der Währung, zu finden. Keynes’ Ausgangspunkt der Kritik ist die klassische Vorstellung eines »Automatismus« in den internationalen Beziehungen, die keinen Raum lässt für nationale kurzfristige Ziele. Keynes unternahm es, die Implikationen dieses Automatismus gerade für solche wirtschaftspolitischen Ziele aufzuzeigen.17
»Inflation ist ungerecht und Deflation ist hemmend«, auf diese Formel gebracht begründet Keynes das Ziel interner Preisniveaustabilisierung. Die Argumente gegen beide Arten der Preisniveauänderung müssen hier nicht wiederholt werden, denn insbesondere die Verteilungswirkungen, sprich Wirkungen auf Gläubiger-Schuldner-Beziehungen von Inflation und Deflation, sind inzwischen Allgemeingut geworden.18 Keynes argumentiert, rechtzeitige Änderungen des Außenwertes der Währung, also Veränderung des Wertes des Geldes im Raum, könnten verhindern, dass von außen eine inländische Geldpolitik, die auf Stabilisierung des Geldwertes in der Zeit gerichtet ist, immer wieder unterlaufen wird, weil der internationale Zusammenhang der Preise gehandelter Güter19 und der Goldumlaufmechanismus es nur sehr kurzfristig zulassen, dass ein Land seine interne Kaufkraft höher oder niedriger festlegt als seine Handelspartner. Keynes sieht den Ausweg in einem nationalen Papiergeldstandard, der die Möglichkeit eröffnet, den Wechselkurs zu ändern.
Die Behauptung aber, Autonomie des Preisniveaus über Änderungen des Wechselkurses erreichen zu können, kann nur analytischen Bestand haben, wenn gleichzeitig verdeutlicht wird, welches die Determinanten des Wechselkurses sind, beziehungsweise wann der Wechselkurs geändert werden sollte. Keynes findet eine Möglichkeit zur Erklärung der Bewegung der Wechselkurse in der Kaufkraftparitätentheorie. Diese Theorie, für die Klassiker nicht mehr als der Truismus des einheitlichen Preises auf verbundenen Märkten, wurde nach dem Ersten Weltkrieg von Cassel20 in einer erweiterten Fassung vertreten und fand auch eine gewisse empirische Bestätigung zwischen 1920 und 1923.21 Obwohl Keynes in Richtung Truismus und bezüglich der Einführung von Kapitalverkehr bedeutende Abstriche von der ursprünglichen Cassel’schen Fassung machte, musste er doch das Prinzip der Determination des Wechselkurses auf diesem Wege anerkennen, um seine Behauptung von der möglichen Autonomie des heimischen Preisniveaus halten zu können. Nicht ganz deutlich wird, ob er wie Cassel die Kaufkraftparitätentheorie tatsächlich als eine Erklärung der Bewegung eines marktbestimmten Wechselkurses ansieht oder als Norm für politisch bestimmte Änderungen des Außenwertes der Währungen.22 Keynes hat den Zusammenhang als Theorie nicht aufrechterhalten,23 sondern sich später eindeutig für wirtschaftspolitisch festgelegte, auch von der Kaufkraftparitätentheorie unabhängige, Wechselkursänderungen ausgesprochen.
Eine theoretisch wesentlich fundiertere Analyse als im »Tract« liefert Keynes, der nach dem Ersten Weltkrieg zum führenden Vertreter einer nationalen wirtschaftspolitischen Strategie geworden war, in seiner »Treatise on Money«. Zwar hatte er schon im »Tract« der Gefahr einer Deflation ein größeres Gewicht als der Gefahr einer Inflation gegeben, doch wird erst hier in aller Deutlichkeit das Problem einer internen Deflation aus Zahlungsbilanzgründen, d. h. der eigentliche Konflikt zwischen internem und externem Gleichgewicht, aufgeworfen. Keynes besitzt jetzt das analytische Instrumentarium, das erlaubt, diesen Konflikt und seine Lösungsmöglichkeiten zu erklären. Er hat die Wicksell’schen Überlegungen vom Entstehen inflationärer und deflationärer Prozesse übernommen und kann infolgedessen unmittelbar die Folgen einer Zinssenkung oder Steigerung aus Zahlungsbilanzgründen auf die heimische Beschäftigung und das Preisniveau darstellen. Das ist von überragender Bedeutung: Es gelingt Keynes, die Friktionen des internationalen Austauschs von Gütern und Kapital zu transformieren in Friktionen des intertemporalen Austauschs von Gütern und Kapital. Der Konflikt wird damit auf eine Ebene gehoben, wo es keine a priori-Entscheidung mehr für die Hinnahme der internationalen Friktionen geben kann. Die Frage ist nur, ob ein Mechanismus existiert, der die Rückwirkungen der Friktionen des internationalen Austauschs auf den intertemporalen beseitigen kann.
Bevor aber die Keynes’sche Konfliktsituation näher zu charakterisieren ist, muss kurz auf die Bedeutung, die der sogenannten Methode des Diskontsatzes24 zur Zahlungsbilanzanpassung seit den Klassikern zukam, hingewiesen werden.
Wie oben erwähnt, spielten in der klassischen Vorstellung der Anpassung Zinsänderungen als Anpassungsvariable keine eigenständige Rolle, da es weniger auf einen Ausgleich von Handels- und Kapitalverkehrsbilanz ankam als vielmehr auf den langfristig für unumgänglich erachteten Ausgleich der Handelsbilanz selbst. So waren Zinserhöhungen als Folge des Goldabflusses zwar hinzunehmen, bildeten aber nur einen Schritt auf dem Wege zur Preissenkung. Die (naive) quantitätstheoretische Auffassung machte die Beobachtung des Transmissionsmechanismus weitgehend überflüssig. Es gibt m. E. keine eindeutigen Hinweise, ob die klassischen Autoren explizit die Bedeutung der Zinssteigerung als Folge eines Goldabstroms und deren primäre Wirkung auf die Verringerung des Abstroms bzw. die Umkehr der Kapitalströme erkannt haben.25 Spätestens seit Goschens Theorie der Wechselkurse trat jedoch immer mehr die eigenständige Wirkung von Zinssteigerungen auf den Kapital(Gold-)zufluss in den Vordergrund.26 Die Erfahrung zeigte, dass der Zins ein zumindest auf die kurze Frist wirkungsvolles Mittel war, um den Anpassungsprozess nicht alIein den Effekten der Preisänderungen auf Warenströme überlassen zu müssen. Für die lange Frist der Klassiker war dies jedoch ebenso wenig relevant wie die Frage, welcher Transmissionsmechanismus (welche realen Nebenwirkungen) zu einer Preissenkung führt (eine Preissenkung mit sich bringen).