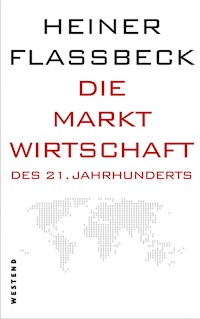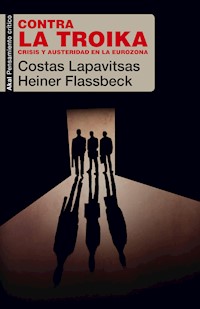59,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Westend Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Eine neue und relevante Ökonomik ist dringend erforderlich. In den acht Kapiteln dieses Buches werden deren Grundprinzipien erklärt: "Kapitel 1: Die Große Depression ist auch nach hundert Jahren noch unverstanden, "Kapitel 2: Schumpeter ist wichtiger als Keynes, "Kapitel 3: Es gibt keine durch den Lohn gesteuerte Substitution zwischen Arbeit und Kapital, "Kapitel 4: Es gibt keine durch einen Marktzins gesteuerte Umwandlung von Sparen in Investieren, "Kapitel 5: Geld ist wichtig, aber Inflation ist immer und überall ein Lohnphänomen, "Kapitel 6: Der internationale Handel wird von absoluten Vor- und Nachteilen bestimmt; "es gibt keine komparativen Vorteile, die von den Entwicklungsländern genutzt "werden könnten, "Kapitel 7: Kapitalmärkte, einschließlich der grenzüberschreitenden Finanzmärkte, "sind niemals effizient, sondern destabilisierend, "Kapitel 8: Der Staat muss die drei makroökonomischen Preise, Zins, Lohn und "Wechselkurse, unter Kooperation der Länder steuern; gleichzeitig sollte der Preis für fossile Energie in Übereinstimmung mit einem sinkenden Angebot von der Staatengemeinschaft systematisch nach oben geschleust werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 759
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Ebook Edition
Heiner Flassbeck
Grundlagen einer relevanten Ökonomik
Unter Mitarbeit von Friederike Spiecker, Patrick Kaczmarczyk und Alexander Mosca Spatz
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.westendverlag.de
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
ISBN: 978-3-98791-016-6
1. Auflage 2024
© Westend Verlag GmbH, Waldstr. 12 a, 63263 Neu-Isenburg, 2024
Umschlaggestaltung: Buchgut, Berlin
Grafiken im Innenteil: ZitterCraft, Jasmin Zitter, Mannheim
Satz: Publikations Atelier, Weiterstadt
Inhalt
Cover
Vorwort
Einleitung
Einhundert Jahre ökonomischer Irrungen und Wirrungen
1.1 Die Große Depression
1.2 Bretton Woods
1.3 Angebotsschocks und die neoklassische Konterrevolution
1.4 Die Angebotspolitik der 1980er-Jahre und ihre Nachfragewirkungen
1.5 Die neue globalisierte Wirtschaft
1.6 Die Währungskrise von 1992
1.7 Die 1990er-Jahre, das Jahrzehnt der Währungskrisen
1.8 Der Euro: Chance und Risiko zugleich
1.9 Nach der Jahrhundertwende: Das Jahrzehnt des Finanzkasinos
1.10 Die 2010er-Jahre: Europas verlorenes Jahrzehnt
1.11 Das Coronavirus und die Weltwirtschaft
1.12 »Inflation« und das erneute Versagen der Geldpolitik in den 2020er-Jahren
1.13 Das große Paradoxon
1.14 Das Rätsel, das es zu lösen gilt
Statik und Dynamik in der Geschichte des ökonomischen Denkens
2.1 Léon Walras und das Gleichgewicht von Angebot und Nachfrage auf allen Märkten
2.2 Die Stationarität der Neoklassik und die Wachstumstheorie
2.3 Say’s Law: Der »Battle Cry« und seine Bedeutung
2.4 Knut Wicksell und die Bedeutung von Zeit und Geld
2.5 Intertemporale Vorsprünge à la Schumpeter
2.6 Wilhelm Lautenbach und Keynes’ Treatise
2.7 Keynes und die General Theory
2.8 Mr. Hicks und der Keynesianismus
2.9 Milton Friedman und der Monetarismus
2.10 Goldstandard und Vollgeld
2.11 Inflationserwartungen, die neue Geldmenge
2.12 Trilemma oder Dilemma: Gibt es eine außenwirtschaftliche Absicherung?
2.13 Der Rückschritt der Mikrofundierung
2.14 Neue Irrwege des Keynesianismus
Wirtschaftliche Entwicklung in Zeit und Raum
3.1 Die intertemporale Entwicklung
3.1.1 Schumpeters Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung
3.1.2 Schumpeters Zinstheorie
3.2 Die internationale Entwicklung
3.2.1 Der internationale Handel und die Existenz absoluter Vorteile
3.2.2 Absolute Vorteile durch Kapitalwanderung
3.3 Sparen und Investieren
3.3.1 Warum ist in der Entwicklung S niemals gleich I ?
3.3.2 Sparen und Investieren in der offenen Volkswirtschaft
3.3.3 Ausgeben und Einnehmen in einem konsistenten empirischen Rahmen
Arbeit und Lohn
4.1 Die betriebliche Sicht oder der Exportkanal
4.2 Angebot, Nachfrage und ein Arbeitsmarkt?
4.3 Der neoklassische Arbeitsmarkt ist eine Fiktion
4.4 Die makroökonomische Bedeutung des Lohnstandards
4.5 Herkömmliche »Arbeitsmarkttheorien« und ihre Schwächen
4.6 Wettbewerbsfähigkeit und Handel auf Unternehmensebene und auf nationaler Ebene
4.7 Die mikroökonomische Bedeutung des Lohnstandards
4.7.1 Löhne, Preise und Produktivität
4.7.2 Investitionen und Produktivität
4.7.3 Der Flächentarifvertrag
4.8 Entlohnung nach der individuellen Grenzproduktivität?
4.9 Warum sich bei Arbeit und Lohn das Schicksal der Neoklassik entscheidet
Geld, Kapital und monetäre Stabilität
5.1 Die Rolle des Geldes
5.1.1 Was ist Geld?
5.1.2 Der Zins
5.1.3 Zins und Rendite
5.2 Die Rolle des Kapitals
5.2.1 Was ist Kapital?
5.2.2 Kapital und Gewinn
5.2.3 Wie entsteht Kapital?
5.2.4 Wie fließt das Kapital?
5.2.5 Der Kapitalstock
5.3 Geldwertstabilität in Zeit und Raum
5.3.1 Geldwertstabilität in der Zeit
5.3.2 Der Kern der Geschichte: Stabiles Geld, Wachstum und Produktivität
5.3.3 Die Lehren für die Welt
5.3.4 Geldwertstabilität im Raum
Absolute Vorteile bestimmen die Handelsströme
6.1 Alter und neuer Merkantilismus
6.2 Die klassische und die neoklassische Theorie des internationalen Handels
6.3 Gibt es eine Theorie der komparativen Vorteile?
6.4 Arbeit, Kapital und Handel
6.5 Absolute Vorteile sind entscheidend
6.6 Entwicklungsländer brauchen Schutz
6.7 Wettbewerb der Nationen und die WTO
Der internationale monetäre Rahmen
7.1 Kapitalbewegungen und Finanzmärkte
7.2 Ist der Devisenmarkt effizient?
7.3 Eine allgemeine Kritik der Effizienzmarkthypothese
7.4 Rohstoffspekulation
7.5 Der Finanzmarkt als Richter über staatliche Politik?
7.6 Gibt es monetäre Autonomie?
7.7 Was der EWU geschehen ist
7.8 Die Ecklösungen des IWF und Dollarisierung
7.9 Die Lösung: Feste reale Wechselkurse
7.10 Das Dilemma der Strom- und Bestandswerte
Wirtschaftspolitik
8.1 Makropolitik
8.1.1 Geldpolitik und die Rollenverteilung in der Wirtschaftspolitik
8.1.2 Muss die Geldpolitik unabhängig und auf ein Ziel ausgerichtet sein?
8.1.3 Mikro oder Makro: Was ist wichtiger?
8.1.4 Lohn- und Einkommenspolitik
8.1.5 Staatliche Politik und Finanzpolitik
8.1.6 Steuerpolitik
8.1.7 Internationale monetäre Politik
8.1.8 Entwicklungspolitik
8.2 Strukturpolitik
8.2.1 Sozialpolitik
8.2.2 Arbeit und Migration
8.2.3 Rentenpolitik
8.2.4 Klima- und Umweltpolitik
Was am Ende bleibt
Literaturverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Kapitel 1: Einhundert Jahre ökonomischer Irrungen und Wirrungen
Kapitel 2: Statik und Dynamik in der Geschichte des ökonomischen Denkens
Kapitel 3: Wirtschaftliche Entwicklung in Zeit und Raum
Kapitel 5: Geld, Kapital und monetäre Stabilität
Kapitel 7: Der internationale monetäre Rahmen
Kapitel 8: Wirtschaftspolitik
Orientierungsmarken
Cover
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Dieses Buch ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Lebenswerk, das Werk meines Lebens. Seit mehr als fünfzig Jahren beschäftige ich mich praktisch jeden Tag mit den großen Fragen der Makroökonomik und habe dabei nicht nur zeitlich einen weiten Weg zurückgelegt. Auch geistig war der Weg ungewöhnlich lang und beschwerlich, weil ich in einigen Fällen Jahrzehnte gebraucht habe, um mich von der Geisteswelt zu emanzipieren, die von der Ökonomik in den vergangenen zweihundert Jahren aufgebaut worden ist.
Ich habe allerdings das große Glück gehabt, dass mich keine meiner beruflichen Stationen von meinem Weg abgebracht oder auch nur dabei aufgehalten hat. Im Gegenteil, ich durfte, wo ich auch arbeitete, immer wieder etwas Neues lernen.
Erstaunlicherweise wusste ich von Anfang an genau, dass ich mich mit nahezu allen makroökonomischen Bereichen auseinandersetzen muss, um das große Ganze zu verstehen, zu kritisieren und weiterzuentwickeln. Also habe ich nie länger an einer Station haltgemacht, sondern bin weitergezogen in der festen Überzeugung, eine umfassende Antwort zu finden.
Die ökonomische Lehre ist wie ein gewaltiges Labyrinth mit nahezu unendlich vielen Wegen, die ins Nichts führen. Das macht es so mühsam. Wer schnell einmal hindurch will, um das ganze Gebilde wieder in Ruhe von außen betrachten und beurteilen zu können, hat keine Chance. Nur wer die Geduld aufbringt, eine Sackgasse nach der anderen abzuarbeiten, kommt durch und vermag am Ende eine neue Schneise zu schlagen, die den Nachfolgenden die Möglichkeit gibt, schneller ans Ziel zu kommen.
Zu danken habe ich meinen geistigen Gegenübern. Ohne die intellektuelle Auseinandersetzung mit ihnen hätte ich in etlichen Sackgassen länger zugebracht und wäre vielleicht niemals bis zum Ende durchgedrungen. Insbesondere die harten Diskussionen im Stab des Sachverständigenrates, im Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung und bei der Gemeinschaftsdiagnose der Wirtschaftsforschungsinstitute haben meine Ansichten vermutlich stärker geformt als die bloße Lektüre der herrschenden Lehre. Meine Arbeit bei der UNCTAD hat mir gezeigt, wie global das Unverständnis in ökonomischen Fragen ist und wie sehr es der wirtschaftlichen Entwicklung von Milliarden von Menschen im Wege steht; meine politische Arbeit hat mir die Augen dafür geöffnet, wie sehr die Politik der Sklave der ökonomischen Lehrmeinungen ist.
Dieses Buch wäre ohne tatkräftige Hilfe nicht möglich gewesen. Friederike Spiecker hat so viele und so bedeutende Beiträge geleistet, dass ich gar nicht versuche, sie einzeln aufzulisten.
Patrick Kaczmarczyk ist vor etwa zehn Jahren zu uns gestoßen, weil er einen zu klaren Verstand hat, um den Verstrickungen der herrschenden Lehre folgen zu können und zu wollen. Patrick hat sich vor allem um das Handelskapitel verdient gemacht. Allein hätte ich es nicht geschafft, mich durch den Dschungel der Handelstheorien zu quälen und am Ende die richtige Schneise zu schlagen.
Alexander Mosca Spatz ist der Jüngste im Bunde. Auch er hat schon während seines Studiums verstanden, dass die Neoklassik kein Angebot macht, das man als vernunftbegabter Mensch, der wissenschaftlich arbeiten will, annehmen kann. Alexander hat einige wertvolle Beiträge zu Schumpeters Entwicklungstheorie, zur modernen Literatur, zur Besteuerung und zur Rente beigesteuert.
Dea Ketrin Dubovci hat die Lohnentwicklung in Deutschland vor und während der Großen Depression ermittelt. Jan Frederik Moos hat Korrektur gelesen und die Literaturliste erstellt. Jasmin Zitter hat die Grafiken umgesetzt und Philipp Müller hat das Lektorat übernommen. Allen habe ich zu danken für eine effiziente und vertrauensvolle Zusammenarbeit.
Ganz besonders zu danken habe ich dem Westend Verlag, der mich schon im Vorfeld der Entstehung dieses Buches großzügig unterstützt und damit viele entscheidende Vorarbeiten möglich gemacht hat.
Schließlich kann ein solches Buch nur zustande kommen, wenn auch das private Umfeld die Bedingungen schafft, unter denen man in der Lage ist, unbeschwert die vielfältigen Herausforderungen zu meistern, die der vollkommene Bruch mit herkömmlichen Denkmustern über Jahrzehnte mit sich bringt. Meiner Familie gebührt daher der allergrößte Dank.
Alle Fehler und Irrtümer gehen selbstverständlich zu meinen Lasten. Was mich allerdings nicht sehr belastet. Selbst wenn an der ein oder anderen Stelle ein Urteil zu hart oder eine Kritik zu streng ausfällt – darauf kommt es nicht an. Was allein zählt ist die Zusammenschau der Kritik und die unbestreitbare Tatsache, dass die Gleichgewichtsanalyse von Märkten daran scheitert, die dynamische Entwicklung von Volkswirtschaften zu beschreiben und zu erklären. Ich will die Ökonomen dazu anregen, die viel zu einseitige Methodik des Marktgleichgewichts über Bord zu werfen und sich endlich der Dynamik zu verschreiben. Geht die Reise in eine solche Richtung, will ich mich gerne belehren lassen, was man noch besser machen und weiterentwickeln sollte, als es mir in meinem Lebenswerk gelungen ist.
Einleitung
Schaut man auf mehr als zweihundert Jahre Ökonomik zurück, muss man einen einfachen Sachverhalt konstatieren: Die Ökonomen haben es sich zu leicht gemacht! Das Zusammenspiel von Wirtschaft und Gesellschaft auf der nationalen und auf der internationalen Ebene sowie in seinem zeitlichen Ablauf ist weit komplexer als es die herrschende Lehre wahrhaben will. Man hat versucht, die Komplexität mit einfachen Modellen auf leicht verständliche Zusammenhänge zu reduzieren, aber dieser Versuch ist vollständig gescheitert.
Die weit überwiegende Mehrzahl der Ökonomen, die sich darum bemühten und bemühen, das komplexe Zusammenspiel von Wirtschaft und Gesellschaft in einem prinzipiell marktwirtschaftlichen System zu ergründen, haben sich stets auf die Frage konzentriert, auf welche Weise der Markt oder ein System von Märkten aus sich heraus und in Reaktion auf äußere Einwirkungen dabei helfen kann, wirtschaftliche und gesellschaftliche Probleme zu lösen.
Das ist zu wenig. Die Wirtschaftswissenschaften sind darauf aus Marktlösungen zu suchen; nur wenige Ökonomen haben stattdessen gefragt, wie sich die wirtschaftlichen Abläufe in die Gesellschaft einfügen und ob und auf welche Weise Märkte dabei eine Rolle spielen. So ist die Aufteilung der »Welt« in verschiedene Märkte typisch für die herrschende Lehre. Praktisch jedes Modell und jedes Lehrbuch der Ökonomik analysiert Geld- und Kapitalmärkte, die national und international verbunden sind mit den Güter- und Arbeitsmärkten. Jeder dieser Märkte, so die herkömmliche Ansicht, weist seine eigenen Angebots- und Nachfragebedingungen auf, interagiert aber mit allen anderen und reagiert auf Schocks, die von außerhalb des Marktsystems kommen.
Dieser Ansatz führt fundamental in die Irre. Die Frage, ob und wie ein Markt funktioniert und mit anderen Märkten interagiert, ersetzt die eigentlich relevante Frage, welche Abläufe in der sozialen und wirtschaftlichen Wirklichkeit beobachtet werden und wie man sie – unter Einschluss der Märkte oder ohne typische Marktmerkmale zu verwenden – erklären kann.
Weil die Suche nach Marktlösungen das Forschungsinteresse der Ökonomen beherrscht, neigen sie dazu, die wirkliche Welt durch Modelle zu ersetzen, in denen Angebot und Nachfrage sowie die ihnen entsprechenden Preise alle wichtigen Probleme lösen. Das Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage gerät darin zum absolut dominierenden methodischen Instrument. Nur solche Vorgänge, die sich mit der Methodik eines Marktgleichgewichts abbilden lassen, können überhaupt wissenschaftlich erfasst werden.
Das führt dazu, dass die Ökonomen nahezu alle Bereiche des gesellschaftlichen Miteinanders unter Zuhilfenahme »geeigneter« Annahmen so modellieren, dass sie in ihre Methodik passen. Ob die Annahmen sich noch ausreichend nahe an der Wirklichkeit bewegen, um gehaltvolle Aussagen aus ihnen ableiten zu können, ist für den »Erfolg« der Forschung nicht entscheidend. Schwache empirische Bestätigungen lassen sich auch für Modelle finden, die nachgerade nichts mit den realen Abläufen zu tun haben, solange man »geeignete« ökonometrische Methoden einsetzt. Findet man im Umfeld der Gleichgewichtslehre durchweg nur schwache empirische Belege, legitimiert das jedes Ergebnis, weil man den Mangel an stärkerer Evidenz einfach der »Komplexität« des Forschungsobjekts zuschreiben kann.
Wir gehen einen völlig anderen Weg, indem wir ohne jede Vorprägung durch »Märkte« fragen, ob es für die Phänomene, die empirisch eindeutig zu beobachten sind, angemessene Erklärungen gibt. Auch Märkte werden selbstverständlich in diese Erklärungsversuche einbezogen, sie sind aber nicht das Leitmotiv und stehen nicht im Mittelpunkt unseres Erkenntnisinteresses. Beispielsweise repräsentieren Preise äußerst wichtige Signale für Konsumenten und Unternehmen, wenn man sie aus dem engen Korsett des perfekt funktionierenden Marktes herauslöst. Maßgeblich für die Robustheit und Plausibilität aller Erklärungen ist letztlich ihre widerspruchsfreie Einbindung in grundlegende makroökonomische Zusammenhänge. Kapitel 1 gibt einen Eindruck davon, wie man sich empirisch abgesichert den relevanten Erklärungen für die letzten hundert Jahre nähern kann.
Wir werden in diesem Buch auf den Versuch einer dogmengeschichtlichen Einordnung des jeweils relevanten Paradigmas weitestgehend verzichten. Der Schwerpunkt liegt auf dem Verständnis der Sachzusammenhänge, auch wenn es selbstverständlich ohne einige entscheidende Namen und Quellen nicht geht. Tonnen von Primär- und Sekundärliteratur können jedoch im wahrsten Sinne des Wortes belasten und davon abschrecken, sich in die Sachzusammenhänge selbst hineinzudenken. Die Versuchung ist sowieso groß, das eigene Denken hintanzustellen: Man glaubt, nichts mehr beitragen zu können, weil schon so viele Leute mit großem Namen Wichtiges geäußert haben. Wir wollen jedenfalls unsere Leser nicht damit ermüden, von uns als Sackgassen erkannte Wege in der wirtschaftswissenschaftlichen Literatur genau nachzuverfolgen. Dennoch werden wir in Kapitel 2 einen schnellen Gang durch zweihundert Jahre wirtschaftswissenschaftlicher Literatur beschreiten, bevor wir in den Kapiteln 3 bis 7 die neuen Ansätze im Detail vorstellen.
Herausgekommen ist das erste Buch, bei dem Ökonomen, die keineswegs Feinde der Marktwirtschaft sind, die herrschenden ökonomischen Doktrinen, die versuchen, die Marktwirtschaft mit allen Mitteln zu verteidigen und ihre gesellschaftliche Dominanz intellektuell zu begründen, vom ersten bis zum letzten Schritt einer Vernunft- und Realitätsprüfung unterzogen haben – mit ernüchternden Ergebnissen.
Viele werden gegen diese vorwiegend ökonomische Sicht der Dinge einwenden, dass ein Buch, das sich der Makroökonomie widmet, auch die Frage beantworten muss, wie der Mensch mit den natürlichen Ressourcen umgehen soll, die ihm der Planet zur Verfügung stellt. Diese Frage ist äußerst wichtig, aber in diesem Zusammenhang nicht zielführend. Kapitel 8 wird darlegen, dass es sich bei Klima- und Umweltpolitik um strukturpolitische Herausforderungen handelt, die parallel zu den makroökonomischen Aufgaben angegangen werden müssen. Klima und Umwelt so umfassend zu schützen, wie es notwendig ist, gelingt in demokratischen Systemen nur dann, wenn man parallel wirtschaftlich erfolgreich ist. Wirtschaftlicher Erfolg bei gleichzeitigem raschem Strukturwandel zugunsten der natürlichen Ressourcen funktioniert jedoch nicht, wenn die makroökonomischen Weichen falsch gestellt sind. Insofern ist das Wissen um die relevanten wirtschaftlichen Zusammenhänge nachgerade die Voraussetzung für erfolgreiche Umweltpolitik.
Kapitel 1
Einhundert Jahre ökonomischer Irrungen und Wirrungen
Bevor eine neue und relevante Vorstellung von der Dynamik einer gemischten Wirtschaft mit großen marktwirtschaftlichen Elementen dargelegt wird, gilt es die jüngere Vergangenheit der globalen Wirtschaft in Form zentraler empirischer Resultate Revue passieren zu lassen und dazu grundlegende Fragen zu stellen. Die wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung ist keineswegs stetig verlaufen. Vielmehr ist die Wirtschaftsgeschichte der vergangenen hundert Jahre mit wenigen Ausnahmen eine Geschichte von Krisen und Turbulenzen, die das gesellschaftliche System häufig an die Grenzen des Beherrschbaren geführt haben. Ohne Zweifel hat ein unzureichendes Verständnis wirtschaftlicher Abläufe in erheblichem Maße dazu beigetragen.
Die von uns betrachtete Periode beginnt mit der Großen Depression gegen Ende der 1920er- und Beginn der 1930er-Jahre. Diese Krise war ein gewaltiger Einschnitt. Allerdings liegt nicht im gleichen Maße wie heutzutage empirisches Material vor, das für eine gesamtwirtschaftliche Einordnung geeignet ist. Immerhin kann man gut zeigen, dass die Ursachen der größten Wirtschaftskrise der letzten zweihundert Jahre bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht wirklich verstanden worden sind.
Weit besser ist die Datenbasis für die Periode nach dem Zweiten Weltkrieg, weil die Einführung des gesamtwirtschaftlichen Denkens auch im Bereich der Statistik große Fortschritte erlaubt hat. Dabei fällt auf, dass bereits eine einfache empirische Gesamtbetrachtung viele Fragen aufwirft, auf die die herrschende Lehre keine überzeugenden Antworten gibt.
Obwohl dieses Kapitel noch keine tiefgehenden Erklärungen anbietet, lässt sich unschwer zeigen, dass ohne die Kenntnis der wichtigen makroökonomischen Verläufe das entscheidende Ereignis der Nachkriegszeit, die neoliberale Konterrevolution der 1970er-Jahre und ihr Scheitern, nicht zu verstehen ist. Wie konnte es passieren, dass sich die intellektuelle Ausrichtung der Mehrzahl der Ökonomen schon zwei Jahrzehnte nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wieder vom gesamtwirtschaftlichen Denken abwandte und uralten Lehren weichen musste, die ohne Zweifel einen intellektuellen Rückschritt bedeuteten?
1.1 Die Große Depression
Die Große Depression der Jahre 1929 bis 1933 erschütterte nicht nur die Weltwirtschaft, sondern auch die herrschende ökonomische Lehre nachhaltig. Doch selbst diese Erschütterung reichte nicht aus, um die Wirtschaftswissenschaft dauerhaft auf einen erfolgreichen Weg zu führen. Nach einer nur etwa drei Dekaden dauernden Episode, in der alternative Lehren wenigstens zu Gehör kamen, ist seit den 1970er-Jahren genau die Ökonomik weltweit wieder dominant, die für die ungeheuerlichen Fehlleistungen des Faches in der Großen Depression verantwortlich gewesen war.
Am 24. Oktober 1929, dem berühmten »Schwarzen Donnerstag«, begann die Große Depression mit einem Börsencrash. Sie dauerte fast vier Jahre und wird zu Recht als einer der großen, wenn nicht als der größte Einschnitt im Wirtschaftsleben der Nationen angesehen. Ihre unmittelbaren und mittelbaren politischen Konsequenzen waren enorm.
Auch für die Ökonomik brachte sie zunächst eine Zäsur. Viele theoretische Vorstellungen, die man z. T. seit Beginn des 19. Jahrhunderts als unumstößlich angesehen hatte, wurden im Gefolge dieses Ereignisses immerhin temporär in Frage gestellt. Der Glaube an eine aus sich heraus vorhandene Stabilität der Wirtschaft war schwer erschüttert.
Abbildung 1.1 zeigt die Wachstumsrate der USA für fast einhundert Jahre. Die Wucht der Großen Depression wird darin zwar nicht vollständig deutlich, weil die Reihe erst mit Daten ab 1930 beginnt. Aber der enorme Rückgang des preisbereinigten Bruttoinlandsprodukts (BIP) in den Jahren 1930, 1931 und 1932 ist klar zu erkennen. Offensichtlich wird auch, dass außer dem Einbruch um 1945, der dem enormen Kriegsboom folgte und nur recht kurz war, kein späteres Ereignis dieser Krise gleichkam.
Im Gefolge der Krise sprang die Arbeitslosigkeit in den USA von nahe null im Jahr 1930 auf 25 Prozent zu Beginn des Jahres 1933 (Abbildung 1.2). Das war ein unerhörter Wert, der unvorstellbar viele Menschen in Armut stürzte und selbst das stabile amerikanische System zum Wanken brachte. Hätte es nicht Franklin Delano Roosevelt gegeben, der sich ab 1933 als Präsident der USA gegen den ökonomischen Mainstream stellte und quasi im Alleingang eine antizyklische Politik, den New Deal, durchsetzte, wären die Folgen noch weitaus schlimmer gewesen.
Erst nach dem Anlaufen der Kriegswirtschaft ab dem Jahr 1938 ging die Arbeitslosigkeit auch in den USA wieder deutlich zurück und erreichte, nach einem Rückschlag in den Jahren 1937 und 1938, erneut einen Wert nahe null mitten im Zweiten Weltkrieg, als die US-Wirtschaft wegen der Aufrüstung enorme Wachstumsraten verzeichnete.
Daten für die Inflationsrate der USA liegen ebenfalls zurück bis 1929 vor. Es handelt sich dabei um die Steigerungsrate des Preisindex für den Individualkonsum, der keine Ausgaben für Lebensmittel und Energie enthält und daher weniger schwankt als der umfassendere Verbraucherpreisindex, dessen Daten nicht so weit in die Vergangenheit reichen. Dieser kann als Kernrate bezeichnet werden, die eng mit der Inflationsrate des Verbraucherpreisindex korreliert (Abbildung 1.3). Auch hier ist der extrem tiefe Schnitt der großen Krise nicht zu übersehen: Im Jahr 1931 sank die Kernrate in den USA um mehr als 10 Prozent.
Auch in Deutschland war der wirtschaftliche Einbruch enorm. Wie die Abbildung 1.4 zeigt, brach die Industrieproduktion von 1929 bis 1932 um sage und schreibe 40 Prozent ein. Das dramatische Abfallen des nominalen Bruttosozialprodukts (dunkelblaue Linie) zog auch das reale BSP (hellblaue Linie) mit sich nach unten, dessen Wert von etwa 70 Milliarden Reichsmark im Jahr 1929 auf 60 Milliarden im Jahr 1932 schrumpfte. Die reale Wirtschaftsleistung sank also um ungefähr 15 Prozent.
Zudem stieg in Deutschland die Arbeitslosigkeit in ungeheurem Tempo, von etwa 1,5 Millionen Personen im Jahr 1928 auf 5,5 Millionen im Jahr 1932 oder fast 30 Prozent der Erwerbstätigen (Abbildung 1.5). Einem politischen Umsturz war damit Tür und Tor geöffnet.
Im Zuge der Großen Depression ging man politisch und ökonomisch neue Wege. Dem Vorbild der USA folgend, engagierte sich in vielen Ländern der Staat in einem bis dahin nicht gekannten Ausmaß mit öffentlichen Investitionen, um die Arbeitslosigkeit zu reduzieren. Eine wirkliche Kehrtwende in der Politik, die dem Staat größere Bedeutung bei der Stabilisierung der Wirtschaft verlieh, gab es jedoch vor allem in Europa nicht vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs.
Obwohl über die Ursachen der Großen Depression Bibliotheken gefüllt worden sind, hat man bis heute keine allgemein akzeptierte Erklärung gefunden. Wie konnte ein Börsencrash, wie er sich vorher und hinterher einige Male auch im globalen Maßstab ereignete, eine so gewaltige Schockwelle auslösen und sich in die Geschichte der Menschheit als schicksalhaftes Ereignis einbrennen?
Bislang liegt nur ein Sammelsurium an möglichen Ursachen vor. Das zeigt den Stand der ökonomischen Forschung bis heute und die Schwächen der überwiegend angewandten Methodik. Vermutlich ist eine systematische Suche nach den Ursachen der großen Krise ausgeblieben, weil man bei diesem Schock mit der Gleichgewichtsökonomik keinen Schritt weiterkommt, sie aber noch immer das vorherrschende Analyseinstrument darstellt. Unabhängig davon, mit wie vielen Feinheiten und raffinierten Abwandlungen man die Gleichgewichtsökonomik anreichert, sie ist, wie an etlichen Stellen in diesem Buch gezeigt werden wird, vollkommen ungeeignet, dynamische Prozesse zu erfassen.
Die Mehrzahl der Ökonomen suchte die Ursachen genau dort, wo sie erwarteten, Fehler konstatieren zu können, nämlich beim Staat. In Deutschland konzentrierte man sich im Nachhinein vorwiegend auf das Versagen der Finanzpolitik, also auf die vom damaligen Finanzminister Brüning zu verantwortende Austeritätspolitik. Der Versuch der Finanzpolitik, inmitten einer zusammenbrechenden Wirtschaft die eigene Verschuldung in engen Grenzen zu halten, wird als einer der Eckpfeiler dieses Erklärungsversuchs angesehen. In den USA beruft man sich dagegen auf eine Mischung mehrerer Ursachen als ausschlaggebende Faktoren. Paul Samuelson, der einflussreiche Autor eines der erfolgreichsten Lehrbücher aller Zeiten, etwa glaubte an ein Zusammentreffen nicht miteinander verbundener zufälliger Umstände.
In liberalen und ultraliberalen Kreisen sah man die Goldenen Zwanziger mit ihrer Überkonsumption der privaten Haushalte (getrieben durch zu hohe Löhne) und Überinvestition der Unternehmen als Ursache für eine Gegenreaktion des Systems an. Im englischen Cambridge erschien 1931 Friedrich August von Hayek, der bis heute als einer der führenden Köpfe des Ultraliberalismus gilt, zu einem Vortrag, der großes Erstaunen hervorrief. Auf die Frage eines Kollegen, ob die Entscheidung einer Person, einen Mantel zu kaufen, die Arbeitslosigkeit erhöhe, antwortete Hayek mit einem eindeutigen Ja.1
Einen vermeintlich neuen Ansatz präsentierte später Milton Friedman, der geistige Vorreiter des sogenannten Monetarismus. Für ihn und seine Koautorin Anna Schwarz war eine systematisch ungeeignete Geldpolitik, die sinkende Geldmengenaggregate zugelassen hatte, der entscheidende Auslöser der Weltwirtschaftskrise gewesen. In ihrem voluminösen Werk A Monetary History of the United States2 identifizieren sie das Versagen der Geldpolitik als zentrale Ursache. Es bleibt in dieser Analyse jedoch ungeklärt, ob die zweifellos sinkenden Geldmengenaggregate die Folge oder die Ursache des Wirtschaftseinbruchs waren.
In der wohl bekanntesten Arbeit zum Thema, dem Buch The World in Depression, 1929–19393 von Charles P. Kindleberger findet man eine Reihe von Ursachen eher politischer Art, aber keine Erklärung eines systematischen Politikversagens aufgrund einer ungeeigneten Theorie.
Das ist seltsam. Ausgerechnet für die gewaltige Krise, die, wie wir ausführlich zeigen werden, eine wirkliche Neuerung im ökonomischen Denken auslöste, finden sich außer einer prozyklischen Fiskalpolitik und einiger schwer zu interpretierender geldpolitischer Fehlentwicklungen keine großen systemischen Irrtümer, die erklären können, wie die halbe Welt in Arbeitslosigkeit und Elend gestürzt wurde – ist das möglich?
Zwar wird im Zusammenhang mit der Weltwirtschaftskrise immer wieder die Deflation (also der Rückgang des allgemeinen Preisniveaus) erwähnt, die den Einbruch der Wirtschaft begleitete. Es gibt aber nur wenige Quellen, die explizit auf eine Lohndeflation verweisen. Fallende Löhne wurden von den allermeisten Ökonomen als Reaktion auf die steigende Arbeitslosigkeit angesehen und insoweit als die zu erwartende und das System stabilisierende Marktreaktion begrüßt. Hier liegt der entscheidende Fehler.
Die Datenlage zur damaligen Lohnentwicklung ist lückenhaft, aber es lässt sich zeigen, dass die Rezession in allen großen Ländern mit massiven Lohnsenkungen einherging. Für die USA gibt es eine Statistik der Stundenlöhne für die Bauarbeiter, die in den frühen 1920er-Jahren beginnt. Danach sind im Zuge der Großen Depression die Löhne von etwa 0,40 US-Dollar pro Stunde im Jahr 1929 auf etwa 0,32 Dollar im Jahr 1933 gefallen, also um 20 Prozent. Die Löhne der gelernten Bauarbeiter fielen von 1,38 Dollar im Jahr 1930 äußerst rapide auf teilweise 0,94 Dollar im Jahr 1932, was eine Reduktion um 32 Prozent bedeutet (Abbildung 1.6).
Für Großbritannien (UK) finden sich ebenfalls klare Hinweise auf fallende Nominallöhne, dargestellt in Abbildung 1.7. Hier gibt es sogar einen Index der durchschnittlichen wöchentlichen Löhne, der von einem Wert von etwa 100 im Jahr 1927 auf deutlich unter 95 im Jahr 1933 zurückgeht.
Auch für Frankreich liegen Daten vor, die, wie die Abbildung 1.8 zeigt, klar auf absolut fallende Nominallöhne ab dem Jahr 1930 hindeuten; für die Berufsgruppe der Bergarbeiter sank der durchschnittliche Tageslohn bis 1935 um 16 Prozent.
Für Deutschland ist die Datenlage schwierig, weil das Statistische Reichsamt damals zwar große Mengen an Daten sammelte, aber nicht versuchte, diese systematisch zusammenzuführen. Wir haben aus dem Puzzle der Einzeldaten Reihen für die Lohnentwicklung von sechs Berufsgruppen zusammengestellt, die den Zeitraum von 1924 bis 1934 umfassen (Abbildung 1.9).
Hier liegt der Rückgang der Löhne von 1929 bis 1934 in der Größenordnung von über 30 Prozent. Der durchschnittliche Arbeitnehmer war mit einer Situation konfrontiert, in der der Druck auf die Löhne enorm stieg, weil die Arbeitslosigkeit in kürzester Zeit massiv zunahm. Vermutlich waren auch die Gewerkschaften bereit, sich auf Kürzungen der Löhne einzulassen, weil nach allgemeinem Verständnis im Übrigen praktisch keine wirtschaftspolitischen Instrumente bereitstanden, um den Anstieg der Arbeitslosigkeit zu stoppen.
Für die Unternehmen lag der Schritt nahe, bei fallender Nachfrage zunächst Arbeitskräfte zu entlassen und dann zusätzlich zu versuchen, bei den verbleibenden Mitarbeitern Lohnsenkungen durchzusetzen. Aus der Sicht jedes einzelnen Unternehmens war das ein Weg, seine Lage zu stabilisieren. Die Unternehmen hatten von Arbeitnehmerseite nicht viel Widerstand zu erwarten, weil kaum abgesicherte Arbeiter den Gang in die Arbeitslosigkeit fürchteten. Eine staatliche Arbeitslosenversicherung gab es erst seit 1927. Diese geriet aufgrund der im Zuge der Weltwirtschaftskrise rasant ansteigenden Arbeitslosenzahlen schnell unter finanziellen Druck, so dass 1932 nicht einmal ein Drittel der Arbeitslosen Unterstützung von der Versicherung erhielt.4 Folglich waren die Arbeitskräfte bereit, Lohnzugeständnisse zu machen. An dieser Schwäche der Arbeitnehmerseite in einer konjunkturell kritischen Phase hat sich bis heute im Prinzip nichts geändert, auch wenn es eine weit bessere staatlich organisierte Versicherung gegen Arbeitslosigkeit gibt.
Ob ein solcher mikroökonomischer Kampf gegen die Existenzbedrohung der Unternehmen makroökonomische Konsequenzen nach sich zieht, interessiert weder die Arbeitgeber noch die Arbeitnehmer. Selbst für die große Mehrzahl der Volkswirte reicht angesichts der Vorstellung eines funktionierenden Arbeitsmarkts die mikroökonomische Logik vollständig aus. Sinkende Löhne als Reaktion auf steigende Arbeitslosigkeit sind im Marktmodell selbstverständlich und ohne weiteres stabilisierend, weil man davon ausgeht, dass die Unternehmen die Lohnsenkungen zum Anlass nehmen, ihre Produktion in Richtung höherer Arbeitsintensität umzubauen. Dazu mehr in Kapitel 4.
Man unterstellt also, dass die Einkommen der Arbeitnehmer in der Summe (die sogenannte Lohnsumme) konstant bleiben, weil die Lohnsenkung pro Kopf durch die Zunahme der Beschäftigung genau ausgeglichen wird. Wenn in Reaktion auf die ursprüngliche Krise in den USA oder in Deutschland die Löhne um etwa 30 Prozent gefallen waren, dann müsste die Beschäftigung zur gleichen Zeit um 30 Prozent gestiegen sein, um einen negativen Nachfrageeffekt von Seiten der Arbeitnehmer zu verhindern.
Allerdings stieg, wie die Empirie eindeutig zeigt, die Arbeitslosigkeit von 1929 bis 1933 durchgängig stark an. Das schließt einen Beschäftigungsaufbau aus und macht den Lohnrückgang und den Beschäftigungsrückgang zu zeitgleichen Erscheinungen. Folglich ist der Schluss zwingend, dass die Nachfrage in den betroffenen Volkswirtschaften auch deswegen fiel, weil es in Reaktion auf die Krise zu absolut sinkenden Löhnen kam.
Das heißt, dass der Arbeitsmarkt gerade nicht so funktionierte, wie es von der herrschenden neoklassischen Lehre erwartet wird. Die Bedeutung dieser Einsicht kann gar nicht überschätzt werden. Ohne einen »Arbeitsmarkt«, der bei Lohnsenkungen die Beschäftigungslage verbessert, ist das theoretische Gebäude der Neoklassik akut vom Einsturz bedroht. Die gesamte heute praktisch verwendete Ökonomik steht dann auf tönernen Füßen und bedarf einer grundlegenden Revision. Sie kann in diesem Fall nicht mehr als Basis für wirtschaftspolitische Empfehlungen dienen. Genau das wird dieses Buch zeigen.
Einen weiteren Hinweis zur Beantwortung der Frage nach der Funktionsweise des »Arbeitsmarktes« erhält man, wenn man eine der größten ökonomischen Krisen der vergangenen Jahre genauer anschaut. In Griechenland wurde von den Gläubigerstaaten achtzig Jahre nach der Großen Depression in den Jahren ab 2010 auf der Basis der neoklassischen Theorie zum ersten Mal in der modernen Geschichte in einem entwickelten Land eine massive Lohnsenkung durchgesetzt.
Griechenland ist deswegen so interessant, weil sich der eigentliche tiefe Absturz der Wirtschaft und der dramatische Anstieg der Arbeitslosigkeit ab dem Jahr 2010 ereigneten, einem Zeitpunkt also, als die Regierung in Athen längst unter strenger Kontrolle der Troika aus Europäischer Zentralbank (EZB), EU-Kommission und Internationalem Währungsfonds (IWF) stand, deren Mission im April des Jahren begonnen hatte. Danach hätten keine gravierenden wirtschaftspolitischen Fehler mehr passieren dürfen – doch der Troika fehlte die geeignete Theorie.5
Auch in Griechenland konzentriert sich im Nachhinein die Suche nach den Ursachen für den Absturz der Wirtschaft und den Anstieg der Arbeitslosigkeit auf die klassischen Politikbereiche, insbesondere die Fiskalpolitik, weil es aufgrund des Euros keine eigenständige Geldpolitik gab. Allerdings waren die langfristigen Zinsen für Griechenland mehr als für andere Länder vom Kapitalmarkt in die Höhe getrieben worden, was die EZB damals – in einer Verkennung ihres ökonomischen Mandats – zugelassen hatte.
Hohe langfristige Zinsen und eine restriktive Fiskalpolitik können aber nicht erklären, warum der reale private Verbrauch im Verlauf dieser Krise um über 20 Prozent einbrach. Es wäre auch aus Sicht der Institutionen, die die Troika bildeten, absurd gewesen, vorsätzlich eine Politik zu fahren, die zu einem so starken Einbruch der Gesamtnachfrage führen und extreme Arbeitslosigkeit nach sich ziehen sollte. Es muss folglich noch einen anderen Faktor gegeben haben, den die Troika zwar bewusst einsetzte, dessen reale Auswirkungen ihr aber nicht vorab klar gewesen waren.
Dabei handelte es sich nach allem, was wir heute wissen können, um die von der Troika mit Gewalt durchgesetzte Lohnsenkung. Tatsächlich sanken in Griechenland ab 2009 die Löhne in realer und in nominaler Rechnung (Abbildung 1.10). Der Rückgang beschleunigte sich in den Folgejahren unter dem Druck der Troika. Insgesamt sank der Reallohn, berechnet als Differenz zwischen Nominallohn- und Verbraucherpreisanstieg, von über 13 Euro im Jahr 2009 auf unter 10 Euro im Jahr 2018 und damit um 26 Prozent.
Dem entsprach fast genau der Rückgang des realen privaten Verbrauchs um etwa ein Viertel zwischen 2009 und 2018, wie Abbildung 1.11 zeigt.
Die Arbeitslosenquote stieg in Griechenland im Gefolge dieser Politik und parallel zu dem enormen Rückgang der Reallöhne steil auf ein vorher nicht gekanntes Niveau von fast 30 Prozent an (Abbildung 1.12) und blieb auch in den Folgejahren trotz eines leichten Rückgangs mit mehr als 15 Prozent äußerst hoch.
Auch in Spanien lässt sich ein ähnliches Muster beobachten (Abbildung 1.13). Die Reallöhne (deflationiert mit dem Verbraucherpreisindex) fielen von 2009 bis 2012 um 6 Prozent und der private Verbrauch fiel nochmals (nachdem er schon von 2008 auf 2009 gefallen war) zwischen 2010 und 2013 um 9 Prozent.
Das Zusammenfallen von Reallohnrückgang und Nachfragerückgang ist, wie oben schon beschrieben, für die herrschende neoklassische Lehre ein unerklärliches Phänomen. Diese Abweichung der Wirklichkeit von der erwarteten Entwicklung hat zumindest den IWF stark irritiert. In einem Statement zu den »Fortschritten« des spanischen Anpassungsprogramms kam man dort schon im Jahr 2013 zu der Erkenntnis, dass sinkende Löhne die Beschäftigung verringern, weil die Kaufkraft der privaten Haushalte sinkt. Wörtlich sagte der IWF:
A mechanism should be explored to bring forward the employment gains from structural reforms. This would augment ongoing efforts to help guide Spain’s economy to a better outcome and could comprise two elements: (1) employers committing to significant employment increases in return for unions agreeing to significant further wage moderation and (2) some fiscal incentives in the form of immediate cuts in social security contributions offset by indirect revenue increases in the medium term. A significant increase in employment and reduction in inflation will be critical so that household purchasing power in the aggregate does not suffer. The challenges for all involved are enormous, and it will be crucial to avoid that the approach is watered down or needed structural reforms delayed.6
Dass der IWF eine Verpflichtung der Unternehmen verlangt, um die fallende Kaufkraft der privaten Haushalte zu verhindern, ist die Bankrotterklärung der herrschenden Lehre. Wer soll in einer Marktwirtschaft die Unternehmen dazu zwingen, je nach Lohnsenkung so viele Neueinstellungen vorzunehmen, dass die Lohnsumme in jedem Unternehmen unverändert bleibt? Das ist absurd.
Mit der Entscheidung des Europäischen Rates und der Troika, im Zuge »struktureller Reformen« von den Krisenländern Lohnsenkungen zu verlangen, damit sie ihre Wettbewerbsfähigkeit wiedergewinnen, haben die entscheidenden Institutionen die Weichen auf Arbeitsplatzvernichtung gestellt. In Spanien gab es nach einem ersten Schub an Arbeitslosigkeit im Gefolge der Rezession von 2008/2009 und dem Beginn der restriktiven Finanzpolitik einen zweiten Schub von etwa 18 auf 26 Prozent bei der Arbeitslosenquote (Abbildung 1.14), der genau mit dem Lohnkürzungsprogramm zusammenfällt.
Es ist offensichtlich, dass der außenwirtschaftlich motivierte Kurs der Lohnsenkung (man wollte eine sogenannte interne Abwertung erreichen) in Ländern wie Spanien und Griechenland mit einem Anteil der Binnenwirtschaft am Bruttoinlandsprodukt in der Größenordnung von 75 Prozent zu einem Einbruch der Binnennachfrage führte, der potenzielle Erfolge bei der Verbesserung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit weit in den Schatten stellte.
Weil eine Lohnsenkung unmittelbar die Nachfrage der privaten Haushalte vermindert und damit die Auslastung der vorhandenen Kapazitäten der Unternehmen senkt, kommt der neoklassische Mechanismus, der auf eine Substitution von Kapital durch Arbeit (siehe Kapitel 4) wegen der Veränderung der Faktorpreisrelationen setzt, überhaupt nicht zum Zuge. Die von den Unternehmen gezahlten Löhne pro Beschäftigten sinken zwar, aber das wird nicht durch Mehreinstellungen, wie die Neoklassik verspricht, so kompensiert, dass die Lohnsumme wenigstens konstant bliebe. Vielmehr führt die fallende Binnennachfrage unmittelbar zu Entlassungen und steigender Arbeitslosigkeit.
Damit ist auch die Große Depression erklärt. Weil in ihrem Zuge die Machtverhältnisse am Arbeitsmarkt eine Lohnsenkung ermöglicht hatten, wurden Dauer und Tiefe der Krise massiv verstärkt. Offensichtlich wirken Lohnsenkungen nicht anders als Kürzungen der Ausgaben anderer Sektoren, wie denen des Staates, unmittelbar krisenverschärfend. Schon hiermit ist die neoklassische Theorie aus den Angeln gehoben. Wer die Wirkung einer Lohnsenkung nicht in Übereinstimmung mit der Empirie erklären kann, kann auch alles andere, was in der Gesamtwirtschaft tatsächlich stattfindet, nicht erklären.
1.2 Bretton Woods
Fast jeder Deutsche ist mit dem Wissen aufgewachsen, dass Deutschland in der Nachkriegszeit einem Mann namens Ludwig Erhard ein »Wirtschaftswunder« zu verdanken habe. Im Geschichtsunterricht wurde und wird bis heute vermittelt, dass es seine Politik war, die es ermöglicht hatte, dass sich die deutsche Wirtschaft rasch aus der Nachkriegsdepression befreien und durchstarten konnte. Die marktwirtschaftlichen Reformen Erhards, so die Überlieferung, hätten Deutschland auf die Schiene Richtung Wirtschaftswunder gesetzt.
Das ist eine schöne Legende. Wie alle Legenden ist sie aber der Unfähigkeit und der Unwilligkeit der Menschen geschuldet, eine komplexe Wirklichkeit wirklich verstehen zu wollen. Nichts von dem, was Deutschland vorweisen kann, war außergewöhnlich, wenn man Deutschland mit anderen Ländern unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg vergleicht.
Stellt man die Wachstumsraten Deutschlands denen ähnlich großer Länder gegenüber, also Frankreichs, Italiens, Großbritanniens, aber auch Japans in den ersten zwanzig Jahren nach dem Krieg, bleibt zwar etwas, das man durchaus als Wirtschaftswunder bezeichnen kann. Die Hypothese von einer besonderen deutschen Leistung durch besondere deutsche Politik initiiert von besonderen deutschen Politikern fällt dabei jedoch wie ein Kartenhaus in sich zusammen. In den Überblicken 1 bis 3 sind die im Folgenden diskutierten Größen Wachstum, Arbeitslosigkeit und Inflation, also die drei grundlegenden Indikatoren einer Volkswirtschaft, in sechs Industrieländern jeweils für die Zeitabschnitte von 1950 bis 1970, von 1970 bis 1990 und von 1990 bis 2023 dargestellt. Der Vergleich der drei Perioden zeigt für jede der Kennzahlen eine deutliche Veränderung, von der die gezeigten Länder mehr oder weniger ähnlich betroffen sind.
Im Vergleich zu den meisten europäischen Ländern war Deutschland beim Wachstum nur ein paar Jahre lang herausragend. Schon 1958 holte Italien, das auch zu Beginn der 1950er-Jahre kräftig gewachsen war, Deutschland ein und verzeichnete in den Folgejahren durchweg bessere Ergebnisse als das »Wirtschaftswunderland«. Dass es trotzdem Ende der 1960er-Jahre einen Zustrom von Arbeitnehmern von Italien nach Deutschland gab, lag vor allem an dem damals sehr unterschiedlichen Lohnniveau und den regionalen Problemen. Frankreich war in den 1950er-Jahren weniger kräftig gestartet, wuchs aber ab den frühen 1960er-Jahren stabiler und schneller als der vom Krieg weit stärker zerstörte Nachbar Deutschland.
Noch weniger beeindruckend ist das deutsche Wirtschaftswunder, wenn man es mit dem Aufholprozess des anderen großen Verlierers des Zweiten Weltkriegs, mit dem Japans, vergleicht. Japan wuchs nicht nur in den 1950er-Jahren annähernd so stark wie die Bundesrepublik, sondern ließ die deutsche Aufholjagd in den 1960er-Jahren wie einen Spaziergang aussehen. Damit überbot die damals größte asiatische Volkswirtschaft bei weitem die Leistung aller europäischen Wettbewerber und schickte sich an, rasch zur zweitgrößten der Erde aufzusteigen.
Für die USA lassen sich die Überbewertung des US-Dollars und die technologische Spitzenposition anführen, um das relativ schwache Wachstum zu erklären. Wer Technologie nicht kopieren kann, sondern selbst neu erfinden muss, fällt leicht zurück gegenüber denjenigen, die Spitzentechnologien einfach kopieren. Weit erstaunlicher ist die Schwäche Großbritanniens. Bis zum Ende des vergangenen Jahrhunderts, genau bis zu den einschneidenden Reformen der »Eisernen Lady« Margaret Thatcher in den 1980er-Jahren, war das Land der »Modellfall« für gescheiterte Versuche, Staatswirtschaft und Gewerkschaftsmacht mit Marktwirtschaft in Einklang zu bringen.
Betrachtet man die durchschnittlichen Raten (Überblick 1), war Japan in den ersten zwanzig Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg absolut führend. Mit einer durchschnittlichen Wachstumsrate von über 8 Prozent in der ersten Periode und sogar mehr als 10 Prozent in den 1960er-Jahren stellte es alle anderen weit in den Schatten. Deutschland lag in den 1950er-Jahren mit Japan gleichauf, schaffte im darauffolgenden Jahrzehnt aber »nur« noch 4,5 Prozent. Frankreich und Italien waren in dieser zweiten Dekade mit knapp 6 und leicht über 6 Prozent deutlich dynamischer als Deutschland. Die USA erreichten in den 1960er-Jahren immerhin etwas mehr als 4 Prozent pro Jahr, während Großbritannien ab Mitte der 1950er-Jahre ein durchschnittliches Wachstum von etwas über 3 Prozent aufwies. Die Dynamik der britischen Wirtschaft reichte in der gesamten Zeit des Aufholens unter den Bedingungen des herrschenden weltweiten Währungssystems von Bretton Woods, also von 1950 bis 1972, niemals an die der anderen großen Volkswirtschaften, die der übrigen Sieger und die der Verlierer gleichermaßen, heran; folglich erwarb Großbritannien den Titel des »kranken Mannes in Europa«.
Die durchweg gute wirtschaftliche Entwicklung war von niedriger Arbeitslosigkeit begleitet (Überblick 2). Nur in den USA lag die Quote zu Ende der 1950er-Jahre mit mehr als 6 Prozent eindeutig über den Werten (in der Größenordnung) von 4 Prozent, die dort als Vollbeschäftigung bezeichnet werden können. Auch in diesem Fall kam es erst in den 1970er-Jahren zu einer Besserung. Während Japan praktisch keine Arbeitslosigkeit kannte, waren die 1950er-Jahre in Großbritannien mit einer Quote von 2 Prozent ebenfalls von Vollbeschäftigung gekennzeichnet. Dort gab es jedoch einen deutlichen Anstieg in den 1960er-Jahren.
Auch auf dem europäischen Kontinent ist Arbeitslosigkeit in diesen beiden Jahrzehnten kein wirtschaftspolitisches Problem. Deutschland startete zwar mit einer Rate von über 10 Prozent im Jahr 1950, aber die boomende Wirtschaft brachte einen raschen Abbau der Zahl der Arbeitslosen mit sich, so dass schon 1960 mit einer Quote von unter einem Prozent Vollbeschäftigung herrschte. Frankreich bewegte sich um die 2 Prozent, nur Italien verzeichnete etwas höhere Raten, was seinem starken Nord-Süd-Gefälle geschuldet war.
Inflation war während des Systems von Bretton Woods nahezu kein Thema (Überblick 3). Wie die Abbildung zeigt, kam es, abgesehen von einigen Spitzen – wie in Frankreich mit einer Währungsumstellung und Abwertung im Jahr 1958 – nirgendwo zu größeren Ausreißern. Die Zahlen liegen fast überall unter oder maximal bei 5 Prozent. Das scheint aus heutiger Sicht ein recht hoher Wert, ist aber, wenn es keine Tendenz zu einer Beschleunigung gibt, vollkommen unproblematisch. Gleichwohl kam in Deutschland, wo die Inflationsrate stabil und deutlich unter 5 Prozent lag, immer wieder ein Geraune um eine »schleichende Inflation« hoch, mit dem orthodoxe deutsche Ökonomen wie Herbert Giersch (später Präsident der Instituts für Weltwirtschaft in Kiel) das System von Bretton Woods kritisierten und in Frage stellten.
Man muss anfügen, dass für die meisten aufholenden Länder die globalen gesamtwirtschaftlichen Bedingungen in den ersten beiden Jahrzehnten nach dem Krieg ideal waren. Das in Bretton Woods entstandene neue Welt-Währungs- und Handelssystem schuf sowohl hervorragende währungs- als auch handelspolitische Bedingungen, um aus einer Position der Schwäche heraus gegenüber der dominanten Macht USA aufholen zu können, weil es die amerikanische Volkswirtschaft und die amerikanische Wirtschaftspolitik zu dominanten Größen für fast alle Länder der westlichen Welt machte.
Der US-Dollar war zur Leitwährung erkoren worden, und das führte dazu, dass die amerikanische Zentralbank (das Federal Reserve System, auch Fed) für zwanzig Jahre im Alleingang die Geldpolitik und damit die globalen Investitionsbedingungen festlegte. Das war der entscheidende Punkt: Weil die amerikanische Wirtschaft all die Sonderfaktoren nicht aufwies, von denen die anderen profitieren konnten, musste die Geldpolitik dort für eine massive Anregung sorgen. Folglich war das globale Zinsniveau (wie in Abschnitt 1.13 in aller Ausführlichkeit gezeigt wird) extrem niedrig und damit der globalen Investitionstätigkeit äußerst zuträglich.
Weil zudem die Währungsrelationen mit so wichtigen Ländern wie Deutschland und Japan gegenüber dem US-Dollar fixiert wurden und die Währungen dieser Länder über viele Jahre unterbewertet waren, also unter dem Wert lagen, der die Wettbewerbsfähigkeit der Volkswirtschaften angemessen widergespiegelt hätte, konnten auch die Verlierer des Krieges den großen amerikanischen Absatzmarkt erobern und ihre Position als Global Player aufbauen.
Das heißt, es war nicht in erster Linie die Rückkehr Deutschlands zu marktwirtschaftlichen Verhältnissen nach dem Krieg, die das Wirtschaftswunder auch nur in Ansätzen erklären könnte, sondern ein globaler Aufbruch, der durch extrem expansive amerikanische Geldpolitik und fixe Wechselkurse besonders gute monetäre Bedingungen erzeugte. Dass die direkten Hilfen aus den USA, wie der viel gerühmte Marshall-Plan ebenfalls eine Rolle beim Wiederaufbau der Bundesrepublik spielten, muss man nicht bestreiten, wenngleich ihre quantitative Bedeutung wahrscheinlich weit überschätzt wird.
Die Einführung des Systems von Bretton Woods fiel nicht nur zeitlich zusammen mit der Revolution im ökonomischen Denken, die John Maynard Keynes angestoßen hatte, sondern es war Keynes selbst, der Bretton Woods entscheidend prägte. Deutschland war bei der Konferenz gar nicht vertreten und den deutschsprachigen Ökonomen fehlte der Zugang zu den großen Kontroversen, die sich aus der Großen Depression ergeben hatten. In der Tat war die keynesianische Revolution nicht nur wegen Keynes selbst in hohem Maße eine angelsächsische Revolution.
Die intellektuellen Kontroversen um die Erklärung der Großen Depression der 1930er-Jahre fanden wegen des Dritten Reiches und des Zweiten Weltkriegs im deutschsprachigen Raum nicht statt. In den angelsächsischen Ländern dagegen prägte diese Frage – wie nie eine andere Frage zuvor und danach – zwei Jahrzehnte lang die ökonomische Auseinandersetzung. Dort war das Paradigma des jederzeit funktionierenden Marktsystems derart erschüttert, dass niemand Ökonomik betreiben konnte, ohne sich mit der potenziellen Instabilität des Marktsystems auseinanderzusetzen. In Deutschland und Österreich fielen diese zwei Jahrzehnte kritischer ökonomischer Forschung aus.
Hierzulande war man in den 1950er-Jahren zufrieden damit, dass es nach dem großen Zusammenbruch aufwärts ging. Schon zu Beginn der Dekade, als man weder Bretton Woods noch den Keynesianismus in Deutschland wirklich aufgegriffen oder verstanden hatte, stimmte man in den herrschenden ökonomischen Kreisen überein, dass Keynes’ Theorie nur eine Krisenlehre war, die für den Nicht-Krisen-Alltag nicht taugte.
Es ist bemerkenswert, dass schon in Zins, Kredit und Produktion, dem 1952 posthum erschienenen einzigen Buch des deutschen Ökonomen Wilhelm Lautenbach, der vier Jahre zuvor verstorben war und manchmal als »der deutsche Keynes« bezeichnet wird, die Ablenkungsmanöver seiner Kollegen in vollem Gange waren. Wilhelm Röpke, einer der immer noch als bedeutend angesehenen Ordoliberalen, schrieb im Vorwort zu dem Buch, er hätte gerne gewusst, ob Lautenbach (den er offensichtlich persönlich kannte) sich der »außerordentlichen Bedingtheit« der keynesianischen Lehre, ihrer »engen Grenzen« und »der schweren Gefahren ihres Missbrauchs« bewusst gewesen sei. Schließlich habe sich die »einzigartige Situation der Großen Depression, von der Lautenbach und Keynes ausgegangen waren, völlig umgekehrt […]«.7
Die Theorie von Keynes und Lautenbach ist jedoch, wie in Kapitel 2 in aller Ausführlichkeit zu zeigen sein wird, in keiner Weise »außerordentlich bedingt«. Ihre in vieler Hinsicht unbestreitbaren Erkenntnisse sind allerdings bis heute nicht in die herrschende liberal-neoklassische Ökonomik vorgedrungen. Genau deswegen hat man die Dynamik einer Marktwirtschaft nicht im Ansatz verstanden.
Aus der Vorkriegsgeschichte war für Deutschland scheinbar nur die große Inflation ab Beginn der 1920er-Jahre interessant. Aus dem Ende der Großen Depression zur Mitte der 1930er-Jahre wollte aus verständlichen Gründen einfach niemand eine Heldengeschichte im Sinne eines »New Deal« wie in den USA basteln. Der Fokus auf Inflation war auch deswegen gut geeignet, weil es nach dem Zweiten Weltkrieg ebenfalls ein kurzes Aufflackern der Inflation gegeben hatte, das aber (als Heldengeschichte) von Ludwig Erhard mit den Mitteln der Marktwirtschaft und tapferen Notenbankern rasch ausgetreten worden war.
Auch das von Keynes aufgebrachte Transferproblem, um nur ein weiteres wichtiges Beispiel zu nennen, das für Deutschland eigentlich überragende Bedeutung hatte, weil es im Gefolge der Reparationszahlungen des Ersten Weltkriegs entstanden war, ist hierzulande praktisch nicht rezipiert worden.8 Genau dieses Problem hat allerdings sowohl während der Wiedervereinigung als auch in der Krise der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion (EWU) eine große Rolle gespielt.9 Die Tatsache, dass die große Mehrheit der deutschen Ökonomen damit nichts anfangen kann, war für Europa und insbesondere für die EWU mit enormen Kosten verbunden.
Box 1: Keynes und Bretton Woods
Als sich der britische Ökonom John Maynard Keynes zu Beginn der 1940er-Jahre des vergangenen Jahrhunderts auf den Weg nach New Hampshire in den USA machte, um an der Konferenz der Vereinten Nationen teilzunehmen, die so entscheidend für das Schicksal der gesamten Menschheit werden sollte, hatte er eine Reihe von Erkenntnissen zur Hand, die ihn von fast allen seinen Kollegen unterschied. Er wusste z. B. mit Sicherheit, dass es einen sinnvollen und für alle Völker nutzbringenden Handel nur geben kann, wenn es gelingt, der Weltwirtschaft ein monetäres System zur Seite zu stellen, das zu einem Ausgleich der Wettbewerbsunterschiede, der absoluten Vor- und Nachteile, die durch unterschiedliche Inflationsraten ausgelöst werden, führt. Keynes sagte dazu im britischen Oberhaus im Mai 1944 im Zuge der schon laufenden Bretton-Woods-Verhandlungen:
To begin with, there is a logical reason for dealing with the monetary proposals first. It is extraordinarily difficult to frame any proposals about tariffs if countries are free to alter the value of their currencies without agreement and at short notice. Tariffs and currency depreciations are in many cases alternatives. Without currency agreements you have no firm ground on which to discuss tariffs. In the same way plans for diminishing the fluctuation of international prices have no domestic meaning to the countries concerned until we have some firm ground in the value of money. Therefore, whilst the other schemes are not essential as prior proposals to the monetary scheme, it may well be argued, I think, that a monetary scheme gives a firm foundation on which the others can be built. It is very difficult while you have monetary chaos to have order of any kind in other directions.10
Keynes wusste einerseits, dass man dem Markt die Festlegung der Währungsrelationen auf keinen Fall überlassen darf, andererseits aber – wegen der einschlägigen Erfahrungen mit dem Goldstandard –, dass ein System fester Wechselkurse oder einer Weltwährung ebenfalls nicht geeignet sind, weil man nicht erwarten kann, dass sich alle Länder an die einmal gegebenen Versprechen halten. International kann die Einhaltung von Regeln nicht eingeklagt und auch politisch nicht durchgesetzt werden. Keynes wusste auch, dass Länder dazu neigen, sich wie Unternehmen zu verhalten und sich auf merkantilistische Weise durch Lohnsenkung Vorteile zu verschaffen, obwohl das im globalen Kontext sinnlos ist.
Für Keynes war es offensichtlich, dass nur ein Währungssystem, das flexibel genug ist, um große Ungleichgewichte im Handel der Nationen zu verhindern, und gleichzeitig fix genug, um die Spekulation auszuschalten und den Ländern sowie den Unternehmen Planungssicherheit hinsichtlich des Geldwertes zu geben, den oben genannten Ansprüchen genügen würde. Feste, aber anpassungsfähige Wechselkurse mussten das Ziel sein und genau dieses Ziel wurde in Bretton Woods erreicht.
Keynes ahnte vermutlich auch, dass ein solches Währungssystem der fatalen Neigung vieler Nationen, Krisen und steigender Arbeitslosigkeit mit Lohnsenkungen zu begegnen, einen Riegel vorschieben kann, weil deren Hoffnung, auf diesem Wege den Handelspartnern Marktanteile und Arbeitsplätze abzujagen, wenigstens auf längere Sicht nicht von Erfolg gekrönt sein wird. Das ist, wie wir in Kapitel 7 zeigen werden, von allergrößter Bedeutung.
1.3 Angebotsschocks und die neoklassische Konterrevolution
Das Ende des Währungssystems von Bretton Woods Anfang der 1970er-Jahre wurde überlagert von den Folgen des ersten Ölpreisschocks. Zur Mitte der Dekade stiegen sowohl die Arbeitslosenquoten als auch die Inflationsraten in der gesamten industrialisierten Welt. Diese Kombination von hoher Inflation und gleichzeitig steigender Arbeitslosigkeit stellte die Wirtschaftspolitik vor eine schier unlösbare Aufgabe. Eine einfache Anregung der Wirtschaft durch mehr staatliche Ausgaben erwies sich in dieser Konstellation als schwierig, weil die Gefahr bestand, damit die Inflation noch weiter anzufachen. Die alte Vermutung der Neoliberalen und Neoklassiker, der Staat sei mit der Aufgabe der gesamtwirtschaftlichen Steuerung systematisch überfordert, erhielt in ungeahntem Maße neue Nahrung.
Im Durchschnitt der 1970er-Jahre sind noch nicht die großen Umbrüche zu erkennen, die in diesem Jahrzehnt anstanden. Japan wuchs durchweg kräftig und auch die USA erreichten im Durchschnitt 3 Prozent (Überblick 1), ungeachtet der großen Einbrüche im Zusammenhang mit den beiden Ölpreisexplosionen. In Europa zeigten sich Frankreich und Italien relativ erfolgreich in Sachen Wachstum, obwohl sie von den inflationären Folgen der Ölpreisschocks viel stärker als Deutschland betroffen waren.
Arbeitslosigkeit wurde zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg zu einem großen Thema (Überblick 2). Während man durch die 1970er-Jahre noch mit einem blauen Auge gekommen war, erreichte nach der zweiten Rezession im Gefolge eines Ölpreisschocks, eklatanter Inflationsgefahren und extrem restriktiver Geldpolitik die Arbeitslosenrate in den USA über 9 Prozent und in Großbritannien nahezu 12 Prozent. Auch in Deutschland und Frankreich ging es in den 1980er-Jahren mit der Arbeitslosigkeit stetig nach oben; zu Ende dieses Jahrzehnts schrammte Italien sogar an der Zehn-Prozent-Linie entlang.
Die Entwicklung der Verbraucherpreise zeigt, dass nun völlig neue Bedingungen für die Wirtschaftspolitik herrschten (Überblick 3). Selbst in Japan stieg die Inflationsrate kurzzeitig auf über 20 Prozent an und in Großbritannien erreichte sie fast 25 Prozent. In den USA löste eine Rate von deutlich mehr als 10 Prozent den schärfsten geldpolitischen Kurs aller großen Industrieländer aus, der unter dem Namen des damaligen Vorsitzenden der Fed, Paul Volcker, berühmt wurde. Innerhalb der Europäischen Union reagierte auch die Deutsche Bundesbank mit großer Härte, obwohl die deutsche Inflation im Vergleich zu der der anderen Länder mit einem Höchstwert von 7 Prozent durchaus moderat war. Italien lag nahe bei 20 Prozent und sogar leicht darüber; Frankreich gelang es immerhin, unter 15 Prozent zu bleiben.
Der erste Ölpreisschock im Jahr 1973 und der zweite im Jahr 1979 markierten den Anfang vom Ende des Keynesianismus in der Wissenschaft wie in der Politik. Hatte man sich bis dahin vor allem mit Nachfrageproblemen beschäftigt, tauchte mit dem plötzlichen starken Anstieg der Ölpreise die Frage auf, wie das marktwirtschaftliche System auf eine schockartige Veränderung reagiert, die von der Angebotsseite kommt. Eine derart massive und ruckartige Verteuerung der Vorleistungen hatte es in der bisherigen Geschichte der modernen Industriegesellschaften noch nicht gegeben. Zwar waren immer wieder einmal Missernten aufgetreten, hier aber ging es um einen globalen Effekt bei dem Grundstoff, an den sich die Welt wie an keinen zweiten als Schmiermittel des Wachstums gewöhnt hatte.
Bisher hatten sich die Auseinandersetzungen der Ökonomen vor allem um die Phillips-Kurve (siehe Box 6) gedreht, also um die Frage, in welcher Beziehung die beiden Ziele der Preisstabilität und der Vollbeschäftigung zueinanderstehen. Musste die Wirtschaftspolitik, so der Kern des Streits, immer wieder den richtigen Punkt wählen zwischen einem hohen Beschäftigungsstand und einer Beschleunigung der Inflation oder konnte man das System so stabilisieren, dass es in der Lage war, beide Ziele gleichzeitig in befriedigender Weise zu erreichen?
Nun aber drohte parallel zu einer Inflationsbeschleunigung eine rezessive Wirtschaftsentwicklung und steigende Arbeitslosigkeit, die sogenannte Stagflation (also Inflation bei Stagnation). Das warf alle Modelle, die man kannte, über den Haufen. Dieses Phänomen stieß die Tür auf für eine sehr alte Theorie, die darauf beharrt, Inflation sei immer ein rein monetäres Phänomen, das den Einsatz der Geldpolitik erfordere, bei Inflation also in restriktiver Richtung. Der Monetarismus, wie jene Theorie seit den 1930er-Jahren genannt wurde, sollte nach 1970 zur dominierenden Lehre der nächsten dreißig Jahre in Europa und in vielen Ländern der Welt werden.
Paradox ist, dass die Preissteigerungen, die im Zusammenhang mit den Ölpreisschocks auftraten, offensichtlich kein rein monetäres Phänomen waren. Die Schocks selbst bestanden in den abrupt steigenden Preisen für Öl. Doch was sich daraufhin bei den restlichen Preisen, namentlich denen für den Faktor Arbeit, den Löhnen also, abspielte und als »Inflation« diagnostiziert wurde, hatte weitgehende Folgen für die Realwirtschaft. Die harsche Politik, mit der die Zentralbanken auf die Preisveränderungen reagierten, führte zum ersten Mal seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs zu einem erheblichen Ausmaß an Arbeitslosigkeit. Dieses sollte viele Jahre prägend für die Wirtschaftspolitik bleiben, vor allem in Europa.
Wenn der Preis eines importierten Vorprodukts stark steigt, verschlechtern sich die Terms of Trade (grob das Verhältnis der Export- zu den Importpreisen, siehe Abschnitt 3.3.2) – verschlechtern in dem Sinne, dass das exportierende Land relativ weniger Einnahmen pro exportierter Gütereinheit im Vergleich zu den Ausgaben für eine importierte Gütereinheit erhält als zuvor. Das bringt ceteris paribus einen Realeinkommensverlust für die gesamte Volkswirtschaft mit sich. Denn die Preissteigerung beim Vorprodukt wird von den Unternehmen im Regelfall weitergegeben (überwälzt), jedenfalls dann, wenn sich das importierte Vorprodukt nicht oder nur in geringem Umfang durch im Inland produzierte Güter ersetzen lässt. Das ist regelmäßig bei Rohstoffen der Fall, die ungleich auf dem Globus verteilt sind. Marktmechanismen in Verbindung mit technischem Fortschritt, die es ermöglichen, verteuerte Importgüter zu ersetzen, wirken tendenziell mittel- bis langfristig. Kurzfristig ist daher ein Realeinkommensverlust unvermeidlich. Wie schnell sich die Preissteigerung beim Vorprodukt bis zu den Endprodukten durcharbeitet, hängt von der Intensität des Wettbewerbs zwischen den Unternehmen ab: Je härter die Konkurrenz, desto schneller kommt es zu Preissteigerungen. Das liegt daran, dass in einem starken Wettbewerbsumfeld alle Anbieter ihre Preise von vornherein knapp kalkulieren müssen, also wenig Spielraum beim Stückgewinn besteht, um die Kostensteigerung abzufangen und nicht auf den Stückpreis durchschlagen zu lassen. Da Erdöl damals wie heute ein extrem wichtiges Vorprodukt für viele Bereiche der Wirtschaft ist, waren die Endproduktpreise auf breiter Front von den Ölpreisschocks betroffen. Die Preissteigerungsrate stieg allenthalben an.
Machen die Endproduktpreise einen Sprung nach oben, während sich an der realen Produktion nichts weiter ändert, nimmt offensichtlich das Realeinkommen der Masse der Bevölkerung ab. Die Volkswirtschaft muss wohl oder übel einen Teil ihrer realen Wirtschaftsleistung an die Länder abtreten, denen es gelungen ist, sich zu einem Ölkartell zusammenzuschließen, das Angebot an Öl kurzzeitig einzuschränken und – zusammen mit spekulativen Kräften – den Preis nach oben zu treiben. Zumindest kurzfristig können sich die Kunden dieser »zwangsweisen« Umverteilung zugunsten der Produzenten kaum entziehen, solange Öl absolut notwendig für die Aufrechterhaltung der normalen Lebens- und Produktionsweise ist.11
Wenn die Nachfrage der Konsumenten nach den speziell teurer werdenden Gütern wenig elastisch auf die gestiegenen Preise reagiert (bei einer Preissteigerung von 10 Prozent sinkt z. B. die nachgefragte Menge nur um 5 Prozent oder geht überhaupt nicht zurück), ist der negative Einkommenseffekt der spezifischen Preissteigerung größer als bei einer elastischen Reaktion. Die Ölrechnung, die man zu zahlen hat, wird bei steigenden Preisen umso höher, je weniger man (kurzfristig) in der Lage ist, Öl einzusparen, etwa weil man nicht rasch auf eine andere Heizungsmethode oder vom Ölpreis unabhängige Mobilitätslösung umstellen kann. Entsprechend weniger bleibt dann vom Gesamteinkommen für die Nachfrage nach anderen Gütern übrig.
Die Konsumenten in den Industrieländern zahlten also für etwa die gleiche Menge Öl jetzt deutlich mehr als zuvor. Folglich musste man damit rechnen, dass die dortigen Verbraucher weniger für andere (auch für im Inland produzierte) Güter, die normalerweise auf ihrer Einkaufsliste standen, ausgeben würden. Das ist – für sich genommen – ein negativer Nachfrageeffekt, der unmittelbar von dem Angebotsschock ausgelöst wird.
Bei einer globalen Analyse der Auswirkungen des Preisschocks muss man allerdings gegenrechnen, dass die Produzenten von Öl nun genau die gleiche Menge an Mehreinnahmen verzeichneten, die den Verbrauchern in den konsumierenden Ländern fehlten. Der Ölpreisanstieg war schließlich nichts anderes als eine globale Umverteilung von den Konsumenten zu den Produzenten von Öl.
Hätten die Ölproduzenten (durch Zufall) die gleichen Wünsche wie die Konsumenten in den Industrieländern gehabt und dort genau die gleichen Güter gekauft, die von den Konsumenten aufgrund des gesunkenen Realeinkommens nicht mehr nachgefragt werden konnten, wäre weder bei der Produktion von Gütern und Dienstleistungen noch bei den Arbeitsplätzen in den Industrieländern irgendetwas passiert; die Ölproduzenten wären nur reicher an Gütern geworden, die anderen ärmer als zuvor. Hätten sie dagegen ihre Zusatzeinnahmen in gleicher Höhe ausgegeben, allerdings für andere Produkte und in anderen Ländern, wäre es für die Welt insgesamt zu einem gravierenden Strukturwandel gekommen, aber nicht zu gewaltigen negativen makroökonomischen Effekten, wie sie tatsächlich beobachtet wurden.
Das klingt alles ziemlich undramatisch und genau das ist es auch. Dramatisch wurden die Auswirkungen der Ölpreisschocks nur infolge vielfältiger Fehleinschätzungen der Masse der – ebenso neoliberalen wie keynesianisch inspirierten – Ökonomen. Zunächst wurde im Lichte der neoklassischen Produktionstheorie mit gewaltigen Verzerrungen der Produktion gerechnet, weil eine wichtige Vorleistung, die man nicht schnell ersetzen konnte, nun plötzlich in geringeren Mengen zur Verfügung stand und wesentlich mehr kostete. Von Rationierungsszenarien war die Rede. Doch es gab keine wirkliche dramatische physische Knappheit von Öl, der Rohstoff war nur teurer als zuvor, und die Firmen, die Öl verbrauchten, wälzten das in den Preisen weiter.
Angesichts zunehmender Leistungsbilanzüberschüsse der Ölproduzenten zog allerdings zunehmend die Gefahr eines globalen Nachfrageausfalls herauf. Die Überschüsse zeigten schließlich, dass das oben genannte Strukturwandel-Szenario nicht eintrat, weil die Ölproduzenten wesentlich weniger Güter unmittelbar nachfragten, als es die westlichen Konsumenten getan hatten. Die vom Angebotsschock Begünstigten sparten im Verhältnis mehr. Neoklassiker hätten folglich darauf setzen müssen, dass die Zinsen weltweit sinken, weil – in ihrer Sichtweise – mehr Kapital zur Verfügung stand. Sinkende Zinsen hätten dann wiederum die Unternehmen dazu anregen können, mehr zu investieren, so dass ein staatliches Eingreifen nicht nötig gewesen wäre.
Viele Keynesianer forderten angesichts des globalen Nachfrageausfalls, mit expansiver Fiskalpolitik, also mit höheren staatlichen Defiziten, einen Anstieg der Arbeitslosigkeit zu verhindern. Man übersah allerdings, dass sich die geldpolitischen Rahmenbedingungen grundlegend geändert hatten. Die weitgehend unabhängig agierenden Notenbanken waren nicht ohne Weiteres bereit, die aus ihrer Sicht unabdingbare Inflationsbekämpfung für den Fall einer expansiven Fiskalpolitik zurückzustellen. Sie befürchteten eine durch die Preissteigerung bei dem wichtigen Importgut Öl induzierte Inflationsbeschleunigung in den Konsumentenländern. Die war keineswegs selbstverständlich, weil eine einmalige Erhöhung des Ölpreises, wie sie damals stattgefunden hatte, für sich genommen auch nur einen einmaligen Niveaueffekt auf die Preise auslöst. Die Inflationsrate steigt danach keineswegs automatisch, wenn nicht weitere Faktoren hinzutreten (siehe Kapitel 5).
An der Inflationsfront bestand also eigentlich kein Grund zur Panik. Dann aber traten nach dem ersten Ölpreisschock im Herbst 1973 im Jahr 1974 weltweit die Gewerkschaften auf den Plan (man muss sehr genau zwischen dem ersten und dem zweiten Ölpreisschock unterscheiden; hier geht es zunächst um den ersten). Die Gewerkschaften hatten bereits zu Beginn der 1970er-Jahre fast überall steigende Lohnquoten durchgesetzt, und die Unternehmen versuchten, die höheren Löhne auf die Preise abzuwälzen. Eine latente Inflationsgefahr war folglich schon gegeben, bevor die Ölpreise stiegen.
Hinzu kam, dass es in vielen Ländern eine automatische Anpassung der Nominallöhne an die tatsächliche Inflationsrate gab: Stieg die Inflationsrate, stieg automatisch, ohne weitere Verhandlungen, der Nominallohn. Die Indexierung der Löhne an die Inflation war üblicherweise rückwärtsgewandt (sogenannte backward looking indexation), was heißt, dass die Inflationsrate der Vorperiode zum Maßstab der Nominallohnerhöhung in der Gegenwart gemacht wurde.
Das ist bei einem negativen Angebotsschock problematisch, weil damit aus einer einmaligen Preiserhöhung (wie dem Ölpreisschock) eine dauerhafte Erhöhung der Inflationsrate wird. Letzteres bedeutet aber keineswegs automatisch eine längerfristige, sondern lediglich eine kurzzeitige Inflationsbeschleunigung. Denn die Lohnpolitik schließt bei der rückwärtsgewandten Indexierung nach einem Preisschock wie beim Öl zwar höher ab (z. B. bei 7 Prozent statt wie zuvor bei 4 Prozent), bleibt aber dann bei der höheren Rate und steigert sie nicht weiter automatisch. Diese Lohnregel bringt also die Inflationsrate auf ein höheres Niveau (7 Prozent minus die durchschnittliche Produktivitätsentwicklung anstelle der 4 Prozent abzüglich Produktivitätsentwicklung). Dieses neue Niveau bleibt dann aber konstant.