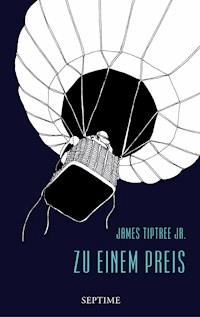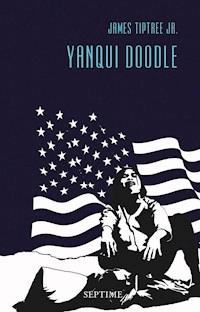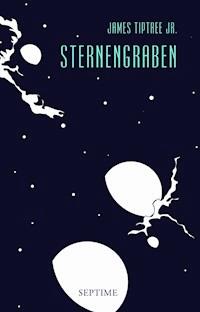19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Septime Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Mauern der Welt hoch ist der erste von zwei aus James Tiptree Jrs. Feder stammenden Romanen. Während auf der Erde Dr. Daniel Dan ein lang geplantes Experiment zu Telepathie medizinisch betreut und dabei gegen seine eigenen Abgründe kämpft, kehrt Tivonel, ein rochenartiges Wesen, in ihre Heimat Tyree zurück. Dort erfährt sie schon bald, dass ihre Welt bedroht wird von einem alles vernichtenden riesigen Zerstörer, der ziellos durchs All treibt und eine Galaxie nach der anderen verschlingt. Doch Rettung scheint in Sicht, als einige Bewohner von Tyree mittels Teleportation auf die Gruppe um Dr. Dan stoßen. Gegen den Willen und den Ethos der Altvorderen begehen sie Lebensraub, indem sie die Körper der irdischen Telepathen infiltrieren und deren Bewusstsein nach Tyree transferieren. Menschen und Tyrenner lernen einander kennen und kämpfen nun gemeinsam gegen den großen Zerstörer. Allerdings ist seine Bedrohlichkeit von einer unermesslichen Einsamkeit durchdrungen, und es fällt schwer, in ihm nur das Böse zu sehen. So wie sich die unterschiedlichsten Wesen mehr und mehr durchdringen, so durchdringen sich auch Gut und Böse.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 705
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Cover
Impressum
Autorin und Klappentext
Titelseite
Buchanfang
Die Werkausgabe
Leseproben
Band 1: DOKTOR AIN
Band 2: LIEBE IST DER PLAN
Band 3: HOUSTON, HOUSTON!
Band 4: ZU EINEM PREIS
Band 5: QUINTANA ROO
Band 6: STERNENGRABEN
Band 7: YANQUI DOODLE
Helligkeit fällt vom Himmel
Originaltitel: James Tiptree Jr. – Up the Walls of the World
Copyright © 1978 by James Tiptree, Jr.
James Tiptree Jr. – Die Mauern der Welt hoch
Copyright © 2016, Septime Verlag, Wien
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Bastian Schneider
Umschlag: Jürgen Schütz
EPUB-Konvertierung: Esther Unterhofer
ISBN: 978-3-903061-45-3
Printversion: Hardcover, Schutzumschlag, Lesebändchen
ISBN: 978-3-902711-46-5
www.septime-verlag.at
www.facebook.com/septimeverlag
www.twitter.com/septimeverlag
www.facebook.com/james.tiptree.jr
Über die Autorin
James Tiptree Jr.
(1915-1987) ist das männliche Pseudonym von Alice B. Sheldon. Tiptrees geheimnisvolle Identität faszinierte die Fans und gab Anlass zu vielen Spekulationen, freilich glaubten alle, es müsse sich um einen Mann handeln. Die Aufdeckung, noch zu ihren Lebzeiten, war ein Schlag: Diese knappen, harten und frechen Kurzgeschichten, die nur allzu häufig mit dem Tod enden, waren von einer alten Dame mit weißen Federlöckchen verfasst worden.
Sie zählt unter Science-Fiction-Fans zu den großen Klassikern, gleich neben Philip K. Dick und Ursula K. Le Guin. Ihre Kurzgeschichten, die sie erst im Alter von einundfünfzig Jahren zu schreiben begann, und von denen einige wohl zu den besten des späten 20. Jahrhunderts gehören, brachten ihr schnell Ruhm und zahlreiche Auszeichnungen ein.
Dennoch litt sie ständig unter schweren Depressionen und Todessehnsucht. Nach einem vorab geschlossenen Selbstmordpakt erschießt Sheldon im Alter von einundsiebzig Jahren erst ihren vierundachtzigjährigen Mann und dann sich selbst.
James Tiptree Jr.
Die Mauern der Welt hoch
Roman
Aus dem Amerikanischen von Bella Wohl
Für H. D. S.
Für Träume, die niemals sterben
Kapitel 1
KALT, KALT UND ALLEIN DURCHSTREIFT DAS BÖSE WESEN DIE STERNENSTRÖME. ES IST UNERMESSLICH GROSS UND DUNKEL UND NAHEZU IMMATERIELL. SEINE MACHT ÜBERSTEIGT DIE ALLER ANDEREN FÜHLENDEN GESCHÖPFE. UND ES HAT SCHMERZEN.
DIE SCHMERZEN, GLAUBT ES, KOMMEN VON SEINEM VERBRECHEN.
SEIN VERBRECHEN IST NICHT MORD: TATSÄCHLICH MORDET ES VÖLLIG BEDENKENLOS. DIE SÜNDE, FÜR DIE ES SICH SCHÄMT UND DIE IN JEDER FASER SEINES GEWALTIGEN ORGANISMUS BRENNT, IST DIE ABKEHR VON DER AUFGABE SEINER RASSE.
KEINER SEINER ARTGENOSSEN HAT JE DERART FREVELHAFTES VERHALTEN AN DEN TAG GELEGT: DIE VERBINDUNG ABZUBRECHEN, SICH EINFACH TREIBEN ZU LASSEN UND EINEM UNBEKANNTEN DRANG ZU FOLGEN. SEIN RICHTIGER NAME ERKLINGT AUF DEN ZEITBÄNDERN, DOCH ES SELBST NENNT SICH NUR: DAS BÖSE.
VON DEN TRÜMMERN BEI DEN FEUERN IM ZENTRUM DES STERNENSCHWARMS HÖRT ES DIE STIMMEN SEINER RASSE, DIE ZWISCHEN DEN KLEINEN SONNEN WIDERHALLEN UND JEDES EINZELNE ZU DEN KONFIGURATIONEN DER MACHT RUFEN. VERTEIDIGT – ZERSTÖRT, ZERSTÖRT!
NUR ES ALLEIN WIRD NICHT, KANN NICHT GEHORCHEN.
EINSAM UND RIESENHAFT GLEITET ES ENTLANG DER STAUBIGEN AUSLÄUFER DAVON, EINE SCHMERZERFÜLLTE KREATUR AUF DEN WINDEN DES WELTALLS, KAUM DICHTER ALS EIN VAKUUM: GIGANTISCH, SCHWARZ, MÄCHTIG UND TÖDLICH.
Kapitel 2
Das Böse trifft Tivonel auf dem strahlenden Höhepunkt ihres Lebens. Doch anfangs merkt sie nichts von dem, was ihr bevorsteht.
Voller Eifer schwebt sie oberhalb der Hoch-Station und wartet auf den Gleiter, der von Tief heraufkommt. Ihre Hülle ist frisch gereinigt und leuchtet, zum ersten Mal seit einem Jahr hat sie wieder ordentlich gegessen. Der Morgen ist wunderschön. Unter ihr treiben drei Weibliche aus dem Stationsteam hinaus bis zum Rand des Aufwindes, der die Hoch-Station trägt, um Ausschau nach dem Gleiter zu halten. Das biolumineszente Geplapper ihrer Hüllen lässt fröhliche Orangetöne erklingen.
Tivonel räkelt sich genüsslich und kostet jeden Augenblick ihres Daseins aus. Ihr starker, anmutiger Astronautenkörper hält in dem heulenden, böigen Luftstrom, der ihr eher wie eine friedliche Wildwiese vorkommt, mühelos das Gleichgewicht. Sie befindet sich dreißig Meilen über der Oberfläche des Planeten Tyree, einer Welt, die noch kein Angehöriger ihrer Rasse je gesehen hat.
Um ihren leiblichen Körper wogt die Aura ihres Lebensenergiefeldes, unbefangen und strahlend vor Glück. Das letzte Jahr war fantastisch und ihr Einsatz in der Hohen Wildnis ein voller Erfolg. Jetzt ist es Zeit für die Belohnung, die sie sich selbst versprochen hat: Vor ihrer Rückkehr nach Tief wird sie Giadoc auf dem nahegelegenen Wachposten der Hohen Horcher besuchen.
Giadoc. Wie schön, wie außergewöhnlich er war! Wie wird er wohl jetzt sein? Denkt er noch manchmal an sie? Die Erinnerung an ihre Paarung lässt unwillkürlich eine sexuelle Verzerrung durch ihr Lebensfeld zucken. Oh nein! Hastig beherrscht sie sich. Hat jemand etwas mitbekommen? Sie sieht sich um, bemerkt jedoch keinen Schimmer von Gelächter.
Also wirklich, schimpft Tivonel sich aus, ich muss mir wieder Manieren beibringen, bevor ich mich unten in Tief unters Volk mische. Hier oben vernachlässigt man die Felddisziplin. Vater würde sich schämen, wenn er wüsste, dass ich Ahura kurz vergessen habe, die seelische Selbstbeherrschung.
In ihrem Überschwang vergisst sie sie dann schleunigst wieder.
Heute ist so ein herrlicher, unbeschwerter Morgen. Der untergehende Klang gleitet hinter die dichte obere Lufthülle von Tyree und verblasst zu einem violetten Raunen. Als es verebbt, tritt Stille ein – für Tivonel gleichbedeutend mit Tag –, die nur vom sanften weißen Zwitschern des Stationssignals unterbrochen wird. Über ihr, in der Hohen Wildnis, flackert schon die farbenprächtige Melodie der Winde von Tyree, die voller Leben sind. Vom fernen Himmel vernimmt sie leise Glockenschläge: die ersten Funken der Begleiter des Tages. Natürlich weiß Tivonel, was die Begleiter in Wirklichkeit sind: die Stimmen von anderen Klängen – von Klängen wie ihrem, nur unvorstellbar weit weg. Doch ihr gefällt die traditionelle, poetische Bezeichnung.
Was für ein schöner langer Tag heute, denkt sie. Die Hoch-Station liegt so nah am Fernen Pol von Tyree, dass der Klang in dieser Jahreszeit kaum den Horizont übersteigt. Direkt am Pol, wo sich Giadoc und die Horcher aufhalten, geht er gar nicht auf; folglich herrscht endloser, stiller Tag. Glücklich und zufrieden beobachtet Tivonel die dunklen Schichten unterhalb der Station. Dort ist fast kein Leben auszumachen. Nur ganz weit unten entdeckt sie auf den Lebensbändern ein schwaches Signal; sicher die Ausstrahlung der fernen, dicht gedrängten Leben in Tief. Wo bleibt nur der Gleiter? Ach – da! Ein naher Lebenspuls, der rasch anschwillt. Das Stationsteam düst hinunter, um zu helfen; Sekunden später hört Tivonel das leise gelbe Hupen des Signalhorns. Zeit für die Männlichen, abzureisen.
Die stattlichen Männlichen versammeln sich neben den gewebten Stationsinseln, ihre Hüllen murmeln in tiefem Rubinrot. Automatisch schwenkt Tivonels Seelenfeld in ihre Richtung. Während des einjährigen Abenteuers waren sie ihre Gefährten, die ganze Zeit hat sie über sie gewacht und sie unterstützt. Doch natürlich nehmen sie keine Notiz mehr von ihr, jetzt, da sie Väter geworden sind. Gut geschützt in ihren Beuteln tragen sie die stolzen Früchte ihrer Mission: die Kinder, die sie aus der Wildnis gerettet haben. Beim ersten Kontakt mit dem vergleichsweise sanften Wind hier unten reagierten die Kleinen ängstlich; Tivonel entdeckt vereinzelte grüne Angstschreie, die unter den Hüllen der Männlichen sichtbar werden. Die riesigen Lebensfelder der Väter ziehen sich zusammen und beruhigen die jungen ungestümen Seelen. Das Stationspersonal schwebt in respektvollem Abstand in der Luft, bemüht, keine ungebührliche Neugier an den Tag zu legen.
Die Männlichen waren großartig, denkt Tivonel jetzt anerkennend. Sie konnte sich ihre Überlegenheit nicht wirklich vorstellen, bevor sie sie in Aktion erlebte. So erstaunlich feinfühlig für alles Lebendige, so kompetent! Natürlich mussten sie sich anfangs an den stürmischen Wind gewöhnen – aber andererseits, wie tapfer sie übten, wie unermüdlich. Wie sie die schwer lokalisierbaren Signale der Verlorenen aufspürten, während sie im freien Fall durch die mächtigen Luftwirbel des Großen Windes stürzten und gar nicht genug davon bekommen konnten, genau wie die Wilden. Sie müssen Tyree wohl hundert Mal umkreist haben, während sie sie suchten, aufspürten, verfolgten, sie verloren und von neuem suchten.
Aber sie hätten das alles nie geschafft ohne mich, ohne dass ich sie führte und den Kontakt zwischen ihnen aufrechterhielt, denkt Tivonel voller Stolz. Dazu braucht es eine Weibliche. Was für ein Jahr, was für ein Abenteuer dort oben! Die unglaubliche Vielfalt des Lebens in der Wildnis, ein endlos vorbeirauschendes Geflecht von unzähligen primitiven Geschöpfen, Pflanzen und Tieren, alle pulsierend vor Energie und Lichtklängen, alle mit größeren Lebensformen verkettet. Die köstlichen ewigen Winde, aus denen unsere Rasse hervorgegangen ist. Aber ach, die lauten Nächte in dieser Höhe! Der Klang, der über ihnen durch die dünne obere Luftschicht dröhnte – das war heftig, selbst für sie. Die feinfühligen Männlichen hatten Qualen gelitten, einige hatten sich sogar ein wenig verbrannt. Doch sie waren tapfer; sie wollten diese Kinder, wie echte Väter.
Das war das Aufregendste, erinnert sich Tivonel: als die Männlichen endlich behutsam Seelenkontakt mit den Verlorenen aufnahmen und allmählich ihre primitive Lichtsprache lernten. Schließlich konnten sie ihr Vertrauen gewinnen, wenigstens soweit, um mit ihnen zu verschmelzen und ihre Erlaubnis einzuholen, die Kinder hinunter nach Tief mitzunehmen und ihnen eine ordentliche Erziehung angedeihen zu lassen. Das kann nur ein Männlicher, findet Tivonel; ich habe nicht die Geduld dazu, geschweige denn die Feldstärke.
Und wie ergriffen sie waren, als sie merkten, dass die Verlorenen bruchstückhafte Erinnerungen von früheren Generationen bewahrt hatten, aus der Zeit, als ihre Vorfahren durch die schreckliche Explosion unterhalb von Alt Tief in die Wildnis versprengt wurden. Sie sind zweifellos die letzten Überlebenden, die letzte wilde Schar, die noch übrig ist. Jetzt sind die Kinder gerettet. Äußerst befriedigend! Doch um die Wahrheit zu sagen, irgendwie bedauert sie das auch; sie würde liebend gern eine zweite Reise unternehmen.
Sie wird das alles vermissen, das weiß sie genau. Tief erscheint ihr zunehmend kompliziert und engstirnig. Natürlich möchten die Männlichen dort unten bleiben und von uns ernährt werden, das ist ganz natürlich. Aber selbst manche der jungen Weiblichen wollen sich nicht rühren, wollen nicht hier heraufkommen, in den wirklichen Wind. Und neuerdings kultivieren sie dort auch noch die unterschiedlichsten Nahrungspflanzen … Trotzdem wird sie niemals für immer unten bleiben, niemals. Sie liebt die Wildnis, den nächtlichen Lärm und alles. Ihr Vater hatte das erkannt, als er sie Tivonel nannte, Weit-Fliegerin; ein Wortspiel, das auch unzivilisiertes Kind oder Kind des wilden Windes bedeutet. Ich bin beides, denkt sie, und ihre Hülle lässt rot-gelbe Lachspitzen aufflackern. Sie wirft einen Abschiedsblick nach oben, wo Tyrees Planetenstürme in alle Ewigkeit vorbeibrausen – und keiner ihrer Rasse hat sie je gehört.
»Der Gleiter ist da!«
Das Blinkzeichen kommt von ihrer Freundin Iznagel, der weiblichen Stationsältesten. Sie haben Mühe, das Gefährt im Aufwind der Station ins Gleichgewicht zu bringen.
Der Gleiter besteht aus einem riesigen Gehäuse mit Propellerflügeln und ist ausschließlich aus Pflanzen hergestellt, die aus den tiefsten Tiefen über dem Abgrund stammen. Eine der großartigen neuen Errungenschaften derer von Tief. Ganz nützlich für Situationen wie diese, muss Tivonel zugeben. Sie selbst vertraut jedoch lieber auf die Kraft ihrer eigenen Propellerflügel.
Die Gleiterpilotin deckt das gelbe Signalhorn ab und klettert heraus, um sich zu recken. Es ist eine Weibliche in mittleren Jahren, die Tivonel noch nicht kennt. Iznagel überreicht ihr Lebensmittelpakete, und sie lässt überschwänglichen Dank erstrahlen; es ist eine lange Reise bis hier herauf, und nach den eintönigen Rationen in Tief sind die frischen, wild wachsenden Nahrungsmittel wahre Leckerbissen. Doch zuerst muss sie Iznagel ihre Erinnerung an die Windbedingungen in den tiefer gelegenen Schichten anbieten. Tivonel beobachtet, wie sich die Seelenfelder der beiden Weiblichen im Übertragungsmodus aufbauen, und spürt das Einrasten der schwachen Lebenssignale, als sie verschmelzen.
»Lebewohl, Lebewohl!« Die Stationsbesatzung flackert schon die Abschiedsgrüße. Es ist Zeit für die Männlichen, an Bord zu gehen. Aber man darf sie nicht hetzen.
Tivonel schwebt hinunter zu der Gleiterfliegerin.
»Eine Nachricht für Ellakil, die Leiterin der Nahrungsmittelversorgung, wenn du so gut sein willst«, signalisiert sie höflich. »Sag ihr, Tivonel kommt später. Ich reise zuerst zum Fernen Pol und besuche die Horcher.«
Die Pilotin, die verlegen weiterkaut, signalisiert Zustimmung. Doch Iznagel fragt überrascht: »Was willst du denn da, Tivonel?«
»Der Vater-meines-Kindes, Giadoc, ist dort.« Gerade noch rechtzeitig ermahnt sie sich, ihre Gedanken zu zügeln. »Ich möchte hören, was es Neues gibt«, fügt sie hinzu – was soweit durchaus stimmt.
Iznagels Hülle verbreitet ein skeptisches Schimmern.
»Was macht ein Vater am Fernen Pol?«, fragt die Fliegerin, deren Neugier stärker ist als ihre Verlegenheit, weil sie in aller Öffentlichkeit gegessen hat.
»Er ist Horcher geworden, vor einiger Zeit, als Tiavan herangewachsen war. Es hat ihn schon immer fasziniert, Näheres über das Leben jenseits des Himmels zu erfahren.«
»Wie unväterlich.« Der Tonfall der Pilotin ist ein kurz angebundenes Grau.
»Das kannst du nur sagen, weil du ihn nicht kennst«, kontert Tivonel. »Irgendjemand muss schließlich neue Erkenntnisse sammeln, und unsere Felder sind dafür nicht groß genug. Man braucht die Feinfühligkeit eines Vaters, um den Himmel zu erforschen.« Doch während sie das ausspricht, muss sie der Gleiterfliegerin dennoch Recht geben. Egal; mein Giadoc ist ein echter Männlicher.
»Da kommen sie endlich. Tretet zurück.«
Die stattlichen Männlichen düsen etwas ungeschickt hinaus zum Gleiter. Als sie sich nähern, bricht unter ihren Hüllen ein Gezeter aus schrillen grünen Schreien aus: Die Aussicht, in dieses Gehäuse einzusteigen, versetzt die Kleinen erneut in Angst und Schrecken. Sie kreischen und wehren sich rabiat gegen ihre neuen Väter, indem sie ihre kümmerlichen Seelenfelder gegen die ungeheuren fremden Energien stemmen, die sie umgeben, um Trost zu spenden. Die Kinder sind stark, aber durch ihre allzu frühen Erfahrungen in der Wildnis ziemlich verkorkst. Selbst der kräftige Ober muss sich offenbar anstrengen, um Haltung zu bewahren.
Im Vorbeischweben flattert Obers Hülle aufwärts, entblößt den sich vorwölbenden väterlichen Beutel und gestattet einen flüchtigen Blick auf die Düsen des Kindes. Die Gleiterpilotin lässt vor Verlegenheit ein grelles türkisfarbenes Quieken vernehmen. Iznagel wendet sich nur ab, wobei unter dem höflichen Erröten, das Hochachtung vor den Heiligen Fertigkeiten signalisiert, ein amüsiertes Glühen zum Vorschein kommt. Tivonel ist nach den letzten Monaten an den Anblick solcher Intimitäten gewöhnt. Diese dumme Fliegerin – die Tiefer scheinen die Tatsachen des Lebens zu vergessen, denkt sie. Ich bin lieber hier oben, wo die Leute intensiver dem Wind ausgesetzt und dadurch wesentlich offener sind.
Hinter sich bemerkt sie die beiden jungen Stationsmännlichen, deren Lebensfelder sich in heftiger Gefühlswallung sichtlich ausdehnen. Wahrscheinlich sehen sie zum ersten Mal erwachsene Väter in Aktion. Erst jetzt überprüft sie ihr eigenes Feld und stimmt ihre Hülle auf das korrekte Erröten ab. Die letzten Väter steigen ein.
»Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen! Der Wind segne euch«, signalisiert sie förmlich, kann jedoch nicht verhindern, dass ein Wirbel ihres Feldes in der Hoffnung auf einen letzten herzlichen Kontakt zu ihnen hinströmt. Natürlich reagieren sie nicht darauf. Sei nicht albern, rügt sie sich. Für die Väter hat gerade ein bedeutender Lebensabschnitt begonnen, der mit großem Ansehen verbunden ist. Möchte ich eigentlich auch so eine unnormale Weibliche sein wie die Paradomin, wäre ich vielleicht selbst gern Vater? Auf keinen Fall; schieß doch das ganze Ansehen in den Wind! Ich liebe mein Leben als Weibliche – Reisen, Arbeit, Entdeckungsfahrten, Handel, der Reiz der Gefahr. Ich bin Tivonel!
Die Gruppe ist jetzt eingestiegen, die individuellen Lebensausstrahlungen haben sich zu einer einzigen massiven Präsenz verdichtet. Die Fliegerin klettert auf den Pilotensitz. »Lebewohl, Lebewohl!«, singen goldgelb die Hüllen des Stationspersonals. Die Propellerflügel des Gleiters werden aufgestellt, die Helfer düsen mit ihm hinaus in den Wind.
Plötzlich richtet er sich auf, der Luftstrom erfasst ihn, das Gehäuse wird davongetragen, abwärts. Die entschwindenden Lebensfelder, die ihr so vertraut geworden sind, schrumpfen zu einem Punkt zusammen, verflüchtigen und entfernen sich mit dem Wind ins leblose Dunkel. Ein sanftes gelbes Signal erklingt, wiederholt sich und verstummt. Jetzt ist alles still; der Klang ist untergegangen.
Tivonel hebt den Blick, ihre Lebensgeister wenden sich wieder dem herrlichen Tag zu. Es wird Zeit, sich auf die Reise zu begeben, gegen den Wind, zum Fernen Pol und zu den Horchern. Zu Giadoc.
Doch zunächst sollte sie sich nach dem Weg erkundigen. Sie zögert, ist versucht, sich ausschließlich auf ihre eigenen Fähigkeiten zu verlassen. Es wäre ganz einfach; sie hat bereits ein äußerst schwaches, aber stabiles Lebenssignal von ganz weit windaufwärts ausgemacht. Das müssen die Horcher sein. Und ihre Hüllensensoren haben ein Druckgefälle registriert, das sie zu einer Schnittstelle zwischen den Windströmen führen sollte – eigentlich ein kinderleichtes Unterfangen.
Doch es gehört sich, nachzufragen, schon aus Höflichkeit. Ahura, Ahura, ermahnt sie sich. Wenn ich mich unten in Tief so benehme, werden sie mich für eine Verlorene halten.
Iznagel gibt gerade Anweisungen für das Verstauen einer Insel voller Nahrungspflanzen, die für Tief bestimmt ist und auf den nächsten Gleiter warten muss.
Tivonel beobachtet die mit Narben bedeckte ältere Weibliche liebevoll. Eines Tages werde ich so sein wie sie, denkt sie. So robust, tatkräftig und kompetent. Auch Iznagel war schon in den höchsten Höhen, sieh dir die Brandspuren auf ihren Propellerflügeln an. Es ist viel Arbeit, die Station hier in Schuss zu halten. Aber ein gutes Leben; vielleicht lande ich auch mal hier, wenn ich alt bin. Eine Sorge trübt kurzfristig ihre Stimmung: Unten in Tief fangen die Leute neuerdings an, ihre eigene Nahrung anzubauen, wie lange werden sie die Station hier oben noch unterhalten? Aber solche Grübeleien sind sinnlos – außerdem schmecken die kultivierten Nahrungsmittel einfach scheußlich. Iznagel ist jetzt fertig; Tivonel gleitet zu ihr hinunter.
»Darf ich den Weg zu den Horchern erfahren?«, fragt sie im förmlich-freundschaftlichen Modus.
Iznagel funkelt freundliche Zustimmung und zögert dann.
»Sag mir eins, Tivonel«, signalisiert sie vertraulich. »Ich konnte kaum glauben, was deine Erinnerung uns übermittelt hat: dass diese Wilden versucht haben, etwas – naja, Kriminelles zu tun.«
»Oh, das haben sie.« Tivonel überläuft ein leichtes Schaudern, als sie sich an ihre Bösartigkeit erinnert. »In Wirklichkeit habe ich nichtmal alles in dein Gedächtnis übertragen, es war zu schlimm. Die Männlichen können es den Chronisten in Tief erzählen, wenn sie wollen.«
»Haben sie wirklich auf eure Lebensfelder eingeschlagen?«
»Ja. Mehrere von ihnen haben probiert, unseren Seelenkontakt zu unterbrechen, als wir uns näherten. Ein Männlicher hat mich angegriffen und versucht, mein Feld zu spalten! Ich war so erschrocken, dass ich nur mit knapper Not entkommen konnte. Dem Wind sei Dank haben sie kaum Übung darin, aber sie sind so gemein. Sie tun sich das auch gegenseitig an – viele von ihnen wirkten, als hätten sie Feld eingebüßt.«
»Wie grässlich!«
»Ja.« Tivonel kann der Versuchung nicht widerstehen, ihre Freundin noch ein bisschen mehr zu schockieren. »Es kam noch schlimmer, Iznagel.«
»Nein – was?«
»Sie haben nicht nur versucht, unseren Seelenkontakt zu unterbrechen. Sie … haben geschoben.«
»Nein! Nein – du meinst doch nicht Lebensraub?« Iznagels Tonfall ist dunkellila vor Entsetzen.
»Pass auf. Wir haben einen Vater getroffen, der das Lebensfeld seines eigenen Sohnes beiseitegeschoben und seinen Körper gestohlen hat!« Tivonel schaudert abermals, Iznagel ist sprachlos. »Wahrscheinlich wollte er ewig leben. Das war wirklich abstoßend. Und so herzergreifend: das Leben des bedauernswerten Kindes, das den verbrauchten alten Leib des Vaters umhüllte. Ober und die anderen haben den Alten aus dem Körper verjagt und das Kind wieder zurückgeholt. Das war der aufregendste Anblick, den du dir ausmalen kannst.«
»Lebensraub … Stell dir vor, ein Vater, der so etwas tut!«
»Ja. Ich habe nie begriffen, wie schrecklich das sein muss. Ich meine, man erklärt dir, dass solche schlimmen Dinge passieren, aber du kannst es dir nicht vorstellen, bis du es siehst.«
»Das mag sein. Jedenfalls, Tivonel, hast du zweifellos eine Menge erlebt.«
»Und ich habe vor, noch mehr zu erleben, liebe Iznagel.« Tivonel kräuselt neckisch ihr Feld. »Wenn du so freundlich wärst, mir den Weg zu zeigen.«
»Gern. Ach übrigens, wo wir gerade von schlimmen Dingen sprechen, du könntest den Horchern erzählen, dass in Tief neue Gerüchte kursieren. Localin, die Pilotin, sagt, die Horcher am Nahen Pol hätten tote Welten oder sowas ähnliches bemerkt. Die Tiefer glauben, dass wieder ein Feuerball auf uns zukommt.«
»Oh, der Nahe Pol!«, lacht Tivonel. »Die haben schon immer Gerüchte verbreitet, seit ich klein war. Sie essen zu viele Quinoa-Schoten.«
Auch Iznagel muss jetzt lachen. Der Nahe Pol muss häufig für Witze herhalten, trotz seiner Schönheit und Bedeutung. Sein unterer Wirbel liegt so dicht bei Tief, dass die jungen Leute häufig dort Urlaub machen, den Himmel und sich gegenseitig beobachten und so tun, als wären sie Horcher. Es gibt natürlich auch echte Horcher, aber die bleiben lieber unter sich.
Iznagels Seelenfeld baut sich zur Erinnerungs-Übertragung auf. Tivonel bereitet sich auf den Empfang vor. Genau in diesem Moment düst ein kleines Kind zu ihnen herauf, umgeben von einem Lichtschein hellster Begeisterung.
»Lass mich, Iznagel! Lass mich! Vater – sag, dass ich darf!«
Hinter der Kleinen taucht die kräftige Gestalt von Mornor auf, ihrem Vater, der nachsichtig zwinkert. Tivonel empfindet doppelten Respekt für ihn – ein Vater mit genügend Unternehmungsgeist, um hier heraufzukommen und seiner Tochter obendrein zu ermöglichen, dass sie die Wildnis kennenlernt.
»Wenn die Fremde nichts dagegen hat?« Sanft lässt Mornor die förmliche Bitte um Unterweisung des Kindes aufleuchten. Hier oben bei der Station hat er gewiss nicht oft Gelegenheit, sein Kind trainieren zu lassen.
»Nehme mit Vergnügen an.« Ermutigend dehnt Tivonel ihr Lebensfeld dem Kind entgegen. Nachdem sie monatelang die chaotischen Übertragungen der Verlorenen empfangen hat, schreckt es sie nicht im Geringsten, von einem Kind durchgerüttelt zu werden.
Die Kleine schwebt schüchtern in der Luft, ordnet ihr Seelenfeld und pulsiert aufgeregt vor lauter Anstrengung, alles richtig zu machen. Ruckartig sammeln sich ihre kindlichen Gedanken und bilden eine wabbelige Wölbung.
Tivonel leitet sie zu einer vorschriftsmäßigen Verschmelzung mit ihrem eigenen Feld an und empfängt eine wohlgeordnete sensorische Gedächtnisspur an den Weg, recht klar und detailliert. Sie enthält einen einzigen kindlichen Ausrutscher – die prickelnde Erinnerung an einen Versuch der Selbststimulierung. Nach all dem erregten Durcheinander und Misstrauen im Kontakt mit den Seelen der Wilden findet Tivonel dieses Kind geradezu entzückend.
Sie funkelt der Kleinen ein förmliches Dankeschön zu und tut so, als hätte sie den Patzer nicht bemerkt.
»Hat meine Tochter dich vor den Zeitstrudeln gewarnt?«, fragt Mornor.
Tivonel zieht ihre neue Erinnerung zurate. »Ja, das hat sie.«
»Dann Lebewohl, und möge der Große Wind dich tragen.«
»Lebewohl, und komm wieder, Tivonel-Liebes«, signalisiert Iznagel.
»Euch allen sei Dank«, antwortet Tivonel und lässt Iznagels Namenslichter liebevoll wogen, während sie sich abwendet. »Auf Wiedersehen.« Wie sie vermutet hat, beginnt der Pfad tatsächlich an dieser Schnittstelle windaufwärts.
Tivonel düst aus der Station und ermahnt sich, die geziemende Geschwindigkeit einzuhalten. Als sie die Inseln passiert, an denen die Station befestigt ist, streift ihr Feld einen unbemerkten Lebenswirbel von der Gruppe unter ihr. Sie entziffert eine warmherzige Anerkennung für ihren Rettungseinsatz – und ein sehr deutliches, nicht gerade schmeichelhaftes Bild von ihr selbst bei der Ankunft: wild, schmutzig und ungepflegt. Tivonel kichert. Die Leute hier oben sind nicht ganz so penibel darauf bedacht, ihre Seelen zu kontrollieren. Ahura!
Ehrlich, wie soll sie es im dicht bevölkerten, zivilisierten Tief bloß aushalten, wenn sie zurückkehrt?
Egal! Als der erste Windstoß sie erfasst, lenkt die freudige Erregung, ihre körperliche Kraft zu spüren, sie von all ihren Sorgen ab. Nach etlichen Drehungen und einem strammen Flug erreicht sie die Anschlussstelle und schießt gegen den Wind weiter, wobei ihre Hülle laut lachend leuchtet. Wozu sich grämen? Sie hat noch so viel vor sich, hat Wunder zu bestaunen, das Leben zu leben und Sex zu entdecken. Sie ist Tivonel, ein fröhliches Geschöpf der Großen Winde von Tyree, auf ihrem Lebensweg.
Kapitel 3
Auch Doktor Daniel Dan ist auf seinem Lebensweg. Doch er ist alles andere als fröhlich.
Er beendet gerade das Datieren und Unterzeichnen der Ausdrucke von Proband R-95 und denkt wie üblich, dass sie für dieses idiotische Projekt wirklich keinen ausgebildeten Arzt benötigen. Und er sagt sich, ebenfalls wie üblich, er sollte froh sein, dass sie das anders sehen. Falls er beschließt, weiterzuexistieren.
Proband R-95 wischt sich die imaginäre Elektrodenpaste aus dem Haar. Er ist ein kräftiger, normal aussehender junger Mann mit deprimiertem Gesichtsausdruck.
»So viele tote Aerosole«, bemerkt er mit tonloser Stimme.
Nancy, die technische Assistentin, schaut ihn fragend an.
»Riesige Haufen davon. Berge«, murmelt R-95. »All die leuchtend bunten Spraydosen, alle tot. Man drückt auf die Düsen, aber sie sprühen nicht. Obwohl sie intakt zu sein scheinen. Wie traurig.«
»War es das, was Sie empfangen haben?«, fragt ihn Nancy.
»Nein.« R-95 hat das Interesse verloren. Wieder eins seiner bizarren Bilder, befindet Doktor Dan. R-95 und sein Zwillingsbruder R-96 nehmen seit drei Jahren am Projekt Polymer teil. Beide verhalten sich die Hälfte der Zeit, als wären sie bekifft. Das beunruhigt Dan, und zwar aus gutem Grund.
»Doktor! Doktor Dan!«
Das Mädchen von der Anmeldung klopft gegen die Glasscheibe der Kabine. Dan geht hinaus zu ihr; er duckt sich, um nicht gegen die viel zu niedrige Türöffnung zu stoßen.
»Lieutenant Kirk hat eine Schnittwunde am Bein, Doktor! Er ist in Ihrem Dienstzimmer.«
»Okay, Nancy, halten Sie den letzten Probanden fest. Bin gleich wieder da.«
Dan eilt den Korridor entlang und denkt: Mein Gott, ein waschechter medizinischer Notfall. Und ausgerechnet Kendall Kirk – wie passend.
Im Behandlungsraum trifft er auf den Lieutenant, der verkrampft auf einem Stuhl kauert und ein blutiges Bündel Papierhandtücher gegen die Innenseite seines Oberschenkels presst. Sein Hosenbein hängt zerschnitten und durchnässt herunter.
»Was ist passiert?«, fragt Dan, sobald er ihn auf dem Tisch hat.
»Dieser verdammte Computer«, antwortet Kirk wütend. »Was hat er mit mir gemacht? Ist – Bin ich …«
»Zwei ziemlich oberflächliche Schnittverletzungen. Ihre Genitalien sind in Ordnung, falls Sie das meinen.« Dan untersucht den Hosenstoff, der in die Wunden gepresst wurde, und denkt nebenbei über die Wut in Kirks Stimme nach, über den Computerraum und indirekt über Miss Omali. »Sie sagen, ein Computer hat das verursacht?«
»Ein Ventilatorflügel ist abgesprungen.«
Dan lässt seine Finger arbeiten, während er sich die Computerreihen bildlich vorstellt. Die Motoren irgendwo hinter den unteren Lüftungsgittern, und etwa auf Schenkelhöhe könnten die Ventilatoren sitzen. Bizarre Situation. So wenig er Kendall Kirk leiden kann, der Mann ist nur knapp einer Kastration entgangen. Ganz zu schweigen von einer zerschnittenen Arterie.
»Sie hatten Glück, dass es Sie nicht paar Zentimeter weiter oben oder unten erwischt hat.«
»Wem sagen Sie das.« Kirks Stimme klingt brutal. »Muss es genäht werden?«
»Mal sehen. Lieber würde ich die Wunden nur klammern, wenn Sie das Bein eine Weile schonen.«
Kirk ächzt, und Dan beendet schweigend seine Arbeit. Zu dieser Morgenstunde bewegen sich seine Hände mit erfreulicher Selbstständigkeit – maximale Blutkonzentration dessen, was er als seine Erhaltungsdosis ansieht. Ein normaler Arbeitstag. Doch der Unfall holt ihn unwirsch in die Realität zurück – bis jetzt noch ungefährlich. Er verabscheut Kendall Kirk, auf eine klinische, beinahe genüssliche Art und Weise. Der Lieutenant ist das Musterexemplar eines jungen Schreibtischbeamten, Geheimdienstoffizier bei der Navy: rüpelhaft, adrett, für das unwissende Auge ein Ehrenmann. Offensichtlich nicht übermäßig beeindruckend für seine Vorgesetzten, sonst hätte man ihn nicht zu diesem lächerlichen Projekt abkommandiert. Seit Kirk, ähm, mit an Bord ist, werden für das Projekt Polymer immer mehr lästige Formalitäten erforderlich. Doch der alte Noah liebt das.
Dan schickt Kirk nach Hause und geht zurück, um den letzten Probanden zu erlösen. Unterwegs kann er nicht widerstehen und macht einen Umweg, an Miss Omalis Computerraum vorbei. Die Tür ist, wie üblich, geschlossen.
Die letzte Versuchsperson ist T-22, eine fröhliche blauhaarige Frau von ungefähr fünfzig, die Dan bei sich Die Hausfrau nennt: Sie erinnert ihn an eine Million Werbespots im Fernsehen. Seinetwegen könnte sie auch Löwenbändigerin sein. Er vergleicht sie nicht mit der einen Hausfrau, die er sehr persönlich gekannt hat und an die er hoffentlich nie wieder denken wird.
»Ich sterbe fast vor Neugier, wie viele ich richtig habe, Doktor Dan!« T-22 blinzelt zu ihm auf, während er sie von Noahs Aufzeichnungsgeräten befreit. »Manche der Buchstaben waren so klar und deutlich. Wann werden wir es erfahren?«
Dan hat es aufgegeben, ihr zu erklären, dass er dafür nicht zuständig ist. »Ich bin sicher, Sie haben eine hohe Punktzahl, Mrs. – ähm …«
»Aber wann werden wir es wirklich wissen?«
»Naja, es, ähm, die Daten werden zuerst im Rechenzentrum ausgewertet, verstehen Sie.« Undeutlich erinnert er sich, dass die Versuchsreihe etwas mit verschlüsselten Botschaften und multiplen Empfängern zu tun hat, mit Redundanz. Egal. Noahs sogenannter telepathischer Sender befindet sich an einem geheimen Navystützpunkt, meilenweit entfernt. Kirks Werk; er scheint einflussreiche Freunde beim Geheimdienst zu haben. Teil seiner Anziehungskraft.
Dan verabschiedet sich von Der Hausfrau, duckt sich hinaus und stolpert beinahe über Noah. Doktor Noah Catledge ist der Begründer von Projekt Polymer und seiner ganzen fragwürdigen Sippschaft. Er trippelt neben ihm den Flur entlang und braucht zwei Schritte für jeden langen Schritt von Dan.
»Also, Dan, es kann sich nur noch um Tage handeln, bis sich Ihr Gehalt bezahlt macht«, plappert Noah. Er wirkt ungewöhnlich manisch.
»Was denn, werden Sie veröffentlichen?«
»Ach du lieber Himmel, nein, Dan. Dafür ist unsere Arbeit viel zu geheim. Es wird natürlich eine eingeschränkte interne Verbreitung geben, aber zuerst findet die förmliche Präsentation vor dem Komitee statt. Dabei kommen Sie ins Spiel. Ich sage Ihnen, ich bin verdammt froh, dass wir diesmal hochqualifizierte Leute haben, um jeden Schritt des Verfahrens zu zertifizieren. Keine dummen Auseinandersetzungen mehr über die Versuchsanordnung.« In seiner Begeisterung klopft er Dan auf den Rücken.
»Was haben Sie eigentlich herausbekommen, Noah?«, fragt Dan ohne wirkliches Interesse.
»Meine Güte!« Noahs Augen strahlen freudig (was wahrscheinlich auf eine Schilddrüsenüberfunktion zurückzuführen ist). »Eigentlich dürfte ich nicht, wissen Sie.« Er kichert. »Dan, alter Freund, der Durchbruch!«
»Gute Arbeit, Noah.« Dan hat das schon ein Dutzend Mal gesagt.
»Der Durchbruch …«, seufzt Noah träumerisch. »Wir kriegen mehrfach gekoppelte Signale durch, Dan. Dauerhaft. Dauerhaft. Redundanz, das ist der Schlüssel. Das ist der goldene Schlüssel! Warum habe ich nicht schon früher daran gedacht?«
»Glückwunsch, Noah. Großartige Arbeit.«
»Ach – ich möchte, dass Sie sich bereithalten, die Stadt für einige Tage zu verlassen, Dan. Wir alle. Der große Test. Sie geben uns tatsächlich ein U-Boot. Keine Sorge, Sie müssen da nicht rein, ha ha! Aber ich kann Ihnen nicht sagen, wohin wir fahren. Navygeheimnis!«
Dan beobachtet, wie Noah davonhüpft. Was zum Teufel ist passiert, wenn überhaupt? Er kann unmöglich glauben, dass der glotzäugige kleine Gnom mit dem wirren Haarschopf einen »Durchbruch« erzielt hat – in was-auch-immer-er-seiner-Meinung-nach-hier-tut. Dan kann sich das einfach nicht vorstellen.
Er biegt zu seinem Dienstzimmer ab und überlegt, was er über das Projekt Polymer eigentlich weiß. Polymer ist Noahs letzte verzweifelte Hoffnung; er hat sein ganzes Leben mit Psi-Forschung verbracht, Parapsychologie, oder was für pompöse Bezeichnungen es für dieses Nichts sonst noch gibt. Dan hatte ihn vor Jahren kennengelernt und mit leichter Belustigung und Mitgefühl verfolgt, wie der Alte einen Sponsor nach dem anderen verschliss – ohne jemals Ergebnisse zu erzielen. Als seine letzte Finanzquelle an der Universität versiegte, konnte Noah sich irgendwie eine kleine Subvention vom National Institute for Mental Health, dem staatlichen Forschungszentrum für psychische Störungen, NIMH, ergaunern und diese schließlich zu Polymer ausbauen.
Noch zu NIMH-Zeiten hatte er Dan die Mitarbeit angeboten, nach den – nach den Ereignissen, die nicht erinnert werden sollen. Der Alte musste begriffen haben, dass Dan es nicht ertragen würde, wieder als niedergelassener Arzt zu praktizieren. Nicht einmal nach einem Ortswechsel. Irgendetwas, Gott weiß was, hielt Dan vom Selbstmord ab, doch der Gedanke, ganz normalen, lebendigen Menschen nahe zu sein, war – ist – unerträglich. Unter Noahs grauem Haarschopf verbirgt sich zurückhaltendes Mitgefühl; Dan ist ihm dankbar, allerdings sorgfältig darauf bedacht, das nicht zu empfinden. Das Unpersönliche und Widersinnige der Parapsychologie, dieses Büro und seine verrückten Mitarbeiter bieten ihm die perfekte Möglichkeit, ein Dasein als Scheintoter zu fristen. Nicht real, ohne echte Anteilnahme am Leben. Ganz zu schweigen von Noahs Schrank mit den Betäubungsmitteln und von seiner Bereitschaft, jegliches Psychopharmakon auszuprobieren.
Dans Arbeit erwies sich als denkbar einfach: Hauptsächlich muss er die Versuchspersonen an verschiedene Bioüberwachungsgeräte anschließen und die Auslesebögen beglaubigen sowie für Noahs jämmerlichen Haufen sogenannter hochgradig paranormaler Probanden den Hausarzt spielen. Weder glaubt Dan an die Existenz übersinnlicher Kräfte noch bezweifelt er sie, er ist lediglich sicher, dass er selbst keine besitzt. Er hatte ein ruhiges, genügsames Leben und einen überaus praktischen Rezeptblock. Bis Polymer und Kendall Kirk auftauchten.
Wie zum Teufel bekam Noah überhaupt Kontakt zum Verteidigungsministerium? Der Alte ist gerissen und arbeitet mit beispielloser Hingabe. Irgendwie hatte er das einzige praktische Anwendungsgebiet für Telepathie aufgespürt, für das Mittel aus dem Verteidigungsbudget zu holen waren: eine seit langem gesuchte Kommunikationsmöglichkeit mit U-Booten, die unter Wasser liegen. Offensichtlich gab es tatsächlich entsprechende Versuche, und die Sowjets berichteten von gewissen Ergebnissen. Worauf man sich natürlich keineswegs verlassen konnte. Jetzt hat Noah der Navy dieses Forschungsprojekt verkauft, samt Biofeedback-Überwachung und der Redundanz, die von den Empfängerteams produziert wird. Das Ganze erschien Dan von Anfang an vollkommen sinnlos – gerade richtig für einen Geisteskranken wie Noah und einen Toten wie ihn selbst.
Doch es sieht ganz danach aus, als sollte sein beschauliches Dasein als Abgetauchter demnächst gestört werden. Dan wird wegen dieses idiotischen Tests irgendwo hinfahren müssen. Schlimmer noch, er muss Noah vor dem Komitee unterstützen. Schafft er das? Kurzfristig plagen ihn Zweifel, doch vermutlich kriegt er es hin; er hat Noah viel zu verdanken. Bei seinem letzten Projekt war der Alte dumm genug, seiner unqualifizierten Geliebten die medizinischen Aufgaben zu übertragen, und wurde entsprechend an den Pranger gestellt. Jetzt hat er den hochkompetenten Doktor Dan. Den in jeder Hinsicht unnormalen Doktor Dan. Na schön, Dan wird sich für ihn einsetzen, so gut er kann.
Er zittert immer noch und bessert seine eigene psychoaktive Medikation behutsam mit einer Spur Oxymorphon auf. Armer Noah, wenn das rauskommt.
Der Nachmittag vergeht. Die Donnerstage hält Dan sich frei, um neue potentielle Probanden zu untersuchen. Diesmal kommen zwei Zwillingspaare, Mädchen; Zwillinge sind Noahs Stärke. Dan notiert ihre Vorgeschichten und registriert verträumt und amüsiert die Übereinstimmung ihrer Eigenarten.
Seine letzte Aufgabe ist die regelmäßige Überprüfung von E-100, einem bärtigen Navy-Fähnrich, der zum Polymer-Team gehört. E-100 ist wesentlich jünger, als er aussieht. Ein tragischer Fall: Leukämie in Remission, also zeitweise symptomfrei, aber unheilbar. Die Navy hatte ihn vom aktiven Dienst suspendiert, doch Noah rekrutierte ihn mit irgendeinem Sonderstatus für sein Projekt. E-100 weigert sich zu glauben, dass die Remission nur vorübergehend ist.
»Ich werde bald wieder zur See fahren, nicht wahr, Doc?«
Dan murmelt Banalitäten und ist dankbar für die Traumflüssigkeit in seiner Blutbahn. Als E-100 geht, sieht Dan Lieutenant Kirk vorbeihumpeln. Pflichteifer oder was? Naja, die Schnitte sind nicht schwerwiegend. Aber was zum Teufel ist eigentlich in diesem Computerraum vorgefallen? Ventilatoren, die sich selbstständig machen? Unvorstellbar. Die Wunden stammen nicht von, sagen wir mal, Messerschnitten. In seinem leicht stimulierten Zustand vermutet Dan, dass die Ereignisse etwas mit einer gewissen hochgewachsenen Gestalt im weißen Kittel zu tun haben. Kendall Kirk und Miss Omali? Bitte nicht.
Dan will gerade Feierabend machen, als seine Tür sich leise öffnet. Er dreht sich um und hat das Gefühl, der Raum sei zu neuem Leben erwacht. Neben seinem Schreibtisch steht eine große schlanke Erscheinung in Schwarz-Weiß. Miss Margaret Omali persönlich.
»Setzen Sie sich, bitte …« Gott, denkt er, die Frau kann einen glatt umhauen. Sex … ja, aber auch unsägliche Anspannung. Wie ein Starkstromkondensator.
Die Erscheinung setzt sich mit minimalem Getue und maximaler Eleganz. Eine sehr große, schlanke, zurückhaltende junge schwarze Frau mit aristokratischer Selbstsicherheit in einem stinknormalen weißen Baumwollkittel. Nichts an ihr wirkt unverhohlen feminin oder extravagant, doch ihr Gesamtbild scheint lautlos zu schreien: Ich bin.
»Probleme?«, fragt er und hört, wie piepsig seine Stimme klingt. Ihr Haar ist eine kurze, krause, tiefschwarze Haube und bringt den kleinen Kopf auf ihrem langen makellosen Hals perfekt zur Geltung. Ihre Augenlider wirken übernatürlich groß und ägyptisch. Sie trägt keinerlei Schmuck. Das vollendete Gesicht, die schmalen Hände bleiben absolut reglos.
»Problem«, korrigiert sie leise. »Ich brauche etwas gegen Kopfschmerzen. Ich glaube, ich habe Migräne. Beim letzten Mal war ich zwei Tage außer Gefecht gesetzt.«
»Ist das neu?« Dan weiß, dass er ihre Akte holen sollte, bleibt jedoch wie gelähmt sitzen. Wahrscheinlich steht sowieso nichts drin; Miss Omali wurde ihnen vor einem Jahr zugeteilt und brachte ihre ärztliche Unbedenklichkeitserklärung gleich selbst mit. Noch einer von Noahs hochqualifizierten Mitarbeitern, Abschluss in Computer-Mathematik oder was auch immer. Sie kam erst ein einziges Mal in Dans Behandlungsraum, zur Grippe-Impfung im Oktober. Für Dan war sie das exotischste und schönste menschliche Wesen, das er je erblickt hatte. Er musste den Gedanken unverzüglich unter Quarantäne stellen. Neben anderen Gründen – neben vielen und endgültigen anderen Gründen – ist er alt genug, um mindestens ihr Vater zu sein.
»Ja, es ist neu«, antwortet sie. Ihre Stimme klingt gedämpft und beherrscht, und Dan stellt überrascht fest, dass ihre Sprechweise seinem eigenen, westlich geprägten weißen Mittelklasse-Sprachstil ähnelt. »Früher hatte ich Magengeschwüre.«
Sie will ihm damit sagen, dass sie die Ätiologie versteht.
»Was ist mit den Magengeschwüren passiert?«
»Sie sind weg.«
»Und jetzt haben Sie Kopfschmerzen. Wie Sie andeuten, könnte es sich auch um Stresssymptome handeln. Echte Migräne ist behandelbar. Welche Seite ist betroffen?«
»Es beginnt links und breitet sich aus. Sehr schnell.«
»Gibt es irgendwelche Frühwarnzeichen?«
»Ja, durchaus. Ich fühle mich … merkwürdig. Stunden vorher.«
»Richtig.« Er lässt sich ihre Symptomatik noch ausführlicher schildern, so dass sich das Bild einer klassischen Migräne bestätigt: die Übelkeit, das Pochen, die visuellen Phänomene, die vorausgehende »Aura«. Doch er wird nicht oberflächlich vorgehen – nicht bei ihr.
»Darf ich fragen, wann Ihr Hausarzt den letzten medizinischen Check-up durchgeführt hat?«
»Vor zwei Jahren war ich zur Kontrolluntersuchung beim ärztlichen Gesundheitsdienst. Ich habe keinen … Hausarzt.« Ihr Tonfall ist weder feindselig noch freundlich. Spöttisch?
»Mit anderen Worten, Sie wurden seit dem Auftauchen der Schmerzen noch nicht untersucht. Na schön, wir können das Naheliegende überprüfen. Ich benötige eine Blutprobe und eine Blutdruckmessung.«
»Bluthochdruck in der schwarzen weiblichen Bevölkerung?«, fragt sie mit seidenweicher Stimme. Ihre Feindseligkeit ist jetzt nicht zu überhören. »Sehen Sie, ich möchte keine große Sache daraus machen, Doktor. Ich habe einfach Kopfschmerzen.«
Sie wird gleich gehen. Von Panik erfüllt ändert er seine Taktik.
»Bitte, ich weiß, Miss Omali. Bitte hören Sie zu. Natürlich gebe ich Ihnen ein Rezept gegen die Schmerzen. Aber Sie müssen bedenken, dass Kopfschmerzen Indikatoren für andere Probleme sein können. Was ist, wenn ich Sie mit einem Schmerzmittel und einer akuten Staphylokokkeninfektion nach Hause schicke? Oder mit einem beginnenden Gefäßverschluss? Ich beschränke mich schon auf das absolute Minimum. Die Blutdruckmessung dauert keine Minute. Das Labor schickt uns Dienstag den Leukozytenwert. Ein verantwortungsvoller Arzt würde auch auf einem EKG bestehen, mit unseren Apparaturen hier wäre das ganz einfach. Ich verzichte jetzt erst einmal darauf. Bitte.«
Sie entspannt sich ein wenig. Er holt sein Blutdruckmessgerät heraus und versucht, nicht hinzuschauen, als sie sich aus dem Laborkittel schält. Ihr Kleid ist schlicht und streng neutral. Hinreißend. Sie entblößt einen langen blauschwarzen Arm, dessen Anmut ihn schmerzt; als er ihr die Manschette anlegt, hat er das Gefühl, den Körperteil eines geheimnisvollen wilden Fabelwesens zu berühren.
Ihr Blutdruck liegt bei einhundertzwanzig zu siebzig, kein Problem. Wie hoch sein eigener ist, möchte er lieber nicht wissen. Umspielt ein ironischer Zug ihre Nofretete-Lippen? Hat seine Miene ihn verraten? Als er ihr die Blutprobe abnimmt, muss er sich mit aller Kraft beherrschen, um ruhig zu bleiben und ihre Oberschenkelvene mit der Nadel zu treffen. Okay, Gott sei Dank. Das satte Rot – ihr Blut – fließt kräftig heraus.
»Ihr Blutdruck ist okay. Sie sind wie alt, achtundzwanzig?«
»Fünfundzwanzig.«
So jung. Er sollte sich alles notieren, doch ein Nachhall in ihrer Stimme lenkt ihn ab. Schmerz, kaschiert durch perfekte Kontrolle. In ihm erwacht etwas – ein Abglanz jenes Arztes, der er einmal war.
»Miss Omali.« Er bringt sein früheres beruhigendes Lächeln zustande und den sanften Tonfall, sein Sesam-öffne-dich, mit dem er den Patienten ihre Leiden entlockte. »Natürlich geht mich das nichts an, aber gab es irgendeinen besonderen Stress, der für das Auftauchen dieser Kopfschmerzen verantwortlich sein könnte?«
»Nein.«
Kein Sesam-öffne-dich. Er fröstelt, als hätte er in einer lebensgefährlichen Substanz herumgestochert.
»Ich verstehe.« Lächelnd beschäftigt er sich mit dem nützlichen Rezeptblock und murmelt irgendwas von seiner Aufgabe, ihre Gesundheit zu erhalten, und wie viel besser es wäre, die Ursachen herauszufinden anstatt mit Medikamenten nur die Symptome zu bekämpfen. Die Scheinheiligkeit in seiner Stimme macht ihn krank. Sie sitzt da wie eine Statue.
»Schauen Sie Dienstagmorgen herein, wegen des Laborberichts. Einstweilen nehmen Sie sofort eine davon, sobald Sie merken, dass es losgeht. Ein Koffein-Ergotamin-Präparat. Falls die Schmerzen sich trotzdem ausweiten, nehmen Sie das.« Aus Wut auf alles hat er ihr nicht das Morphinderivat verschrieben, wie er es vorhatte, sondern nur ein Kodeinpräparat.
»Vielen Dank.« Ihr Laborkittel liegt über ihrem Arm wie der Pelz einer Königin. Abgang Königin. Das Büro kollabiert in Entropie, bleibt unerträglich leer zurück.
Dan lässt alles schnell verschwinden und bricht auf, hinterlegt noch rasch im zweiten Stock, an der Sammelstelle für medizinische Untersuchungen, ihre Blutprobe. Ihr Blut, satt, leuchtend, intim. Blut hat gelegentlich eine ganz und gar unprofessionelle Wirkung auf ihn.
Als er aus der Eingangstür des Gebäudes tritt, bekommt er sie noch einmal flüchtig zu sehen. Sie bückt sich gerade und steigt in einen cremefarbenen Lincoln Continental ein. Hinter dem Steuer sitzt eine goldhäutige junge Frau. Irgendwie deprimiert ihn das mehr, als säße dort ein Mann. Wie reich, wie fremdartig ist ihre Welt. Wie verschlossen für ihn. Der cremefarbene Mark IV entschwindet zwischen den gewöhnlichen irdischen Fahrzeugen. Scher dich zum Teufel, Doktor Dan.
Aber er ist nicht deprimiert, nicht wirklich. Das alles war irreal. Einfach nur sehr schön. Und vor ihm liegt noch der Dienstagmorgen.
Der Gedanke gibt ihm weiterhin Kraft, lässt ihn den Stumpfsinn seines Abends durchhalten, seine betäubte Nacht: ein silbernes Fischlein im toten Meer seiner Seele. Er begleitet ihn noch immer, während er Freitagvormittag die Routinemessungen durchführt.
Die Probanden sind wegen des bevorstehenden Großen Tests ganz aufgeregt. Noah hat ihnen erklärt, dass sie in einem Flugzeug der Navy reisen werden, und Lieutenant Kirk hält einen übereifrigen Vortrag zum Thema Sicherheit. Sechs kommen mit: Die Hausfrau, der tragische Fähnrich, R-95 (missmutig und besorgt, weil sein Zwillingsbruder im U-Boot mitfährt), zwei Mädchen, die Dan bei sich Die Prinzessin und Die Vogelscheuche nennt, und K-30, ein zwergwüchsiger kleiner Mann. Dan möchte unbedingt noch fragen, wer außerdem dabei sein wird; er wagt es nicht. Ganz sicher benötigen sie keinen Computer, wo auch immer dieser blöde Test stattfindet. Irgendwie hat er jetzt schon Mitleid mit Noah; schließlich muss das ganze Projekt irgendwann zwangsläufig ein Ende finden. Vielleicht nicht als eindeutiger Fehlschlag. Vielleicht uneindeutig genug, um das Gesicht zu wahren.
Die Vormittagsergebnisse sind sehr schlecht.
Während er noch über sein Mittagessen, genauer gesagt sein Ritalin-und-Mittagessen nachdenkt, läutet sein Telefon.
»Wie bitte? Ich kann Sie nicht hören.«
Ein kaum erkennbares schwaches Flüstern.
»Miss Omali? Was ist passiert?«
»Ich konnte die … Rezepte … noch nicht einlösen. Ich … brauche die Pillen.«
»Der Kopfschmerz? Wann war er wieder da?«
»Gestern … Abend.«
»Haben Sie irgendwas dagegen eingenommen?«
»Seconal … zwei … nutzlos. Das Erbrechen ist so …«
»Nein, Seconal wird nicht helfen. Nehmen Sie nichts anderes. Ich beschaffe Ihnen sofort etwas. Geben Sie mir Ihre Adresse.« Sobald er es ausgesprochen hat, erschrickt er. Vielleicht wohnt sie fünfzig Meilen entfernt, vielleicht in einem gefährlichen schwarzen Viertel, in das niemand liefern wird.
Das Flüstern dirigiert ihn zur Woodland City-Wohnanlage direkt am Autobahnring.
Er hat seinen Erste-Hilfe-Kasten überprüft und ist schon in der Tiefgarage, bevor ihm bewusst wird, dass er ihr die Medikamente persönlich bringen will.
Erst in der zweiten Apotheke bekommt er, was er braucht, Arzneimittel, die er nicht länger vorrätig zu halten wagt. Woodland City erweist sich als ungefähr so exotisch wie die Forschungsbibliothek des US-Kongresses. Fünfundzwanzig Minuten nach ihrem Anruf eilt er einen langen Gang hinunter, der etwa so viel Flair hat wie die Flure in einem Motel, und sucht Nummer 721. Die Stahltüren wirken durch den Anstrich, als wären sie aus Holz.
Beim zweiten Klopfen öffnet sich 721 einen Spaltbreit, eine Kette rasselt.
»Miss Omali? Ich bin’s, Doktor Dan.«
Eine schmale schwarze Hand schiebt sich durch den Türspalt, die blasse Handfläche zeigt nach oben.
»… Vielen Dank.«
»Möchten Sie mich nicht hereinlassen, bitte?«
»… Nein.« Die Hand verharrt leicht zitternd. Er hört sie atmen.
Misstrauen durchzuckt ihn. Was ist da drinnen los? Ist sie allein? Ist das irgendein Trick, ist er ein Narr? Die Hand wartet. Er hört das würgende Stocken ihres Atems. Vielleicht hat sie Angst, einen fremden Mann einzulassen.
»Miss Omali, ich bin Arzt. Ich habe hier ein rezeptpflichtiges Betäubungsmittel. Ich darf und werde es Ihnen nicht auf diese Weise aushändigen. Falls Sie, ähm, beunruhigt sind, kann ich gern hier warten, während Sie eine Freundin anrufen und bitten, herzukommen.«
Oh Gott, denkt er, was, wenn es ein Freund ist? Doch plötzlich steht direkt hinter ihm eine Frau und ruft: »Marge?«
Es ist die Goldhäutige aus dem Auto; sie trägt Einkaufstüten in den Armen und starrt ihn unter ihrer wilden Afrofrisur misstrauisch an.
»Marge«, ruft sie erneut. »Ich bin wieder da. Was ist hier los?«
Undeutliche Geräusche jenseits des Eingangs – dann knallt die Tür zu, die Kette rasselt, und die Tür schwingt weit auf. Drinnen durcheinanderwehende, hauchdünne weiße Stoffbahnen. Eine Zimmertür wird geschlossen.
Die Frau geht an ihm vorbei in das zugige Apartment und schaut ihn feindselig an. Dan erwidert ihren Blick und hofft, dass sein graues Haar und der schlichte, unmodische graue Anzug an seinem schlaksigen Körper als Beweis für seine Harmlosigkeit genügen. Der Juniwind lässt lange weiße und graue Vorhänge in den Raum hineinzüngeln wie wolkige Flammen. Dan erklärt seine Anwesenheit. »Ich nehme an, Sie sind eine Freundin von ihr?«
»Ja. Wo ist die Medizin?«
Dan zieht die Schachtel heraus, steht da und hält sie fest, während hinter den Kulissen eine Toilettenspülung zu hören ist. Dann öffnet sich die Zimmertür, sie umklammert den Türpfosten, mustert ihn prüfend und drückt ein nasses weißes Handtuch gegen ihre Stirn.
Ihr langer Morgenrock aus reiner grauer Seide ist zerknittert und voller Schweißflecken. Was er von ihrem Gesicht sieht, ist kaum wiederzuerkennen, fahl und runzlig vor Schmerz. Die Unterlippe ist nach unten verzerrt, die herrlichen Augenlider sind zu Schlitzen verengt. Das Wasser aus dem Handtuch rinnt unbeachtet ihren Hals hinunter. Sie hält sich aufrecht wie jemand, der gezüchtigt wird; ihr Anblick tut ihm weh. Er reißt die Schachtel auf.
»Das hier sind Zäpfchen, damit die Wirkung nicht durch Erbrechen verloren geht. Kennen Sie sich damit aus?«
»Ja.«
»Nehmen Sie zwei. Dieses ist gegen die Schmerzen und das hier gegen die Übelkeit.«
Sie umschließt sie in ihrer grauen, zitternden Handfläche. »Wie … lange?«
»Etwa dreißig Minuten, dann werden Sie Erleichterung spüren.« So distanziert wie möglich fügt er hinzu: »Versuchen Sie, sie möglichst hoch zu schieben, damit die Krämpfe sie nicht herauspressen.«
Sie entschwindet und lässt die Tür halb offen. Durch den Spalt sieht er einen weiteren Raum in Weiß und Grau. Ihr Schlafzimmer. Er ignoriert den strengen Blick der Freundin und tritt ein. Noch mehr hauchdünner weißer Stoff, aber die Fenster sind geschlossen. Schlichte weiße Laken, zerwühlt und feucht. Eine weiße Schüssel zwischen den durchnässten Kopfkissen. Auf dem Nachttisch steht die Flasche Seconal, leuchtend rot in all dem Weiß. Er nimmt sie in die Hand. Beinahe voll und laut Datum über ein Jahr alt. Okay. Er öffnet die Nachttischschublade, findet weiter nichts.
Die Frau ist ihm gefolgt, zieht die Laken glatt und beobachtet ihn spöttisch.
»Sind Sie fertig?«
»Ja.« Er geht zurück in das zugige Wohnzimmer. »Ich werde warten, bis die Medikamente wirken.« Tatsächlich hatte er keine derart lächerliche Absicht gehabt. Entschlossen setzt er sich in einen mit weißem Tweed bezogenen Sessel. »Ich habe Miss Omali ein ziemlich starkes Mittel gegeben und möchte sichergehen, dass alles in Ordnung ist. Sie scheint hier allein zu wohnen.«
Endlich lächelt die Frau und wirkt augenblicklich völlig verändert.
»Oh, ich verstehe.« Der Ton ist sarkastisch, aber freundlicher. Sie stellt die Tüten ab und schließt die Fenster: Die Vorhänge erschlaffen. Während sie Milch in einem Kühlschrank in der Ecke verstaut, bemerkt Dan, dass sie im herkömmlichen Sinne schön ist, trotz einer minderschweren Dermatitis. »Ja, Marge ist zu viel allein.«
Die Badezimmertür öffnet sich, eine Stimme flüstert: »Samantha?«
»Sie soll sich flach hinlegen«, sagt Dan.
Die Frau, Samantha, geht hinein und schließt die Tür. Dan sitzt steif in dem weißen Sessel und erinnert sich, wie er während seines Militärdienstes einmal in der Wohnung eines unbedeutenden asiatischen Diktators wartete. Der Mann wurde von quälenden Hämorrhoiden geplagt, seine Berater waren ausgesprochen schießwütig. Dan hatte nie wieder etwas von ihnen gehört.
Samantha kehrt zurück und nimmt unterwegs ihre Einkäufe an sich. »Ich wohne weiter den Gang hinunter. Wie kommt es, dass Sie Hausbesuche machen?«
»Ich war für heute sowieso fertig. Die Gesundheit unserer Mitarbeiter liegt uns immer am Herzen.«
Sie scheint irgendeine Botschaft zu begreifen und sieht ihn wohlwollender an.
»Ich bin froh, dass ihr jemand beisteht. Ich schaue später nochmal nach ihr«, sagt sie abschließend zur Warnung und geht hinaus.
Allein in dem jetzt ruhigen Zimmer sieht Dan sich um. Es ist von einer spartanischen Eleganz, Schattierungen von Weiß, strenge Stoffe: eiskalt und trostlos, wenn es nicht ihres wäre. Keine geheimnisvolle afrikanische Kunst, wie er erwartet hatte. Er weiß, er macht sich zum Narren, die Frau ist völlig gesund, von neuerlichem Flüssigkeitsverlust abgesehen. Wird man ihn im Büro vermissen? Freitag, nicht viel zu tun. Egal. Egal auch, dass er sein, ähm, Mittagessen verpasst hat … Ein Narr.
Er nimmt ein graues Fachjournal zur Hand, Die Zeitschrift für Angewandte Computerwissenschaft, und versucht herauszufinden, was ein Algorithmus ist.
Als er ihr Würgen aus dem Schlafzimmer hört, klopft er an und tritt ein. Sie liegt im Bett, um die Schüssel gekrümmt wie ein kranker Kranich, und erbricht nur noch Schleim. Ihr Blick begegnet seinem, leidend und herausfordernd. Er gibt sich Mühe, ihr den Eindruck vom gutmütigen älteren Arzt zu vermitteln. Es ist außergewöhnlich, sie da liegen zu sehen. In ihrem Bett.
Danach nimmt er die Schüssel, spült sie aus und bringt sie zurück, füllt das Wasserglas auf dem Nachttisch.
»Versuchen Sie zu trinken, selbst wenn Sie es nicht bei sich behalten.«
Ihr Kinn bringt mit majestätischer Geste Gleichgültigkeit zum Ausdruck, sie sinkt zurück in die durchnässten Kissen. Er geht wieder hinaus und wartet. Er führt sich auf wie ein unglaublicher Trottel, ein Geisteskranker. Es ist ihm egal. Er nimmt ein beliebiges Taschenbuch zur Hand. Die Sufis, von einem Idries Shaw. Er legt es beiseite, unfähig, sich für uralte Weisheit zu interessieren. Der blitzblanke spartanische Raum weckt Schmerz in ihm. Ein Gedicht von irgendwem – Aiken? Der Schauplatz war von nichts als Schmerz erfüllt. Was bleibt denn auch, wenn Chaos seine Kräfte bündelt, ein einziges Blatt zu formen.
Er weiß nichts über das Blatt, jedoch alles über den Schmerz. Die sorgsam gewählten neutralen Farben, in denen sie lebt, die schmucklosen Formen, ihre beherrschte Lautlosigkeit, all das offenbart ihm eine Person, die Angst davor hat, unkontrollierbare Qual zu wecken. Es kommt ihm nicht in den Sinn, dass die meisten Menschen das gar nicht bemerken würden. Er ist ein verrückter, nicht mehr ganz junger Mann, der auf sein Mittagessen verzichtet hat.
Als er wieder zu ihr hineinschaut, stellt er eine unfassbare Wandlung fest. Ihr Gesicht glättet sich, die Schönheit strömt zurück. Die Wunder der Chemie. Ihre Augenlider sind noch verkrampft, doch offensichtlich nimmt sie ihre Umwelt wieder wahr. Tollkühn setzt er sich auf den schlichten Schlafzimmerstuhl und beobachtet sie. Sie erhebt keine Einwände.
Als sie schluckt, hält er ihr ein Glas frisches Wasser hin.
»Versuchen Sie’s.«
Sie nimmt es, mit verschleiertem Blick mustert sie ihn wie von ganz weit weg. Sie behält das Wasser bei sich. Absurderweise macht ihn das glücklich. Wie lange ist es her, seit er einen bettlägerigen Patienten hatte? Wie lange, seit er am Bett einer Frau gesessen hat. Frag nicht. Frag niemals … Zum ersten Mal seit wer-weiß-wie-langem verspürt er nicht das Bedürfnis nach seinem eigenen Wunder der Chemie. Eine Empfindung, die er ängstlich als Lebendigkeit identifiziert, schleicht sich in ihn hinein. Es tut noch nicht weh. Vertrau nicht darauf. Denk nicht darüber nach, sie wird verschwinden. Unwirklichkeit, das ist der Schlüssel, wie Noah sagen würde.
Sein Blick ruht auf ihren halb geschlossenen Augen, eine stille, distanzierte Gemeinschaft. Ganz plötzlich glätten sich die letzten Falten, der dunkle Blick öffnet sich weit. Sie atmet tief ein, entspannt sich, lächelt fassungslos. Er lächelt zurück. Zu seinem Entzücken schaut sie ihm in die Augen. Ein Moment einfachen Glücks.
»Es ist wirklich weg.« Versuchsweise bewegt sie den Kopf, seufzt, leckt sich die trockenen Lippen und starrt ihn immer noch an wie ein Kind. Ihre Hand tastet nach dem Wasserglas. Er sieht, dass er es dummerweise zu weit weggestellt hat, und beugt sich vor, um es ihr zu reichen.
Als seine Hand sich nähert, erstarrt er.
Das Wasserglas bewegt sich. Im Nu schlittert es über die Nachttischplatte gut zehn Zentimeter zu ihr hin.
Seine Hand zuckt hoch und weg von dem unheimlichen Ding, er gibt einen Laut von sich. Das Glas stoppt, ist wieder nur ein gewöhnliches Wasserglas.
Zu Tode erschrocken steht er da und starrt darauf. So fängt es also an – Oh Gottogott. Eine Chemikalie zu viel in meinem malträtierten Kortex. Langsam nimmt er das Glas und reicht es ihr.
Während sie trinkt, schießt ihm ein absurder Gedanke durch den entsetzten Kopf. Natürlich unmöglich, doch er kann nicht umhin, sie zu fragen.
»Sie sind nicht, ähm, sind Sie auch eine von Doktor Catledges Versuchspersonen?«
»Nein!«
Schroffe, herablassende Verneinung; jegliche Harmonie ist verflogen. Natürlich nicht, natürlich kann kein Mensch Dinge bewegen. Das einzige Ding, das sich bewegt hat, war eine Spannungsdifferenz an einer gestörten Synapse in seinem eigenen Gehirn. Aber es wirkte so real, so alltäglich. Ein Glas, das einfach gleitet. Es wird wieder passieren. Wie lange wird es ihm gelingen, sich zu kontrollieren?
Er starrt in seine hirngeschädigte Zukunft und hört ihre kalten Worte: »Ich weiß nicht, was Sie meinen.« Ihre Augen strahlen opiatinduzierte Lebhaftigkeit aus. »Ich möchte nichts damit zu tun haben. Gar nichts. Verstehen Sie?«
Die ungewohnte Wut in ihrer Stimme durchdringt sein Entsetzen. Ist tatsächlich etwas geschehen, etwas außerhalb von ihm? Sie hat Angst. Wovor?
»Oh, verdammt, Gott verdammt«, flüstert sie und tastet nach der Schüssel. Das Wasser kommt wieder hoch.
Dan trägt die Schale hinaus, in seinem Kopf wirbelt Unmögliches durcheinander. Als er sie zurückbringt, sagt er vorsichtig: »Miss Omali. Bitte. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Ich dachte, ich hätte gesehen …, dass sich etwas bewegt. Ich habe Anlass, mir Sorgen um mich zu machen. Um meinen, naja, meinen Geisteszustand. Verzeihen Sie, ich weiß, wie das klingt. Aber vielleicht haben Sie – haben Sie es auch gesehen?«
»Nein. Sie müssen verrückt sein. Ich weiß nicht, was Sie meinen.« Sie wendet den Kopf ab, schließt die Augen. Ihre Lippen zittern ganz leicht.
Er setzt sich, mitgenommen von der Aufregung, die ihm fast den Atem raubt. Sie weiß es. Es ist tatsächlich etwas geschehen. Es lag nicht an mir. Oh Gott, oh Gott, es lag nicht an mir. Aber wie? Was?
Der lange, zerbrechliche Körper ruht still unter dem Laken, das makellose Profil reglos, abgesehen von diesem kaum wahrnehmbaren Spannungstremor. Sie kann Dinge tun, denkt er. Sie hat das Glas bewegt. Wie hat Noah das genannt, Telekinese? Das gibt’s gar nicht, abgesehen von diesem Poltergeistblödsinn bei gestörten Kindern. Statistische Mehrdeutigkeiten mit Würfeln, ja. Nicht sowas, ein schlitterndes Wasserglas. Miss Omali, die Magierin. Ihre Wut, ihr Leugnen haben ihn vollkommen überzeugt. Sie möchte es verbergen, möchte kein »Proband« sein. Auch das versteht er vollkommen.
»Ich werde es nicht verraten«, sagt er sanft. »Ich habe gar nichts gesehen.«
Ihr Kopf fliegt herum, ihr Gesicht wirkt verschlossen und hochmütig.
»Sie haben den Verstand verloren. Sie können jetzt gehen, ich fühle mich viel besser. Danke für das Zeug.«
Die Abfuhr schmerzt ihn mehr, als er für möglich gehalten hat. Dummer Doktor Dan. Seufzend erhebt er sich und packt seinen Arztkoffer. Der wunderbare Moment ist vorbei, für immer. Besser so; was hat er auch mit Glück zu schaffen?
»Vergessen Sie nicht, soviel zu trinken, wie Sie können. Dienstag habe ich Ihren Laborbericht.«
Kaltes Nicken.
Während er sich zum Gehen wendet, klingelt das Telefon. Seltsamerweise scheint sie keinen Anschluss im Schlafzimmer zu haben.
»Soll ich abnehmen?«
Wieder ein Nicken. Als er den Hörer ans Ohr hält, fragt eine männliche Stimme laut: »Omali? Warum waren Sie heute nicht im Büro?«
Es ist Kendall Kirk.
Bestürzt starrt Dan sie durch die Türöffnung an und antwortet: »Kirk? Kirk? Hier spricht Doktor Dan. Haben Sie eine Nachricht für Miss Omali?«
Sie zeigt keinerlei Reaktion, ganz sicher keine Freude.
»Was?«, fragt Kirk mit belegter Stimme. Er klingt leicht angetrunken. »Wer sind Sie? Wo ist Omali?«
»Ich bin’s, Doktor Dan, aus Ihrem Büro, Kirk. Miss Omali hatte gerade einen, ähm, neurovaskulären Anfall. Ich wurde zu ihr gerufen.«
Das dunkle Profil auf den Kissen scheint sich leicht zu entspannen. Erledigt er das zu ihrer Zufriedenheit?
»Ach, ist sie krank?«
»Ja. Sie steht unter Medikamenten, sie muss im Bett bleiben.«
»Na schön, wann kommt sie wieder? Der Computer ist im Arsch.«
»Frühestens Montag, das hängt davon ab, ob sie wieder fit ist oder nicht. Wir erwarten den Laborbericht am Dienstag.«
»Oh. Naja, sagen Sie ihr, es gibt einen Haufen Arbeit für sie.«
»Das können Sie ihr selbst sagen, wenn Sie sie sehen. Jetzt ist sie zu krank.«
»Oh. Kommen Sie nochmal her?«
»Wahrscheinlich nicht, Kirk. Ich habe noch einen Hausbesuch zu machen.«
Kirk legt auf.
Schweren Herzens wendet sich Dan zum Gehen. »Nochmal: Auf Wiedersehen. Bitte rufen Sie mich an, falls Sie mich brauchen, ich lasse meine Nummer hier.«
»Auf Wiedersehen.«
Gerade als er die Tür zuzieht, hört er sie heiser rufen: »Warten Sie.«
Die Geschwindigkeit, mit der er wieder neben ihrem Bett steht, erschreckt ihn. Sie mustert ihn, legt die Stirn hinter ihrer Hand in Falten.
»Ach, zum Teufel. Ich wünschte, ich könnte Menschen besser einschätzen.«
»Das wünschen wir uns alle.« Er lächelt zaghaft.
Ohne sein Lächeln zu erwidern sagt sie schließlich mit kaum hörbarer Stimme: »Sie sind nicht verrückt. Erzählen Sie’s niemandem, oder ich verhexe Sie.«
Zu verblüfft, um zu begreifen, erwidert Dan: »Mach ich nicht. Versprochen.« Mit zittrigen Beinen setzt er sich hin.
»Sie sind verpflichtet, Doktor Catledge darüber zu informieren, nicht wahr?«
»Nein. Das Projekt des guten Noah bedeutet mir nichts. Eigentlich habe ich nie daran geglaubt – das heißt, bis vor zwei Minuten.«
Sie starrt ihn an, misstrauisch, hoffnungsvoll, die großen braunen Augen unmenschlich schön.
»Ich werde niemals etwas tun, was Sie nicht möchten – niemals«, verspricht er wie ein Schuljunge. Es ist die Wahrheit.
Sie lächelt ein wenig. Die Augen verändern sich, sie lehnt sich zurück. »Vielen Dank.«
Sie sind Verbündete. Doch selbst jetzt weiß er, dass er sich mit sowas wie Glück nicht verbünden wird.
»Ihre Freundin Samantha sagte, sie würde nochmal vorbeikommen. Wird sie Ihnen was zum Abendessen machen?«
»Sie ist so gut zu mir. Und das mit fünf Kindern.« Das Medikament belebt ihr Mienenspiel und macht sie redselig. Er sollte gehen. Stattdessen holt er noch ein Glas Wasser und reicht es ihr, ist sich der Zärtlichkeit in seinem Gesicht nicht bewusst.
»Ich glaube, ich habe gesehen, wie sie Sie abgeholt hat.«
Sie nickt, hält das Glas in unvorstellbar zarten, langen dunklen Fingern. »Sie arbeitet im Fotolabor im dritten Stock. Sie war mir immer eine gute Freundin … aber wir haben nicht viel gemeinsam. Sie ist eine Frau.«
Wieder erfüllt Schmerz das Zimmer. Um sie abzulenken, stellt er die erste idiotische Frage, die ihm in den Sinn kommt.
»Bevorzugen Sie männliche Freunde?«
»Nein.«
Er lacht in sich hinein, Vater und Kind. »Naja, da bleibt nicht mehr viel übrig, stimmt’s? Mit wem haben Sie denn etwas gemeinsam, wenn ich fragen dürfte?«
»Mit Computern«, antwortet sie unerwartet und lacht sogar laut auf. Das Geräusch klingt auf kalte Weise fröhlich.
»Ich verstehe nicht viel von Computern. Wie sind sie denn so, als Freunde?«
Sie kichert wieder, weniger schroff.
»Sie sind cool.«
Sie meint es wörtlich, begreift er. Nicht umgangssprachlich – cool. Kalt, gefühllos, nicht in der Lage, weh zu tun. Wie gut er das kennt.
»Mochten Sie schon immer …?« Mit offenem Mund hält er inne. Er hat keine telepathischen Fähigkeiten, nicht die geringsten, doch der Schmerz im Raum würde selbst einen Ochsen umhauen. Behutsam und leise sagt er zu seinem verletzten Kind: »Ich mag auch coole Dinge. Meine sind ein bisschen anders.«
Schweigen, Schmerz, der zu Stille wird. Er hält es nicht aus.
»Vielleicht möchten Sie irgendwann mal ein paar von meinen kennenlernen«, prescht er vor. »Man könnte sie wahrscheinlich hier vom Dach aus sehen, falls das Gebäude eine Sonnenterrasse hat. Wir könnten auch Samantha mitnehmen.«
Die Ablenkung funktioniert. »Was meinen Sie?«
»Sterne. Die Sterne.« Er lächelt. Er hat in den letzten zehn Minuten mehr gelächelt als seit Jahren. Schwachsinnig. Überglücklich sieht er, wie ihr fast heiteres, verblüfftes Gesicht offener wird. Freundschaft zittert zwischen ihnen.
»Jetzt ruhen Sie sich aus. Durch die Medikamente fühlen Sie sich stark, aber Sie werden bald müde sein. Schlafen Sie. Falls Sie in vier Stunden noch Schmerzen haben, nehmen Sie eine weitere Dosis. Wenn es dann nicht aufhört, rufen Sie mich an. Egal, um welche Zeit.«
»Sie gehen jetzt zu Ihrem Hausbesuch«, sagt sie, schon traumverloren.
»Es gibt keinen Hausbesuch.« Er lächelt. »Ich mache keine Hausbesuche mehr.«
Er schließt sehr behutsam die Tür, versiegelt ihre Schönheit, seinen Augenblick Lebendigkeit. Draußen auf dem Gang, zurück in seiner unwirklichen Welt, begegnet ihm Samantha.