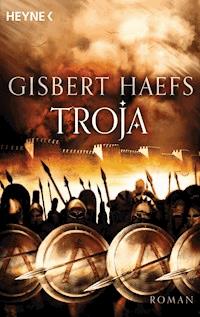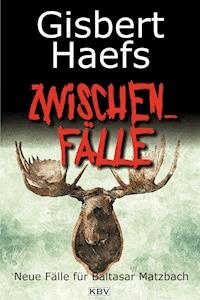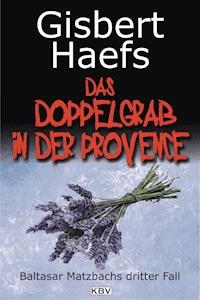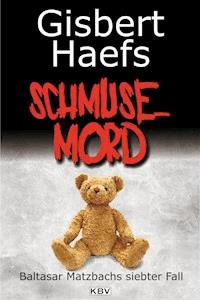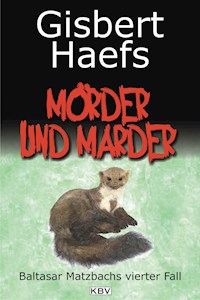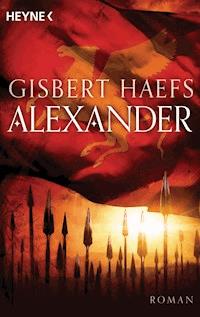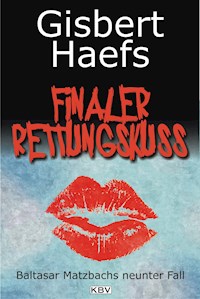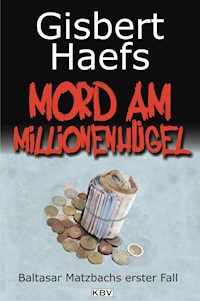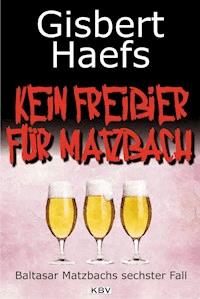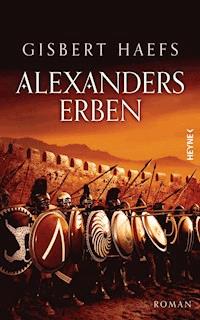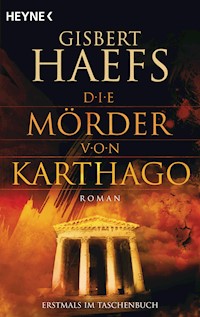
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Im mörderischen Netz der politischen Intrige
Mit dem Bestseller "Hannibal" hat Gisbert Haefs eine unvergleichliche Kulisse des antiken Karthago geschaffen: modern und multikulturell, machtbesessen und mörderisch. Jetzt kehrt er abermals dorthin zurück und lässt Bomilkar, den »Herrn der Wächter«, in einem Netz der politischen Intrige ermitteln.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 341
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Das Buch
Drei Morde beschäftigen Bomilkar, als »Herr der Wächter« zuständig für Ruhe und Ordnung in Karthago: ein Inder – Pilger und buddhistischer Missionar – wurde erstochen, ein Marktarbeiter überfahren, der Besitzer mehrerer Mietshäuser vom Dach gestürzt. In die verwickelten Ermittlungen mischt sich die Politik. Anno 228 v. Chr., zehn Jahre vor Beginn des Zweiten Punischen Kriegs, sind die Beziehungen zwischen Karthago und Rom ruhig, aber es ist ein unbehaglicher Friede. Der Senat betrachtet Karthagos Unternehmungen auf der iberischen Halbinsel mit Mißtrauen; deshalb schickt der karthagische Rat eine Gesandtschaft nach Rom. Und Bomilkar muß die Gesandten begleiten: Er hat in Iberien gekämpft, kennt sich mit den dortigen Zuständen aus und soll außerdem die Ratsherren beschützen. Oder will man seine Ermittlungen behindern? Gibt es Zusammenhänge zwischen den drei Morden und anderen Vorgängen? Widerwillig reist er nach Rom. Dort trifft er auf seinen alten Freund und Gegenspieler Laetilius und erhält überraschende Informationen, die sich aber erst nach der Rückkehr in Karthago auswerten lassen. Und dort sind inzwischen weitere Morde geschehen.
Der Autor
Gisbert Haefs, 1950 in Wachtendonk am Niederrhein geboren, lebt und schreibt in Bonn. Als Übersetzer und Herausgeber ist er unter anderem für die neuen Werkausgaben von Ambrose Bierce, Rudyard Kipling, Jorge Luis Borges und zuletzt Bob Dylan zuständig.
Zu schriftstellerischem Ruhm gelangte er nicht nur durch seine Kriminalromane, sondern auch durch seine farbenprächtigen historischen Werke Hannibal, Alexander, Troja und Caesar.
Gisbert Haefs
Die Mörder von Karthago
Roman
WILHELM HEYNE VERLAGMÜNCHEN
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Taschenbuchausgabe 02/2012
Copyright © 2010 by Gisbert Haefs
Copyright © 2010 by Wilhelm Heyne Verlag, München,in der Verlagsgruppe Random House GmbH,Neumarkter Str. 28, 81673 München.Umschlaggestaltung: Eisele Grafik · Design, MünchenSatz: Leingärtner, Nabburg
ISBN: 978-3-641-25031-7V002
www.heyne.de
1. KAPITEL
[228 v. Chr.] Als Bomilkar die Wachstube neben dem Tynes-Tor betrat, sah sein Stellvertreter auf, grunzte und ließ den Blick wieder auf den Halm sinken, den er eben in Tinte getaucht hatte.
»Du könntest auch lächeln«, sagte Bomilkar. »Die Götter mögen dir einen Tag der Wonne und des Entzükkens gewähren.«
Autolykos kritzelte auf dem Papyros herum. »Bah. Sie tun nichts dergleichen.«
Bomilkar legte die Umhängetasche auf die Bank an der Wand zum hinteren Raum. Leise pfeifend, ging er zum Tisch, stützte die Fäuste auf die Platte und versuchte, die Zeichen zu enträtseln. »Dichtung oder Wahrheit?«
Autolykos steckte den Halm ins Tintentöpfchen. »Dichtung«, sagte er. »Der Rat will eine Rechtfertigung dafür, daß wir über unseren üppigen Sold hinaus Geld ausgeben.«
»Und weil du ohnehin einen weit besseren Überblick hast als ich …«
Autolykos deutete neben sich auf den Boden. Dort stand eine Kiste, bis unter den Rand gefüllt mit abgerissenen Papyrosfetzen. »Du kannst das doch alles gar nicht lesen«, sagte er mit künstlich matter Stimme. »Und mir hilft es, nicht an anderes zu denken.«
»An was, zum Beispiel?«
»Daran, daß ich jetzt irgendwo hinter Capua geruhsam zwei Ochsen und einen Pflug lenken könnte. Wenn ich nicht Lesen und Schreiben gelernt hätte.«
»Du vergißt etwas.« Bomilkar ging zu dem kleinen Eisenofen, auf dem ein Topf mit Kräutersud, Fruchtstückchen und ein wenig Wein stand. Er goß einen Becher halb voll und trank.
»Was vergesse ich?«
Bomilkar wandte sich wieder dem grauhaarigen kampanischen Hellenen zu. »Vor vierundzwanzig Jahren …«
»Sechsundzwanzig.«
»Meinetwegen. Damals bist du unseren Werbern gefolgt, um auf Sizilien gegen die Römer zu kämpfen.«
Autolykos hob die Schultern. »Ich hätte ja zurückgehen können.«
»Dann dürftest du jetzt als römischer Bundesgenosse ackern und säen.«
»Kleinigkeiten wie diese übersieht ein großer Geist.«
»Gibt es andere Kleinigkeiten, von denen ich wissen sollte?«
»Drei, aber ehe du sie erfährst, wollte ich dich hiermit erheitern.« Autolykos klopfte auf seinen Papyros.
»Aha. Werde ich vor Wonne kreischen? Oder muß ich mich setzen, um es zu ertragen?«
»Besser, ja. Wo hast du denn herumgelungert, daß du erst jetzt auftauchst?«
Bomilkar ließ sich auf die Ruhebank sinken. »Ich habe mir erlaubt, zum ersten Mal seit anderthalb Monden zu schlafen, bis der Schlaf von selbst aufgehört hat.«
»Üppige Schwelgerei.« Autolykos schien zu warten, bis Bomilkar den nächsten Schluck genommen und den Becher abgesetzt hatte; dann sagte er: »Himilko, Schreiber des edlen Arish, Fünf-Herr für Fremdlande, will dich sprechen. Irgendwas im Zusammenhang mit Rom.«
»Aha. Das kann warten. Weiter.«
»Eine Leiche. Der Inder.«
Bomilkar starrte ihn einen Moment ratlos an und dachte an einige der Inder genannten Elefantenreiter in der Festung. Dann begriff er. Und spürte, wie sich seine Nackenhaare aufrichteten.
»Der Pilger? Priester?« Er fuhr sich mit der Hand ins Genick, um die Haare glattzustreichen.
Autolykos hob die Brauen. »Sträubt sich da was? Böses Zeichen, wie?«
Bomilkar nickte. Die Nackenhaare hatten ihn vor Überfällen und Hinterhalten gewarnt, als er noch bei den Truppen in Iberien gewesen war, und seit man ihn zum Herrn der Wächter von Qart Hadasht gemacht hatte, waren sie immer ein zuverlässiges Zeichen gewesen, daß etwas nicht so war, wie es sein sollte. »Wo und wie?« sagte er.
»In einer Gasse nordöstlich der Agora. Man hat ihm die Kehle geschlitzt und den Bauch geöffnet.«
»Unsere besonderen Freunde?«
»Vielleicht. Jedenfalls in ihrem Gebiet.«
Die Gegend zwischen Agora, Byrsahang und Seemauer war das Reich der Fürsten der Finsternis: Schmuggler, Diebe, Räuber, Totschläger. Bomilkar und seine Büttel mieden diese Straßen und Gassen – außer wenn es unbedingt sein mußte, und dann gingen sie in Gruppen.
»Was kann er da gesucht haben?«
Autolykos breitete die Arme aus. »Was hat er überhaupt hier gesucht?«
Der Mann fiel ihm auf, weil er etwas tat, was Bomilkar für seine eigene Form des Erfassens hielt und noch bei keinem so gesehen hatte: Er atmete durch die Nase und die Zähne und hielt dabei die Augen geschlossen.
Bomilkar erinnerte sich an die eigene Ankunft im großen Hafen von Qart Hadasht; wie der Mann, den er beobachtete, hatte er damals ein Schiff verlassen, sein karges Gepäck auf dem Kai abgestellt, die Augen geschlossen und die Stadt, den Hafen und den Weltkreis geatmet. ›Vielleicht wäre eratmet besser‹, dachte er – eratmen, wie erfassen oder erkennen oder ergreifen. Brackwasser, feuchtes Holz, Taue, Leder, Segeltuch, Männerschweiß, Fisch, Füße, ein Gemenge der Ausdünstungen von tausend Menschen, Tieren, Waren; gestrige Speisen, heutiger Wein … Der Fremde öffnete langsam die Augen und sah sich um. Er trug ein seltsames Wickelgewand, das vor langer Zeit einmal gelb oder gelbrot gewesen sein mußte, und neben seinem rechten Bein lag ein kleiner Reisebeutel. Das Schiff, das ihn in den Hafen gebracht hatte, kam aus der Mutterstadt der Chanani, aus Tyros, aber der Mann war kein Phöniker.
Er öffnete die Augen. Offenbar hatte er die Welterfassung durch Riechen beendet. Ohne Anzeichen von Eile nahm er seinen Beutel auf und tat ein paar Schritte, wich Stauern aus, sah sich um. Er schien etwas zu suchen, nicht dringend, eher beiläufig, und sah Bomilkar, der auf einem Poller saß und als einziger in Sichtweite nichts zu tun hatte. Der Fremde näherte sich und hob die Hand.
»Du Hellenisch reden, koine?« sagte er in brüchigem Phönikisch.
»Für dich mache ich eine Ausnahme.«
Der Fremde lächelte, was die tausend Runzeln in seinem Gesicht tanzen ließ. Bomilkar schätzte ihn auf mindestens sechzig.
»Gut, ich danke dir. Kennst du dich aus in Karchedon?«
»Einigermaßen.«
»Kannst du mir ein Geldhaus nennen? Eines, das mit fernen Ländern handelt? Und eine gastliche Stätte, wo ein müder Reisender Unterschlupf suchen kann?«
Bomilkar verkniff sich ein Lächeln. Die griechischen Sätze klangen, als spräche sie einer aus einem anderen Jahrhundert.
»Komm«, sagte er, »ich bringe dich zu einem Geldhaus, und danach zeige ich dir eine Unterkunft für Reisende. Hast du viel Geld oder wenig?«
»Nicht viel, nicht wenig – Unterschlupf suche ich nur für eine Nacht, vielleicht zwei, bis ich ein wenig mehr gesehen habe und weiß, wo ich unter einem Baum schlafen und den Menschen meine Lehre verkünden kann.«
Bomilkar ging langsam nach Norden; der Fremde folgte. Dort, wo der Handelshafen endete und die gesperrte Durchfahrt zum Kriegshafen begann, befand sich auch der Hafeneingang der Sandbank.
»Wir müssen uns etwas beeilen«, sagte Bomilkar. »Wenn die Sonne sinkt, schließen die Herren des Geldes ihr Geschäft. Wie heißt du, und woher kommst du?«
»Ich bin Teschu, aus Indien. Wenn du weißt …«
»Ich weiß. Dort, wo Alexanders Krieger nicht mehr weitergehen wollten.«
Teschu nickte. »Dort, und dann noch viele Meilen, bis zu den himmelhohen Bergen; daher komme ich.«
»Ich bin Bomilkar, und es ist meine Aufgabe, in dieser Stadt den Frieden und die Ordnung zu hüten.«
Der Bewaffnete vor dem Eingang zum Bankhaus nickte Bomilkar zu. Der Inder sah sich um, als sie die Bank betraten. Ein Labyrinth bunter Säulen – dazwischen Tische, Bänke und Menschen – trug die Decke; vielfarbiges Licht gischtete durch eine große Öffnung von oben herab. In der Halle war es hell und angenehm kühl; die Steinplatten des Bodens waren hier und da mit großen Teppichen belegt, an den Seitenwänden prangten Bilder, die Episoden der Odyssee darstellten, und die Geschäftigkeit der Mitarbeiter und Kunden ergab etwas wie ein fernes Rauschen und Murmeln, aber kein Stimmengewirr.
Eine Treppe aus rötlich glimmendem Holz, mit gedrechselten Geländerstäben, führte ins obere Stockwerk zu den Schreibräumen der Eigentümer. Teschu blieb einen Moment am Fuß der Treppe stehen, blickte hinauf, seufzte leise und folgte Bomilkar zu einem der hohen Steintische, an denen man Geld wechseln und kleinere Geschäfte abwickeln konnte. Ein junger Punier begrüßte sie.
»Hüter der Ordnung«, sagte er, »was darf ich für dich tun?«
»Für mich nichts, aber für diesen Fremden hier, der sich unter meinen Schutz begeben hat.«
»Er ist dort gut aufgehoben. Was ist dein Begehr?«
Teschu nestelte unter seinem Wickelgewand und zog ein mehrfach gefaltetes Lederstück hervor. Darin, ebenfalls mehrfach gefaltet, war ein mit allerlei Siegeln und Stempeln versehener Papyros, den er dem Punier reichte.
»Ah.« Der Angestellte betrachtete das Schriftstück, drehte es hin und her und schüttelte langsam den Kopf. »Ich kann es nicht lesen.«
»Vielleicht sollte sich Bostar darum kümmern.«
»Ich will sehen, ob der Herr der Bank Zeit hat.«
Der Inder sah dem jungen Mann nach, der treppauf eilte. »Ist es angebracht, einen großen Mann mit einem kleinen Ding zu behelligen?«
Bomilkar lachte. »Manchmal sind große Männer froh, wenn sie sich mit kleinen Dingen befassen dürfen. Und wenn keiner sonst deinen Bankbrief lesen kann, muß es wohl einer der beiden Herren der Bank sein.«
»Ah, gibt es zwei?«
»Der andere ist punischer Hellene, Antigonos; er reist aber gern und viel und ist vielleicht gar nicht da.«
»Gern und viel reisen ist förderlich.« Teschu nickte nachdrücklich. »Wer viel sieht, erkennt früher als andere, daß alle Dinge nichtig sind. Auch feine Treppen.«
Bomilkar wußte nicht recht, was er darauf erwidern sollte, deshalb schwieg er, bis der Punier zurückkam. Ihm folgte ein etwa vierzigjähriger Mann mit grauen Schläfen. Er trug einen gewöhnlichen kitun. Erst bei näherem Hinsehen konnte man den feinen Goldsaum entdecken, der den knielangen Leibrock vom Gewand eines einfachen Mannes unterschied.
»Der Herr der Wächter«, sagte Bostar mit einem flüchtigen Lächeln. »Diesmal nicht in schlimme Verbrechen verwickelt?«
»Die Götter werden uns beizeiten mit neuer Finsternis versorgen, Herr«, sagte Bomilkar. Dann wechselte er vom Punischen in die koine. »Dies hier ist Teschu aus Indien. Er hat einen Bankbrief, den dein trefflicher junger Mitarbeiter nicht lesen kann.«
Bostar entließ den Angestellten mit einer Handbewegung und nahm den Papyros. Er pfiff leise, hob die Brauen und betrachtete den Inder. »Erstaunlich«, sagte er.
»Erleuchte mich, Herr«, sagte Bomilkar.
»Ich kann nicht alles lesen.« Bostar hob die Schultern. »Was ich lesen kann, sagt mir, daß die Gemeinschaft, der du angehörst, Teschu, nicht eben arm ist.«
Der Inder lächelte. »Wir sind auf die Gaben guter Menschen angewiesen, um essen und trinken zu können. Manchmal, vor allem in der Fremde, sind diese guten Menschen nicht so schnell zu finden. In der Zwischenzeit …«
»Das reicht für die Zwischenzeit. Wieviel willst du haben?«
Teschu wandte sich an Bomilkar. »Was braucht ein Bescheidener, um in eurer Stadt zu überleben?«
»Glück«, sagte Bomilkar. »Große Städte sind nichts für Bescheidene. Und Geld. Eine Familie braucht einen halben siglos am Tag oder etwas mehr. Aber du wirst mehr brauchen, du hast ja keine Behausung.«
»Bis ich einen Baum gefunden habe, zu dessen Füßen ich schlafen kann, und gute Menschen, die meine Bettelschale füllen … Fünfzig?«
Bostar nickte, winkte den jungen Mann wieder herbei und sagte auf Punisch: »Nimm ihn mit, gib ihm fünfzig shiqlu, groß und klein gemischt; ich bereite die Eintragung hier vor.«
Der Punier und der Inder gingen zu einem kleineren Steintisch; Bomilkar blickte hinterher und schüttelte den Kopf.
»Was ist das für eine Gemeinschaft, der er angehört? Und wieso kannst du lesen, was dein Mitarbeiter nicht enträtselt?«
Bostar hatte aus einer Vertiefung Papyros, Tinte und einen Halm genommen und zu schreiben begonnen. Ohne aufzublicken, sagte er:
»Es ist so etwas wie ein Tempel. Eine Art Bruderschaft von Priestern. Die indischen Zeichen kann ich nicht lesen, aber hier« – er deutete auf ein Gewirr von Strichen und Klecksen – »sind im Fernhandel mit dem Osten übliche Kürzel eines baktrischen Bank-hauses.«
»Darf ich fragen, wie ein solcher Handel, das Verschieben von Geld, abläuft?«
»Ganz einfach. Ich bestätige auf seinem Bankbrief, daß er Geld bekommen hat. Und fünf Hundertstel für unsere Leistung und Mittlerschaft. Auf diesem Papyros trage ich es für uns ein. Davon werden mehrere Abschriften gemacht. Irgendwann kommen Händler vorbei, die dort etwas zu erledigen haben. In Indien oder Baktrien. Dann wird es mit ihren Schulden oder Guthaben verrechnet. Wenn bis zum Ende des Jahres nichts geschehen ist, geht alles an die Königliche Bank in Alexandria; die verwalten die Geschäfte der östlichen Bankhäuser und verrechnen das mit unseren Schulden oder Guthaben.«
»Ich danke dir für die Erhellung, Herr.«
Bostar grinste flüchtig. »Sag Bescheid, wenn du Geld in Indien anlegen willst.«
»Ich kümmere mich lieber weiter um die Ordnung der Stadt; das erscheint mir weniger unsicher.«
Teschu kam zurück; im Gehen stopfte er Münzen in einen Beutel – Schekel, Halbschekel, Viertel und Achtel, soweit Bomilkar dies sehen konnte. Den Beutel steckte er ins Wickelgewand und barg ihn vor der Brust. Dort hing an einem dünnen Lederbändchen ein Gegenstand, wie Bomilkar ihn noch nie gesehen hatte: zwei aus Speichen oder gebogenen Metallstreben geformte Kugeln, verbunden durch einen ebenfalls metallenen Stab.
»Ah, eines noch, Herr«, sagte Bomilkar, als sie sich von Bostar verabschiedet hatten und gehen wollten. »Da du dich auskennst – gibt es Beziehungen zwischen seinem Tempel und einem der hiesigen?«
Bostar schob die Unterlippe vor. »Hm. Ich weiß nicht. Die vom Melqart-Tempel haben die engsten Beziehungen mit Suru – Tyros, weißt du«, setzte er in der koine hinzu, an Teschu gewandt. Er lächelte boshaft und fuhr auf Punisch fort: »Du kannst ja mit deinem besonderen Freund Hanno reden, er ist immer noch Hoher Priester des Melqart.«
»Ach nein, lieber nicht, Herr.«
Als sie die Bank verlassen hatten, erkundigte sich Teschu, der zumindest Bruchstücke verstanden hatte, was es mit der Freundschaft zwischen Bomilkar und Hanno auf sich habe.
»Das ist eine längere Geschichte«, sagte Bomilkar.
»Ich mag längere Geschichten. Aber sag mir zuerst noch, wenn du magst, wie es kommt, daß der Herr aller Wächter dieser großen Stadt sich um einen unwichtigen Reisenden kümmert.«
Bomilkar lachte. »Komm; ich bringe dich zu dem Tempel, den der Herr der Sandbank erwähnt hat. Sie liegt für mich am Weg. Ich habe mit einigen Wächtern in der Nähe des Hafens gesprochen, um einen alten Vorgang abzuschließen, und deine Art, die Welt durch die Nase aufzunehmen, hat mich bewegt, mit dir zu sprechen.«
Teschu hatte das gefaltete und gewickelte Leder mit Bostars Vermerk bis jetzt in der rechten Hand gehalten. Nun schob er es unter sein Gewand und sagte: »Die Nase erkennt, was den Augen entgeht. Gehört und geschaut hatte ich schon vorher. Ein Tempel, sagst du? Welcher? Wem ist er heilig?«
»Dem Baal Melqart, das heißt ›Herr der Stadt‹. Es gibt dort ein sehr altes Bildwerk aus Eisen. Heiliges Eisen, aus vom Himmel gefallenen Steinen, nicht Eisen aus der Erde.«
Der Inder blieb stehen. »Himmelseisen? Wie das hier.« Er klopfte sich an die Brust; Bomilkar nahm an, daß er den seltsamen Gegenstand meinte, der an seinem Hals hing. »Ist es der Gott, dem Kinder geopfert werden?« Er verzog das Gesicht.
»Das behaupten die Hellenen«, sagte Bomilkar. »In seinem Eisenmund werden totgeborene oder als Säugling gestorbene Kinder geopfert, damit der Gott der Stadt lebensfähige Kinder schenkt.«
»Ah. Und warum bringst du mich dorthin?«
»Da du ein Priester bist, werden dir andere Priester vielleicht zunächst weiterhelfen.«
»Möglich. Nun sprich von deiner Freundschaft mit diesem Hanno, wenn du magst.«
»Eigentlich mag ich nicht. Das liegt an der Innigkeit der Freundschaft. Aber …« Bomilkar hob die Schultern. »Wenn du es hören willst, sei es. Was weißt du über die Stadt und ihre Geschichte?«
»Eine große Stadt«, sagte Teschu, »und eine alte Stadt. Vor fast sechshundert Jahren von Menschen gegründet, die aus Tyros kamen, nicht wahr? Ihr beherrscht die Küsten und einen Teil des Hinterlands von der Grenze zu Ägypten im Osten bis zum Großen Ozean weit im Westen, und dazu den Süden des Landes Iberien. Und ich weiß, daß es einen langen Krieg mit Rom gab.«
Bomilkar nickte. »Da beginnt meine Freundschaft mit Hanno.«
Sie hatten den Hafen verlassen und gingen auf der Großen Straße nach Westen – nicht weit, nur ein paar Blocks, dann bogen sie nach Süden ab, um zum tofet zu gelangen, dem alten Opferplatz, an dem der größte Tempel des Baal Melqart lag. Dabei betrachtete Teschu die Menschen und die Geschäfte, die Arbeiten und Karren und das Gedränge, während Bomilkar gewohnheitsmäßig Ausschau nach auffälligen Vorgängen oder Dingen hielt. ›Wir sehen die gleichen Gegenstände und Bewegungen‹, dachte er, ›aber wir nehmen anderes wahr.‹ Und während sie gingen und schauten, versuchte er, dem Fremden in kurzen Sätzen die Zusammenhänge zwischen Krieg und jener besonderen Freundschaft zu erläutern.
»Vor sechsunddreißig Jahren«, sagte er, »als ich noch nicht geboren war, hat es begonnen – auf Sizilien. Weißt du, wo das ist?«
Teschu nickte, und Bomilkar berichtete von dem alten Vertrag zwischen Rom und Qart Hadasht – »Karchedon«, sagte er, da sie die hellenische koine verwendeten, »die Römer nennen es Karthago« –, über die Grenzen und den Frieden: Die Punier besaßen alte Stützpunkte im Westen Siziliens, der Rest der großen Insel war teils von alten Völkern wie den Elymern, teils von zugewanderten Hellenen bewohnt und beherrscht, und Rom hatte sich verpflichtet, nicht nach Sizilien zu greifen. Im Krieg gegen Pyrrhos – der Inder nickte und sagte: »Einer der Diadochen, ein paar Jahrzehnte nach dem Tod des großen Alexander, nicht wahr?« – half Qart Hadasht den Römern, und als schweifende Söldner, Mordbrenner, die Stadt Messana auf Sizilien einnahmen und gegen einen Angriff aus Syrakus punische Hilfe erbaten, verweigerte Qart Hadasht diese, weil die alten Verträge die Punier auf den Westen der Insel beschränkten. Darauf wandten die Mörder sich an Rom, und die Römer brachen den Vertrag, indem sie Truppen nach Sizilien schickten.
»So begann der Krieg«, sagte Bomilkar, »und er dauerte dreiundzwanzig Jahre. In seinem sechzehnten Jahr gelang es uns, alle römischen Flotten zu versenken. Und hier beginnt meine Liebe zu Hanno.«
Es habe damals, fuhr er fort, in der Stadt zwei Gruppen gegeben – die »Alten«, zu deren Führer sich Hanno machte, wollten ihren Reichtum bewahren, ihre Landgüter und ein wenig Handel mit abhängigen Gebieten betreiben; die »Neuen« wollten offenen Fernhandel mit der ganzen Welt. Die »Alten« meinten, Rom werde irgendwann den Krieg einstellen, und da sie mächtig waren, sorgten sie dafür, daß die siegreichen Flotten nicht weiter eingesetzt, daß keine Truppen zusätzlich nach Sizilien geschickt wurden, wo ein Stellungskrieg ausgetragen wurde. Statt dessen schickten sie Krieger ins Hinterland, um die libyschen Bauern zu unterdrücken und die Landgüter zu sichern.
»Und die ›Neuen‹?«
Bomilkar seufzte. »Die ›Neuen‹ wußten, daß Rom nicht aufgeben, keinen Verhandlungsfrieden schließen wird, aber sie konnten sich nicht durchsetzen. Und die Römer bauten neue Flotten, verstärkten ihre Truppen auf Sizilien, so ging schließlich der Krieg verloren. Der beste Feldherr war ein ›Neuer‹, Hamilkar, genannt baraq, das ist Blitz, und daraus wurde ›Barkas‹ im Sprachengemisch des Heeres. Er kam aus dem Krieg und übernahm die Führung der ›Neuen‹, und er wollte, daß seine Krieger, die aus Sizilien heimkehrten, den vereinbarten Sold erhielten. Aber Hanno und die ›Alten‹ meinten, das sei nicht mehr nötig, und außerdem sei nicht genug Geld vorhanden, denn wir mußten ja nicht nur den Römern Sizilien abtreten, sondern ihnen auch noch viel, sehr viel Silber zahlen. So kam es zum nächsten Krieg, dem Krieg der unbezahlten Söldner gegen die Stadt, der fast zu unserem Untergang geführt hätte. Am Ende rettete Hamilkar Qart Hadasht; mit neuen Truppen mußte er gegen seine alten Krieger ziehen. Und als diese besiegt waren, schickte Rom eine weitere Gesandtschaft; sie verlangte noch mehr Silber und die Übergabe der anderen großen Inseln, Sardinien und Korsika. Andernfalls – Krieg, für den Qart Hadasht allzu erschöpft war. Hamilkar wußte, daß es früher oder später zum nächsten Römischen Krieg kommen wird, und um die Stadt dafür zu stärken, beschloß er, den punischen Besitz in Iberien auszubauen, Land zu erobern. Dort ist er im vorigen Sommer gefallen.«
»Und du? Wie bist du zum Herrn der Wächter geworden?«
Sie hatten den Tempel erreicht. Bomilkar winkte einen Tempelsklaven herbei und befahl ihm, einen Priester zu holen. Als der Sklave verschwand, sagte er:
»Ich stamme aus einer anderen Stadt, Ityke, die von den Söldnern verwüstet wurde. Dabei sind meine Eltern und viele aus der übrigen Familie umgekommen; ich war bei Hamilkars Truppen. Mit ihm bin ich nach Iberien gegangen und später, vor ein paar Jahren, hergekommen, um die Büttel zu leiten und die Ordnung zu hüten.«
»Wie es Hamilkar gefiel?«
Bomilkar lächelte. »Und wie es Hanno mißfällt. Nun weißt du es. Und da ist einer der Priester.«
Ein älterer Mann kam langsam zu ihnen, musterte Bomilkar mit leicht gehobenen Brauen, dann ohne sichtbare Neugier den Inder. »Herr der Wächter?« sagte er.
»Hüter des Heiligtums – dies hier ist ein weitgereister Priester. Ich weiß nicht, welchen Gott er verehrt, aber da Baal Melqart erhaben und gastfreundlich ist …«
Der Priester nickte. »Wir werden ihn aufnehmen und als Gast betrachten. Spricht er eine geläufige Zunge?«
»Die koine.«
Der Baal-Priester neigte den Kopf vor Teschu und wechselte in die hellenische Verkehrssprache. »Freund der Götter, tritt ein und sei unser Gast.« Er hob den linken Arm und wies in den Innenhof des Tempels.
»Ich danke dir und deinem Gott.« Teschu verneigte sich ebenfalls gemessen; dann wandte er sich an Bomilkar. »Und dir, Herr der Wächter, danke ich für die Hilfe und das Geleit.«
»Gehab dich wohl.« Bomilkar berührte ihn an der Schulter. »Und irgendwann in den nächsten Tagen mußt du mir von der Nichtigkeit aller Dinge erzählen. Und von deiner Reise.«
»Vom Großen Nichts, ja, und vom Rad der Dinge. Leb wohl bis dahin.«
Vom Tempel ging Bomilkar zum Karrenschuppen, in dem einige Männer Fahrzeuge ausbesserten oder bauten und verkauften. Tatsächlich sammelten sie Nachrichten von den weitgereisten Händlern, denen sie Karren und Ausbesserungen anboten – Nachrichten, die Bomilkar nach geziemender Prüfung an den Strategen von Libyen und Iberien weiterleitete, der nicht mehr Hamilkar Barkas hieß. Nachfolger des Unersetzlichen war auf Beschluß des iberischen Heers sein Schwiegersohn geworden, Hasdrubal, genannt »der Schöne«.
Im Schuppen gab es keine wichtigen Neuigkeiten. Bomilkar bat seine Leute, hin und wieder ein Auge auf den Mann aus Indien zu werfen; und am nächsten Tag wies er seinen Stellvertreter Autolykos und andere Unterführer der Büttel ähnlich an. Einer der anderen, Mutumbal, fragte nach dem Grund. »Was ist an einem von tausend Fremden wichtiger als an den sonstigen?«
Bomilkar hob die Schultern. »Er kommt aus einer sehr weiten Ferne und hat unterwegs vielleicht etwas gehört, was für uns nützlich zu wissen wäre. Und vielleicht ist er nicht nur ein harmloser Priester und Pilger. Man kann nie wissen.«
Danach begab er sich zum Ratsgebäude – einer der Richter hatte ihn zu einer späten Unterredung bestellt, um einen Fall zu besprechen. Abzuschließen, genauer; in den Bergen aus noch zu brennenden Tontafeln und beschriebenen Papyrosblättern fehlten einige Angaben und die Unterschrift des Herrn der Wächter. Ein Mörder war hingerichtet worden, ein Mann, der ihm bei der Tat geholfen hatte, sollte bis ans Ende seiner Tage dem Gemeinwohl dienen, indem er seine beträchtliche Kraft auf die guten Werke verwandte, die in einem Steinbruch verrichtet wurden. Ein riesiger Kerl namens Agizul; er kam aus den mauretanischen Bergen und hatte zum Abschied geschworen, diese, seine Heimat, wieder aufzusuchen und auf dem Weg dorthin Bomilkar langsam umzubringen. Vielleicht auch den Richter Adonibal, aber ganz gewiß Bomilkar.
Als alles erledigt war, suchte Bomilkar nach dem Schreiber Himilko, der ihn hatte sprechen wollen, konnte ihn aber nicht finden und litt nicht darunter.
Dies hatte sich vor zwei Tagen zugetragen. Am nächsten – inzwischen gestrigen – Tag hatten andere Dinge Bomilkar so sehr beschäftigt, daß er nicht mehr dazu gekommen war, an den Inder zu denken.
Der nun tot war. Ermordet im Reich der Herren des Zwielichts, dem Labyrinth. Und Bomilkars Nackenhaare, die sich nicht richtig glätten lassen wollten, sagten ihm, daß etwas daran nicht so war, wie es sich für einen ordentlichen Mord im Labyrinth gehörte.
»Wer hat ihn gefunden?« sagte er. »Und wo genau?«
Autolykos ließ das Schreibzeug sinken, lehnte sich zurück und faltete die Hände hinter dem Kopf. »Ja, nicht wahr? Alles ungewöhnlich. Leute, die am Rand des Labyrinths wohnen, haben unsere Männer gerufen und zu dieser Gasse geführt. Gleich links hinter dem Tor der Tränen.«
»Wo ist die Leiche?«
Autolykos hob den rechten Ellenbogen, als wollte er mit ihm auf eine bestimmte Stelle der Wand deuten. »Bei Artemidoros; damit der mal wieder etwas zu zerschneiden hat.«
»Was machst du daraus?«
»Aus dem Zerschneiden? Nichts.« Autolykos grinste.
»Ernsthaft; du weißt, was ich meine.«
»Ich finde es … beunruhigend.« Autolykos löste die verschränkten Hände, beugte sich vor und stützte die Ellenbogen auf den Tisch. »Die Herren des Zwielichts legen Leichen gewöhnlich nicht so hin, daß man sie findet. Wie du weißt. In die Bucht, auf den Abfall, in einen entlegenen Garten, meinetwegen auf Tempelstufen.«
»Ah«, sagte Bomilkar.
»Ah, genau; möglicherweise auch oh.«
»Sieht aus wie eine Botschaft. Aber von wem für wen?«
Autolykos knurrte leise. »Für uns, wahrscheinlich. Von wem? Keine Ahnung. Und ich weiß auch nicht, was der Inhalt der Botschaft ist.«
»Dann wollen wir ein bißchen graben.« Bomilkar erhob sich von der Bank. »Liegt sonst etwas an?«
»Das, was immer anliegt.« Autolykos schielte auf die Papyrosfetzen. »Eine Messerstecherei auf dem Markt, vor dem Tynes-Tor; ein Karawanenmann vermißt drei Kamele, wahrscheinlich diese Nacht gestohlen; ein paar Einbrüche; und eine gewöhnliche Leiche.«
»Wie gewöhnlich?«
»Der Herr mehrerer Mietshäuser draußen am Seeufer. Niemand hat ihn gemocht; er war unfreundlich, heißt es, und hat hohe Mieten für schlechte Unterkünfte genommen.«
»Kümmere du dich darum.« Bomilkar überlegte einen Lidschlag lang. »Die Jungs von der nächstgelegenen Wachstube sollen feststellen, wo sich der Inder aufgehalten hat. Und fragen; vielleicht hat ja jemand etwas gesehen. Ich gehe zu Artemidoros. Bis gleich.«
»Ah«, sagte Autolykos. »Eh.«
Bomilkar blieb in der Tür stehen und drehte sich um. »Und zwar?«
»Bei all dem Gerede über Leichen habe ich einen Lebenden vergessen.« Autolykos runzelte die Stirn. »Dumm von mir.«
»Sprich dich aus. Möglichst noch heute.«
Der Kampanier nickte. »Agizul«, sagte er.
Bomilkar dachte an den Riesen mit seinen Muskelbergen und der ausgefransten Narbe auf der Wange; er bleckte die Zähne. »Was ist mit ihm?«
»Er hat es geschafft, kurz hinter Tynes die Ketten zu sprengen und zu fliehen. Es heißt, er sei nicht nach Westen geflohen, zu seiner Heimat, sondern nach Osten.«
»Dann werden wir ihn willkommen heißen.«
»Ich habe unsere Leute angewiesen, nach ihm zu suchen.« Autolykos blinzelte. »Sieh dich jedenfalls vor.«
2. KAPITEL
Bomilkar mußte ein paar Atemzüge lang warten, bis er eine Lücke zwischen den Karren, Packtieren, Lastträgern und allem anderen nutzen konnte. Auf der Großen Straße, die vom Hafen nach Westen zum Tynes-Tor, dem Markt und den Vorstädten verlief, herrschte das übliche Vormittagsgedränge. An der Südseite des Tors lagen die Hauptwache der Büttel und die Unterkünfte für die Männer, die nicht woanders mit oder ohne Familien lebten. Nördlich der Straße begann die mächtige Festungsanlage der Isthmos-Mauer, und dort lagen auch die Behandlungsräume des Arztes.
Aus dem hinteren Zimmer stank es nach Blut und Eingeweiden. Bomilkar rümpfte die Nase, warf einen Blick in den ersten Raum und folgte dem Geruch. Er fand Artemidoros zwischen zwei hohen Tischen. Die Leiche auf dem linken Tisch war zugedeckt, in der auf dem rechten stocherte der Arzt mit einem langen spitzen Messer. Ohne aufzublicken, sagte er:
»Die Hufschläge des Herrn der Büttel, wenn ich mich nicht irre.«
Bomilkar verspürte keinerlei Bedürfnis, sich den Tischen zu nähern. »Hast du ein neues Duftwasser?«
»Netter Scherz.« Artemidoros stieß eine Art Glucksen aus, legte das lange Messer auf den dritten, kleineren Tisch, fast zwischen die Köpfe der Toten, und berührte eine große Schüssel, die ebenfalls dort stand. »Möchtest du wissen, wie die Innereien beschaffen sind? Oder was er zuletzt gegessen hat?«
»Wer? Der eine oder der andere Tote? Wen hast du denn eigentlich da?«
»Den Inder« – Artemidoros blickte auf die Leiche hinab, an der er zuletzt gearbeitet hatte; dann wies er mit dem Kinn auf den anderen Tisch – »und den Hausbesitzer. Die dritte Leiche liegt nebenan und harrt der Eröffnung.«
»Von einer dritten Leiche weiß ich nichts.«
Der Arzt wandte sich ihm zu und verzog das Gesicht zu einem grimmigen Lächeln. »Ganz frisch, eben erst von deinen Leuten geliefert. Ich wünschte, der Fisch auf dem Markt wäre immer so frisch wie der Kerl nebenan.«
»Es stinkt«, sagte Bomilkar. »Können wir die erfreuliche Unterredung vielleicht woanders fortsetzen?«
»Die rosige Daimonin der Empfindsamkeit scheint dich heute zu behausen, Junge; aber wenn du es so willst …«
Bomilkar ging voraus ins vordere Zimmer. Hinter sich hörte er, wie Wasser in eine Schüssel gegossen wurde. Offenbar wusch sich Artemidoros die Hände; dabei pfiff er mißtönend durch die Zähne. Bomilkar betrachtete die von Papyros, Schreibhalmen und allerlei Gegenständen übervölkerte Platte des Schreibtischs. Eine kleine Sphinx war dabei, ein besonders häßliches Geschöpf mit Segelohren und langen Reißzähnen, das auf einem Hügel aus Papyrosfetzen thronte und so aussah, als wollte es durch heftiges Drücken Kot ausscheiden, diesem dann die Beschwerung der Fetzen überlassen und sich auf den Betrachter stürzen.
Bomilkar schnalzte leise, grinste und ließ sich auf den Stuhl vor dem Schreibtisch sinken.
»Und welche der Früchte des Totenbaums bringt dich zu mir?« Der Arzt kam vom Gang ins Zimmer, klopfte Bomilkar auf die Schulter, schlurfte seitwärts zwischen den Regalen und dem Tisch hindurch zur Fensteröffnung, lehnte das Gesäß an die Simskante und starrte Bomilkar an.
»Der Inder – aber was ist mit dem dritten Toten?«
Artemidoros hob die Schultern. »Überfahren, auf dem Markt. Die haben ihn zu mir gebracht, weil bekanntlich der blöde Alexandrier für die Beseitigung aller Leichen der Umgebung zuständig ist.«
»Also nichts, was auf ein Verbrechen hindeutet?«
»Nichts.« Der Arzt verschränkte die Arme vor der Brust. »Angeblich hat jemand ihn im Gedränge gestoßen, und dann ist er von einem Karren überrollt worden. Hals und Teile des Brustkorbs sind zerquetscht.«
Bomilkar nickte. »Hört sich gewöhnlich an. Weiß jemand, wer er ist? Wo er wohnt? Angehörige?«
»Frag deine Leute.«
»Hat er etwas bei sich? Im Gürtel? In einer Tasche?«
»Ich werde gleich nachsehen. Was ist mit dem Inder?«
Bomilkar rieb sich die Nase. »Er ist vor ein paar Tagen angekommen, mit einem Schiff aus deiner Heimat. Ich habe ihn zum Melqart-Tempel gebracht, wo sie ihn als Gast aufnehmen wollten. Mehr weiß ich nicht.«
Artemidoros grunzte, löste die Verschränkung der Arme und setzte sich in seinen Scherensessel. »Aber ich«, sagte er dabei. »Nicht viel, aber immerhin.«
»Und zwar?«
Der Arzt griff zu einem gründlich breitgekauten Schreibhalm und begann damit zu spielen. »Etwa zu der Zeit«, sagte er halblaut, »als der König in Alexandria beschloß, uns Ärzten zu besonderer Fortbildung zu verhelfen …« Er machte eine Pause und blickte von dem Halm auf.
Bomilkar nickte. Die Ptolemaier hatten vor Jahrzehnten befunden, daß zum Tode Verurteilte dem Staat und dem Wissen durchaus noch nützlich sein konnten, wenn sie von lerneifrigen Ärzten langsam und gründlich zerlegt wurden. Vor dem Tod.
»Ich weiß«, sagte er. »Und ich hoffe, meinen Tod fern von Alexandria verbringen zu dürfen.«
»Selbstsüchtiger Wunsch.« Artemidoros schob die Unterlippe vor. »Etwa zu dieser Zeit hat ein indischer Herrscher namens Asoka, oder so ähnlich, Gesandte der besonderen Art zu allen Fürsten geschickt, die sich um das Erbe des großen Alexandros stritten. Gesandte, die jenen Glauben verbreiten sollten, dem Asoka anhing. Ich glaube, dein toter Inder nebenan ist so einer.«
»Möglich; er hat etwas von seiner Lehre gesagt, und daß er zu den Menschen reden will. Was ist das für ein Glaube? Und könnte er nicht auch einem anderen angehören?«
Artemidoros wackelte mit dem Kopf. »Ich bin kein Fachmann für indische Formen des Aberglaubens. Vielleicht wissen die Melqart-Priester mehr, die ihn aufgenommen haben. Ich meine aber, die anderen heiligen Männer Indiens hätten Zeichen am Körper, farbige Punkte, aus denen man dies und das lesen kann. Der hier hat so etwas nicht.«
»Na schön. Jedenfalls kam er aus Indien, hieß Teschu und ist tot. Wie ist er gestorben?«
»Das haben dir deine Leute doch sicher schon gesagt. Man hat ihm die Kehle geschlitzt und den Bauch geöffnet. Ich glaube aber, daß man ihn vergiftet hat. Vorher.«
»Warum glaubst du das?«
»Der Inhalt seines Magens und Gedärms. Nur Getreide, Früchte und Gemüse, dazu Wasser – kein Fleisch, kein Fisch, kein Wein.« Der Arzt bleckte die Zähne und grinste. »Vergiftet, wie ich sagte.«
»Und der andere?«
»Den hat man, wie deine Leute sagten, im Innenhof eines seiner Häuser gefunden.« Artemidoros lehnte sich in seinem Sessel zurück und faltete die Hände hinter dem Kopf. »Er hat sich totgefallen, könnte man sagen. Ein paar mindere Quetschungen an den Oberarmen, ansonsten die üblichen Dinge, die man bei einem findet, der aus größerer Höhe fällt und sich das Genick bricht.«
»Oberarme?« Bomilkar kniff die Augen halb zu. »So, als ob ihn jemand gepackt und gehalten und dann über ein Geländer gestoßen hätte?«
»So etwa. Er wird schon nicht freiwillig gesprungen sein, und ein Sturz aus Versehen oder Leichtsinn? Bah.«
»Kannst du mir etwas über das Alter der Leute sagen?«
»Dein Inder … schwer zu sagen, vielleicht fünfzig. Der vom Dach Gefallene auch. Und der Überfahrene? Vierzig? Ein paar Jahre mehr oder weniger.«
»Irgendwas gefällt mir nicht«, sagte Bomilkar halblaut. Er schüttelte den Kopf.
»Was denn?« Artemidoros musterte ihn. »Etwas Bestimmtes, oder nur ein Gefühl?«
»Ein bestimmtes Gefühl.«
Der Arzt seufzte. »Du und deine Gefühle! Aber … ich werde sie mir alle noch einmal vornehmen. Bis morgen abend kann ich sie aufbewahren, unten, wo es etwas kühler ist. Danach …« Er faßte sich an die Nase.
»Na gut. Dann laß uns noch einen Blick auf das werfen, was die drei bei sich hatten. Ist alles da?«
Artemidoros stieß einen schrillen Pfiff aus, ohne Miene und Haltung wesentlich zu ändern. Aus einem der hinteren Räume näherte sich mit hörbar uneiligen Schritten einer seiner Sklaven.
»Bring uns die drei Bretter mit dem Zeug«, sagte Artemidoros. Als der Sklave wieder verschwunden war, setzte der Arzt hinzu: »Alles da, wie immer; du hast deine Leute gut erzogen.«
Bomilkar lächelte flüchtig. »Es war nötig.«
Sie schwiegen, bis der Sklave das erste Brett brachte und auf einen langen schmalen Tisch vor den Regalen legte.
Bomilkar stand auf, ging zum Tisch, beugte sich über den Stapel schmieriger Habseligkeiten und rümpfte die Nase. »Der Überfahrene, nehme ich an.«
Artemidoros grunzte nur.
Sandalen, ein löchriger Leibschurz mit allerlei Spuren von Ausscheidungen, ein ebenso löchriger Chiton, ein Tuchfetzen, in den ein paar kleine Münzen gewikkelt waren, ein Ohrring – Gold, aber dünn und nahezu wertlos – und ein Lederband mit kurzen Knotenschnüren und ein paar bunten Glasperlen. Bomilkar legte Münzen, Ohrring und Armband an den Rand des Bretts; mit spitzen Fingern faßte er den Chiton an und hielt ihn hoch, um ihn genauer zu betrachten. Er drehte ihn von außen nach innen, besah ihn sich von vorn und hinten und schätzte, daß der Leibrock zu etwa einem Viertel aus Löchern bestand.
»Trefflich«, sagte Artemidoros. »Ein prachtvolles Gewand mit einem seltsamen Zeichen. Wer bestickt so einen kitun?«
Bomilkar nickte. »Nicht bestickt, aufgenäht«, murmelte er. Es handelte sich um ein etwa daumenlanges Tuchstück, das einen Palmwedel darstellen mochte und irgendwann einmal grün gewesen war; jahrelanges Waschen hatte nur noch geringe Farbspuren übriggelassen.
Das zweite Brett trug die Hinterlassenschaften des Inders: Leibschurz und Wickeltuch, beide blutgetränkt, und das Lederstück mit dem Papyros, auf das zuletzt Bostar von der Sandbank Zeichen gekritzelt hatte. Bomilkar seufzte leise, nahm den umwickelten Papyros an sich und sagte:
»Sonst nichts?«
Artemidoros runzelte die Stirn. »Was erwartest du? Ein indischer Pilger schleppt nicht viel Besitz mit sich, weil er nichts besitzt.«
»Er hatte Geld. Und ein Schmuckstück, eine Art Amulett, an einem Lederbändchen.«
»All das hält sich wahrscheinlich bei dem auf, der ihn vom Leben zum Tod befördert hat.«
Auch das dritte Brett war karg: Sandalen, ein Chiton aus Leinen und Wolle, ein Leibschurz.
»Er wird Schmuck besessen haben«, sagte Artemidoros. »An den Fingern sind Spuren von Ringen, und er hat Löcher in beiden Ohren. Aber …« Er zuckte mit den Schultern.
»Der Mann, der überfahren wurde, war sofort tot«, sagte Bomilkar. »Der hier vermutlich auch, oder?«
»Ja und nein. Ich sagte schon, Druckspuren an den Oberarmen …«
»Können die auch älter sein?«
Artemidoros nickte. »Können sie, aber nicht viel. In den letzten Stunden vor seinem Tod hat jemand ihn an den Oberarmen gepackt und gedrückt. Das hat er natürlich überstanden. Den Sturz hat er nicht überlebt, und an diesem Sturz ist er gestorben – keine vorherige Vergiftung oder derlei. Und um ihn zu plündern, braucht man nicht viel Zeit. Der Inder dagegen …«
»Was ist mit ihm?«
»Die Leute, die ihn hergebracht haben, sagen, daß er nicht in einer großen Lache gelegen hat. Blut war da, auch an den Kleidern, aber nicht genug … Hals und Bauch. Ich nehme an, er ist woanders getötet worden, und dann hat man ihn dorthin gelegt, wo deine Männer ihn gefunden haben. Als ich ihn untersucht habe, war er ungefähr sechs Stunden tot.«
»Wie ungefähr?«
Artemidoros betrachtete seine Fingerspitzen. »Sechs bis acht, meinem feinen Gefühl und Wissen zufolge«, sagte er. »Hängt davon ab, wie kalt oder warm es dort war, wo er gelegen hat. Stell fest, wie schnell deine Leute ihn gefunden und hergebracht haben, dann …« Mit dem Kinn wies er auf eine Sanduhr. Sie stand in einer Fensternische, war verstaubt und zweifellos lange nicht mehr umgedreht worden.
›Netter Vorschlag‹, dachte Bomilkar, als er den Arzt verließ. Er kam jedoch zunächst nicht weit. Auf der Straße, die zwischen der riesigen Festungsmauer und den nächsten Gebäuden nordsüdlich verlief, zog ein Trupp von Treibern oder Pflegern mit zehn Elefanten vorüber, offenbar auf dem Weg von den Weideplätzen zu Stallungen in der Mauer. Zerstreut fragte er sich, warum; ob ein Einsatz geplant war? Vielleicht sollten sie nach Iberien verschifft werden – oder es war einfach die Zeit für besondere Pflege oder Untersuchungen.
Zeit. Auf der Agora gab es eine von den Ratsdienern gewartete Wasseruhr, und jeden Mittag blies dort ein Wächter das große Horn. In einigen Tempeln und den Häusern mancher Reichen mochte es ebenfalls solche Klepsydren geben, natürlich auch Sand- und Sonnenuhren. Aber für die gewöhnlichen Menschen genügten Sonnenauf- und -untergang, das Mittagshorn und die gefühlte Länge der zu verrichtenden Arbeiten. ›Wer muß es denn so genau wissen, außer bei Leichen?‹ sagte er sich. ›Wer lebt, befindet sich in der Zeit, und wirklich meßbar wird sie erst, wenn man sich außerhalb ihrer begibt. Oder ist das ein Denkbetrug?‹
Er folgte der Elefantengruppe nach Norden, um den Herrn der Festung aufzusuchen. Es gab nichts Wichtiges zu bereden, aber der Stratege Giskon und Bomilkar, die Wächter über die äußere und innere Sicherheit der Stadt, hatten sich daran gewöhnt, einander einmal alle zehn Tage aufzusuchen und Kenntnisse auszutauschen. Und Bomilkar wollte Giskon bitten, die mit Pferden befaßten Leute der Festung Ausschau nach einem riesigen Pferdeknecht mit einer Narbe halten zu lassen.
Giskon war jedoch nicht in seinen Räumen. Einer der Schreiber hob die Schultern, als Bomilkar nach ihm fragte.
»Er ist im Rat«, sagte er.
Bomilkar runzelte die Stirn. »Gibt es etwas, das ich wissen sollte?«
»Ich glaube nicht, Herr. Irgendeiner der hochmögenden Fürsten will eine Reise antreten und vorher sein Wissen ergänzen.«
»Wohin reist er?«
»Nach Rom.«
Bomilkar pfiff leise durch die Zähne. »Dann wird Giskon ihm genau sagen, was er dort zu verschweigen hat, nehme ich an.«
Der Schreiber grinste. »Können Ratsherren schweigen?«
»Weiß man’s? Aber du, sei so gut und schreib einen Befehl an die Pferdeleute. Auf den Koppeln und in den Ställen.«
»Was soll ich ihnen befehlen?«