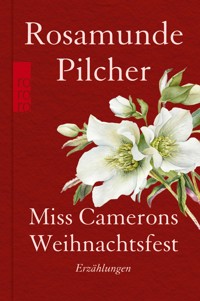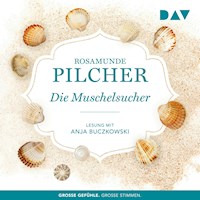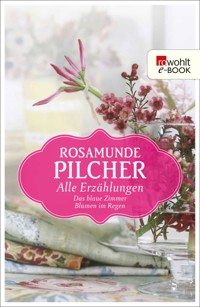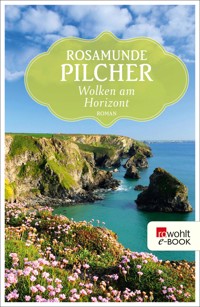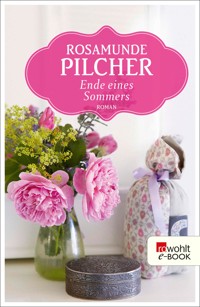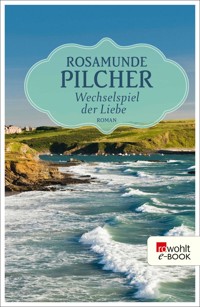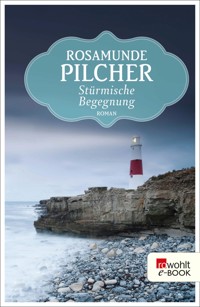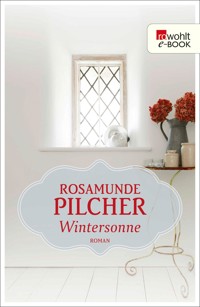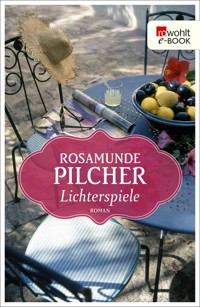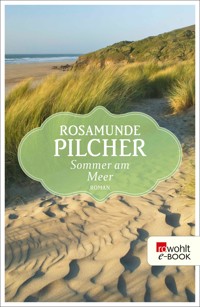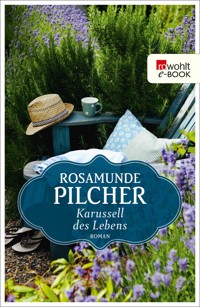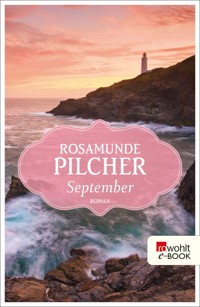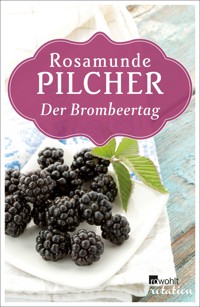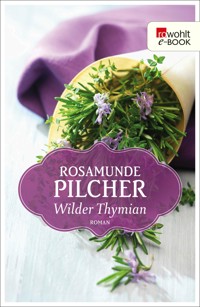9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine unvergessliche Familiensaga. Penelope Keeling kann zurückblicken auf ein langes und bewegtes Leben. Ihr liebster Besitz: ein Gemälde mit dem Titel «Die Muschelsucher», das ihr Vater einst malte. Als ihre Kinder erfahren, dass das Werk mittlerweile ein Vermögen wert ist, entbrennt ein heftiger Streit darum. Doch Penelope kann sich nicht von dem Bild trennen. Zu viele Erinnerungen sind damit verbunden: an ihre unkonventionelle Kindheit in Cornwall, eine Zeit unbeschwerten Glücks, aber auch an die Kriegsjahre, eine unglückliche Ehe – und natürlich an ihre große Liebe. Und je tiefer die Erinnerungen sie in die Vergangenheit ziehen, desto klarer wird Penelope, dass sie die vor ihr liegenden Entscheidungen nur mit dem Herzen treffen kann … Rosamunde Pilchers berühmtester Roman – ein Welterfolg.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1089
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Rosamunde Pilcher
Die Muschelsucher
Roman
Aus dem Englischen von Jürgen Abel
Rowohlt E-Book
Inhaltsübersicht
Dieses Buch ist für meine Kinder –
und für deren Kinder
Prolog
Das Taxi, ein alter Rover, in dem es nach abgestandenem Zigarettenqualm roch, rumpelte gemächlich die leere Landstraße entlang. Es war Ende Februar, ein herrlicher, sehr kalter Nachmittag, mit einem bleichen und wolkenlosen Himmel. Die Sonne warf lange Schatten, spendete aber so gut wie keine Wärme, und die gepflügten Felder waren eisenhart gefroren. Aus den Schornsteinen vereinzelter Farmen und kleiner Steincottages stieg Rauch kerzengerade in die unbewegte Luft, und Grüppchen von Schafen, die schwer an ihrer Wolle und dem in ihnen heranwachsenden Leben trugen, drängten sich um die mit frischem Heu gefüllten Futtertröge.
Hinten im Wagen saß Penelope Keeling. Sie hatte lange durch das staubige Fenster geblickt und war zu dem Schluss gekommen, dass sie die vertraute Landschaft ringsum noch nie so schön gesehen hatte.
Die Straße machte eine scharfe Kurve, und der hölzerne Wegweiser, der die Abzweigung nach Temple Pudley zeigte, kam in Sicht. Der Fahrer bremste, schaltete krachend in den zweiten Gang und bog in die abschüssige, von hohen Hecken gesäumte Straße ein, die die Aussicht verwehrten. Wenige Augenblicke später waren sie im Dorf mit seinen golden leuchtenden Steinhäusern, dem Zeitungsladen, der Metzgerei, dem Sudeley Arms und der Kirche, die durch einen alten Friedhof und einige dunkle Eiben von der Straße getrennt war. Es war fast niemand zu sehen. Die Kinder waren in der Schule, und wer irgend konnte, blieb in der bitteren Kälte zu Hause. Nur ein alter Mann mit Fäustlingen und einem dicken Schal führte seinen noch älteren Hund aus.
«Wo ist es?», fragte der Taxifahrer über seine Schulter hinweg.
Sie beugte sich vor und wurde sich einer lächerlichen Nervosität und Vorfreude bewusst. «Noch ein kleines Stück. Am Ende des Dorfs. Das weiße Tor rechts. Es ist offen. Da. Das ist es.»
Er fuhr durch das Tor und hielt an der Rückseite des Hauses.
Sie öffnete die Wagentür, stieg aus und zog das dunkelblaue Cape enger um sich, als sie von der Kälte getroffen wurde. Sie öffnete ihre Tasche, suchte den Schlüssel, ging zur Tür und schloss auf. Der Taxifahrer klappte den Kofferraum auf und holte ihren kleinen Koffer heraus. Sie drehte sich um, um ihn zu nehmen, aber er hielt ihn besorgt fest.
«Ist denn niemand da, der Sie erwartet?»
«Nein, niemand. Ich lebe allein, und sie denken alle, ich sei noch im Krankenhaus.»
«Schaffen Sie es allein?»
Sie lächelte in sein freundliches Gesicht. Er war noch ziemlich jung und hatte wuscheliges blondes Haar. «Natürlich.»
Er zögerte, wollte sich nicht aufdrängen. «Wenn Sie möchten, trage ich den Koffer hinein. Ich kann ihn auch nach oben bringen.»
«Oh, das ist sehr freundlich von Ihnen. Aber ich schaffe es sehr gut …»
«Gern geschehen», unterbrach er und folgte ihr in die Küche. Sie öffnete eine Tür und führte ihn eine schmale Holztreppe hinauf. Alles roch klinisch sauber. Die gute Mrs. Plackett war in den paar Tagen, die Penelope fort gewesen war, nicht untätig geblieben. Es war ihr ganz lieb, wenn Penelope ab und zu fortging, weil sie dann die Dinge tun konnte, zu denen sie sonst nicht kam, zum Beispiel die weiß gestrichenen Treppenstäbe abwaschen, Putzlappen auskochen und das Messing und Silber polieren.
Die Schlafzimmertür stand weit offen. Sie ging hinein, und der junge Mann folgte ihr und stellte den Koffer ab.
«Kann ich sonst noch etwas für Sie tun?», fragte er.
«Nein, vielen Dank. Was bin ich Ihnen schuldig?»
Er sagte es leise und ein bisschen verlegen, als wäre es ihm peinlich.
Sie bezahlte und ließ sich das Wechselgeld nicht herausgeben. Er bedankte sich, und sie gingen die Treppe wieder hinunter.
Aber er zauderte und schien nicht gehen zu wollen. Wahrscheinlich, sagte sie sich, hat er eine alte Großmutter, für die er die gleiche Verantwortung empfindet.
«Sie kommen wirklich zurecht, ja?»
«Aber sicher. Und morgen kommt meine Freundin, Mrs. Plackett. Dann werde ich nicht mehr allein sein.»
Das beruhigte ihn aus irgendeinem Grund. «Dann gehe ich jetzt.»
«Auf Wiedersehen. Und vielen Dank.»
«Keine Ursache.»
Als er fort war, trat sie wieder ins Haus und machte die Tür zu. Sie war allein. Welch eine Erleichterung. Daheim. Ihr eigenes Haus, ihre eigenen Sachen, ihre eigene Küche. Der Ölherd blubberte friedlich vor sich hin, und alles war herrlich warm. Sie löste den Verschluss ihres Capes, zog es aus und legte es über eine Stuhllehne. Auf dem blankgescheuerten Tisch lag ein Stoß Briefe, und sie blätterte ihn durch, doch weil er nichts Wichtiges oder Interessantes zu enthalten schien, ließ sie ihn liegen und ging durch den Raum, um die Glastür zum Wintergarten zu öffnen. Der Gedanke, dass ihre geliebten Pflanzen vor Kälte oder Durst eingehen könnten, hatte sie in diesen letzten Tagen ein wenig beunruhigt, aber Mrs. Plackett hatte das ebenso wenig vergessen wie alles andere. Die Erde in den Töpfen war feucht und schwer, die Blätter saftig und grün. Eine frühe Geranie trug eine Krone aus winzigen Knospen, und die Hyazinthen waren wenigstens sieben Zentimeter gewachsen. Hinter den Glasscheiben lag ihr winterlicher Garten, die blattlosen Bäume zeichneten sich wie schwarze Gerippe vor dem bleichen Himmel ab, doch zwischen den Moospolstern unter der Kastanie sah sie Schneeglöckchen und die ersten buttergelben Blüten des Winterlings.
Sie verließ den Wintergarten, ging nach oben und wollte eigentlich auspacken, doch stattdessen gab sie sich dem seligen Gefühl hin, wieder zu Hause zu sein. Sie ging umher, öffnete Türen, betrat jedes Schlafzimmer, um durch jedes Fenster zu sehen, Möbel zu berühren, einen Vorhang glatt zu streifen. Alles war so, wie es sein sollte. Nichts hatte sich geändert. Als sie wieder unten in der Küche war, nahm sie die Briefe und ging durch das Esszimmer ins Wohnzimmer. Hier waren ihre kostbarsten Besitztümer, ihr Sekretär, ihre Blumen, ihre Bilder. Im Kamin war alles für ein Feuer bereitet. Sie riss ein Zündholz an und kniete sich hin, um es an das zusammengerollte Zeitungspapier zu halten. Eine Flamme züngelte, dann glommen die Kienspäne auf und begannen leise zu knistern. Sie legte Scheite auf, und die Flammen züngelten in den Abzug. Jetzt lebte das Haus wieder, und nun, da sie diese angenehme Arbeit hinter sich hatte, gab es keinen Vorwand mehr, ihre Kinder nicht anzurufen und ihnen zu sagen, was sie getan hatte.
Aber welches der Kinder? Sie setzte sich in den Sessel und überlegte. Eigentlich Nancy. Sie war die Älteste, und sie war von der Vorstellung nicht abzubringen, sie sei uneingeschränkt für ihre Mutter verantwortlich. Aber Nancy würde entsetzt sein, sich furchtbar aufregen und ihr heftige Vorwürfe machen. Penelope hatte noch nicht die Kraft, mit Nancy fertigzuwerden.
Also Noel? Vielleicht sollte sie mit Noel reden, er war der Mann in der Familie. Aber bei der bloßen Vorstellung, Noel könne ihr mit Rat und Tat zur Seite stehen, musste sie unwillkürlich lächeln. «Noel, ich habe das Krankenhaus auf meine eigene Verantwortung hin verlassen und bin wieder zu Hause.» Eine Information, die er höchstwahrscheinlich mit einem «Oh?» quittieren würde.
So tat Penelope das, was sie die ganze Zeit vorgehabt hatte. Sie nahm ab und wählte die Nummer von Olivias Büro in London.
«Ve-nus.» Das Mädchen in der Telefonzentrale schien den Namen der Zeitschrift zu singen.
«Ich hätte gern Olivia Keeling gesprochen.»
«Einen Augenblick bitte.»
Penelope wartete.
«Vorzimmer Miss Keeling.»
Olivia an den Apparat zu bekommen, war ein bisschen so, als versuche man, mit dem Präsidenten der Vereinigten Staaten zu plaudern.
«Ich möchte bitte Miss Keeling sprechen.»
«Es tut mir leid, Miss Keeling ist gerade in einer Besprechung.»
«Heißt das, dass sie im Konferenzzimmer sitzt, oder ist sie in ihrem Büro?»
«Sie ist in ihrem Büro …» Die Sekretärin klang ungehalten, wie zu erwarten. «Aber sie hat Besuch.»
«Nun, dann stören Sie sie bitte. Ich bin ihre Mutter, und es ist sehr wichtig.»
«Es … es kann nicht warten?»
«Nein, keine Sekunde», sagte Penelope fest. «Aber ich werde sie nicht lange aufhalten.»
«Sehr gut.»
Wieder warten. Dann endlich Olivia.
«Mama!»
«Entschuldige, dass ich dich störe …»
«Mama, ist etwas nicht in Ordnung?»
«Nein, im Gegenteil.»
«Gott sei Dank. Rufst du aus dem Krankenhaus an?»
«Nein, von zu Hause.»
«Von zu Hause? Wann bist du nach Hause gekommen?»
«Gerade eben. Gegen halb drei.»
«Aber ich dachte, du müsstest noch mindestens eine Woche bleiben.»
«Ja, das war auch so geplant, aber ich habe mich schrecklich gelangweilt, und es hat mich erschöpft. Ich habe nachts kein Auge zugetan, und neben mir lag eine alte Dame, die in einem fort geredet hat. Nein, nicht geredet. Gebrabbelt, das arme Ding. Also habe ich dem Arzt einfach gesagt, ich könne es keine Stunde länger aushalten, und dann habe ich meinen Koffer gepackt und bin gegangen.»
«Du hast dich also selbst entlassen», sagte Olivia trocken. Es klang resigniert, aber kein bisschen überrascht.
«Genau. Mir fehlt überhaupt nichts. Und ich habe mir ein schönes Taxi mit einem sehr netten Fahrer genommen, und er hat mich nach Hause gebracht.»
«Hat der Arzt denn nicht protestiert?»
«Doch, sehr laut sogar. Aber er konnte ja nicht viel dagegen machen.»
«O Mama!» In Olivias Stimme vibrierte ein Lachen. «Wie unartig. Ich wollte am Wochenende hinunterkommen und dich im Krankenhaus besuchen. Du weißt schon, dir kiloweise Trauben mitbringen und dann alle selbst essen.»
«Du könntest hierherkommen», sagte Penelope, und dann wünschte sie, sie hätte es nicht gesagt. Vielleicht klang es einsam und sehnsüchtig, womöglich hörte es sich so an, als brauche sie Olivia, um Gesellschaft zu haben.
«Hm … wenn es dir wirklich gutgeht, würde ich es gerne noch etwas verschieben. Ich habe dieses Wochenende schrecklich viel zu tun. Hast du schon mit Nancy gesprochen, Mama?»
«Nein. Ich habe daran gedacht, aber dann war es mir irgendwie zu viel. Du weißt ja, wie umständlich sie immer ist. Ich werde sie morgen früh anrufen, wenn Mrs. Plackett hier ist und alles wieder seinen normalen Gang geht. Ich möchte auf jeden Fall verhindern, dass ich wieder abtransportiert werde.»
«Wie fühlst du dich? Ich meine, wirklich?»
«Sehr gut. Nur ein bisschen müde, wie ich schon sagte.»
«Du wirst doch nicht zu viel tun? Ich meine, du wirst nicht sofort in den Garten laufen und anfangen, Beete umzugraben oder Bäume zu versetzen?»
«Nein, ich verspreche es. Außerdem ist sowieso alles noch steinhart gefroren. Man könnte keinen Spaten in die Erde bekommen.»
«Gott sei Dank. Wenigstens etwas. Mama, ich muss jetzt Schluss machen. Ich habe gerade eine Kollegin bei mir …»
«Ich weiß. Deine Sekretärin hat es mir gesagt. Entschuldige, dass ich dich gestört habe, aber ich wollte, dass du Bescheid weißt.»
«Ich bin froh, dass du es getan hast. Halt mich auf dem Laufenden, und gönn dir ein bisschen Ruhe.»
«Das werde ich. Auf Wiedersehen, Liebling.»
«Auf Wiedersehen, Mama.»
Sie legte auf, stellte den Apparat wieder auf den Tisch und lehnte sich zurück.
Jetzt hatte sie fürs Erste alles erledigt. Sie spürte, dass sie wirklich sehr müde war, aber es war eine angenehme Müdigkeit, gemildert und versüßt durch ihre Umgebung, als wäre das Haus ein freundliches Wesen, das sie liebevoll in die Arme schloss. Sie spürte in dem warmen, vom Feuerschein beleuchteten Zimmer, wie sie von jenem grundlosen Glücksgefühl überrascht wurde, das sie seit Jahren nicht mehr gekannt hatte. Es ist, weil ich lebe. Ich bin vierundsechzig und habe, wenn man diesen idiotischen Ärzten glauben kann, einen Herzanfall gehabt. Etwas in der Richtung. Ich habe es überlebt, und ich werde es in irgendeine Schublade tun und nie wieder darüber sprechen oder daran denken. Weil ich lebe. Ich kann fühlen, alles berühren, sehen, hören, riechen; ich kann allein zurechtkommen, das Krankenhaus aus eigenem Willen verlassen, mir ein Taxi bestellen und nach Hause fahren. Im Garten kommen die ersten Schneeglöckchen, und es wird bald Frühling. Ich werde ihn erleben. Das alljährliche Wunder beobachten und fühlen, wie die Sonne von Woche zu Woche wärmer wird. Und weil ich lebe, werde ich all das sehen und ein Teil des Wunders sein.
Sie erinnerte sich an die Geschichte über Maurice Chevalier. Wie ist es, wenn man siebzig ist?, hatte ein Reporter ihn gefragt. Nicht übel, hatte er geantwortet. Wenn man die Alternative bedenkt.
Aber Penelope Keeling fühlte sich nicht nur nicht übel, sie fühlte sich tausendmal besser. Das Leben war auf einmal nicht mehr die bloße Existenz, die man als selbstverständlich betrachtet, sondern etwas darüber hinaus, ein Geschenk, das jeden Tag, der einem gegeben wurde, ausgekostet werden musste. Die Zeit dauerte nicht ewig. Ich werde keinen einzigen Moment verschwenden, versprach sie sich. Sie hatte sich noch nie so stark und optimistisch gefühlt. Als ob sie wieder jung sei und noch einmal von vorn anfinge, und als ob jeden Augenblick etwas Wunderbares geschehen könne.
1Nancy
Manchmal hatte sie den Eindruck, dass sie, Nancy Chamberlain, dazu verdammt sei, selbst bei der einfachsten, harmlosesten Beschäftigung über kurz oder lang unweigerlich an schier unüberwindliche Hindernisse zu stoßen.
Zum Beispiel heute Morgen. Ein x-beliebiger Tag Mitte März. Alles, was sie tat … alles, was sie vorhatte … war, um Viertel nach neun den Zug von Cheltenham nach London zu nehmen, mit ihrer Schwester zu Mittag zu essen, vielleicht kurz zu Harrods hineinzuschauen und dann wieder nach Hause zu fahren. Es war schließlich ein alles andere als verruchtes Vorhaben. Sie war nicht im Begriff, sich wild extravaganten Ausschweifungen hinzugeben oder einen Liebhaber zu treffen, es war sogar im Grunde ein Pflichtbesuch, bei dem über Verantwortung gesprochen und Entscheidungen getroffen werden mussten, doch sobald sie ihrer Familie das Vorhaben angekündigt hatte, schienen sich alle möglichen Umstände drohend gegen sie zu verschwören, und sie musste Einwände oder, schlimmer noch, Gleichgültigkeit überwinden und hatte schließlich das Gefühl, sie kämpfe um ihr Leben.
Gestern Abend, nach der telefonischen Verabredung mit Olivia, hatte sie angefangen, ihre Kinder zu suchen. Sie hatte sie schließlich in dem kleinen Wohnzimmer gefunden, das sie euphemistisch als Bibliothek bezeichnete, auf dem Sofa vor dem brennenden Kamin, beim Fernsehen. Sie hatten ein eigenes Spielzimmer und ein eigenes Fernsehzimmer, aber das Spielzimmer besaß keinen Kamin und war eine Eishöhle, und der Apparat war ein alter Schwarzweißfernseher, und deshalb war es kein Wunder, dass sie die meiste Zeit hier verbrachten.
«Kinder, ich muss morgen nach London, um Tante Olivia zu treffen und über Großmutter Pen zu sprechen …»
«Aber wer bringt Lightning dann zum Hufschmied, er muss unbedingt neu beschlagen werden?»
Das war Melanie. Während sie redete, kaute sie an ihrem Pferdeschwanz und hielt den Blick finster auf den zappelnden Rocksänger gerichtet, der den Bildschirm füllte. Sie war vierzehn und machte, wie ihre Mutter sich immer wieder sagte, gerade diese schwierige Zeit durch.
Nancy hatte mit der Frage gerechnet und sich die Antwort zurechtgelegt.
«Ich werde Croftway bitten, das zu tun. Er müsste es allein schaffen können.»
Croftway war der Gärtner oder vielmehr der Mann für alles, ein mürrischer Kerl, der mit seiner Frau über dem Pferdestall wohnte. Er hasste die Pferde und machte sie mit seiner lauten Stimme und seiner ungehobelten Art scheu, aber es gehörte zu seiner Arbeit, sich mit um sie zu kümmern, und er tat es widerwillig, indem er die schweißnassen Tiere in die Boxen trieb und das plumpe Gefährt zu verschiedenen Veranstaltungen des Reitclubs kutschierte. Nancy nannte ihn dann immer «unser Stallbursche».
Nun brachte der elfjährige Rupert, der die letzten Worte mitbekommen hatte, seine Einwände vor: «Ich habe Tommy Robson gesagt, dass ich morgen bei ihm Tee trinke. Er hat ein paar Fußballzeitschriften und will sie mir leihen. Wie komme ich nach Haus?»
Er hatte nichts dergleichen vorher erwähnt, Nancy hörte das erste Mal davon. Fest entschlossen, nicht aus der Haut zu fahren, und in dem Wissen, dass der Vorschlag, sich einen anderen Tag auszusuchen, nur lautstarken Protest und ein weinerliches «Das ist nicht fair!» auslösen würde, schluckte sie ihre Gereiztheit hinunter und sagte, so freundlich sie konnte, er könne vielleicht mit dem Bus fahren.
«Aber dann muss ich vom Dorf aus zu Fuß gehen.»
«Oh, es sind doch nur ein paar hundert Meter.» Sie lächelte, um das Beste aus der Situation zu machen. «Es wird dich dieses eine Mal schon nicht umbringen.» Sie hoffte, er würde das Lächeln erwidern, aber er kniff nur den Mund zusammen und wandte seine Aufmerksamkeit wieder dem Fernseher zu.
Sie wartete. Worauf? Vielleicht auf ein bisschen Interesse, wo es doch um etwas ging, das für die ganze Familie sehr wichtig war? Sogar die hoffnungsvolle Frage, welche Geschenke sie mitbringen würde, wäre besser gewesen als nichts. Aber sie hatten ihre Anwesenheit bereits vergessen, konzentrierten sich uneingeschränkt auf das, was sie sahen. Sie fand den Lärm des Apparats plötzlich unerträglich, ging aus dem Zimmer und schloss die Tür hinter sich. In der Diele wurde sie von einer eisigen Kälte umhüllt, die aus den Steinplatten des Fußbodens aufstieg und die Stufen hinaufkroch, um auf den Treppenabsätzen geballt zu lauern.
Es war ein harter Winter gewesen. Nancy sagte sich – oder jedem, den sie zum Zuhören bewegen konnte – von Zeit zu Zeit tapfer, dass die Kälte ihr nichts ausmache. Sie sei ein warmblütiger Mensch, und es störe sie nicht weiter. Außerdem, erläuterte sie, friere man im eigenen Haus nie richtig, weil es immer eine Menge zu tun gebe.
Doch heute Abend, wo die Kinder so unausstehlich waren, erschauerte sie bei dem Gedanken, noch einmal in die Küche gehen und «ein Wörtchen» mit der griesgrämigen Mrs. Croftway reden zu müssen, und zog die dicke Strickjacke enger um sich, während sie sah, wie die Zugluft, die unter der schlecht schließenden Tür ins Haus drang, den abgetretenen Läufer anhob und erzittern ließ.
Das Haus, in dem sie wohnten, war sehr alt, ein georgianisches Pfarrhaus in einem kleinen und malerischen Dorf in den Cotswold Hills. Das «Alte Pfarrhaus», Bamworth. Es war eine gute Adresse, und sie genoss es, wenn sie sie in Geschäften nannte. Belasten Sie einfach mein Konto – Mrs. George Chamberlain, Altes Pfarrhaus, Bamworth, Gloucestershire. Sie hatte sie bei Harrods in Prägedruck auf ihr teures blaues Schreibpapier drucken lassen. Kleine Dinge wie Schreibpapier waren für Nancy wichtig. Sie machten einen guten Eindruck.
Sie und George waren bald nach ihrer Heirat hierhergezogen. Unmittelbar vor jenem Ereignis hatte der frühere Pfarrer von Bamworth plötzlich eine überraschende Anwandlung von Mut gehabt, hatte rebelliert und seinen Vorgesetzten erklärt, man könne von niemandem, nicht einmal von einem weltabgewandten Mann der Kirche, erwarten, in einem so riesigen, unpraktischen und kalten Haus zu wohnen. Nach einigem Überlegen und einem anderthalbtägigen Besuch des Erzdiakons, der sich eine Erkältung geholt hatte und um ein Haar an Lungenentzündung gestorben war, hatte die Diözese sich dazu durchgerungen, ein neues Pfarrhaus zu bauen. So wurde am anderen Ende des Dorfes ein Backsteinbungalow hochgezogen und das Alte Pfarrhaus zum Verkauf ausgeschrieben.
Die Käufer waren George und Nancy. «Wir haben sofort zugegriffen», sagte sie zu ihren Freundinnen, als ob sie und ihr Mann enorm gewieft und schnell gewesen seien, und es traf zu, dass sie es für ein Butterbrot bekommen hatten, aber nur, weil kein anderer es haben wollte.
«Es muss natürlich eine Menge daran getan werden, aber es ist ein sehr schönes Haus, spätgeorgianisch, mit einem herrlichen großen Grundstück … Schuppen und ein großer Stall … und nur eine halbe Stunde nach Cheltenham und zu Georges Kanzlei. Genau das, was wir haben wollten.»
So war es. Für Nancy, die in London aufgewachsen war, bedeutete das Haus die Erfüllung ihrer Teenagerträume, ihrer Phantasien, die bei der Lektüre all der Romane wach geworden waren, die sie verschlungen hatte, all der Bücher von Barbara Cartland und Georgette Heyer. Auf dem Land zu leben und die Frau eines Landadeligen zu sein, natürlich erst nach einer traditionellen Londoner Saison, einer Hochzeit in Weiß mit Brautjungfern und ihrem Bild im Tatler – das war lange Zeit der Gipfel ihres bescheidenen Ehrgeizes gewesen. Bis auf die Londoner Saison hatte sie alles bekommen, und frischvermählt hatte sie sich als Herrin eines Hauses in den Cotswolds wiedergefunden, mit einem Pferd im Stall und einem Garten für Kirchenfeste. Mit den richtigen Freunden und den richtigen Hunden, mit einem Mann, der Ortsvorsitzender der Konservativen Partei war und beim Sonntagsgottesdienst die Losung des Tages las.
Zuerst war alles sehr gutgegangen. Sie hatten damals genug Geld, sie renovierten das alte Haus, ließen es verputzen und eine Zentralheizung einbauen, und Nancy hatte die viktorianischen Möbel arrangiert, die George von seinen Eltern geerbt hatte, und ihr eigenes Schlafzimmer überglücklich in einen Traum von Chintz verwandelt. Doch als die Jahre dahingingen, die Inflation immer mehr wütete und die Kosten für Heizöl und fremde Hilfe stiegen, wurde es zunehmend schwierig, jemanden zu finden, der in Haus und Garten half. Die finanzielle Bürde für den bloßen Unterhalt des Hauses wurde von Jahr zu Jahr schwerer, und sie hatte manchmal das Gefühl, dass der Brocken, den sie geschnappt hatten, zu groß zum Kauen war.
Als ob all das nicht reichte, waren nun auch die atemberaubenden Kosten für die Schulen der Kinder hinzugekommen. Melanie und auch Rupert besuchten als Externe Privatschulen im Ort. Melanie würde wahrscheinlich bis zur Reifeprüfung auf der ihren bleiben, aber Rupert war bereits für Charlesworth, das Internat seines Vaters, ausersehen. George hatte ihn einen Tag nach seiner Geburt angemeldet und gleichzeitig eine kleine Ausbildungsversicherung abgeschlossen, aber von der lächerlichen Summe, die sie herausbekamen, würden sie heute, 1984, gerade eben die erste Eisenbahnfahrt dorthin bezahlen können.
Als sie einmal in London bei Olivia übernachtet hatte, hatte sie sich ihrer Schwester in der Hoffnung anvertraut, diese zielbewusste Karrierefrau könne ihr vielleicht einen nützlichen Rat geben. Aber Olivia hatte kein Verständnis gezeigt. Sie hielt sie für töricht.
«Internate sind sowieso ein Anachronismus», hatte sie Nancy erklärt. «Schickt ihn auf die Einheitsschule im Ort, damit er sich mit den anderen messen kann. Es wird ihm auf lange Sicht mehr nützen als diese elitäre Atmosphäre und die überholten Traditionen.
Aber das war undenkbar. Weder George noch Nancy hatten je daran gedacht, dass ihr einziger Sohn eine staatliche Schule besuchen würde. Nancy hatte manchmal sogar heimlich davon geträumt, Rupert sei in Eton, und sie könne sich am 4. Juli in einem großen Strohhut auf dem berühmten Gartenfest zeigen. So solide und angesehen Charlesworth auch sein mochte, es kam ihr immer ein bisschen wie zweite Wahl vor. Das gab sie Olivia gegenüber allerdings nicht zu.
«Das kommt nicht in Frage», sagte sie kurz.
«Dann soll er sich für ein Stipendium bewerben. Sorgt dafür, dass er selbst was für sich tut. Was für einen Sinn hat es, dass ihr euch für einen kleinen Jungen zugrunde richtet?»
Aber Rupert war nicht übermäßig begabt. Er würde nie ein Stipendium bekommen, und George und Nancy wussten es beide.
«In dem Fall», sagte Olivia abschließend, weil das Thema sie zu langweilen begann, «in dem Fall habt ihr wohl keine andere Wahl, als den alten Kasten zu verkaufen und euch etwas Kleineres zu suchen.»
Aber der Gedanke an einen solchen Schritt flößte Nancy noch mehr Entsetzen ein als die Aussicht, ihr Sohn könne eine staatliche Schule besuchen. Nicht nur, weil es bedeuten würde, ihre Niederlage einzugestehen und auf all das zu verzichten, was sie sich immer gewünscht hatte, sondern auch deshalb, weil sie den nagenden Verdacht hatte, sobald sie und George und die Kinder in irgendeinem praktischen kleinen Haus am Rande von Cheltenham wohnten, ohne die Pferde, den Frauenverein, das Komitee der Konservativen, die Sport- und Kirchenfeste, würde ihr Ansehen sinken, und sie würden für ihre landbesitzenden Freunde nicht mehr interessant sein und, schwindenden Schatten gleich, zu einer Familie vergessener Nichtpersonen dahinwelken.
Sie erschauerte wieder, riss sich zusammen, drängte die beängstigenden Bilder beiseite und ging mit festen Schritten den plattenbelegten Korridor zur Küche entlang. Dort machte der große Ölherd, der niemals ausging, alles warm und gemütlich. Nancy dachte manchmal, besonders in dieser Zeit des Jahres, dass es eigentlich ein Jammer sei, dass sie nicht tagsüber in der Küche wohnten … und wahrscheinlich wäre jede andere Familie – nur nicht die ihre – der Versuchung erlegen und hätte den ganzen Winter dort verbracht. Aber sie waren nicht irgendeine andere Familie. Nancys Mutter, Penelope Keeling, hatte praktisch in der alten Küche im Souterrain des großen Hauses in der Oakley Street gelebt. Sie hatte dort gekocht und an dem schönen, blankgescheuerten Tisch gewaltige Mahlzeiten serviert, sie hatte dort ihre Kinder großgezogen, gestopft und geflickt und sogar die vielen Gäste empfangen und bewirtet, deren Strom nie abzureißen schien. Und Nancy, die nicht mit ihrer Mutter einverstanden gewesen war und sich ihrer sogar ein wenig geschämt hatte, hatte all die Jahre danach gegen diesen angenehmen und zwanglosen Lebensstil aufbegehrt und ihn auf keinen Fall übernehmen wollen. Wenn ich heirate, hatte sie sich schon als Backfisch geschworen, werde ich einen Salon und ein Esszimmer haben wie andere Leute, und ich werde die Küche so selten wie möglich betreten.
George dachte zum Glück ähnlich. Vor einigen Jahren waren sie nach längeren ernsthaften Diskussionen beide zu dem Schluss gekommen, dass der praktische Vorteil, das Frühstück in der Küche einzunehmen, den damit verbundenen Verlust an Stil überwiegen würde. Aber weiter wollte keiner von ihnen gehen. So wurden das Mittagessen und das Dinner weiterhin an dem vorschriftsmäßig gedeckten Tisch in dem riesigen hohen Esszimmer eingenommen, und Förmlichkeit siegte nach wie vor über Behagen. Der düstere Raum wurde von einem elektrischen Kamin beheizt, und wenn sie Gäste erwarteten, stellte Nancy ihn ein paar Stunden vorher an und konnte nie verstehen, warum die Damen unweigerlich in dicke Schals gehüllt kamen. Schlimmer war, dass sie einmal – sie würde den Abend nie vergessen – unter der Weste eines sehr korrekt gekleideten Herrn die unverkennbaren Umrisse eines Pullovers mit V-Ausschnitt entdeckt hatte. Er war nicht wieder eingeladen worden.
Mrs. Croftway stand am Spülbecken und schälte Kartoffeln fürs Abendessen. Sie war eine beeindruckende Person (im Gegensatz zu ihrem Mann, der immerzu schmutzige Reden im Mund führte) und trug bei der Arbeit eine weiße Kittelschürze, als ob sie nur dann professionell kochen und genießbare Gerichte auf den Tisch bringen könne. Was nur selten der Fall war, aber ihr abendliches Erscheinen in der Küche bedeutete wenigstens, dass Nancy nicht selbst zu kochen brauchte.
Sie beschloss ohne Umschweife zur Sache zu kommen. «Übrigens, Mrs. Croftway … eine kleine Planänderung. Ich muss morgen nach London und mit meiner Schwester essen. Es geht um meine Mutter, und alles kann man eben nicht am Telefon besprechen.»
«Ich dachte, Ihre Mutter ist nicht mehr im Krankenhaus.»
«Das stimmt, aber ich habe gestern mit ihrem Arzt telefoniert, und er sagt, es wäre unverantwortlich, wenn sie weiter allein lebt. Es war nur ein leichter Herzanfall, und sie hat sich sehr gut davon erholt, aber trotzdem … man kann nie wissen …»
Sie erzählte Mrs. Croftway diese Einzelheiten nicht etwa deshalb, weil sie Zuspruch oder gar Mitgefühl erwartete, sondern weil Mrs. Croftway für ihr Leben gern über Krankheiten redete, und weil sie, Nancy, hoffte, es würde sich positiv auf ihre Stimmung auswirken. «Meine Mutter hatte mal einen Herzanfall und war danach nie wieder dieselbe. Sie war fast immer blau im Gesicht, und ihre Hände waren so geschwollen, dass man ihr den Ehering abzwacken musste.»
«Das habe ich gar nicht gewusst, Mrs. Croftway.»
«Sie konnte nicht mehr allein leben. Ich habe sie zu mir und Croftway geholt, und sie hat das beste Schlafzimmer bekommen, aber ich kann Ihnen sagen, ich war fix und fertig. Den ganzen Tag auf der Treppe, weil sie oben in einem fort mit einem Besenstiel auf den Fußboden klopfte. Ich war zuletzt ein Nervenbündel. Der Arzt sagte, er hätte noch nie jemanden gesehen, der so mit den Nerven fertig war wie ich. Also hat er Mutter ins Krankenhaus gesteckt, und da ist sie dann gestorben.»
Das war offenbar das Ende der deprimierenden Geschichte. Mrs. Croftway wandte sich wieder ihren Kartoffeln zu, und Nancy fiel nichts anderes ein als: «Das tut mir leid … Es muss eine große Belastung für Sie gewesen sein. Wie alt war Ihre Mutter?»
«Sie wäre in einer Woche sechsundachtzig geworden.»
«Oh …» Nancy gab ihrer Stimme einen entschlossenen Unterton. «Meine Mutter ist erst vierundsechzig, und deshalb bin ich sicher, dass sie sich wieder richtig erholen wird.»
Mrs. Croftway warf eine geschälte Kartoffel in den Topf und drehte sich zu Nancy um. Sie sah anderen selten in die Augen, aber wenn sie es tat, war es beunruhigend, weil ihre Augen sehr hell waren und niemals zu zwinkern schienen.
Mrs. Croftway hatte ihre eigene Meinung über Nancys Mutter. Sie hatte diese Mrs. Keeling nur einmal gesehen, bei einem ihrer seltenen Besuche im Alten Pfarrhaus, aber das hatte allen gereicht. Sie war eine große dürre Frau mit dunklen Zigeuneraugen und Kleidern, die aussahen, als sollte man sie schleunigst irgendeiner Hilfsorganisation geben. Sie war auch dickschädelig gewesen, denn sie kam in die Küche und bestand darauf, das Geschirr abzuspülen, obgleich Mrs. Croftway ihre eigene Methode hatte, die Dinge zu erledigen, und sich nicht gern ins Handwerk pfuschen ließ.
«Komisch, dass sie einen Herzanfall hatte», bemerkte sie nun. «Kam mir kräftig und kerngesund vor.»
«Ja», sagte Nancy schwach. «Ja, es war ein Schock – für uns alle», fügte sie mit salbungsvoller Stimme hinzu, als sei ihre Mutter bereits tot und man könne beruhigt gut über sie reden.
Mrs. Croftway presste die Lippen aufeinander.
«Erst vierundsechzig?», fragte sie dann ungläubig. «Sie sieht aber älter aus, nicht? Ich habe sie auf gut siebzig geschätzt.»
«Nein, sie ist vierundsechzig.»
«Und wie alt sind Sie?»
Sie war wirklich schrecklich. Nancy fühlte, wie sie aufgrund dieses unmöglichen Benehmens innerlich erstarrte, und war sich bewusst, dass ihr das Blut in die Wangen stieg. Wie gern hätte sie den Mut gehabt, die Person anzufahren und ihr zu sagen, sie solle ihre Nase nicht in fremde Angelegenheiten stecken, aber dann würde sie vielleicht kündigen, und Croftway würde auch gehen, und was würde sie, Nancy, dann mit dem Garten und den Pferden und dem riesigen Haus und all den hungrigen Mäulern machen, die sie täglich füttern musste?
«Ich bin …» Ihre Stimme kam wie ein Krächzen. Sie räusperte sich und versuchte es noch mal. «Da es Sie zu interessieren scheint – ich bin dreiundvierzig.»
«Mehr nicht? Oh, ich hätte gedacht, Sie sind keinen Tag jünger als fünfzig.»
Nancy lachte ein wenig und versuchte so zu tun, als betrachte sie es als einen Scherz, was sollte sie sonst machen? «Das ist nicht sehr schmeichelhaft, Mrs. Croftway.»
«Es liegt an Ihrem Gewicht. Das ist es. Nichts macht so alt, als wenn man sich mit der Figur gehen lässt. Sie sollten eine Schlankheitskur machen … Es ist nicht gut für Sie, ich meine, das Übergewicht. Als Nächstes –» sie lachte wie eine alte Henne – «bekommen Sie noch einen Herzanfall.»
Ich hasse Sie, Mrs. Croftway. Ich hasse Sie.
«In der neuen Woman’s Own ist eine sehr gute Schlankheitskur … Man darf am ersten Tag nur eine Pampelmuse und am nächsten einen Becher Joghurt essen. Vielleicht auch umgekehrt … Ich kann sie ausschneiden und Ihnen mitbringen, wenn Sie wollen.»
«Oh … sehr freundlich. Ja, vielleicht.» Sie klang aufgeregt, und ihre Stimme zitterte. Sie riss sich zusammen, holte tief Luft und rettete, was zu retten war. «Aber ich wollte eigentlich von morgen reden, Mrs. Croftway. Ich nehme den Zug um Viertel nach neun, und deshalb habe ich nicht mehr viel Zeit zum Aufräumen, bevor ich gehe, und ich fürchte, Sie werden es tun müssen … das heißt, so weit Sie kommen. Und würden Sie bitte so freundlich sein und die Hunde füttern? Ich tue ihnen das Futter in die Näpfe, und wenn Sie sie dann vielleicht kurz im Garten laufen lassen könnten? Und …» Sie fuhr rasch fort, ehe Mrs. Croftway anfangen konnte, gegen diese Vorschläge zu protestieren. «Und richten Sie Ihrem Mann bitte einen schönen Gruß von mir aus, und er möchte Lightning zum Hufschmied bringen … er muss beschlagen werden, und ich möchte nicht noch länger damit warten.»
«Oooh», machte Mrs. Croftway zweifelnd. «Ich weiß nicht, ob er allein mit dem Gaul fertigwerden kann.»
«Ich bin sicher, er kann es, es ist ja nicht das erste Mal … Und morgen Abend, wenn ich zurückkomme … wir könnten vielleicht Lammkeule zum Dinner haben. Oder Koteletts oder etwas Ähnliches … und ein bisschen von dem herrlichen Rosenkohl, den Ihr Mann anbaut …»
Sie hatte erst nach dem Essen Gelegenheit, mit George zu sprechen. Mit all dem, was sie um die Ohren hatte, dafür sorgen, dass die Kinder ihre Schulaufgaben machten, Melanies Ballettschuhe suchen, das Dinner, das Geschirr abräumen und dann rasch die Frau des Pfarrers anrufen, um ihr zu sagen, dass sie morgen Abend nicht zur Sitzung des Frauenvereins kommen konnte, und all den anderen Dingen, aus denen ihr Leben bestand, schien sie fast nie mehr Zeit zu haben, ein Wort mit ihrem Mann zu wechseln, der erst um sieben Uhr abends nach Hause kam und dann nichts anderes wollte, als sich mit einem Glas Whisky an den Kamin zu setzen und Zeitung zu lesen.
Doch schließlich hatte sie alles erledigt und konnte zu George in die Bibliothek gehen. Sie machte die Tür fest hinter sich zu und erwartete, dass er aufblicken würde, und als er sich hinter seiner Times nicht rührte, ging sie zum Bartisch neben dem Fenster, schenkte sich einen Whisky ein und setzte sich dann ihm gegenüber in den Armstuhl. Sie wusste, dass er gleich die Hand ausstrecken und den Fernseher einschalten würde, um die Nachrichten zu sehen.
Sie sagte: «George.»
«Hmmm?»
«George, hör mir bitte einen Moment zu.»
Er las den Satz, den er angefangen hatte, zu Ende und ließ dann widerstrebend die Zeitung sinken, sodass man das Gesicht eines Mannes mit schütterem Haar und randloser Brille sah, eines Herrn in einem korrekten dunklen Anzug mit gedeckter Krawatte, der Mitte fünfzig war, aber ein gut Teil älter wirkte. George war Anwalt, nur beim Amtsgericht zugelassen, und bildete sich vielleicht ein, sein betont gepflegtes Äußeres – wie für eine Rolle in einem Theaterstück – würde potenziellen Klienten Vertrauen einflößen, aber Nancy hatte manchmal den Verdacht, dass seine Kanzlei, wenn er nur ein bisschen mehr aus sich machte, einen gutgeschnittenen Tweedanzug trüge und sich eine Hornbrille zulegte, ebenfalls aufblühen würde. Denn seit der Einweihung der Schnellstraße von London war dieser Teil des Landes rasch in Mode gekommen. Neue und wohlhabende Leute zogen her, Farmen wechselten für unfassliche Summen den Besitzer, total heruntergekommene Gesindehäuser wurden begierig gekauft und unter gewaltigen Kosten in Wochenendcottages verwandelt. Immobilienmakler und Bauunternehmer machten glänzende Geschäfte, in den unwahrscheinlichsten kleinen Orten wurden exklusive Geschäfte eröffnet, und es ging einfach über Nancys Begriffsvermögen, warum Chamberlain, Plantwell & Richards nicht auf den Wohlstandszug aufgesprungen war, um an einige der Reichtümer heranzukommen, nach denen man bestimmt nur die Hand auszustrecken brauchte. Aber George war altmodisch. Er blieb bei traditionellen Methoden und hatte panische Angst vor Neuerungen. Er war außerdem ein vorsichtiger Mann, der Risiken scheute.
Nun fragte er: «Was hast du mir zu sagen?»
«Ich fahre morgen nach London, um mit Olivia zu essen. Wir müssen über Mutter sprechen.»
«Was ist denn jetzt schon wieder mit ihr?»
«O George, du weißt doch, was. Ich hab dir doch gesagt, dass ich mit ihrem Arzt gesprochen habe, und er sagt, es sei im Grunde unverantwortlich, dass sie allein lebt.»
«Was willst du denn dagegen tun?»
«Ja … Wir müssen eine Haushälterin für sie suchen. Oder eine Gesellschafterin.»
«Das wird ihr nicht sehr gefallen», gab George zu bedenken.
«Und selbst wenn wir jemanden fänden … Ob Mutter es sich leisten kann? Eine gute Frau würde vierzig bis fünfzig Pfund die Woche kosten. Ich weiß, dass sie eine ganze Menge Geld für das Haus in der Oakley Street bekommen hat, und abgesehen von diesem lächerlichen Wintergarten hat sie keinen Penny für Podmore’s Thatch ausgegeben, aber sie muss von den Zinsen leben, nicht wahr? Ob ein solcher Posten drin ist?»
George rutschte vor und langte nach seinem Whiskyglas.
Er sagte: «Ich habe keine Ahnung.»
Nancy seufzte. «Sie ist so geheimnistuerisch, so verflixt unabhängig. Sie will sich nicht helfen lassen. Wenn sie uns nur ins Vertrauen zöge und dir irgendeine geschäftliche Vollmacht gäbe, dann hätte ich es leichter. Ich bin schließlich die Älteste, und Olivia und Noel rühren ja nie einen Finger, um ihr zu helfen.»
George hatte all das schon früher gehört. «Was ist mit dieser Frau, die jeden Tag zu ihr kommt, wie heißt sie doch gleich?»
«Mrs. Plackett. Sie kommt nur drei Vormittage die Woche und hat selbst ein Haus und eine Familie zu versorgen.»
George stellte sein Glas hin und starrte, die Fingerspitzen zusammenlegend, ins Feuer.
Nach einer Weile sagte er: «Ich verstehe nicht ganz, warum du dich eigentlich so aufregst.» Er redete, als hätte er es mit einem besonders begriffsstutzigen Klienten zu tun, und Nancy war verletzt.
«Ich rege mich nicht auf.»
Er überhörte es. «Ist es nur wegen des Geldes? Oder darum, weil du vielleicht keine Frau finden wirst, die selbstlos genug ist, um bei deiner Mutter zu leben?»
«Ich nehme an, beides», gestand Nancy.
«Und was wird Olivia deiner Ansicht nach zur Lösung des Problems beitragen?»
«Sie kann es wenigstens mit mir diskutieren. Schließlich hat sie ihr Leben lang noch nie irgendetwas für Mutter getan … und für uns andere auch nicht», fügte sie, sich an vergangene Affronts erinnernd, bitter hinzu. «Als Mutter damals beschloss, das Haus in der Oakley Street zu verkaufen, und wieder nach Cornwall gehen wollte, hat es mich die größte Mühe gekostet, sie davon zu überzeugen, dass es Wahnsinn wäre, so was zu tun. Vielleicht wäre sie trotzdem gegangen, wenn du ihr nicht Podmore’s Thatch besorgt hättest, wo sie wenigstens nur dreißig Kilometer von uns entfernt ist und wir ein Auge auf sie haben können. Angenommen, sie wäre jetzt in Porthkerris, am Ende der Welt, mit einem schwachen Herzen, und niemand von uns wüsste, was alles passiert?»
«Versuchen wir doch, bei der Sache zu bleiben», bat George in beschwichtigendem Ton.
Nancy achtete nicht darauf. Der Whisky hatte sie innerlich erwärmt und gleichzeitig alte Ressentiments geweckt.
«Und was Noel angeht, er hat Mutter praktisch fallengelassen, seit sie Oakley Street verkauft hat und er ausziehen musste. Es war ein schwerer Schlag für ihn. Er war dreiundzwanzig und hat ihr nie einen Penny Miete gezahlt, und er hat sich von ihr bekochen lassen, ihren Gin getrunken und vollkommen umsonst gelebt. Ich kann dir sagen, es war ein Schock für ihn, als er endlich anfangen musste, für sich selbst zu sorgen.»
George stieß einen tiefen Seufzer aus. Er hatte von Noel keine höhere Meinung als von Olivia. Und seine Schwiegermutter, Penelope Keeling, war für ihn immer ein Buch mit sieben Siegeln gewesen. Das große Wunder war, dass eine so normale Frau wie Nancy dem Schoß einer so absonderlichen Familie entsprungen war.
Er leerte sein Glas, stand auf, legte ein neues Scheit aufs Feuer und ging zum Bartisch, um sich wieder einzuschenken. Während er dort hantierte, sagte er: «Nehmen wir mal den schlimmsten Fall an. Nehmen wir an, deine Mutter kann sich keine Haushälterin leisten.» Er kam zurück und setzte sich wieder in den Sessel seiner Frau gegenüber. «Und nehmen wir an, du findest niemanden, der die schwere Aufgabe auf sich nimmt, ihr Gesellschaft zu leisten. Was dann? Wirst du ihr anbieten, zu uns zu ziehen?»
Nancy dachte an Mrs. Croftway und ihren permanenten Ingrimm. An die Kinder, die laut gegen Großmutter Pens kritische Bemerkungen protestierten. Sie dachte an Mrs. Croftways Mutter, die, nachdem man ihren Ehering mit der Kneifzange entfernt hatte, im Bett lag und mit dem Besenstiel auf den Fußboden klopfte …
Sie sagte verzweifelt: «Ich glaube, ich könnte es nicht ertragen.»
«Ich auch nicht», gab George zu.
«Vielleicht würde Olivia …»
«Olivia?» George hob ungläubig die Stimme. «Olivia und jemanden in ihr geheiligtes Privatleben eindringen lassen? Du willst mich wohl auf den Arm nehmen.»
«Aber Noel kommt nicht in Frage.»
«Anscheinend kommt überhaupt niemand in Frage», sagte George. Er schob verstohlen die Manschette hoch und blickte auf seine Uhr. Er wollte die Nachrichten nicht verpassen. «Und ich sehe nicht, wie ich einen konstruktiven Vorschlag machen soll, ehe du mit Olivia klargekommen bist.»
Nancy war beleidigt. Sicher, sie und Olivia waren nie die besten Freundinnen gewesen … Sie hatten schließlich nichts gemeinsam … Aber sie hatte etwas gegen den Ausdruck «klarkommen», weil es so klang, als würden sie permanent nur streiten. Sie war im Begriff, George darauf hinzuweisen, aber er kam ihr zuvor, indem er den Fernseher einschaltete und das Gespräch auf diese Weise beendete. Es war Punkt neun Uhr, und er machte sich zufrieden auf seine tägliche Ration von Streiks und Bombenattentaten gefasst, von Morden und Finanzkatastrophen und auf die abschließende Mitteilung, dass es morgen früh sehr kalt sein würde und dass man nachmittags überall im Land mit verbreiteten Regenfällen rechnen müsse.
Nach einer Weile stand Nancy unsäglich deprimiert auf. Sie hatte den Verdacht, dass George es nicht einmal merkte. Sie ging zum Bartisch, schenkte sich großzügig neu ein, verließ das Zimmer und machte die Tür leise hinter sich zu. Sie stieg die Treppe hinauf, betrat ihr Schlafzimmer und ging in ihr angrenzendes Bad. Sie steckte den Stöpsel in den Abfluss der Wanne, drehte den Heißwasserhahn auf und schüttete mit derselben Großzügigkeit, mit der sie sich Whisky eingeschenkt hatte, parfümiertes Badeöl in die Wanne. Fünf Minuten später gab sie sich der angenehmsten Beschäftigung hin, die sie kannte – in einem heißen Bad zu liegen und dabei eisgekühlten Whisky zu trinken.
In prickelnden Schaum und feuchten Dampf gehüllt, überließ sie sich einer Woge des Selbstmitleids. Ehefrau und Mutter zu sein, sagte sie sich, war eine undankbare Aufgabe. Man opferte sich für Mann und Kinder auf, war rücksichtsvoll zum Personal, sorgte für die Tiere, hielt das Haus in Ordnung, kaufte ein und wusch die Wäsche, und was bekam man als Dank und Anerkennung?
Nichts.
Tränen stiegen ihr in die Augen und vermischten sich mit den heißen Dampfwolken. Sie sehnte sich nach Anerkennung, nach Liebe, nach zärtlichem körperlichem Kontakt, nach jemandem, der sie in die Arme nahm und ihr sagte, dass sie wunderbar sei und alles ganz großartig schaffe.
Für Nancy gab es nur einen Menschen, der sie nie im Stich gelassen hatte. Daddy war natürlich ein Schatz gewesen, solange es ihn gegeben hatte, aber wer Nancys Selbstvertrauen gestärkt und immer ihre Partei ergriffen hatte, war seine Mutter gewesen. Dolly Keeling.
Dolly Keeling hatte sich mit ihrer Schwiegertochter nie verstanden, sie hatte keine Zeit für Olivia gehabt und Noel nicht über den Weg getraut, aber Nancy war ihr ein und alles gewesen, und sie hatte sie angebetet und verwöhnt. Großmutter Keeling hatte ihr Kleider mit Puffärmeln und Faltenrock gekauft, als Penelope ihre älteste Tochter in einem alten Fetzen aus fadenscheinigem Batist auf Partys schicken wollte. Großmutter Keeling hatte ihr gesagt, dass sie hübsch sei, und sie zum Tee bei Harrods und zum Weihnachtsmärchen eingeladen.
Als sie sich mit George verlobte, hatte es schreckliche Szenen gegeben. Ihr Vater war damals schon fort, und ihre Mutter wollte einfach nicht einsehen, warum es für sie so wichtig war, eine traditionelle Hochzeit in Weiß mit Brautjungfern zu haben, die Herren im Cut, und einen richtigen Empfang. Für Penelope war es anscheinend eine törichte Art, Geld zu verschwenden. Warum kein schlichter Gottesdienst im Kreis der Familie und danach ein schönes Mittagessen an dem großen blankgescheuerten Tisch in der Souterrainküche in der Oakley Street? Oder ein kleines Fest im Garten? Der Garten war sehr groß und bot mehr als genug Platz für alle, und die Rosen würden blühen …
Nancy weinte, knallte Türen und sagte, niemand verstehe sie. Niemand habe sie je verstanden. Zuletzt war sie tagelang beleidigt und sprach mit niemandem mehr, und wenn ihre wunderbare Großmutter nicht eingegriffen hätte, wäre es sicher ewig so weitergegangen. Sie nahm Penelope die ganze Sache aus der Hand, und diese war froh, die Verantwortung los zu sein. Großmutter kümmerte sich um alles. Keine Braut hätte mehr verlangen können. Eine vornehme Kirche, ein weißes Kleid mit Schleppe, Brautjungfern in Rosa und anschließend in einem sehr guten Restaurant in Knightsbridge ein Empfang mit vielen riesigen Blumengestecken und einem Zeremonienmeister in einem roten Gehrock. Und der gute Daddy war auf die Bitte seiner Mutter in einem vornehm aussehenden Cut gekommen, um Nancy zum Altar zu geleiten und dem Bräutigam zu übergeben, und selbst Penelopes Aufmachung, kein Hut und ein uraltes Kleid aus Samtbrokat, konnte die Vollkommenheit des Tages nicht beeinträchtigen.
Oh, wäre Großmutter Keeling doch jetzt da. Während Nancy, eine erwachsene Frau von dreiundvierzig Jahren, in ihrem Schaumbad lag, weinte sie ihrer Großmutter nach. Sie als mitfühlende Seele hier zu haben, um ein bisschen Trost und Bewunderung zu bekommen. O Liebling, du bist wunderbar, du tust so viel für deine Familie und deine Mutter, und sie betrachten es als Selbstverständlichkeit.
Sie konnte die geliebte Stimme hören, aber nur in ihrer Phantasie, denn Dolly Keeling war tot. Letztes Jahr war die tapfere kleine Dame mit dem Rouge auf den Wangen, den lackierten Fingernägeln und den malvenfarbenen Strickkostümen mit siebenundachtzig Jahren im Schlaf gestorben. Das traurige Ereignis fand in einem kleinen Hotel in Kensington statt, das sie, wie eine ganze Reihe sehr alter Herrschaften, gewählt hatte, um dort ihre letzten Jahre zu verbringen, und ihre sterblichen Überreste waren sogleich von dem Bestattungsunternehmen abgeholt worden, mit dem die Hotelleitung in kluger Voraussicht eine feste Vereinbarung getroffen hatte.
Der nächste Morgen war genauso schlimm, wie Nancy befürchtet hatte. Der Whisky hatte ihr stechende Kopfschmerzen beschert, und als sie um halb acht aus dem Bett kletterte, war es kälter denn je und stockdunkel. Sie zog sich an und stellte beleidigt fest, dass der Bund ihres besten Rocks zu eng war, sodass sie ihn mit einer Sicherheitsnadel schließen musste. Sie zog den Lambswoolpulli an, der zu dem Rock passte, und ignorierte die Fettwülste, die aus dem gewaltigen panzerähnlichen Büstenhalter hervorquollen. Sie zog Nylonstrümpfe an, doch weil sie gewöhnlich dicke Wollsocken trug, kam sie sich schrecklich nackt vor und beschloss, hohe Stiefel anzuziehen, und dann konnte sie die Reißverschlüsse kaum zubekommen.
Unten wurde es nicht besser. Einer der Hunde hatte sich übergeben, der Ofen war nur lauwarm, und in der Speisekammer waren nur noch drei Eier. Sie ließ die Hunde in den Garten, wischte die Bescherung auf, füllte den Herd mit dem enorm teuren Spezialheizöl und betete, dass er nicht ganz ausgehen und Mrs. Croftway einen triftigen Grund zu weiterem Genörgel liefern möge. Sie rief die Kinder, befahl ihnen, sich zu beeilen, setzte mehrere Kessel Wasser auf, kochte die drei Eier, machte Toast, deckte den Tisch. Rupert und Melanie kamen mehr oder weniger korrekt angezogen herunter, aber sie stritten sich, weil Rupert sagte, Melanie habe sein Erdkundebuch verloren, während Melanie erklärte, sie habe es nie in der Hand gehabt, und er sei ein frecher Lügner, und Mami, ich brauche fünfundzwanzig Pence für Mrs. Leepers Abschiedsgeschenk.
Nancy hatte den Namen nie gehört.
George war keine Hilfe. Er erschien einfach inmitten des allgemeinen Aufruhrs, aß sein Ei, trank eine Tasse Tee und ging. Sie hörte den Rover die Zufahrt hinunterfahren, während sie hastig Geschirr auf das Abtropfbrett stapelte, wo Mrs. Croftway es finden und nach Belieben damit verfahren würde.
«Na ja, wenn du das Erdkundebuch nicht gehabt hast …»
Vor der Tür winselten die Hunde. Sie ließ sie herein, was sie an ihr Futter erinnerte, sodass sie die Näpfe mit Hundekuchen füllte und eine Dose Bonzo aufmachte und sich in ihrer Hektik den Daumen an dem schartigen Deckelrand aufschnitt.
«Mein Gott, wie ungeschickt du bist», sagte Rupert zu ihr.
Nancy wandte ihm den Rücken zu und hielt den Daumen unter laufendes Wasser, bis er aufhörte zu bluten.
«Wenn ich keine fünfundzwanzig Pence habe, ist Miss Rawlings bestimmt sauer …»
Sie lief nach oben, um sich zurechtzumachen. Sie hatte keine Zeit für zarte Übergänge oder Augenbrauenstift, und das Ergebnis war alles andere als zufriedenstellend, aber sie konnte es nicht ändern. Sie hatte keine Zeit. Sie holte den Pelzmantel aus dem Schrank, die dazu passende Pelzkappe. Sie nahm Handschuhe und die Eidechstasche von Mappin and Webb heraus. Sie schüttete den Inhalt ihrer Alltagstasche hinein, worauf sie natürlich nicht mehr zu schließen war. Von mir aus. Ich kann’s nicht ändern. Ich habe keine Zeit.
Sie lief wieder nach unten und rief nach den Kindern. Wie durch ein Wunder erschienen sie mit ihren gepackten Schultaschen, und Melanie stülpte sich die Mütze auf, die ihr kein bisschen stand. Sie verließen das Haus durch die Hintertür, gingen zur Garage und stiegen in den Wagen, der Gott sei Dank sofort ansprang, und fuhren los.
Sie brachte die Kinder zur Schule, ließ jedes von ihnen am Tor aussteigen und hatte kaum die Zeit, auf Wiedersehen zu sagen, ehe sie weiterfuhr. Dann brauste sie nach Cheltenham. Als sie den Wagen auf dem Bahnhofsparkplatz abstellte, war es zehn nach neun, und als sie die verbilligte Rückfahrkarte kaufte, war es zwölf nach neun. Am Zeitungskiosk mogelte sie sich mit einem, wie sie hoffte, charmanten Lächeln an der Schlange vorbei und kaufte den Daily Telegraph und – ein unerhörter Luxus – eine Harper’s & Queen. Als sie gezahlt hatte, sah sie, dass es eine alte Nummer war, die vom letzten Monat, aber sie hatte keine Zeit, darauf hinzuweisen und das Geld zurückzuverlangen. Außerdem spielte es im Grunde keine Rolle, dass es eine alte Nummer war; sie war schick und hochglanzgedruckt, außerordentlich luxuriös. Während sie sich dies sagte, trat sie auf den Bahnsteig, auf dem der Zug nach London gerade einfuhr. Sie machte die nächstbeste Tür auf, stieg ein und fand einen Platz. Sie war völlig außer Atem, und ihr Herz hämmerte. Sie schloss die Augen. So ungefähr muss es sein, wenn man sich mit knapper Not aus einer Feuersbrunst gerettet hat, sagte sie sich.
Nach einer Weile, nach einigen tiefen Atemzügen und einem kleinen beruhigenden Selbstgespräch, ging es ihr wieder besser. Das Abteil war zum Glück sehr gut geheizt. Sie schlug die Augen auf und öffnete die Schnappverschlüsse des Pelzmantels. Sie setzte sich gemütlich zurecht, betrachtete die graue Winterlandschaft, die am Fenster vorbeiflog, und ließ ihre angespannten Nerven von dem monotonen Rattern des Zuges beruhigen. Sie fuhr gerne Eisenbahn. Das Telefon konnte nicht klingeln, man konnte ruhig dasitzen, man brauchte nicht zu denken.
Die Kopfschmerzen waren fort. Sie nahm ihren Compactpuder aus der Handtasche und begutachtete ihr Gesicht in dem kleinen Spiegel, tupfte ein wenig Puder auf die Nase und rieb die Lippen aufeinander, um den Lippenstift zu verteilen. Die Illustrierte lag wie eine ungeöffnete Schachtel mit dunkelbraunen, innen köstlich weichen Pralinen auf ihrem Schoß. Sie blätterte darin und sah Annoncen für Pelze, für Häuser in Südspanien, für Time-Sharing-Residenzen im schottischen Hochland, für Schmuck, für Kosmetika, die einen nicht nur verschönen, sondern die Haut von innen her aufbauen würden, für Kreuzfahrten in den Süden, für …
Plötzlich wurde ihre Aufmerksamkeit geweckt, und sie hielt abrupt inne. Die Auktionsfirma Boothby’s warb mit einem doppelseitigen Inserat für eine Versteigerung viktorianischer Kunst, die Mittwoch, den 21. März, in ihren Verkaufsräumen in der Bond Street stattfinden würde. Das abgebildete Kunstwerk war ein Gemälde von Lawrence Stern, 1865–1946. Es hieß Die Wasserträgerinnen (1904) und zeigte eine Gruppe von jüngeren Frauen, die große Kupferkrüge auf der Schulter oder an der Hüfte trugen. Nancy betrachtete sie und kam zu dem Schluss, sie müssten wohl Sklavinnen sein, weil sie barfüßig waren, nicht lächelten (die armen Dinger, kein Wunder, die Krüge sahen furchtbar schwer aus) und nur das Allernotwendigste anhatten, tiefblaue und rostrote dünne Fetzen, die unangebrachterweise volle Brüste und rosige Brustwarzen freiließen.
Weder George noch Nancy interessierten sich für Kunst, ebenso wenig übrigens wie für Theater und Musik. Das Alte Pfarrhaus hatte natürlich seinen geziemenden Anteil an Bildern, die Art von Drucken, die Szenen aus dem Sportleben zeigten, die jedes Landhaus, das etwas auf sich hielt, besitzen musste, und einige Ölgemälde mit erlegten Hirschen oder treuen Jagdhunden mit Fasanen im Maul, die George allesamt von seinem Vater geerbt hatte. Als sie einmal in London ein oder zwei Stunden Zeit gehabt hatten, waren sie in die Tate Gallery gegangen und hatten sich pflichtschuldigst eine Constable-Ausstellung angesehen, aber Nancy erinnerte sich nur noch, dass sie eine Menge dichte grüne Bäume gesehen und dass ihre Füße schrecklich weh getan hatten.
Doch selbst Constable war diesem Bild vorzuziehen. Sie betrachtete es und konnte kaum glauben, dass es irgendjemanden gab, der etwas so Scheußliches an der Wand haben oder sogar gutes Geld dafür bezahlen wollte. Wenn sie einen solchen Schinken geerbt oder geschenkt bekommen hätte, hätte sie ihn irgendwo auf dem Speicher versteckt oder verbrannt.
Aber Die Wasserträgerinnen hatten ihre Aufmerksamkeit nicht aus irgendwelchen ästhetischen Gründen gefesselt. Der Grund, weshalb sie das Bild so interessiert betrachtete, war die Tatsache, dass es von Lawrence Stern war. Er war Penelope Keelings Vater gewesen und mithin ihr Großvater.
Das Sonderbare war, dass sie seine Werke praktisch überhaupt nicht kannte. Als sie geboren wurde, war sein Ruhm, der seinen Höhepunkt um die Jahrhundertwende erreicht hatte, bereits verblichen, und seine Arbeiten waren längst verkauft, in alle Himmelsrichtungen verstreut und vergessen. Im Haus ihrer Mutter in der Oakley Street hatten nur drei Bilder von Lawrence Stern gehangen, und zwei davon waren unvollendete Tafelbilder, auf denen eine allegorische Nymphe auf einem grasigen Hang mit Gänseblümchen Lilien verstreute.
Das dritte Bild hing in der Diele im Erdgeschoss, genau unter der Treppe, dem einzigen Platz im Haus, der wegen der beträchtlichen Größe des Kunstwerks in Frage gekommen war. Es war ein Ölgemälde aus Sterns später Schaffensperiode und hieß Die Muschelsucher. Es zeigte eine Anzahl Wellen mit Schaumkronen, einen Strand und einen Himmel mit windgepeitschten Wolken. Als Penelope von der Oakley Street nach Podmore’s Thatch zog, hatte sie diese Besitztümer, an denen sie sehr hing, mitgenommen. Die Tafelbilder hingen oben im Flur, und Die Muschelsucher ließen das Wohnzimmer mit seiner niedrigen Balkendecke noch kleiner wirken, als es ohnehin schon war. Nancy bemerkte sie kaum noch, weil sie ihr so vertraut waren und ebenso sehr zum Haus ihrer Mutter gehörten wie die durchgesessenen Sofas und Armstühle, die altmodischen, viel zu üppigen Blumengestecke in weißblauen Krügen, der köstliche Geruch von brutzelndem Essen.
Um die Wahrheit zu sagen, hatte Nancy seit Jahren nicht mehr an Lawrence Stern gedacht, doch während sie nun in ihrem Pelzmantel und ihren Stiefeln im Zug saß, holte die Erinnerung sie ein und entführte sie in die Vergangenheit. Nicht, dass es viel zu erinnern gab. Sie war Ende 1940 in Cornwall zur Welt gekommen, in dem kleinen Kreiskrankenhaus in Porthkerris, und hatte die Kriegsjahre in Carn Cottage, unter dem schützenden Dach von Lawrence Stern, verbracht. Aber ihre Kindheitserinnerungen an den alten Mann waren verschwommen, mehr das Bewusstsein einer Präsenz als eines Menschen. Hatte er sie je auf die Knie genommen, hatte er sie spazieren gefahren oder ihr etwas vorgelesen? Wenn ja, hatte sie es vergessen. Offenbar hatte sich ihrem kindlichen Geist bis zu dem letzten Tag, als der Krieg endlich vorbei gewesen war und sie und ihre Mutter Porthkerris für immer verlassen hatten und mit dem Zug nach London zurückgefahren waren, nichts eingeprägt. Aus irgendeinem Grund war nur jenes eine Ereignis in ihr Bewusstsein gedrungen und ein Teil ihrer Erinnerungen geworden.
Er hatte sie zum Bahnhof gebracht, um ihnen dort Lebewohl zu sagen. Er hatte, ein sehr alter, sehr großgewachsener, zunehmend gebeugter Mann, auf einen Spazierstock mit silbernem Knauf gestützt am Zug gestanden und Penelope zum Abschied durch das geöffnete Fenster hindurch geküsst. Seine langen weißen Haare hatten auf dem Tweedkragen seines Mantels mit abnehmbarem Cape gelegen, und an seinen knotigen und deformierten Händen hatte er Halbfäustlinge getragen, aus denen die längst nutzlosen Finger weiß und blutleer wie Knochen hervorragten.
Im allerletzten Augenblick, als der Zug sich schon in Bewegung setzte, hatte Penelope sie hochgenommen, und der alte Mann hatte die Hand ausgestreckt und sie an ihre runde Babywange gelegt. Sie erinnerte sich, wie kalt die Hand gewesen war, die sich an ihrer Haut wie Marmor angefühlt hatte. Für mehr hatte die Zeit nicht gereicht. Der Zug wurde schneller, der Bahnsteig entglitt in einer langgezogenen Krümmung, er stand da und wurde immer kleiner und schwenkte seinen großen breitkrempigen Hut in einem letzten Abschiedsgruß. Das war Nancys erste und einzige Erinnerung an ihn, denn er war im Jahr darauf gestorben.
Vergangen und dahin, sagte sie sich. Kein Grund, sentimental zu werden. Aber sehr merkwürdig, dass es heute jemanden geben sollte, der den Wunsch hatte, seine Werke zu kaufen. Die Wasserträgerinnen. Sie schüttelte verständnislos den Kopf, dachte dann aber nicht weiter über das Rätsel nach und wandte sich erwartungsvoll den tröstlichen Illusionen der Gesellschaftsrubrik zu.
2 Olivia
Der neue Fotograf hieß Lyle Medwin. Er war ein sehr junger Mann mit seidigen braunen Haaren, die aussahen wie nach der Suppenschüsselmethode geschnitten, und einem freundlichen Gesicht mit unschuldig blickenden Augen. Er hatte etwas Weltabgewandtes, wie ein inbrünstiger Novize, und Olivia konnte kaum glauben, dass er es bei dem erbarmungslosen Konkurrenzkampf in seiner Branche so weit gebracht hatte, ohne auf der Strecke zu bleiben.
Sie standen am Tisch am Fenster ihres Büros, wo er Proben seiner früheren Arbeiten zu ihrer Begutachtung ausgebreitet hatte, ungefähr zwei Dutzend großformatige Hochglanzabzüge, die sie überzeugen sollten. Olivia hatte sie aufmerksam betrachtet, und sie gefielen ihr. Sie waren vor allem scharf und deutlich. Modefotos, sagte sie immer, mussten zeigen, wie ein Kleidungsstück geschnitten war, wie ein Rock fiel, was für eine Oberflächenstruktur ein Pullover hatte, und all das fiel hier sofort ins Auge. Aber aus den Bildern atmete zugleich Leben, Bewegung, Freude, sogar eine gewisse Zärtlichkeit.
Sie nahm eines hoch. Ein Mann, der wie ein Fußballprofi gebaut war, lief durch Brandungsgischt, und sein Jogginganzug hob sich blendend weiß vor dem kobaltblauen Meer ab. Sonnengebräunte Haut, Schweiß, salzige Seeluft, die man zu riechen glaubte, und Einssein mit dem Körper.
«Wo haben Sie das gemacht?»
«In Malibu. Es war eine Annonce für Sportkleidung.»
«Und das?» Sie nahm ein anderes Foto, eine Abendaufnahme von einem Mädchen in fließendem, flammend rotem Chiffon, das sein Gesicht der blutroten untergehenden Sonne zuwandte.
«Das war Point Reays … für einen Bericht in der amerikanischen Vogue.»
Sie legte die Abzüge wieder hin, wandte sich ihm zu und machte sich etwas kleiner, indem sie sich an die Tischkante lehnte. Ihre Augen waren nun auf gleicher Höhe.
«Was ist Ihr beruflicher Background?»
Er zuckte mit den Schultern. «Fachschule. Dann habe ich ein bisschen frei gearbeitet, und dann bin ich zu Toby Stryber gegangen und war ein paar Jahre sein Assistent.»
«Ja, es war Toby, der mir von Ihnen erzählt hat.»
«Und als ich bei Toby aufgehört habe, bin ich nach Los Angeles gegangen. Ich habe die drei letzten Jahre drüben gelebt.»
«Und Erfolg gehabt?»
Er lächelte bescheiden. «Na ja, ich bin einigermaßen zurechtgekommen.»
Er war absolut kalifornisch gekleidet. Weiße Sneaker, verwaschene Jeans, weißes Hemd, eine verblichene Jeansjacke. Als einzige Konzession an den kalten Londoner Winter hatte er einen korallenroten Kaschmirschal um den Hals. Seine Kleidung war lässig und knautschig, gab ihm jedoch etwas köstlich Sauberes, wie frischgewaschene Wäsche – sonnengetrocknet, aber noch nicht gebügelt. Sie fand ihn enorm attraktiv.
«Carla hat Ihnen erzählt, worum es geht?» Carla war Olivias Moderedakteurin. «Es ist für die Julinummer, ein letzter Bericht über Urlaubskleidung, ehe wir Tweed fürs Hochmoor machen.»
«Ja … Sie hat was von Außenaufnahmen gesagt.»
«Haben Sie eine Idee, wo wir es machen könnten?»
«Wir haben von Ibiza gesprochen. Ich habe da gute Kontakte.»
«Ibiza?»
Er beeilte sich, Flexibilität zu zeigen. «Aber wenn Ihnen etwas anderes vorschwebt, kein Problem. Vielleicht Marokko.»
«Nein.» Sie stieß sich vom Tisch ab und ging zu ihrem Sessel hinter dem Schreibtisch zurück. «Wir hatten Ibiza schon lange nicht mehr … aber ich möchte eigentlich keine Strandfotos. Lieber zur Abwechslung ein ländlicher Hintergrund mit Ziegen und Schafen und kräftigen ausgemergelten Bauern beim Pflügen. Sie könnten vielleicht ein paar Einheimische engagieren, um einen authentischen Touch zu bekommen. Sie haben wunderbare Gesichter und lassen sich gern fotografieren …»
«Sehr gut …»
«Besprechen Sie alles weitere mit Carla.»
Er zögerte. «Dann habe ich den Auftrag?»
«Sicher. Liefern Sie uns gute Bilder.»
«Ich werde mich bemühen. Vielen Dank …» Er sammelte seine Abzüge ein und schob sie zu einem kleinen Stapel zusammen. Olivias Sprechanlage summte, und sie drückte auf die Taste und sprach mit der Sekretärin.
«Ja?»
«Ein Anruf von draußen, Miss Keeling.»
Sie sah auf die Uhr. Es war Viertel nach zwölf.
«Wer ist es? Ich habe eine Verabredung zum Lunch und muss los.»
«Ein Mr. Henry Spotswood.»
Henry Spotswood. Wer zum Teufel war Henry Spotswood? Dann fiel es ihr plötzlich wieder ein, und sie sah den Mann vor sich, den sie vorgestern Abend auf der Cocktailparty der Ridgeways kennengelernt hatte. Graumeliertes Haar und so groß wie sie. Aber er hatte sich als Hank vorgestellt.
«Stellen Sie bitte durch, Jane.»
Während sie zum Hörer griff, ging Lyle Medwin mit seiner Fotomappe unter dem Arm geräuschlos durch den Raum und öffnete die Tür.
«Wiedersehen», sagte er kaum hörbar, und sie hob die Hand und lächelte, aber da war er schon verschwunden.
«Miss Keeling?»
«Ja.»
«Olivia, hier Hank Spotswood, wir haben uns bei den Ridgeways kennengelernt.»
«Ja, ich weiß.»
«Ich habe ein oder zwei Stunden. Könnten wir vielleicht zusammen essen?»