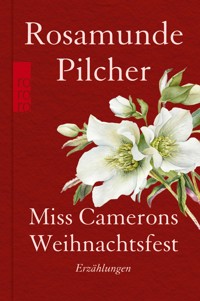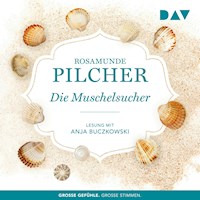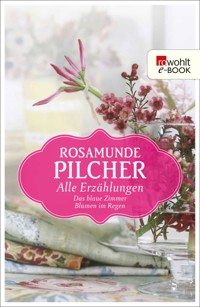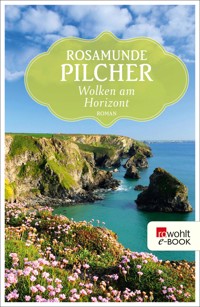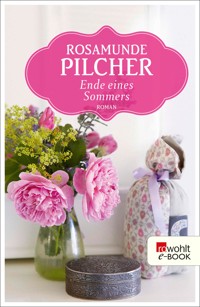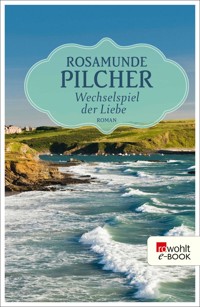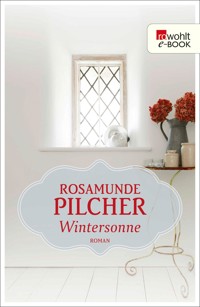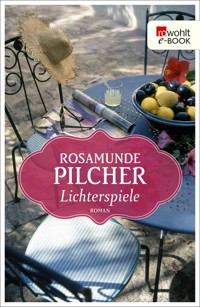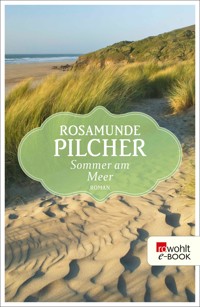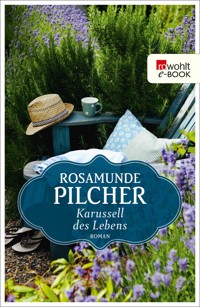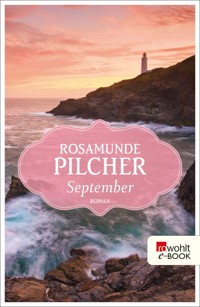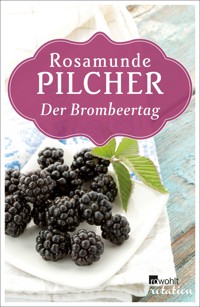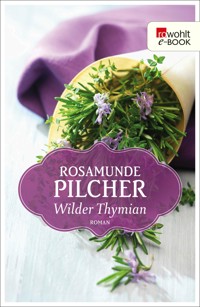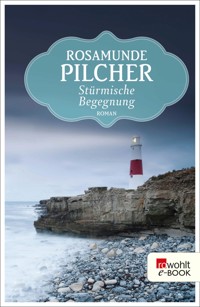
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wo dein Herz zuhause ist. Am Sterbebett ihrer Mutter erfährt Rebecca Bayliss ein langgehütetes Geheimnis: Plötzlich hat sie eine Familie, von der sie bisher nichts ahnte. Im Heimatort der Mutter an der malerischen Küste Cornwalls sucht und findet Rebecca die Menschen, die zu ihr gehören und ihr doch fremd sind. Und mit ihrem gutaussehenden Cousin Eliot verbindet sie bald mehr als nur Verwandtschaft.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 308
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Rosamunde Pilcher
Stürmische Begegnung
Roman
Aus dem Englischen von Jürgen Abel
Rowohlt E-Book
Inhaltsübersicht
1
An einem Montag Ende Januar fing alles an. An einem rauen Tag in einer grauen Jahreszeit. Weihnachten und Silvester waren vorbei und vergessen, und der Frühling hatte noch nicht angefangen, sein Gesicht zu zeigen. London war kalt und abweisend, die Geschäfte boten voll ungewisser Hoffnung Notwendiges «für die Kreuzfahrt in den Süden» an. Die Bäume im Park zeichneten sich kahl, wie Skelette, am verhangenen Himmel ab, und das plattgetretene Gras darunter war stumpf und tot, sodass man einfach nicht glaubte, es könne sich jemals wieder mit einem dichten Muster von lila und gelben Krokusblüten überziehen.
Es war ein Tag wie jeder andere. Der Wecker riss mich aus dem Schlaf in ein Dunkel, das nur durch die großen, gardinenlosen Fenster erträglich wurde, hinter denen ich die Krone der Platane sah, die vom gelblichen Schein einer fernen Straßenlaterne beleuchtet wurde.
In meinem Zimmer standen nur zwei Möbelstücke, die Schlafcouch, auf der ich lag, und ein Küchentisch, den ich abbeizen und mit Bienenwachs polieren wollte, wenn ich Zeit dafür hatte. Sogar der Fußboden war nackt, Dielenbretter, die schutzlos bis zu den Sockelleisten liefen. Eine Apfelsinenkiste diente als Nachttisch, eine andere als Sitzgelegenheit.
Ich streckte die Hand aus, knipste die Lampe an und sah mich hochbefriedigt in der trostlosen Umgebung um. Sie war mein. Meine erste Wohnung. Ich war erst vor drei Wochen eingezogen, und sie gehörte ganz allein mir. Ich konnte mit ihr machen, was ich wollte. Die weißen Wände mit Postern bedecken oder orangefarben streichen. Die Dielenbretter abschmirgeln oder verschiedenfarbig lackieren. Ich hatte bereits ein besitzergreifendes Interesse an Trödelläden und Antiquitätengeschäften entwickelt und konnte an keinem vorbeigehen, ohne das Schaufenster nach irgendeinem Schatz abzusuchen, den ich mir vielleicht leisten könnte. Auf diese Weise war der Tisch in meinen Besitz gelangt, und ich hatte bereits ein Auge auf einen alten Spiegel mit vergoldetem Rahmen geworfen, allerdings bis jetzt nicht den Mut aufgebracht, in das Geschäft zu gehen und nach dem Preis zu fragen. Vielleicht würde ich ihn über den Kamin hängen oder an die Wand gegenüber vom Fenster, damit sich das Bild des Himmels und des Baumes in seinem verschnörkelten Rahmen spiegelte.
Diese angenehmen Vorstellungen nahmen eine ganze Weile in Anspruch. Dann blickte ich wieder auf die Uhr, sah, dass es spät wurde, stand auf und lief barfuß in die winzige Küche, wo ich die Gasflamme anzündete und den Wasserkessel aufsetzte. Der Tag hatte begonnen.
Die Wohnung war in Fulham, im obersten Stock eines kleinen Reihenhauses, das Maggie und John Trent gehörte. Ich hatte sie erst Weihnachten kennengelernt, als ich bei Stephen Forbes, seiner Frau Mary und ihren vielen ungezogenen Kindern in ihrem großen und total unaufgeräumten Haus in Putney gewesen war. Stephen Forbes war mein Chef, der Besitzer der Buchhandlung in der Walton Street, wo ich seit einem Jahr arbeitete. Er war immer sehr nett und gefällig zu mir gewesen, und als er von den anderen Mädchen erfuhr, dass ich Weihnachten allein sein würde, hatten er und Mary sofort eine kategorische Einladung – in Wahrheit mehr einen Befehl – ausgesprochen, die drei Tage bei ihnen zu verbringen. Sie hätten jede Menge Platz, behauptete er, ein Zimmer auf dem Dachboden, ein Bett in Samanthas Zimmer, irgendwas würde sich bestimmt finden, es würde mir doch nichts ausmachen, nicht wahr? Und ich könnte Mary gut dabei helfen, den Truthahn zu begießen und das viele Geschenkpapier vom Fußboden aufzusammeln.
Das überzeugte mich. Ich nahm die Einladung schließlich an und bereute es nicht. Es gibt nichts Schöneres als Weihnachten im Kreis einer Familie, mit lauter Kindern und Krach und Papier und Geschenken und einem duftenden Tannenbaum, an dem glänzende Kugeln und liebenswerter selbstgebastelter Zierrat hängen.
Am zweiten Weihnachtstag gaben die Forbes’ eine Erwachsenenparty, bei der wir allerdings fortfuhren, ziemlich kindliche Spiele zu veranstalten, und als die Kinder sicher im Bett waren, kamen die Gäste, auch Maggie und John Trent. Die Trents hatten erst kürzlich geheiratet. Maggie war die Tochter eines Dekans der Universität Oxford, den Stephen in seiner Studienzeit gut gekannt hatte. Sie war eine fröhliche, herzliche und mitteilsame Person; sobald sie das Haus betreten hatte, kam die Party in Schwung. Wir wurden miteinander bekannt gemacht, hatten aber erst später Gelegenheit, uns zu unterhalten, als wir bei einer Scharade auf dem Sofa saßen und den Filmtitel zu erraten versuchten, den Mary mit den absonderlichsten hampelnden Gesten ausdrücken wollte. «Rosemarys Baby!», rief jemand ohne erkennbaren Grund.
«Clockwork Orange!»
Maggie zündete sich eine Zigarette an und gab sich geschlagen. «Das schaffe ich nie», sagte sie und ließ sich zurücksinken. Dann wandte sie den Kopf und sah mich an. «Sie arbeiten in der Buchhandlung, nicht wahr?»
«Ja.»
«Ich werde nächste Woche vorbeikommen und all die Geschenkgutscheine ausgeben, die ich zu Weihnachten gekriegt habe. Es sind Dutzende.»
«Sie Glückliche.»
«Wir haben gerade ein Haus gekauft, und ich brauche viele Kunstbücher, die ich überall herumliegen lasse, damit unsere Freunde denken, ich sei wahnsinnig intellektuell …» Dann rief jemand: «Maggie, du bist an der Reihe», und sie sagte «Verdammt», und stand auf und überlegte krampfhaft, was sie mimen sollte. Ich weiß nicht mehr, was es war, aber während ich zuschaute, wie sie sich ganz unbefangen zum Narren machte, fand ich sie ausgesprochen sympathisch und hoffte, ich würde sie wiedersehen.
Ich sah sie natürlich wieder. Wie sie gesagt hatte, kam sie ein paar Tage nach Weihnachten in die Buchhandlung, in einem Lammfellmantel und einem langen lila Rock, unter dem Arm eine prallvolle Handtasche mit Geschenkgutscheinen. Ich bediente gerade jemanden und trat hinter einem Stapel Romane mit Hochglanzschutzumschlag hervor. «Hallo.»
«Oh, schön, dass Sie da sind. Könnten Sie mir helfen?»
«Ja, natürlich.»
Wir suchten zusammen ein Kochbuch, eine neue Autobiographie, über die alle Leute redeten, und ein schrecklich teures Buch mit impressionistischen Bildern zum «Herumliegenlassen» aus. Der Preis für die drei Bücher war etwas höher als der Wert der Gutscheine, und sie nahm ein Scheckheft aus der Tasche, um die Differenz zu zahlen.
«John wird stocksauer sein», sagte sie gut gelaunt, während sie den Scheck mit einem roten Filzschreiber ausstellte. Der Scheck war gelb, die Wirkung sehr lustig. «Er sagt, wir geben ohnehin schon viel zu viel aus. Da.» Sie drehte den Scheck um und schrieb ihre Adresse auf die Rückseite. «Bracken Road vierzehn, SW sechs.» Sie sagte es laut für den Fall, dass ich ihre Schrift nicht lesen konnte. «Ich hab mich noch nicht daran gewöhnt, unsere Adresse zu schreiben. Wir sind gerade erst eingezogen. Es ist schrecklich aufregend, wir haben es nämlich gekauft, ob Sie es glauben oder nicht. Unsere Eltern haben uns mit der Anzahlung geholfen, und John hat es geschafft, eine Bausparkasse zu überreden, uns einen Kredit über den Rest zu geben. Aber wir werden den obersten Stock vermieten müssen, um die Hypothek zu zahlen. Ich glaube, dann wird es schon irgendwie klappen.» Sie lächelte. «Sie müssen irgendwann vorbeikommen und es sich ansehen.»
«Ja, gern.» Ich wickelte die Bücher in farblich passendes Geschenkpapier und gab mir Mühe, es sauber zu falten.
Sie sah mir zu. «Hören Sie, es ist furchtbar unhöflich, aber ich weiß Ihren Namen nicht mehr. Ich weiß, Sie heißen Rebecca, aber der Nachname?»
«Rebecca Bayliss.»
«Sie kennen nicht zufällig einen netten, ruhigen Zeitgenossen, der eine unmöblierte Wohnung sucht?»
Ich sah sie an. Unsere Gedanken deckten sich so weitgehend, dass ich kaum etwas zu sagen brauchte. Ich knotete den Bindfaden um das Päckchen und schnitt die Enden ab. «Wie wäre es mit mir?», sagte ich.
«Sie? Suchen Sie denn eine Wohnung?»
«Bis eben noch nicht. Aber jetzt.»
«Es ist nur ein Zimmer und eine Küche. Das Bad müssen wir teilen.»
«Das macht mir nichts aus, wenn es Ihnen nichts ausmacht. Und wenn ich mir die Miete leisten kann. Ich weiß nicht, was Sie sich gedacht haben.»
Maggie sagte es mir. Ich schluckte und rechnete schnell nach. «Das ginge», sagte ich dann.
«Haben Sie denn Möbel?»
«Nein. Ich wohne zusammen mit ein paar anderen Mädchen in einer möblierten Wohnung. Aber ich kann mir welche besorgen.»
«Sie scheinen unbedingt etwas Eigenes haben zu wollen.»
«Nicht unbedingt, aber ich wäre lieber unabhängig.»
«Hm, ehe Sie sich entschließen, müssen Sie natürlich kommen und es sich ansehen. Am frühen Abend, weil wir beide arbeiten.»
«Heute Abend?» Es war unmöglich, die Ungeduld und Aufregung aus meiner Stimme zu verbannen.
Maggie lachte. «In Ordnung», antwortete sie. «Heute Abend.» Und damit nahm sie die wunderhübsch verpackten Bücher und wandte sich zum Gehen.
Ich geriet plötzlich in Panik. «Äh … ich … ich weiß die Adresse nicht …»
«Oh, sie steht doch hinten auf dem Scheck. Sie nehmen am besten den Zweiundzwanziger-Bus. Ich erwarte Sie gegen sieben.»
«Ich komme bestimmt», versprach ich.
Während der Bus langsam die Kings Road entlangrumpelte, musste ich mich zur Ordnung rufen und meine Begeisterung zügeln. Ich durfte nicht die Katze im Sack kaufen. Vielleicht war die Wohnung völlig unmöglich, zu groß oder zu klein oder auf irgendeine andere Weise total ungeeignet. Alles war besser, als enttäuscht zu werden. Tatsächlich war das kleine Haus dann von außen ganz unscheinbar, eines von zehn oder zwölf Reihenhäusern aus rotem Backstein, mit kunstvollen Ausfugungen um den Eingang und vielen geschmacklosen Bleiverglasungen. Aber innen war Nr. 14 hell und freundlich – frische Farbe, neue Auslegware und natürlich Maggie selbst, in alten Jeans und einem blauen Pulli.
«Entschuldigung, ich sehe verheerend aus, aber ich muss die ganze Hausarbeit machen, und deshalb ziehe ich mich immer gleich um, wenn ich aus dem Büro komme. Kommen Sie, gehen wir rauf und schauen es uns an … Legen Sie den Mantel ruhig auf den Treppenpfosten. John ist noch nicht zu Haus, aber ich habe ihm gesagt, dass Sie kommen, und er fand, es sei eine großartige Idee …»
Sie redete die ganze Zeit, während sie mich nach oben führte und mir den Vortritt in das leere Zimmer an der rückwärtigen Seite des Hauses ließ. Sie machte Licht. «Es geht nach Süden, zu dem kleinen Park dort. Die Vorbesitzer haben im Erdgeschoss einen Anbau gemacht, und Sie haben einen kleinen Balkon auf dem Dach des Anbaus.» Sie öffnete eine Glastür, und wir traten zusammen in den kalten dunklen Abend hinaus. Ich roch die abgefallenen Blätter, die feuchte Erde vom Park und sah die Konturen der Bäume im Schein der Straßenlaternen ringsum. Eine kalte Bö ließ das schwarze Gerippe der Platane aufstöhnen, doch das Geräusch ging unter im Lärm eines Düsenflugzeugs oben am Himmel.
«Es ist wie auf dem Land», sagte ich.
«Na ja, vielleicht nicht ganz.» Sie fröstelte. «Gehen wir wieder rein, ehe wir hier erfrieren.» Wir traten wieder ins Zimmer, und Maggie zeigte mir die winzige Küche, die einmal ein tiefer Wandschrank gewesen war, und dann, auf halber Höhe der Treppe, das Badezimmer, das wir teilen würden. Schließlich standen wir wieder unten in ihrem behaglichen, unaufgeräumten Wohnzimmer, und sie holte eine Flasche Sherry und ein paar Kartoffelchips, die bestimmt schon muffig schmeckten, wie sie sagte. Ich fand die Chips in Ordnung. «Interessieren Sie sich immer noch für die Wohnung?», fragte sie.
«Mehr denn je.»
«Und wann möchten Sie einziehen?»
«So bald wie möglich. Nächste Woche, wenn es geht?»
«Was werden die Mädchen aus Ihrer Wohngemeinschaft sagen?»
«Sie werden schon jemand anderen finden. Eine von ihnen hat eine Schwester, die in einer Woche nach London kommt. Ich denke, sie wird mein Zimmer nehmen.»
«Und die Möbelfrage?»
«Oh … Ich denke, ich kriege das irgendwie hin.»
«Ihre Eltern werden bestimmt ein paar tolle Sachen hervorzaubern, das ist immer so», sagte Maggie vergnügt. «Als ich nach London gegangen bin, kramte meine Mutter die schönsten Dinge vom Speicher und aus dem Wäscheschrank …» Sie verstummte. Ich sah sie an, ohne etwas zu sagen, und sie lachte schließlich über sich selbst. «Ich plappere wieder drauflos und trete ins Fettnäpfchen. Entschuldigung. Ich habe offensichtlich etwas schrecklich Dummes und Taktloses gesagt.»
«Ich habe keinen Vater mehr, und meine Mutter lebt im Ausland. Auf Ibiza. Das ist der wahre Grund, weshalb ich etwas Eigenes haben möchte.»
«Entschuldigung. Ich hätte es wissen müssen, wo Sie Weihnachten bei den Forbes’ gewesen sind … Ich meine, ich hätte es mir irgendwie denken können.»
«Wie hätten Sie darauf kommen sollen?»
«Ist Ihr Vater gestorben?»
Sie war offensichtlich neugierig, aber auf eine so herzliche Art, dass es mir plötzlich lächerlich vorkam, zuzuklappen wie eine Auster, was ich sonst immer machte, wenn jemand Fragen über meine Familie stellte.
«Ich glaube nicht», sagte ich und gab mir Mühe, es so zu sagen, als spielte es keine Rolle. «Ich glaube, er lebt in Los Angeles. Er war Schauspieler. Meine Mutter ist mit ihm durchgebrannt, als sie achtzehn war. Aber das häusliche Leben langweilte ihn bald, oder er fand, dass seine Karriere wichtiger sei als eine Familie. Die Ehe dauerte jedenfalls nur ein paar Monate, und dann ging er auf und davon und ließ meine Mutter mit mir sitzen.»
«Wie furchtbar, so etwas zu tun.»
«Ja, ich nehme an, es ist ziemlich lieblos. Ich habe nie groß darüber nachgedacht. Meine Mutter hat nie von ihm gesprochen. Nicht weil sie sehr verbittert oder verletzt war, nein. Sie hat einfach die Gabe, etwas ohne weiteres zu vergessen, wenn es aus und vorbei ist. Sie ist schon immer so gewesen. Sie sieht nur nach vorn, und immer sehr optimistisch.»
«Aber was ist passiert, als Sie geboren wurden? Ist sie zu ihren Eltern zurückgegangen?»
«Nein. Nie.»
«Sie meinen, es kam kein Telegramm mit den Worten ‹Komm zurück, es ist alles verziehen›?»
«Ich weiß es nicht. Wirklich nicht.»
«Es muss schreckliche Szenen gegeben haben, als Ihre Mutter davonlief, aber trotzdem …» Sie verstummte. Sie war offenbar nicht imstande, eine Situation zu begreifen, die ich mein Leben lang gleichmütig akzeptiert hatte. «Wer könnte seiner Tochter so etwas antun?»
«Ich weiß nicht.»
«Das kann nicht Ihr Ernst sein!»
«Doch. Ich weiß es wirklich nicht.»
«Soll das heißen, Sie kennen Ihre Großeltern gar nicht?»
«Ich weiß nicht mal, wer sie sind. Oder vielleicht, wer sie waren. Ich weiß auch nicht, ob sie noch leben.»
«Sie wissen nichts von ihnen? Hat Ihre Mutter Ihnen denn nie etwas gesagt?»
«O doch … Ab und zu kam sie auf früher zu sprechen, aber es waren immer nur Bruchstücke. Sie wissen ja, wie Mütter mit ihren Kindern reden, wenn sie sich an Dinge erinnern, die sie erlebt haben, als sie selbst noch klein waren.»
«Bayliss …» Sie runzelte die Stirn. «Das ist kein häufiger Name. Und er kommt mir irgendwie bekannt vor, aber ich habe keine Ahnung, warum. Haben Sie denn gar keinen Anhaltspunkt?»
Ich musste über ihre Hartnäckigkeit lachen. «Sie reden, als ob ich es unbedingt wissen möchte. Aber ich will es gar nicht wissen, verstehen Sie? Wenn man seine Großeltern nie gekannt hat, vermisst man sie auch nicht.»
«Aber möchten Sie nicht manchmal wissen –» sie suchte nach Worten – «wo sie lebten?»
«Das weiß ich. Sie lebten in Cornwall. In einem Haus aus Feldsteinen, mit Wiesen und Feldern, die zum Meer hin abfielen. Und meine Mutter hatte einen Bruder, der Roger hieß und im Krieg gefallen ist.»
«Aber was hat sie gemacht, als Sie auf die Welt kamen? Ich nehme an, sie musste sich eine Arbeit suchen?»
«Nein, sie hatte etwas eigenes Geld. Sie hatte es von einer Tante geerbt. Wir hatten natürlich nie ein Auto und dergleichen, aber soweit ich weiß, sind wir ganz gut zurechtgekommen. Sie hatte eine Wohnung in Kensington, im Souterrain eines Hauses, das Freunden von ihr gehörte. Dort haben wir gewohnt, bis ich ungefähr acht war, dann kam ich aufs Internat, und danach … danach sind wir von einem Ort zum anderen gezogen.»
«Internate kosten Geld.»
«Meines war nicht sehr vornehm.»
«Hat Ihre Mutter wieder geheiratet?»
Ich sah Maggie an. Sie machte ein schrecklich neugieriges Gesicht, aber ihre Miene war freundlich. Ich fand, jetzt, wo ich schon so weit gegangen war, konnte ich ihr auch den Rest erzählen.
«Sie … sie war irgendwie nicht der Typ, der heiratet … Aber sie war immer sehr attraktiv, und ich kann mich nicht erinnern, sie jemals ohne einen Verehrer erlebt zu haben … Und als ich dann auf dem Internat war, hatte sie sicher keinen Grund mehr, noch groß auf ihren guten Ruf zu achten. Ich wusste nie, wo ich die nächsten Ferien verbringen würde. Einmal fuhren wir nach Frankreich, in die Provence. Manchmal blieben wir hier in England. Zu Weihnachten flogen wir einmal nach New York.»
Maggie schnitt eine Grimasse. «Nicht sehr lustig für Sie.»
«Aber gut für die Bildung.» Ich hatte schon vor langer Zeit gelernt, es von der scherzhaften Seite zu sehen. «Stellen Sie sich all die Orte vor, die ich gesehen habe, und die vielen ungewöhnlichen Plätze, wo ich gewohnt habe. Einmal im Ritz in Paris, und dann in einem scheußlich kalten Haus in Denbigshire. Das war ein Dichter, der glaubte, er müsse es mit Schafezüchten versuchen. Ich war in meinem Leben noch nie so froh wie an dem Tag, als diese Beziehung zu Ende ging.»
«Sie muss sehr schön sein.»
«Nein, aber die Männer finden es. Und sie ist sehr, sehr lustig und verschwenderisch und unergründlich und absolut unmoralisch, wie man es ausdrücken würde. Schrill. Alles ist ein Witz, das sagt sie immer. Unbezahlte Rechnungen sind ein Witz, und verlorene Handschuhe und unbeantwortete Briefe, alles ist ein Witz. Sie hat keine Ader für Geld und kein Verantwortungsgefühl. Es ist sehr anstrengend, mit ihr zu leben.»
«Was macht sie in Ibiza?»
«Sie lebt mit einem Schweden zusammen, den sie dort kennengelernt hat. Sie fuhr hin, um ein befreundetes Ehepaar zu besuchen, dann traf sie ihn, und das nächste, was ich von ihr hörte, war die Nachricht, dass sie zu ihm ziehen wollte. Sie sagte, er sei umwerfend nordisch und schrecklich nüchtern, aber er habe ein tolles Haus.»
«Wann haben Sie sie das letzte Mal gesehen?»
«Vor ungefähr zwei Jahren. Ich verschwand mehr oder weniger aus ihrem Leben, als ich siebzehn war. Ich machte damals einen Sekretärinnenkurs und nahm Aushilfsjobs an, und dann bekam ich den Job bei Stephen Forbes.»
«Gefällt er Ihnen?»
«Ja. Wirklich.»
«Wie alt sind Sie?»
«Einundzwanzig.»
Maggie lächelte wieder und schüttelte verwundert den Kopf. «Sie haben eine Menge durchgemacht», sagte sie, und es klang kein bisschen mitleidig, sondern fast ein wenig neidisch. «Ich war mit einundzwanzig eine errötende Braut in einem scheußlichen engen weißen Hochzeitskleid mit einem alten Schleier, der nach Mottenkugeln roch. Ich bin wirklich nicht altmodisch, aber meine Mutter ist es, und da ich sie sehr mag, habe ich gewöhnlich getan, was sie wollte.»
Ich konnte mir ihre Mutter vorstellen. Da mir nichts anderes einfiel, griff ich in die Kiste tröstlicher Platituden: «Na ja, die Menschen sind verschieden …» Während ich das sagte, hörten wir Johns Schlüssel im Schloss, und damit war das Gespräch über Mütter und Familien beendet.
Es war ein Tag wie jeder andere, aber mit einem Bonus. Ich hatte am Donnerstag Überstunden in der Buchhandlung gemacht, um mit Stephen die Jahresinventur zu beenden, und er hatte mir dafür diesen Vormittag freigegeben, sodass ich den halben Tag zu meiner Verfügung hatte. Ich nutzte ihn, um die Wohnung zu putzen (was höchstens eine halbe Stunde dauerte), einzukaufen und ein paar Sachen zum Waschsalon zu bringen. Gegen halb zwölf hatte ich diese Hausfrauenpflichten getan, zog meinen Mantel an und machte mich auf den Weg zur Arbeit. Ich wollte einen Teil der Strecke zu Fuß gehen und vielleicht irgendwo eine Kleinigkeit essen, ehe ich zur Buchhandlung musste.
Es war einer jener kalten, dunklen, feuchten Tage, an denen es nie so richtig hell wird. Ich spazierte durch den trüben Schleier zur New Kings Road und bog dann nach Westen ab. Hier gibt es in jedem zweiten Laden Antiquitäten, gebrauchte Betten oder alte Bilderrahmen, und ich glaubte sie alle zu kennen, aber auf einmal stand ich vor einem Geschäft, das mir noch nie aufgefallen war. Es war weiß gestrichen, die Fensterrahmen waren schwarz lackiert, und zum Schutz vor dem drohenden Regen war eine rot-weiß gestreifte Markise heruntergelassen.
Ich blickte hoch, um zu sehen, wie der Laden hieß, und sah den Namen TRISTRAM NOLAN in peniblen Großbuchstaben über der Tür. Die Tür war flankiert von Schaufenstern mit dem herrlichsten alten Krimskrams, und ich blieb in dem hellen Schein stehen, den die vielen Lampen drinnen auf den Bürgersteig warfen, und betrachtete die Auslagen. Die meisten Möbel waren viktorianisch, neu gepolstert, aufgearbeitet und hochglanzpoliert. Ein Sofa mit gedrechselten Beinen, ein Nähkasten, ein kleines Bild von mehreren Schoßhündchen auf einem Samtkissen.
Ich schaute weiter in den Laden hinein, und da sah ich die Kirschbaumstühle. Es waren zwei, mit bauchiger Lehne und leicht geschwungenen Beinen, die Bezüge waren mit Rosen bestickt.
Ich musste sie haben. Ich musste. Ich stellte sie mir in meiner Wohnung vor, ich wünschte sie mir verzweifelt. Ich zögerte einen Moment lang. Es war kein Trödelladen, und wahrscheinlich würde ich mir die Stühle nicht leisten können. Aber Fragen kostete ja nichts. Ehe ich den Mut verlieren konnte, öffnete ich die Tür und ging hinein.
Im Laden war niemand, aber die Türglocke hatte geläutet, und ich hörte, wie jemand eine Treppe herunterkam. Dann wurde der Filzvorhang vor der Türöffnung an der hinteren Wand zur Seite geschoben, und ich sah einen Mann.
Ich nehme an, ich hatte jemand Älteren erwartet, der irgendwie zu dem Geschäft und den Antiquitäten passte, aber das Äußere dieses Mannes warf alle meine Erwartungen über den Haufen. Er war jung, großgewachsen, langbeinig und sehr lässig gekleidet, verwaschene Jeans und eine Jeansjacke, ebenso alt und verwaschen, mit aufgekrempelten Ärmeln, unter denen die karierten Manschetten seines Hemds hervorstanden. Er hatte ein Taschentuch um den Hals geschlungen und trug weiche Mokassins mit Fransen.
In jenem Winter sah man in London die unwahrscheinlichsten Typen in Cowboykleidung, aber er wirkte irgendwie echt, und seine abgetragenen Sachen schienen genauso authentisch zu sein wie er selbst. Wir standen da und sahen uns an, und dann lächelte er, was mich aus irgendeinem Grund aus der Fassung brachte. Ich lasse mich nicht gern aus der Fassung bringen und sagte kühler, als es eigentlich meine Art ist: «Guten Morgen.»
Er ließ den Filzvorhang wieder vor die Tür fallen und näherte sich auf seinen leisen Sohlen. «Kann ich etwas für Sie tun?»
Er sah vielleicht aus wie ein waschechter Amerikaner, aber sobald er den Mund aufgemacht hatte, war klar, dass dieser Eindruck täuschte. Das ärgerte mich irgendwie. Das Leben mit meiner Mutter hatte mir einige Erfahrung mit Männern im Allgemeinen und Angebern im Besonderen beschert, und ich kam sofort zu dem Schluss, dass dieser junge Mann ein Angeber war.
«Ich … Ich hätte mich gern nach diesen kleinen Stühlen erkundigt. Die mit der bauchigen Lehne.»
«O ja.» Er trat vor und legte die Hand auf einen der Stühle. Sie war lang und schmal, mit schönen geraden Fingern, sehr braun gebrannt. «Ich habe aber nur die beiden.»
Ich starrte auf die Stühle und versuchte, ihn zu ignorieren.
«Was sollen sie kosten?»
Er ging neben mir in die Hocke und suchte das Preisschild, und ich bemerkte sein dichtes, dunkles Haar.
«Sie haben Glück», antwortete er. «Die Stühle sind sehr billig, weil von einem ein Bein abgebrochen ist und nicht sehr fachmännisch angeleimt wurde.» Er richtete sich sehr schnell auf, sodass seine Größe mich unwillkürlich überraschte. Seine dunkelbraunen Augen standen ein klein wenig schräg und hatten einen Ausdruck, den ich verwirrend fand. Er flößte mir Unbehagen ein, und meine Voreingenommenheit gegen ihn verwandelte sich in Abneigung. «Fünfzehn Pfund für beide», sagte er. «Aber wenn Sie ein bisschen Zeit haben und etwas mehr zahlen wollen, kann ich das Bein verstärken und die Bruchstelle vielleicht geschickt furnieren lassen. Dann wäre er stabiler, und man würde nichts mehr sehen.»
«Ist er jetzt nicht stabil?»
«Wenn Sie darauf sitzen, ja», sagte der junge Mann. «Aber wenn ein großer dicker älterer Herr zum Essen kommt, wird er wahrscheinlich auf seinen vier Buchstaben landen.»
Ich sagte nichts und sah ihn an – kühl, wie ich hoffte. In seinen Augen funkelte ein belustigter Spott, mit dem ich nichts zu tun haben wollte. Ich fand die Andeutung, die einzigen Männer, die zum Essen zu mir kämen, wären groß, dick und älter, ziemlich frech.
Schließlich sagte ich: «Was würde es kosten, wenn ich das Bein reparieren ließe?»
«Sagen wir fünf Pfund. Das hieße, Sie bekämen sie für zehn das Stück.»
Ich überlegte und kam zu dem Schluss, dass ich sie mir so gerade eben leisten könnte.
«Ich nehme sie.»
«Gut», sagte der junge Mann, stemmte die Hände in die Hüften und lächelte liebenswürdig, als sei unser Geschäft damit abgeschlossen.
Ich fand, dass er hoffnungslos unprofessionell sei. «Möchten Sie, dass ich jetzt gleich zahle, oder soll ich etwas anzahlen …»
«Nein, das spielt keine Rolle. Sie können zahlen, wenn Sie sie abholen.»
«Und wann sind sie fertig?»
«Ungefähr in einer Woche.»
«Brauchen Sie meinen Namen nicht?»
«Nur, wenn sie ihn mir sagen wollen.»
«Und was ist, wenn ich nicht wiederkomme?»
«Dann wird sie wohl jemand anders kaufen.»
«Aber ich möchte sie haben.»
«Sie werden sie bekommen», sagte der junge Mann.
Ich runzelte ärgerlich die Stirn, aber er lächelte nur, ging zur Tür und hielt sie mir auf. Kalte Luft strömte herein, es hatte angefangen zu regnen, und die Straße draußen war dunkel wie in der Nacht.
«Auf Wiedersehen», sagte er. Ich lächelte kühl, senkte dankend den Kopf und trat an ihm vorbei ins Freie. Fast im selben Moment sagte mir die Türglocke, dass er die Tür wieder geschlossen hatte.
Der Tag war auf einmal grau in grau. Meine Freude über die beiden Stühle war dahin, vertrieben von der Missstimmung, die ich diesem Mann zu verdanken hatte. Normalerweise fasse ich nicht schnell eine Abneigung gegen andere Leute, und ich ärgerte mich nicht nur über ihn, sondern auch über mich selbst, weil ich so empfindlich war. Ich dachte noch darüber nach, während ich die Walton Street hinunterging und die Buchhandlung betrat. Nicht einmal die Gewissheit, nicht mehr draußen in der Kälte zu sein, und der angenehme Geruch von neuem Papier und Druckerschwärze konnten meine schlechte Laune vertreiben.
Die Buchhandlung hatte drei Stockwerke. Im Erdgeschoss standen die neuen Bücher, oben die antiquarischen Bücher und die alten Drucke, und unten im Souterrain lag das Büro von Stephen. Ich sah, dass Jennifer, die zweite Verkäuferin, gerade jemanden bediente, und da die einzige andere Kundin, eine alte Dame in einem Tweedcape, in den Gartenbüchern schmökerte, ging ich zu dem kleinen Garderobenraum und knöpfte dabei meinen Mantel auf. Ich hörte Stephens schwere Schritte auf der Treppe von unten und blieb stehen, um auf ihn zu warten. Im nächsten Augenblick erschien seine große, leicht gebückte Gestalt, und er stand vor mir mit seinem bebrillten Gesicht und seiner immer freundlichen Miene. Er trug immer dunkle Anzüge, die aussahen, als müssten sie dringend aufgebügelt werden, und seine Krawatte war schon jetzt, zu dieser frühen Stunde, ein Stück nach unten gerutscht, sodass der oberste Hemdknopf zu sehen war.
«Rebecca», sagte er.
«Ja, ich bin da.»
«Gut, dass ich Sie erwische.» Er sprach leise, um die Kunden nicht zu stören, und trat zu mir. «Unten ist ein Brief für Sie, er ist aus Ihrer alten Wohnung nachgeschickt worden. Am besten, Sie gehen gleich runter und holen ihn.»
Ich runzelte die Stirn. «Ein Brief?»
«Ja. Luftpost. Ausländische Briefmarken. Er wirkt irgendwie wichtig, ich weiß nicht, warum.»
Mein Ärger und alle Gedanken an neue Stühle wurden plötzlich von heftiger Besorgnis verdrängt.
«Ist er von meiner Mutter?»
«Ich weiß es nicht. Warum gehen Sie nicht runter und lesen ihn?»
Ich lief die steile, nackte Holztreppe ins Souterrain hinunter, die an diesem düsteren Tag von Neonröhren an der Decke beleuchtet wurde. Das Büro war herrlich unordentlich wie immer, übersät mit Briefen und Paketen und Akten, Stößen von alten Büchern und Pappkartons und Aschenbechern, die nie rechtzeitig geleert wurden. Aber der Brief lag mitten auf Stephens Schreibunterlage und war nicht zu übersehen.
Ich nahm ihn. Ein Luftpostumschlag, spanische Briefmarken, ein Poststempel von Ibiza. Aber die Schrift war dünn und krakelig, wie von einer sehr spitzen Feder, und ich kannte sie nicht. Er war an die alte Anschrift gerichtet, aber die Adresse war durchgestrichen und in einer großen, mädchenhaften Handschrift durch die Adresse der Buchhandlung ersetzt. Ich fragte mich, wie lange der Brief wohl auf dem Tisch an der Wohnungstür gelegen haben mochte, ehe eine von meinen ehemaligen Mitbewohnerinnen gemerkt hatte, dass er dort lag, und sich die Mühe gemacht hatte, ihn mir nachzuschicken.
Ich setzte mich auf Stephens Schreibtischstuhl und schlitzte den Umschlag auf. Er enthielt zwei Blatt dünnes Luftpostpapier, und das Datum oben war der dritte Januar. Fast einen Monat alt. Irgendwo in meinem Kopf schrillte eine Alarmsirene, und ich wurde von einer namenlosen Angst gepackt. Ich las:
Liebe Rebecca!
Ich hoffe, Sie haben nichts dagegen, dass ich Sie mit Ihrem Vornamen anrede, aber Ihre Mutter hat mir so oft von Ihnen erzählt. Ich schreibe Ihnen, weil Ihre Mutter sehr krank ist. Sie hat sich schon seit einiger Zeit nicht wohlgefühlt und ich wollte Ihnen schon vorher schreiben, aber sie hat es nicht zugelassen.
Jetzt tue ich es aber und sage Ihnen mit der ausdrücklichen Zustimmung des Arztes, dass ich finde, es wäre das Beste, wenn Sie hierherkämen und sie besuchten.
Wenn Ihnen das möglich ist, würden Sie mir bitte telegraphieren, wann Ihre Maschine kommt, damit ich Sie am Flughafen abholen kann.
Ich weiß, dass Sie arbeiten und dass es Ihnen vielleicht nicht leichtfallen wird, die weite Reise zu machen, aber ich würde Ihnen raten, keine Zeit zu verlieren. Ich fürchte, sie werden Ihre Mutter sehr verändert vorfinden, aber sie ist immer noch guten Mutes.
Mit den besten Wünschen
Ihr Otto Pedersen.
Ich saß fassungslos da und starrte auf den Brief hinunter. Die höflichen Wendungen sagten mir alles, und zugleich verschwiegen sie das meiste. Meine Mutter war schwer krank, sie lag vielleicht im Sterben. Er hatte mich vor vier Wochen auf gefordert, keine Zeit zu verlieren und zu kommen. Inzwischen war ein Monat vergangen, ich hatte den Brief eben erst bekommen, vielleicht war sie schon tot – und ich war nicht hingefahren. Was würde er von mir denken, dieser Otto Pedersen, den ich nie gesehen hatte, von dem ich bis eben nicht mal gewusst hatte, wie er hieß?
2
Ich las den Brief wieder, und dann noch einmal, und die dünnen Blätter raschelten in meiner Hand. Als Stephen schließlich herunterkam, um mich zu suchen, saß ich immer noch da.
Ich drehte mich um und sah ihn über die Schulter hinweg an. Er sah mein Gesicht und sagte: «Etwas Schlimmes?»
Ich versuchte, es ihm zu sagen, konnte es aber nicht. Stattdessen hielt ich ihm den Brief hin, und während er ihn nahm und las, klammerte ich mich an die Armlehnen des Schreibtischstuhls und kämpfte gegen eine schreckliche Angst an.
Er sah auf, legte den Brief zwischen uns auf den Schreibtisch und sagte: «Haben Sie gewusst, dass sie krank ist?»
Ich schüttelte den Kopf.
«Wann haben Sie zuletzt von ihr gehört?»
«Vor vier oder fünf Monaten. Sie hat nie Briefe geschrieben.» Ich sah zu ihm hoch und sagte zornig, halb erstickt von dem großen Kloß in meiner Kehle: «Es war vor fast einem Monat. Der Brief hat in der Wohnung gelegen, und kein Mensch hat sich die Mühe gemacht, ihn mir nachzuschicken. Sie kann inzwischen tot sein, und ich bin nicht hingefahren. Sie wird denken, dass es mir einfach egal war!»
«Wenn sie gestorben wäre, hätten Sie es sicher erfahren», sagte Stephen. «Weinen Sie nicht, dafür ist jetzt nicht der richtige Augenblick. Wir müssen dafür sorgen, dass Sie auf dem schnellsten Weg nach Ibiza kommen, und diesem –» er warf einen Blick auf den Brief – «diesem Mr. Pedersen Bescheid geben, dass Sie kommen. Alles andere ist jetzt unwichtig.»
«Ich kann nicht», sagte ich, und mein Mund zuckte, meine Unterlippe fing an zu beben, als wäre ich ein zehnjähriges Mädchen.
«Warum nicht?»
«Ich habe nicht genug Geld für den Flug.»
«Oh, liebes Kind, lassen Sie mich das machen …»
«Aber das kann ich nicht zulassen.»
«Doch, Sie können, und wenn Sie zu stolz sind, können Sie es mir über die nächsten fünf Jahre in Raten zurückzahlen, ich kann Ihnen auch Zinsen berechnen, wenn Sie das glücklicher macht, und jetzt reden wir um Gottes willen nicht mehr davon …» Er griff bereits nach dem Telefonbuch und wirkte auf einmal gar nicht mehr versponnen. «Haben Sie einen gültigen Reisepass? Und kein Mensch wird von Ihnen verlangen, dass Sie sich gegen Pocken impfen lassen und dergleichen lästiges Zeug. Hallo, ist dort British Airways? Ich möchte einen Platz in der nächsten Maschine nach Ibiza buchen.» Er lächelte auf mich herunter, und ich kämpfte immer noch gegen Tränen und Wut an, fühlte mich aber schon etwas besser. In Zeiten seelischer Belastung geht nichts über einen großen, freundlichen Mann, der einem alles abnimmt. Er nahm einen Bleistift und machte Notizen. «Ja. Wann? Gut. Reservieren Sie bitte einen Platz, auf den Namen Rebecca Bayliss. Wann ist die Ankunftszeit in Ibiza? Und die Flugnummer? Vielen Dank. Danke.»
Er legte auf und betrachtete mit einer gewissen Befriedigung die unleserlichen Krakel, die er gemacht hatte.
«Sie fliegen morgen früh, steigen in Palma de Mallorca um und kommen gegen halb acht in Ibiza an. Ich bringe Sie zum Flughafen. Nein, keine Widerworte, ich werde erst beruhigt sein, wenn ich gesehen habe, wie Sie an Bord gehen. Und jetzt schicken wir ein Telegramm an Otto Pedersen –» er nahm den Brief wieder auf – «in der Villa Margareta in Santa Catarina und sagen ihm Bescheid, dass Sie kommen.» Er lächelte so aufmunternd und tröstlich, dass ich plötzlich voll Hoffnung war.
«Ich kann Ihnen nicht genug danken …»
«Unsinn», sagte Stephen. «Es ist das Mindeste, was ich tun kann.»
Ich flog am nächsten Morgen, in einer Maschine, die zur Hälfte mit hoffnungsfrohen Wintertouristen besetzt war. Sie hatten sogar Strohhüte auf, um sich vor der vermeintlich sengenden Sonne zu schützen, und als wir in Palma in grauen Nieselregen hinaustraten, machten sie zuerst enttäuschte Gesichter, blickten dann aber wieder entschlossen optimistisch drein, als ob es morgen ganz bestimmt besser werden würde.
Es hörte während der gesamten vier Stunden, die ich in der Transitlounge verbrachte, nicht auf zu regnen, und nach dem Start rumpelte die Maschine durch lauter dicke Regenwolken. Aber als wir die Wolken unter uns ließen und das Meer erreichten, klarte es auf. Die Wolken wurden dünner, teilten sich und gaben einen tiefblauen, fast malvenfarbenen Himmel frei, und weit unten zeichnete das rosarote Licht der untergehenden Sonne breite Streifen über das gekräuselte Wasser.
Bei der Landung war es dunkel. Dunkel und feucht. Während ich unter dem südlichen Himmel, an dem zahllose Sterne leuchteten, die Gangway hinunterging, konnte ich nur den Geruch von Flugbenzin wahrnehmen, aber als ich dann über das pfützenbedeckte Vorfeld zum Flughafengebäude ging, spürte ich den lauen Wind im Gesicht. Er war warm, roch nach Kiefern und beschwor all die Sommerferien herauf, die ich im Ausland verbracht hatte.
Auch diese Maschine war zu dieser ruhigen Jahreszeit nicht vollbesetzt gewesen. Ich kam schnell durch den Zoll, und als mein Pass abgestempelt war, nahm ich meinen Koffer und ging in die Ankunftshalle.
Wie gewöhnlich standen kleine Gruppen von wartenden Leuten herum, andere saßen apathisch auf den hässlichen langen Plastikbänken. Ich blieb stehen, schaute mich um und wartete darauf, dass mich jemand entdeckte, sah aber niemanden, der aussah wie ein schwedischer Schriftsteller. Dann drehte sich ein Mann um, der am Bücherkiosk eine Zeitung gekauft hatte. Unsere Blicke begegneten sich, er faltete die Zeitung zusammen und kam auf mich zu. Er war groß, schlank und blond oder weißhaarig – es war unmöglich, die Haarfarbe bei dem grellen Neonlicht zu erkennen. Während er langsam auf mich zukam, lächelte ich zögernd, und als er vor mir stand, sagte er fragend, immer noch nicht ganz sicher, dass ich es wirklich war: «Rebecca?»
«Ja.»
«Ich bin Otto Pedersen.» Wir gaben uns die Hand, und er machte dabei eine kleine Verbeugung. Nun sah ich, dass sein Haar hellblond war und stellenweise ergraute. Sein Gesicht war knochig und braun gebrannt, mit trockener Haut, die von der Sonne tausend winzige Runzeln hatte. Seine Augen waren sehr hell, mehr grau als blau. Er hatte einen schwarzen Pullover an und einen leichten, hellbraunen Anzug mit gefältelten Taschen wie bei einem Safarihemd. Sein Gürtel hing so lose, dass die Schnalle sich beim Gehen bewegte. Er roch nach Rasierwasser und wirkte peinlich sauber, irgendwie gebleicht.
Jetzt, wo wir uns gegenüberstanden, war es auf einmal schwierig, Worte zu finden. Wir wurden beide urplötzlich überwältigt von den Geschehnissen, die uns hier zusammengeführt hatten, und ich merkte, dass er genauso befangen war wie ich. Aber er war gleichzeitig gewandt und höflich und entspannte die Situation, indem er mir den Koffer abnahm und fragte, ob das mein ganzes Gepäck sei.
«Ja, mehr habe ich nicht.»
«Dann gehen wir am besten. Wenn Sie am Ausgang warten, hole ich den Wagen und erspare Ihnen den Weg zum Parkplatz.»
«Ich komme mit.»
«Es ist nur über die Straße.»
Wir gingen zusammen hinaus, wieder ins Dunkel. Er führte mich zu dem halbleeren Parkplatz. Dort blieben wir neben einem großen schwarzen Mercedes stehen; er schloss auf und legte meinen Koffer auf den Rücksitz. Dann öffnete er mir die Beifahrertür, ehe er sich ans Steuer setzte.