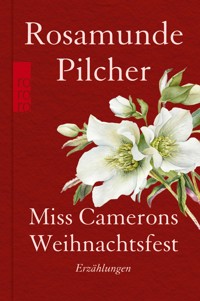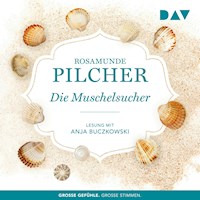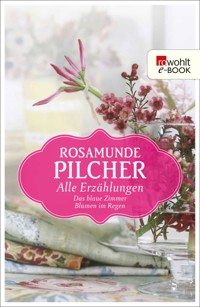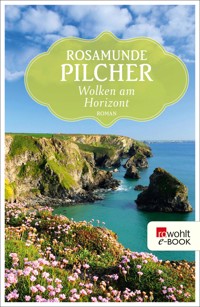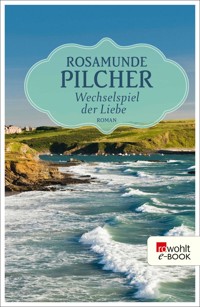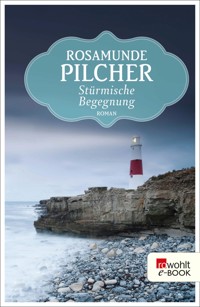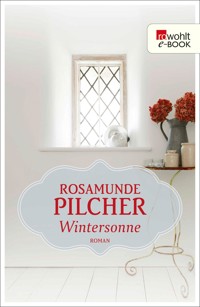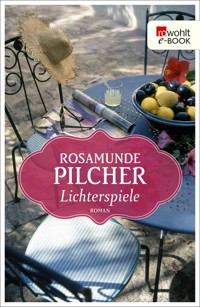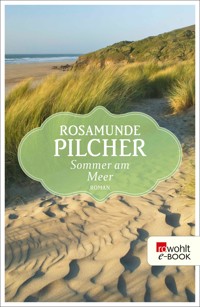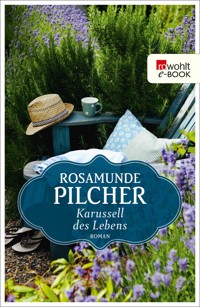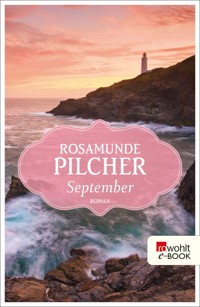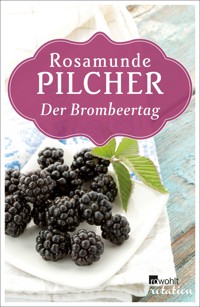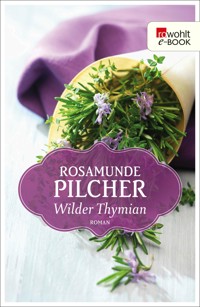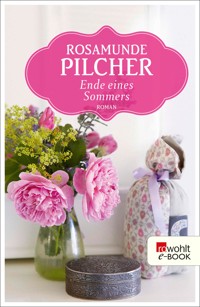
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Liebe in den Highlands Jane lebt bei ihrem Vater, einem exzentrischen Schriftsteller, in Kalifornien. Sehnsuchtsvoll denkt sie zurück an die Sommer ihrer Kindheit auf Elvie, dem schottischen Anwesen ihrer Großmutter - und an Sinclair. Immer hat sie davon geträumt, ihn einmal zu heiraten und auf Elvie zu leben. Eines Tages taucht der junge Anwalt David Stewart auf, der sie im Auftrag ihrer Großmutter nach Schottland einlädt. Schon bald nach ihrer Rückkehr in die Highlands steht sie vor einer schweren Entscheidung. Sinclair zeigt deutliches Interesse an ihr. Doch ist sie vielleicht im Begriff, einen schweren Fehler zu begehen?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 221
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Rosamunde Pilcher
Ende eines Sommers
Roman
Aus dem Englischen von Claudia Preuschoft
Rowohlt E-Book
Inhaltsübersicht
Für Di und John
1
Den ganzen Sommer über war das Wetter drückend und diesig gewesen, die Hitze der Sonne wurde gedämpft von Nebeln, die unablässig vom Pazifik an Land getrieben worden waren. Aber wie so oft in Kalifornien verzogen sich die Nebel im September weit hinaus auf den Ozean, wo sie als lange dunkle Streifen den Horizont verdüsterten.
Im Landesinnern, hinter dem Küstengebiet, brütete das Ackerland ernteschwer im Sonnenschein mit schwellenden Früchten und Mais, Artischocken und orangefarbenen Kürbissen. Kleine Dörfer voller Holzhäuser dösten und rösteten in der Hitze vor sich hin, grau und staubig wie aufgespießte Falter. Die Ebene breitete sich reich und fruchtbar nach Osten zu den Ausläufern der Sierra Nevada hin aus, und der große Freeway des Camino Real schoss durch sie hindurch wie ein Pfeil, nach San Francisco im Norden und Los Angeles im Süden, glitzernd vom heißen Stahl unzähliger Autos.
Der Strand war während der Sommermonate leer gewesen, denn Reef Point war Endstation und wurde nur selten von Tagesausflüglern heimgesucht. Zum einen war die Straße nicht befestigt, unsicher und wenig einladend. Zum anderen lag der kleine Ort La Carmella mit seinen bezaubernden, von Bäumen beschatteten Straßen, seinem exklusiven Country Club und den sauberen Motels gerade jenseits der Landzunge, und jeder, der Verstand und ein paar Dollars übrig hatte, blieb dort. Nur wer sehr abenteuerlustig war oder pleite oder verrückt aufs Surfen, riskierte die letzte Meile und fuhr schlitternd über den steilen, unbefestigten Weg, der zu der vom Sturm ausgewaschenen Bucht hinunterführte.
Aber jetzt, bei dem schönen, heißen Wetter und den sauberen Brechern, die an den Strand rollten, wimmelte es von Menschen. Autos aller Art schlingerten den Hügel hinab, parkten im Schatten der Zedern und spien Picknickfreunde, Zelter, Surfer und ganze Hippiefamilien aus, die San Francisco wieder einmal überhatten und in den Süden aufgebrochen waren, nach New Mexico in die Sonne, wie so viele Zugvögel. An den Wochenenden kamen die Universitätsstudenten von Santa Barbara herauf, in ihren alten Cabrios und ihren mit Blumenaufklebern übersäten Volkswagen, die alle vollgepackt waren mit Mädchen und Kisten voller Dosenbier und den großen, leuchtfarbenen Malibu-Surfbrettern. Sie errichteten überall auf dem Strand kleine Lager; die Luft war erfüllt von ihren Stimmen, ihrem Gelächter und dem Geruch von Sonnenöl.
Nach all den Wochen und Monaten, in denen wir so gut wie allein gewesen waren, umgaben uns nun Menschen und Betriebsamkeit jeglicher Art. Mein Vater arbeitete hart, er versuchte, das Drehbuch, an dem er schrieb, termingerecht fertigzustellen, und war in einer unmöglichen Gemütsverfassung. Ohne dass er es bemerkte, zog ich hinaus an den Strand, nahm mir etwas zu essen mit (Hamburger und Coca-Cola), ein Buch, ein großes Badehandtuch für die Bequemlichkeit und Rusty als Gesellschaft.
Rusty war ein Hund. Mein Hund. Ein braunes, wollenes Etwas von unbestimmter Rasse, aber hoher Intelligenz. Als wir damals im Frühjahr in das Strandhaus einzogen, hatten wir keinen Hund. Sobald er uns erspäht hatte, beschloss Rusty, diesem bedauerlichen Mangel abzuhelfen. Ich verscheuchte ihn, Vater warf alte Schuhe nach ihm, aber er kam wieder, ohne Vorwurf und ohne Arg, setzte sich ein oder zwei Yards vor der hinteren Veranda hin, lächelte und klopfte mit dem Schwanz auf den Boden. An einem heißen Morgen hatte ich Mitleid mit ihm und brachte ihm eine Schüssel mit kaltem Wasser. Er schlappte sie leer, grinste und fing wieder an, mit dem Schwanz zu klopfen. Am nächsten Tag gab ich ihm einen alten Schinkenknochen, den er artig annahm, forttrug und vergrub, nach fünf Minuten war er wieder da. Lächelnd. Klopf, klopf, ging der Schwanz.
Mein Vater kam aus dem Haus und warf einen Stiefel nach ihm, aber ohne große Begeisterung. Es war lediglich eine halbherzige Demonstration von Macht. Rusty spürte das und rückte ein bisschen näher.
Ich sagte zu meinem Vater: «Was glaubst du, wem er gehört?»
«Weiß der Himmel.»
«Er denkt offenbar, er gehöre uns.»
«Stimmt nicht», sagte mein Vater. «Er meint, wir gehören ihm.»
«Er ist nicht bösartig oder sonst was, und er stinkt auch nicht.»
Mein Vater sah von der Zeitschrift auf, die er zu lesen versuchte. «Willst du damit sagen, dass du diesen verdammten Köter behalten willst?»
«Es ist nur, ich weiß nicht … ich weiß nicht, wie wir ihn loswerden sollen.»
«Kurzer Prozess und erschießen.»
«O nein, bitte nicht!»
«Wahrscheinlich hat er Flöhe. Bringt Flöhe ins Haus.»
«Ich kaufe ihm ein Flohhalsband.»
Dad betrachtete mich über seine Brille hinweg. Ich konnte sehen, dass er allmählich lachen musste. «Bitte», sagte ich. «Warum nicht? Er kann mir Gesellschaft leisten, wenn du weg bist.»
«In Ordnung», sagte Dad. Also zog ich auf der Stelle Schuhe an, pfiff dem Hund und ging mit ihm über den Hügel nach La Carmella, wo es einen sehr feinen Tierarzt gibt. Dort wartete ich in einem kleinen Zimmer inmitten verhätschelter Pudel und siamesischer Katzen samt deren Besitzern. Schließlich wurde ich ins Sprechzimmer gelassen, der Tierarzt sah sich Rusty an, erklärte ihn für gesund, gab ihm eine Spritze und sagte mir, wo ich ein Flohhalsband kaufen könne. Ich bezahlte den Tierarzt, ging das Flohhalsband kaufen, dann kehrten wir nach Hause zurück. Als wir in das Haus kamen, las Dad immer noch seine Zeitschrift, der Hund trat höflich ein, und nachdem er eine Weile herumgestanden und gewartet hatte, bis er aufgefordert würde, sich zu setzen, ließ er sich auf dem alten Vorleger vor dem leeren Kamin nieder.
«Wie heißt er?», fragte mein Vater, und ich antwortete: «Rusty», denn ich hatte einmal ein Nachthemd gehabt, auf dem ein Hund aufgedruckt war, der Rusty hieß, und dies war der erste Name, der mir in den Sinn kam.
Ohne Frage passte er zur Familie, denn es sah so aus, als habe er schon immer dazugehört. Wo ich auch ging und stand, Rusty kam mit. Er liebte den Strand, grub dort ständig wertvolle Schätze aus und brachte sie uns nach Hause, damit wir sie bewundern konnten. Altes Strandgut, Plastikflaschen für Spülmittel, lange baumelnde Streifen Seetang. Und manchmal auch Dinge, die er offenbar nicht ausgegraben hatte. Einen neuen Turnschuh, ein helles Badehandtuch und einmal einen durchlöcherten Wasserball, den mein Vater ersetzen musste, als ich den weinenden kleinen Besitzer schließlich ausfindig gemacht hatte. Er schwamm auch gern und bestand immer darauf, mich zu begleiten, obwohl ich viel schneller und weiter schwimmen konnte als er und er jedes Mal abgeschlagen hinter mir herpaddeln musste. Man sollte meinen, das hätte ihm den Mut genommen, aber er gab nie auf.
An diesem Tag, einem Sonntag, waren wir schwimmen gewesen. Dad hatte es geschafft, den Termin einzuhalten, und war nach Los Angeles gefahren, um das Skript persönlich abzugeben. Rusty und ich hatten einander den ganzen Nachmittag im und am Meer Gesellschaft geleistet, Muscheln gesucht und mit einem alten Treibholzstock gespielt. Aber nun wurde es kühler, ich hatte mir wieder etwas übergezogen, und wir saßen nebeneinander, wurden von der goldenen untergehenden Sonne geblendet und beobachteten die Surfer.
Sie waren schon den ganzen Tag auf dem Wasser, und es schien, als würden sie nie müde werden. Auf ihren Brettern kniend paddelten sie hinaus aufs Meer, durch die Brandung zu dem glatten grünen Wasser dahinter. Dort warteten sie geduldig, thronten auf der Horizontlinie wie Kormorane, bis die Dünung anlief und eine Welle bildete, die schließlich brach. Sie standen auf, wenn das Wasser sich aufwölbte, hoch wogte und der Kamm weiß wurde, und wenn die Welle sich überschlug und auf den Strand donnerte, dann kamen die Surfer mit, auf der Welle reitend, in einem geradezu poetischen Balanceakt, voll jugendlicher Zuversicht. Sie ließen sich von der Welle bis auf den Sand tragen, stiegen dann lässig ab, griffen sich ihr Brett und paddelten wieder hinaus aufs Meer, denn nach dem Glaubensbekenntnis des Surfers kommt, jetzt gleich, immer noch ein größerer und besserer Brecher. Die Sonne ging unter, kein Augenblick durfte jetzt noch vertan werden.
Ein Junge hatte meine Aufmerksamkeit erregt. Er war blond und sehr braungebrannt, trug das Haar militärisch kurz geschnitten, seine dünnen Shorts leuchteten im gleichen Blau wie sein Surfbrett. Er war ein großartiger Surfer, neben seinem Stil und Schwung sahen all die anderen aus wie ungeschickte Amateure. Nach einiger Zeit entschloss er sich offenbar, es gut sein zu lassen. Er ritt auf einer letzten Welle ans Ufer, ließ sich sauber auf den Strand gleiten, sprang vom Surfbrett, drehte sich nach einem letzten langen Blick über das rosa verwaschene abendliche Meer um, hob das Surfbrett auf und kam über den Strand auf mich zu.
Ich sah verlegen weg. Er kam in meine Nähe, ging dann ein paar Schritte weiter, wo ein Stapel säuberlich gefalteter Kleider auf ihn wartete, ließ das Surfbrett fallen und fischte ein verschossenes College-Sweatshirt aus dem Stapel. Ich blickte wieder in seine Richtung, und als sein Gesicht in der Halsöffnung seines Sweatshirts erschien, sah er mich direkt an. Entschlossen hielt ich seinem Blick stand.
Er schien amüsiert. «Hi», sagte er.
«Hallo.»
Er zog sein Sweatshirt über die Hüften. «Willst du ’ne Zigarette?»
«Ja, gern.»
Er bückte sich, nahm ein Paket Lucky Strike und ein Feuerzeug aus einer Tasche, schnippte zwei Zigaretten hoch, zündete sie beide an und ließ sich dann neben mir nieder. Bequem streckte er sich in voller Länge aus und lehnte sich auf die Ellenbogen zurück. Seine Beine, sein Hals und sein Haar waren hell, mit Sand bestäubt, er hatte blaue Augen und das saubere, frischgewaschene Aussehen, das auf dem Campus amerikanischer Universitäten immer noch so häufig zu finden ist.
«Du hast den ganzen Nachmittag hier herumgesessen», sagte er. «Ab und zu bist du mal schwimmen gegangen.»
«Ich weiß.»
«Warum hast du nicht bei uns mitgemacht?»
«Ich habe kein Surfboard.»
«Du könntest dir eins besorgen.»
«Kein Geld.»
«Dann borg dir eins.»
«Ich kenne niemanden, von dem ich eins borgen könnte.»
Der junge Mann zog die Stirn kraus. «Du bist Engländerin, oder?»
«Ja.»
«Zu Besuch?»
«Nein, ich lebe hier.»
«In Reef Point?»
«Ja.» Ich deutete zu der Reihe verblichener, mit Schindeln verkleideter Häuschen, die hinter dem Bogen der Dünen gerade noch zu sehen waren.
«Wie kommt’s, dass du hier lebst?»
«Wir haben ein Strandhaus gemietet.»
«Wer ist ‹wir›?»
«Mein Vater und ich.»
«Wie lange seid ihr schon hier?»
«Seit dem Frühling.»
«Aber ihr bleibt nicht den Winter über.»
Das war eher eine sachliche Feststellung als eine Frage. Niemand blieb den Winter über in Reef Point. Die Häuser waren nicht dafür gebaut, Stürmen zu widerstehen, die Zugangsstraße wurde unpassierbar, die Telefonleitung umgeweht, die Elektrizität fiel aus.
«Ich glaube, doch. Wenn wir nicht beschließen weiterzuziehen.»
Er runzelte die Stirn. «Seid ihr Hippies oder so was?»
Ich wusste, wie ich gerade aussah, und konnte ihm diese Frage nicht verdenken.
«Nein. Mein Vater schreibt Filmdrehbücher und solches Zeug fürs Fernsehen. Aber er hasst Los Angeles so sehr, dass er sich weigert, dort zu leben, darum … haben wir das Strandhaus gemietet.»
Er schien fasziniert. «Und was machst du?»
Ich nahm eine Handvoll Sand, ließ ihn, grob und grau, durch meine Finger rieseln.
«Nicht viel. Ich kauf Essen und leere die Mülltonne aus und versuche, den Sand aus dem Haus zu fegen.»
«Ist das dein Hund?»
«Ja.»
«Wie heißt er?»
«Rusty.»
«Rusty. Hey, Rusty, alter Junge!» Rusty nahm seine Annäherungsversuche mit einem Nicken zur Kenntnis, das einer Königlichen Hoheit alle Ehre gemacht hätte, und starrte dann weiter aufs Meer hinaus. Um seinen Mangel an guten Manieren wettzumachen, fragte ich: «Bist du aus Santa Barbara?»
«Mhm.» Aber der Junge wollte nicht über sich sprechen. «Wie lange lebst du schon in den Staaten? Du hast immer noch einen schrecklich britischen Akzent.»
Ich lächelte höflich über diese Bemerkung, die ich schon viele Male vorher gehört hatte. «Seit meinem vierzehnten Lebensjahr. Sieben Jahre.»
«In Kalifornien?»
«Überall. New York. Chicago. San Francisco.»
«Ist dein Vater Amerikaner?»
«Nein. Es gefällt ihm einfach hier. Zuerst kam er vor allem, weil er einen Roman geschrieben hatte, der von einer Filmgesellschaft gekauft wurde. Er ging nach Hollywood, um das Drehbuch zu schreiben.»
«Im Ernst? Habe ich von ihm gehört? Wie heißt er?»
«Rufus Marsh.»
«Du meinst ‹Morgen ist auch noch ein Tag›?» Ich nickte. «Junge, Junge, ich habe es von vorn bis hinten verschlungen, als ich noch auf der Highschool war. Meine gesamte Sexualaufklärung hatte ich aus diesem Buch.» Er sah mich mit neuem Interesse an, und ich dachte, dass es doch immer das Gleiche war. Sie waren freundlich und ganz nett, nie aber interessiert, bis ich «Morgen ist auch noch ein Tag» erwähnte. Ich nehme an, es hat etwas mit meinem Aussehen zu tun, denn meine Augen sind hell wie Silbermünzen, meine Wimpern ziemlich farblos, und mein Gesicht wird nicht braun, sondern ist übersät mit Hunderten riesiger Sommersprossen. Außerdem bin ich zu groß für ein Mädchen, und die Knochen in meinem Gesicht stehen alle hervor.
«Er muss ja ein ziemlich ausgefallener Typ sein.» Ein neuer Ausdruck war in sein Gesicht getreten, eine Mischung aus Verwirrung und Fragen, die er offenbar aus Höflichkeit nicht stellte. Wenn du Rufus Marshs Tochter bist, wie kommt es, dass du an diesem gottverlassenen Strand im hintersten Kalifornien herumsitzt, geflickte Jeans und ein Männerhemd anhast, das schon vor Jahrzehnten in die Lumpenkiste gehört hätte, und nicht einmal genug Dollars zusammenkratzen konntest, um dir ein Surfbrett zu kaufen?
Es war schon zum Lachen, wie deutlich man ihm seine Gedanken ansehen konnte. Schließlich fragte er: «Was für ein Mensch ist er denn so? Ich meine, außer dass er ein Vater ist?»
«Ich weiß nicht.» Ich konnte ihn nie beschreiben, nicht einmal für mich selbst. Ich nahm eine weitere Handvoll Sand, ließ ihn zu einem Miniaturberg rinnen, drückte meine Zigarette auf seiner Spitze aus und formte so einen kleinen Krater, einen winzigen Vulkan mit dem Zigarettenstummel als rauchendem Inneren. Ein Mann, der immer in Bewegung sein muss. Ein Mann, der leicht Freundschaften schließt und sie am folgenden Tag ebenso schnell verliert. Ein streitsüchtiger und kampflustiger Mann, talentiert, wenn nicht genial, dem die kleinen Probleme des täglichen Lebens aber ein völliges Rätsel sind. Ein Mann, der bezaubern und einen zur Weißglut treiben kann. Ein Widerspruch auf zwei Beinen.
Ich sagte noch einmal: «Ich weiß nicht», und wandte mich dem Jungen neben mir zu. Er war nett. «Ich würde dich ja zu einem Bier nach Hause einladen, dann könntest du ihn kennenlernen und es selbst herausfinden. Aber er ist gerade in Los Angeles und kommt vor morgen früh nicht nach Hause.»
Er dachte darüber nach und kratzte sich gedankenverloren am Hinterkopf, wobei er einen kleinen Sandsturm auslöste.
«Weißt du was», sagte er, «wenn das Wetter so bleibt, komme ich nächstes Wochenende wieder.»
Ich lächelte. «Wirklich?»
«Ich werde nach dir Ausschau halten.»
«In Ordnung.»
«Ich bringe noch ein Brett mit, das ich übrig habe. Dann kannst du surfen.»
«Du brauchst mich nicht zu bestechen.»
Er tat, als sei er beleidigt. «Was meinst du mit bestechen?»
«Ich nehme dich nächstes Wochenende mit, damit du ihn kennenlernst. Er hat gern neue Gesichter um sich.»
«Ich wollte dich nicht bestechen. Ehrlich.»
Ich gab nach. Außerdem wollte ich gern surfen. «Ich weiß», sagte ich.
Er grinste und drückte seine Zigarette aus. Die Sonne sank dem Meeresspiegel entgegen, nahm Gestalt und Farbe an und wurde zu einem orangefarbenen Kürbis. Er setzte sich auf, kniff gegen das grelle Licht seine Augen zusammen, gähnte leicht und streckte sich. «Ich muss gehen», sagte er, stand auf und zögerte einen Augenblick, als er vor mir stand. Sein Schatten schien sich endlos auszudehnen. «Wiedersehen dann.»
«Wiedersehen.»
«Nächsten Sonntag.»
«Okay.»
«Das ist eine Verabredung. Nicht vergessen.»
«Vergesse ich schon nicht.»
Er drehte sich um, sammelte seine Klamotten auf und sah sich noch einmal um, bevor er davonging, am Strand entlang, dorthin, wo die alten, sandverwehten Zedern den Weg markierten, der zur Straße hinaufführte.
Ich sah ihm nach, und mir wurde bewusst, dass ich seinen Namen nicht kannte. Und, was noch schlimmer war, er hatte sich nicht einmal die Mühe gemacht, nach meinem zu fragen. Ich war einfach Rufus Marshs Tochter. Aber trotzdem, wenn das Wetter so blieb, würde er nächsten Sonntag vielleicht wiederkommen. Wenn das Wetter so blieb. Immerhin etwas, worauf man sich freuen konnte.
2
Der Grund dafür, dass wir in Reef Point wohnten, war Sam Carter. Sam war der Agent meines Vaters in Los Angeles, und als er schließlich anbot, uns eine billige Unterkunft zu suchen, tat er das aus schierer Verzweiflung, denn Los Angeles und mein Vater waren einander so heftig zuwider, dass er kein verkäufliches Wort schreiben konnte, solange wir dort wohnten. Sam lief also Gefahr, sowohl wertvolle Kunden als auch Geld zu verlieren.
«Es gibt da dieses Haus in Reef Point», hatte Sam gesagt. «Es ist eine gottverlassene Gegend, aber wirklich friedlich … so friedlich wie am Ende der Welt», fügte er hinzu und beschwor damit Visionen einer Art gauguinschen Paradieses.
Und so hatten wir das Strandhaus gemietet, packten all unsere weltliche Habe, die jämmerlich gering war, in Dads alten klapprigen Dodge, ließen den Smog und die Hektik von Los Angeles hinter uns und fuhren hierher, aufgeregt wie Kinder, als wir zum ersten Mal den Geruch des Meeres wahrnahmen.
Zuerst war es auch aufregend. Nach der Großstadt war es zauberhaft, nur von den Schreien der Seevögel und dem endlosen Donnern der Brandung geweckt zu werden. Es tat gut, am frühen Morgen über den Sand zu laufen und zu beobachten, wie die Sonne über den Bergen aufging, Wäsche auf die Leine zu hängen und zuzusehen, wie sie sich mit dem Seewind füllte und sich weiß aufblähte wie neue Segel.
Unser Haushalt war gezwungenermaßen einfach. Ich war ohnehin nie eine besonders gute Hausfrau gewesen, und in Reef Point gab es nur einen kleinen Laden, einen Drugstore, der allerdings ein umfassendes Warenangebot auf Lager hatte – von Waffenscheinen bis zu Hauskleidern, von Tiefkühlkost bis zu Kleenexpackungen. Er wurde von Bill und Myrtle eher nebenbei geführt; zum Einkaufen brauchte ich immer viel Zeit, denn jedes Mal waren frisches Gemüse und Obst, Hühnchen und Eier, all die Dinge, die ich kaufen wollte, offenbar gerade ausgegangen. Allerdings entwickelten wir im Lauf des Sommers geradezu eine Vorliebe für Chili con Carne aus der Dose, tiefgekühlte Pizza und die zahlreichen Sorten Eiscreme, die Myrtle offensichtlich besonders gern aß, denn sie war enorm fett, ihre breiten Hüften und Oberschenkel wölbten sich in extra weiten Jeans, und ihre schinkenförmigen Arme quollen aus den ärmellosen mädchenhaften Blusen, die sie dazu trug.
Aber jetzt, nach sechs Monaten Reef Point, wurde ich allmählich unruhig. Wie lange würde dieser schöne Spätsommer anhalten? Einen weiteren Monat vielleicht. Und dann würden die Stürme ernst machen, die Dunkelheit würde früher hereinbrechen, der Regen würde kommen, Matsch und Wind. Das Strandhaus hatte keine Zentralheizung, nur einen riesigen Kamin in dem zugigen Wohnzimmer, der in erschreckendem Tempo Treibholz verbrannte. Voller Sehnsucht dachte ich an heimelige Kohleeimer, aber es gab keine Kohle. Jedes Mal, wenn ich vom Strand kam, schleifte ich wie eine Pioniersfrau ein oder zwei Stücke Treibholz mit und stapelte sie auf der hinteren Veranda. Der Holzstoß wurde allmählich riesig groß, doch ich wusste, wenn wir erst einmal heizen mussten, würde der ganze Haufen in null Komma nichts verfeuert sein.
Das Häuschen lag direkt hinter dem Strand, ein kleiner Wall von Sanddünen war der einzige Windschutz. Es war aus Holz, das zu einem silbrigen Grau verblichen war, und stand auf Pfeilern, sodass jeweils ein paar Stufen zu der vorderen und der hinteren Veranda hinaufführten. Innen gab es ein großes Wohnzimmer mit einem Panoramafenster zum Meer, eine winzige, enge Küche, ein Badezimmer – ohne Badewanne, aber mit einer Dusche – und zwei Schlafzimmer, ein großes «Elternschlafzimmer», wo mein Vater schlief, und einen kleineren Raum mit einer Koje, der vielleicht für ein kleines Kind oder einen unwichtigen älteren Verwandten gedacht war – das war mein Zimmer. Die Einrichtung war eher deprimierend, wie so oft in Sommerhäusern, alle Möbel schienen unerwünschte Relikte aus anderen, größeren Häusern zu sein. Vaters Bett war ein Monstrum aus Messing, dem die Knäufe fehlten, dafür hatte es eine Garnitur Sprungfedern, die jedes Mal quietschten, wenn er sich umdrehte. In meinem Zimmer hing ein verschnörkelter goldener Spiegel, der aussah, als habe er sein Dasein in einem viktorianischen Bordell begonnen. Wenn ich hineinsah, schaute ich eine mit schwarzen Flecken übersäte Wasserleiche an.
Das Wohnzimmer war nicht viel besser – alte Sessel, deren verschlissene Stellen unter gehäkelten Decken versteckt waren, der Teppich vor dem Kamin hatte ein Loch, und die anderen Stühle waren rosshaargepolstert, wobei das Rosshaar keine Mühe mehr hatte, aus den Polstern herauszuquellen. Es gab nur einen Tisch, Dad benutzte ein Ende davon als Schreibtisch, sodass wir unsere Mahlzeiten in drangvoller Enge und mit angelegten Ellenbogen am anderen Ende einnehmen mussten. Der schönste Platz im Haus war die Fensterbank, die die gesamte Breite des Raums einnahm, sie war mit Schaumstoff, warmen Decken und Kissen gepolstert und so einladend wie ein altes Kinderzimmersofa, man konnte sich darauf zusammenrollen und lesen, den Sonnenuntergang betrachten oder einfach nachdenken.
Aber das Haus lag einsam. Nachts drang heulend der Wind durch die Ritzen in den Fensterrahmen, und in den Räumen raschelte und quietschte es seltsam wie auf einem Schiff auf hoher See. Wenn mein Vater da war, machte mir das alles nichts aus, aber wenn ich allein blieb, begann meine Einbildungskraft, auf Hochtouren zu arbeiten, angeregt von all den Geschichten alltäglicher Gewalt, die ich aus den Spalten der Lokalzeitung gepickt hatte. Das Häuschen selbst war äußerst unsicher, keines der Schlösser an den Türen oder Fenstern hätte einen entschlossenen Eindringling abgehalten. Und jetzt, wo der Sommer vorbei war und die Bewohner der anderen Strandhäuser gepackt hatten und nach Hause zurückgekehrt waren, lag es vollständig von der Welt abgeschnitten. Selbst Myrtle und Bill wohnten eine gute Viertelmeile entfernt, und das Telefon war ein Gemeinschaftsanschluss und funktionierte nicht immer zuverlässig. Ich mochte gar nicht darüber nachdenken, was alles passieren konnte.
Ich sprach nie mit meinem Vater über diese Ängste – schließlich hatte er zu arbeiten, und im Großen und Ganzen war er recht scharfsichtig. Ich bin sicher, er wusste, dass ich mich in einen Zustand heilloser Angst hineinsteigern konnte. Das war wohl einer der Gründe, weshalb er zuließ, dass ich Rusty behielt.
An jenem Abend, nach dem Tag am überfüllten Strand, dem fröhlichen Sonnenschein und meiner Begegnung mit dem jungen Studenten aus Santa Barbara, schien mir das Strandhaus verlassener denn je.
Die Sonne war hinter dem Saum des Meeres verschwunden, eine Abendbrise erhob sich, und es würde bald dunkel sein. Deshalb zündete ich ein Feuer an, um mich weniger allein zu fühlen, schichtete unbekümmert Treibholz im Kamin auf, tröstete mich mit einer heißen Dusche, wusch mein Haar und ging dann, in ein Handtuch gehüllt, in mein Zimmer, um saubere Jeans und einen alten weißen Pullover anzuziehen, der meinem Vater gehört hatte, bevor ich ihn aus Versehen hatte einlaufen lassen.
Unter dem Bordellspiegel stand ein lackiertes Schränkchen, das als Frisierkommode dienen musste. Darauf hatte ich, aus Mangel an anderen Möglichkeiten, meine Fotografien aufgestellt. Es waren zahlreiche Fotos, und sie beanspruchten viel Platz. Meistens schenkte ich ihnen nicht viel Beachtung, aber an diesem Abend war es anders. Während ich mein verfilztes nasses Haar auskämmte, betrachtete ich sie genau, eines nach dem anderen, als gehörten sie einer Person, die ich kaum kannte, und als wären darauf Orte dargestellt, die ich nie gesehen hatte.
Da war meine Mutter, auf einem offiziellen Porträt, in Silber gerahmt. Mutter mit bloßen Schultern, Diamantsteckern in den Ohren und von einem teuren Friseur frisch zurechtgemacht. Ich liebte das Bild, aber es entsprach nicht meiner Erinnerung an sie. Das andere war besser, ein vergrößerter Schnappschuss bei einem Picknick, wo sie ihren Schottenrock trug, bis zur Taille im Heidekraut saß und lachte, als ob gleich irgendetwas furchtbar Komisches passieren würde. Und dann war da die Sammlung – eher eine Collage –, mit der ich beide Seiten eines großen zusammenklappbaren Lederrahmens gefüllt hatte. Elvie, das weiße Haus, vor dem Hintergrund eines kleinen Wäldchens, dahinter erheben sich die Berge, der See glitzert am Ende des Rasens, wo der Anlegesteg ist und das lecke alte Dingi lag, das wir benutzten, wenn wir Forellen fischen gingen. Und meine Großmutter, an der offenen Fenstertür, die unvermeidliche Gartenschere in der Hand. Und eine kolorierte Postkarte von Elvie Loch, die ich im Postamt von Thrumbo gekauft hatte. Und ein weiteres Picknick, auf dem meine Eltern zusammen zu sehen waren, unser altes Auto im Hintergrund und ein dicker, rot-weißer Spaniel zu Füßen meiner Mutter.
Außerdem waren da die Fotografien von meinem Vetter Sinclair, Dutzende von Fotos. Sinclair mit seiner ersten Forelle, Sinclair im Kilt, vor irgendeinem Ausflug, Sinclair in einem weißen Hemd, als Kapitän der Cricket-Mannschaft seiner Schule. Sinclair, beim Skilaufen, am Steuer seines Wagens, mit einem Papierzylinder und ein bisschen betrunken bei irgendeiner Silvesterparty. (Auf dieser Fotografie hatte er seinen Arm um ein hübsches dunkelhaariges Mädchen gelegt, aber ich hatte die Bilder so angeordnet, dass man sie nicht sah.)
Sinclair war das Kind des Bruders meiner Mutter, Aylwyn. Aylwyn hatte – nach Ansicht aller anderen viel zu jung – ein Mädchen namens Silvia geheiratet. Diese Wahl wurde von der Familie missbilligt, und zwar aus guten Gründen, wie sich unglücklicherweise herausstellte. Sobald sie ihrem Ehemann einen Sohn geboren hatte, verließ sie beide und ging fort, um mit einem Mann zu leben, der auf den Balearen Grundstücke verkaufte. Als der anfängliche Schock überwunden war, fanden alle übereinstimmend, dies sei das Beste, was hatte passieren können, insbesondere für Sinclair, der seiner Großmutter übergeben wurde und in Elvie unter den glücklichsten Umständen aufwuchs.
An seinen Vater, meinen Onkel Aylwyn, konnte ich mich überhaupt nicht erinnern. Als ich noch sehr klein war, ging er nach Kanada, vermutlich kam er von Zeit zu Zeit zurück, um seine Mutter und sein Kind zu besuchen, aber er war nie in Elvie, wenn wir dort waren. Ich hatte nur ein einziges Anliegen an ihn: Er sollte mir einen Indianerkopfschmuck schicken. Im Lauf der Jahre muss ich diesen Wunsch mehrere hundertmal geäußert haben, aber es war nie etwas daraus geworden.
Sinclair war also praktisch das Kind meiner Großmutter. Und solange ich denken konnte, war ich mehr oder weniger in ihn verliebt gewesen. Er war sechs Jahre älter als ich, und ich hatte wie zu einem großen Bruder zu ihm aufgeblickt, er war ungeheuer weise und unendlich mutig. Er hatte mir beigebracht, wie man einen Haken an einer Angelschnur befestigt, kopfüber auf einem Trapez schwingt, einen Cricketball wirft. Wir gingen zusammen schwimmen und Schlitten fahren, machten unerlaubterweise Lagerfeuer, bauten ein Baumhaus und spielten in dem leckenden alten Boot Piraten.